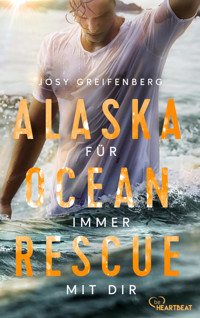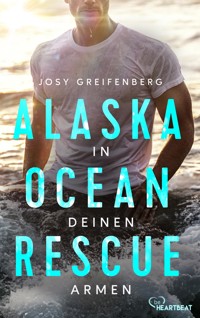
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantische Coastguard-Romance in Alaska
- Sprache: Deutsch
Ein Blick in deine Augen, in denen Wirbelstürme toben ...
Als Ruby nach Kodiak Island zieht, wünscht sie vor allem eins: viel Abstand von ihrem alten Zuhause und den Menschen, die glauben, besser zu wissen, was für Ruby gut ist, als sie selbst. In der idyllischen Kleinstadt trifft sie auf argwöhnische Bewohner, nasskaltes Wetter und Owen - Coastguard und ihr neuer Nachbar. Obwohl er distanziert und abweisend ist, fühlt sie eine Anziehung, der sie kaum widerstehen kann.
Langsam kommt Ruby hinter das Geheimnis seiner Vergangenheit, und nach und nach verliert sie auch ihr Herz an seinen niedlichen Sohn. Die beiden kommen sich näher, Ruby gewinnt Owens Vertrauen ... doch plötzlich holt ihre Vergangenheit sie wieder ein. Können Ruby und Owen das Geschehene hinter sich lassen und ihr Glück finden?
Der Auftakt der neuen Coastguard-Reihe in Alaska: Emotional, heiß, packend.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27EpilogDanksagungÜber die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Ein Blick in deine Augen, in denen Wirbelstürme toben …
Als Ruby nach Kodiak Island zieht, wünscht sie vor allem eins: viel Abstand von ihrem alten Zuhause und den Menschen, die glauben, besser zu wissen, was für Ruby gut ist, als sie selbst. In der idyllischen Kleinstadt trifft sie auf argwöhnische Bewohner, nasskaltes Wetter und Owen – Coastguard und ihr neuer Nachbar. Obwohl er distanziert und abweisend ist, fühlt sie eine Anziehung, der sie kaum widerstehen kann. Langsam kommt Ruby hinter das Geheimnis seiner Vergangenheit, und nach und nach verliert sie auch ihr Herz an seinen niedlichen Sohn. Die beiden kommen sich näher, Ruby gewinnt Owens Vertrauen … doch plötzlich holt ihre Vergangenheit sie wieder ein. Können Ruby und Owen das Geschehene hinter sich lassen und ihr Glück finden?
Der Auftakt der neuen Coastguard-Reihe in Alaska: Emotional, heiß, packend.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
J O S Y G R E I F E N B E R G
A L A S K A
I N
O C E A N
D E I N E N
R E S C U E
A R M E N
Für Papa,Ich hätte dich gern länger an meiner Seite gehabt.
Kapitel 1
»Wo zur Hölle steckst du?«
Ich zuckte zusammen, weil die Stimme meiner besten Freundin Claire viel zu laut aus meinem Handy dröhnte.
»In Alaska.« Während ich mir das Smartphone ans Ohr hielt, sah ich mich suchend in dem kleinen Flughafengebäude um.
»Ruby! Ich mache mir Sorgen um dich, wenn du den ganzen Tag nicht ans Telefon gehst. Also, hör auf zu scherzen!«
»Das war kein Witz. Ich bin gerade auf Kodiak Island gelandet.« Meine Stimme klang in etwa so, wie ich mich fühlte. Trocken. Emotionslos. Ich war soeben ans andere Ende des Landes gezogen – mit nichts als zwei Koffern. Viertausend Meilen lagen zwischen mir und meinem alten Zuhause. Es schien, als wüsste mein Herz einfach nicht, was es fühlen sollte.
»Was machst du in fucking Alaska?!« Claires Ausdrucksweise ließ etwas zu wünschen übrig, wie so oft, wenn sie aufgebracht war. Normalerweise brachte mich das zum Schmunzeln, doch danach war mir heute nicht.
»Bei meiner Tante in der Schule fällt eine Lehrerin aus. Ich werde ihre Klasse übernehmen«, erklärte ich knapp.
»Erzähl keinen Scheiß! Du hast hier in Jacksonville einen Job.«
»Den habe ich gekündigt. Hör zu, Claire. Da vorne steht meine Tante, die mich vom Flughafen abholt. Ich muss erst mal ankommen. Lass uns morgen in Ruhe sprechen, ja?«
»Du meinst das ernst, oder? Warum hast du mir nichts erzählt?« Auf einmal klang Claires Stimme viel leiser. Sie begann zu begreifen, und natürlich war sie verletzt. Sofort überkam mich ein schlechtes Gewissen. Ich hätte ihr viel früher von meinem Entschluss erzählen müssen, aber sie hätte mit Sicherheit versucht, mich davon abzuhalten, und für lange Diskussionen fehlte mir die Kraft.
»Es tut mir leid. Bis morgen«, flüsterte ich, ehe ich auflegte.
Ich blieb noch kurz stehen, um einmal tief durchzuatmen. Ich würde das nicht bereuen. Nicht jetzt schon. Entschlossen packte ich meine beiden Koffer und zog sie weiter in Richtung des Ausgangs. In der Empfangshalle standen genau zwei Menschen. Das war allerdings nicht verwunderlich, denn in der kleinen Propellermaschine, in die ich nach meinem letzten Zwischenstopp gestiegen war, hatten kaum zwanzig Leute Platz gefunden.
»Tante Maddie!« Ich trat auf die große, schlanke Frau zu. Sie trug wetterfeste hohe Boots, eine helle Skinny Jeans und ein rotes Holzfällerhemd, das sich hervorragend mit ihren roten Locken biss. Über ihrem Arm hing eine Regenjacke, die vermutlich einem Tsunami standhalten würde. Sofort kam ich mir mit meinen dünnen Sneakers und meiner Jeansjacke unpassend gekleidet vor.
»Psst, lass das hier bloß niemanden hören! Was sollen denn die Leute denken?« Mit einem frechen Augenzwinkern sah Tante Maddie mich an. Sie war die beste Freundin meiner Ma, meine selbst ernannte Tante, und sie war manchmal so verrückt wie Luna Lovegood aus Harry Potter mit ihrer Gespensterbrille. Trotzdem verwirrte mich ihre Reaktion. Vermutlich war ich einfach zu k. o., um ihren Scherz zu verstehen. Sie schien das zu bemerken, winkte ab und schloss mich in eine herzliche Umarmung.
»Ach, Ruby. Es ist so schön, dass du wirklich gekommen bist.«
»Finde ich auch. Wobei ich es noch nicht so richtig fassen kann. Jetzt werde ich all das sehen, wovon du uns immer vorgeschwärmt hast.«
Maddison und meine Mutter hatten sich während des Studiums in Florida kennengelernt und waren von da an unzertrennlich gewesen. Bis Maddies Mann vor ein paar Jahren nach Kodiak versetzt worden war.
Inzwischen war sie Direktorin der hiesigen Middle School und ihr Mann der Captain der Coast Guard in Kodiak.
Maddison hakte sich bei mir unter und dirigierte mich zum Ausgang. Kaum verließen wir das Flughafengebäude, schlug mir eine kühle feuchte Windböe entgegen. Ich blieb stehen und genoss das ungewohnte Gefühl.
Selbst in den Wintermonaten in Jacksonville, wenn es einen der seltenen Regentage gab, hatte die Luft nie so gerochen wie hier. Der Asphalt der Großstadt speicherte die Wärme zu gut, und es roch immer ein wenig nach Staub. Hier fühlte sich die Luft hingegen klar und sauber an.
»Unglaublich, oder?«, fragte Maddie mit einem wissenden Blick zu mir. »Du wirst es lieben, da bin ich sicher.«
Gemeinsam luden wir meine Koffer in ihren bereitstehenden Jeep. Dann machte ich es mir auf dem Beifahrersitz gemütlich und freute mich, während der Fahrt mehr von der Insel zu sehen.
Doch schon nach vier Minuten hielt Maddison am Ende einer schmalen Straße. »So, da wären wir.«
»Wie jetzt, so schnell?«, fragte ich verwirrt. »Das Stück hätten wir laufen können.«
»Man läuft zu dieser Jahreszeit besser nicht einfach so durch Kodiak, wenn man keinem Bären begegnen will.«
Ich runzelte die Stirn. Zwar war ich bei meiner Recherche über die kleine Insel auch auf den Kodiakbären gestoßen – laut Schätzungen kam etwa ein Braunbär auf fünfundzwanzig Inselbewohner –, aber die würden doch wohl nicht durch die Stadt streifen … also die Bären. Oder?
»Komm, ich möchte dir deine Bleibe zeigen.« Maddison führte mich zu dem letzten Gebäude der Straße und zückte den Schlüssel. Während sie aufschloss, sah ich mich neugierig um. Wir befanden uns in einer Wohnsiedlung, in der lauter blaue Holzhäuser im gleichen Stil standen.
»Ruby?« Tante Maddie steckte den Kopf zur Tür heraus und winkte. Scheinbar hatte ich etwas zu lange einfach nur die Gegend betrachtet. In meinem Kopf fühlte sich alles so surreal an.
»Hier unten sind Küche und Wohnzimmer«, begann Maddie zu erklären, als ich ihr endlich in das Haus gefolgt war. Eine rustikale, aber geräumige Holzküche sprang mir sofort ins Auge.
»Genug Platz für dich zum Werkeln, oder?« Maddie lächelte.
»Ja … ja, bestimmt«, antwortete ich etwas abwesend.
Von der Küche führte ein Durchgang direkt in das geräumige Wohnzimmer. Zwei kleine Sofas standen nebeneinander mit Blick auf den großen Fernseher. Ich versuchte, alles auf mich wirken zu lassen, doch Maddie schritt bereits zügig die Treppe hinauf. Nachdem sie mich auch durch die obere Etage geführt hatte, schaute ich meine Tante besorgt an.
»Das Haus ist riesig, Tante Maddie!«
Es gab nicht nur zwei Schlafzimmer mit Kingsize-Betten und zwei Bäder, sondern auch jede Menge Stauraum in Form von Einbauschränken.
»Es ist auch eigentlich für Familien der Guards gedacht.« Maddie zuckte mit den Schultern.
»Und ich darf hier einfach so wohnen?«
»Ruby, Schätzchen. James ist der Captain. Natürlich kannst du hier wohnen. Außerdem habe ich auf die Schnelle nichts anderes gefunden. Wenn es dir lieber ist, können wir aber gemeinsam nach Wohnungen in der Stadt gucken.« Liebevoll sah Maddie mich an.
»Entschuldige, dass ich dir so einen Stress gemacht habe.« Betreten sah ich zu Boden.
»Ach, Ruby. Das war kein Stress. Im Gegenteil. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell Ersatz für eine erkrankte Lehrerin gefunden.« Aufmunternd zwinkerte mir Maddie zu. Ich würde ihr ewig dankbar sein für das, was sie die letzten Tage für mich getan hatte, ob sie es nun wollte oder nicht.
Kapitel 2
Am nächsten Morgen erwachte ich viel zu früh. Vier Stunden Zeitverschiebung gingen nicht spurlos an mir vorbei, und die ungewohnte Umgebung hatte ebenfalls nicht zu einem erholsamen Schlaf beigetragen. Lange hatte ich noch wach im Bett gelegen und versucht zu begreifen, dass ich in weniger als zwei Wochen meinen gesamten Alltag auf den Kopf gestellt hatte.
Heute startete mein neues Leben auf Kodiak. Schon übermorgen würde ich das erste Mal vor meiner eigenen Klasse stehen. Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen. In Jacksonville war ich als Vertretungslehrerin angestellt gewesen und überall eingesprungen, wo ich gebraucht wurde. Eine richtige Beziehung hatte ich dabei nicht zu meinen Schülern aufbauen können. Das wollte ich hier ändern!
Etwas gerädert von der unruhigen Nacht ging ich hinunter in die Küche, und dank Tante Maddie fand ich frisches Brot und ein Glas selbst gemachte Marmelade auf dem Tisch vor. Nur der Kaffee fehlte. Etwas, was ich heute schleunigst ändern musste. Ich bestrich mir eine Scheibe Brot großzügig mit Marmelade und biss noch im Stehen das erste Mal ab.
»Mhh.« Ich seufzte laut, als sich der köstliche saure Geschmack auf meiner Zunge ausbreitete. Gedankenverloren lief ich mit dem Brot in der Hand an die große Fensterfront im Wohnzimmer.
Hinter dem Garten meines Hauses verlief eine weitere schmale Straße, die zu einer Reihe baugleicher Häuser führte. Direkt dahinter schaute ich auf einen mächtigen Berg. Ich konnte immer noch nicht fassen, dass ich dieses Haus allein bewohnen würde. In Jacksonville hatte ich nur eine kleine Einliegerwohnung bei meiner Mutter und ihrem Freund im Haus gehabt – und bei Weitem nicht so viel Platz.
Neugierig schaute ich auf das merkwürdige Gärtchen, das zu meiner neuen Bleibe gehörte. Es gab keine Hecke und nicht eine einzige Pflanze. Dafür aber einen saftig grünen Rasen, dessen Bewässerung in Florida ein kleines Vermögen kosten würde. Ein vollkommen rechteckiger grüner Zaun grenzte das Grundstück von dem anscheinend identischen Nachbargrundstück und der schmalen Parallelstraße ab.
Nur … Warum war das Zaunfeld so beschädigt? Eines der grünen Maschendrahtteile war heruntergebogen, als hätte sich ein Mensch einen Wippsitz formen wollen. War das gestern schon so gewesen? Ich konnte mich nicht erinnern.
Ich steckte mir das letzte Stück Brot in den Mund und öffnete das Schiebefenster. Barfuß trat ich auf den Rasen und merkte schon nach zwei Schritten, dass man so etwas auf Kodiak besser nicht allzu oft tat. Brrr, war das kalt! Trotzdem setzte ich meinen Weg fort und musterte das Zaunfeld genauer. Es wirkte, als wären die einzelnen Maschen mit Gewalt herausgebogen worden. Gänsehaut, die nichts mit der Kälte zu tun hatte, kroch meine Arme herauf. Das konnte ein Mensch unmöglich ohne Werkzeug geschafft haben. War hier jemand eingebrochen? Vergangene Nacht?
Unsicher blickte ich die Straße hinunter. Nein, versuchte ich mich zu beruhigen. Der Zaun ging mir kaum bis zur Taille. Ein Einbrecher hätte mühelos darüberspringen können. Der kaputte Zaun musste eine andere Ursache haben.
Plötzlich packte mich jemand von hinten an der Taille. Erschrocken keuchte ich auf. Doch bevor ich laut schreien konnte, wurde mir eine Hand auf den Mund gepresst.
Ich strampelte wild, um mich aus dem schraubstockartigen Griff zu winden. Ohne Erfolg.
Ich versuchte noch einmal zu schreien.
»Psst«, zischte die Person wütend, und unerbittlich wurde ich zurück ins Haus getragen.
Schweiß brach mir auf der Stirn aus.
»Seien Sie leise, verdammt!«, flüsterte eine raue Männerstimme direkt in mein Ohr. Ehe ich mich’s versah, rastete die Fensterscheibe mit einem geräuschvollen Klicken ein, und ich wurde in die Ecke meines neuen Wohnzimmers gedrängt.
»Was fällt Ihnen ein?! Lassen Sie mich los!«, rief ich panisch und versuchte, mich zu befreien. Doch der fremde Mann presste mich schnell atmend an die Wand.
»Was mir einfällt? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Wollten Sie mit dem Bären da draußen ein nettes Pläuschchen halten?«
»Mit dem … Was?!« Entsetzt drehte ich mich zum Fenster, und diesmal ließ der Fremde mich gewähren.
Dort in meinem Garten hockte ein Braunbär und blickte aufmerksam in Richtung des Fensters, neben dem wir standen. Entsetzt schnappte ich nach Luft.
»Ruhig!«, flüsterte der Mann wieder. »Wir dürfen ihn nicht provozieren.«
Wie sollte man ruhig bleiben bei dem Anblick eines riesigen Raubtiers in seinem Garten? Für einen Moment hörte ich nur unser beider keuchenden Atem. Dicht an dicht standen wir weiterhin an die Wand gedrückt. Obwohl der Fremde mich nicht mehr wie ein Schraubstock gepackt hielt, ließ er mich nicht los, als befürchtete er, ich könnte wieder nach draußen zu der Bestie rennen. Doch ich war wie erstarrt.
Die Sekunden vergingen wie in Zeitlupe. Der Bär stand mit lauerndem Blick da – eine Pfote in der Luft – und lauschte. Er wartete. Wir warteten. Konnte der Bär die Scheibe einschlagen, wenn er sich von uns bedroht fühlte? Wahrscheinlich.
Erschrecke niemals einen Bären, das war der oberste Grundsatz gewesen, den ich in der Touristenbroschüre im Flugzeug gelesen hatte. Wie hatte ich diesen braunen Koloss übersehen können?
Langsam trat der Bär einen Schritt auf das Fenster zu. Jeder Muskel in meinem Körper verkrampfte sich.
Es knallte. Vor Schreck zuckte ich zusammen. Auch der Kodiakbär drehte den Kopf.
Es dauerte einen Moment, ehe ich das Geräusch als zuschlagende Autotür einordnen konnte.
»Waa… Was macht ein Bär in meinem Garten?«, stammelte ich. Meine Stimme war nur ein leises Krächzen. Obwohl der Bär sich auf das kaputte Zaunstück zubewegte, den Blick neugierig in Richtung des nun anfahrenden Autos gerichtet, zitterte ich am ganzen Körper.
»Wie können Sie so kopflos sein und einfach nach draußen rennen, wenn Sie schon aus der Ferne sehen, dass ein Bär Ihren Zaun kaputtgemacht hat!?« Der fremde Mann stieß sich von der Wand ab, das Fenster stetig im Auge behaltend.
»Mir … Ich …« Immer noch versuchte ich zu begreifen, was eben geschehen war. Auf einmal wurde mir schwindlig. Halt suchend stützte ich mich an der Wand ab. Meine Knie drohten, unter mir nachzugeben.
»Sie müssen langsamer atmen, Ms.« Auf einmal klang seine Stimme viel tiefer. Er trat wieder auf mich zu und fasste sanft nach meinen Unterarmen. »Sehen Sie mich an.«
Stumm folgte ich seinem Befehl. Mein Blick traf auf einen Wirbelsturm. Seine dunkelblauen Augen hatten die Farbe von Wolken, die sich über dem Meer zum Sturm zusammenbrauten. Ich konnte die angespannten Emotionen, die darin wallten, beinahe greifen. Darüber zogen sich dichte dunkle Augenbrauen, und er hatte die Stirn grimmig zusammengezogen. Die kurzen schwarzen Haare standen in alle Richtungen ab. Mein Blick glitt über die kantigen Gesichtszüge hinunter zu dem glatt rasierten Kinn, auf dem sich trotz fürsorglicher Rasur ein dunkler Bartschatten abzeichnete.
Mein Retter war ein auffällig attraktiver Mann, und während ich immer noch von ihm gehalten wurde, nahm ich seine Nähe überdeutlich wahr. Raue, warme Hände hielten mich, als befürchtete er, dass ich jeden Moment umkippen würde. Sein T-Shirt spannte um seine kräftigen Oberarme und die breite Brust.
Langsam beruhigte sich etwas in meinem Inneren, und mir wurde unangenehm bewusst, wie sehr ich diesen fremden Mann anstarrte. Ein Kodiakbär in meinem Garten hatte eindeutig einen schlechten Einfluss auf meine Manieren.
»Danke.« Ich räusperte mich verlegen und sah dem Mann, den ich auf Mitte dreißig schätzte, wieder in die Augen. »Ich würde Ihnen ja gern einen Kaffee anbieten, aber leider habe ich außer etwas Brot und Marmelade noch nichts weiter im Haus.«
»Erst mal nehme ich ein Telefon. Wir müssen die Wache der Base erreichen.«
»Was machen die mit dem Bären?«, fragte ich zögerlich, während ich an dem breitschultrigen Mann vorbei in Richtung des Küchentresens sah. Dort irgendwo musste mein Handy liegen.
»Wenn möglich, ihn vertreiben. Wenn nicht … ihn erschießen.« Während er sprach, versicherte er sich mit einem weiteren Blick aus dem Fenster, dass uns der Bär keine Beachtung mehr schenkte, dann trat er zur Seite.
Zögerlich lief ich in die Küche. Der Mann, von dem ich anhand seines Outfits vermutete, dass er mein Nachbar war, folgte mir. Wie ich wirkte er in seinem schlichten schwarzen T-Shirt, der Jeans und den Hausschuhen, die er trug, nicht warm genug angezogen für das Wetter. Ich sah an mir hinab und seufzte innerlich. Natürlich. Ausgerechnet, wenn ein gut aussehender Mann mir zu Hilfe eilte, trug ich meine ausgewaschene graue Jogginghose mit dem weitesten Schlafshirt, das ich besaß. Dabei fielen mir meine ungekämmten Haare ins Gesicht und erinnerten mich an den zerknitterten Anblick, den ich heute Morgen im Spiegel hatte betrachten dürfen.
Ich entsperrte mein Handy und sah fragend zu meinem Retter.
»Darf ich?« Abwartend blickte er mich an. Ich reichte ihm mein Telefon, und er wählte aus dem Kopf eine Nummer. Es dauerte nicht lange, und am anderen Ende nahm jemand ab. »AST1 Owen Henderson. Wir haben hier einen jungen Bären im Garten der 301.« Er wartete einen Moment. »Nein, bisher nicht.« Obwohl sein Gesprächspartner ihn nicht sehen konnte, nahm der Petty Officer Haltung an, während er sprach.
Die Navy musste ihm in Fleisch und Blut übergegangen sein. Ich wusste nicht, wofür »AST« stand, dafür kannte ich mich nicht genug mit den Berufsbezeichnungen der Coast Guard aus, aber die Eins in seinem Titel zeigte mir, dass er den höchsten Unteroffiziersrang innehatte.
»Jawohl. Danke.« Mit einem Kopfnicken beendete er das Gespräch und sah wieder zu mir.
»In welcher Unit fangen Sie an?« Er schien nicht viel von Small Talk zu halten, dieser Owen Henderson.
»Ich fange in keiner Unit an.« Ich schob mich an ihm vorbei und schmierte mir noch eine Scheibe Brot, nur um etwas zu tun zu haben. »Ich werde an der Middle School unterrichten.«
»Und Ihr Mann?« Stirnrunzelnd betrachtete der Coast Guard mich und wandte dann seinen Blick zur Treppe, als erwartete er, jeden Moment jemanden die Stufen herunterkommen zu hören.
»Der existiert nicht«, antwortete ich zickiger als notwendig. Es war logisch, dass er vermutete, ich würde in der Base arbeiten, wenn ich in diesem Haus wohnte.
Statt mich für den Tonfall zu entschuldigen, bot ich ihm die Scheibe Brot an, doch Petty Officer Henderson musterte mich nur mit durchdringendem Blick.
»Warum wohnen Sie dann hier?«
»Meine Tante Mad…« Gerade rechtzeitig erinnerte ich mich noch, dass ich sie hier nicht bei ihrem Spitznamen nennen sollte. »Meine Tante ist die Frau von Captain Walsh.«
Seine Augen verdunkelten sich. Es sah nun wirklich so aus, als würde der Sturm in seinen Augen jeden Augenblick losbrechen. »Mrs. Walsh … Das hätte ich mir denken können.« Er ballte die Hand zur Faust. »Ich muss zur Arbeit.«
Ich nickte bloß. Die ganze Situation überforderte mich zunehmend. Mir war bewusst, dass man sich selten Freunde machte, wenn man aufgrund von Beziehungen etwas bekam. Doch dass ich deswegen gleich an meinem ersten Tag verurteilt werden würde, hatte ich nicht erwartet.
»Machen Sie so etwas nicht noch mal«, ermahnte er mich unfreundlich. Als hätte ich mich dem Bären freiwillig genähert! Bevor ich etwas erwidern konnte, marschierte der Petty Officer zurück ins Wohnzimmer.
Der Bär war inzwischen zurück über das heruntergebogene Zaunstück geklettert, sodass es jetzt endgültig auf dem Boden lag, und spazierte seelenruhig über den Fußgängerweg.
Der Coast Guard öffnete das Fenster und verschwand schneller, als ich gucken konnte, im Nachbarhaus.
Nachdem ich mich von dem ereignisreichen Morgen mithilfe einer heißen Dusche erholt hatte, brach ich auf, um mich meiner langen To-do-Liste zu widmen.
Ich musste dringend ein paar Klamottenläden aufsuchen. Kurz nach meinem Frühstück hatte ein leichter Regen eingesetzt und seitdem nicht mehr aufgehört. Mangels Alternativen machte ich mich entgegen Maddies Rat zu Fuß auf den Weg zum Flughafen und der ansässigen Mietwagenstation. Allerdings hielt ich auf dem gesamten Weg vorsichtig nach Bären Ausschau und war mir jetzt schon sicher, dass ich das von nun an immer machen würde, wenn ich auf der Insel unterwegs war. Eine Bärenbegegnung war mir definitiv genug.
Schon auf dem kurzen Fußweg waren meine dünnen Sneakers komplett durchnässt, und auch meine Jacke hing schwer an mir herab.
Deshalb war ich froh, als ich endlich in meinen Mietwagen steigen konnte. Nach einer kurzen Fahrt über eine der wenigen Hauptstraßen parkte ich in der gut ausgeschilderten Innenstadt, die den gleichen Namen wie die Insel trug. Schon als ich die Fahrertür öffnete, schoss mir sofort der Duft nach Fisch in die Nase.
Tief sog ich die Luft ein, schloss die Augen und erinnerte mich an die Angelausflüge, die ich als Kind immer mit meinem Vater gemacht hatte. Über zehn Jahre war es jetzt her, dass er verstorben war, und noch immer fiel es mir schwer, nur an die schönen Zeiten, die uns vergönnt gewesen waren, zu denken. Oft fragte ich mich, was wir noch alles gemeinsam erlebt hätten, wenn dieser unbarmherzige Krebs ihn nicht geholt hätte.
Jetzt konnte ich nicht mal mehr sein Grab besuchen, wenn mir danach war. Alles nur wegen …
Genug jetzt, Ruby! Heute war keine Zeit für trübselige Erinnerungen! Ich schnappte mir meinen Rucksack und lief zielstrebig in Richtung des Stadtzentrums. Eine schmale gedrungene Straße führte bergab in Richtung des Hafens. Links und rechts waren ein paar kleine Geschäfte, die sich mit normalen Wohnhäusern in bunten Farben abwechselten.
Ich kam an einer Bude vorbei, aus der es herrlich nach gebratenen Pilzen roch, zwei urigen Hostels und einem Souvenirladen. Die kleine Fischerstadt war augenscheinlich für Touristen ausgelegt. Doch auch als ich den gesamten Weg bis zum Hafen zurückgelegt hatte, war ich immer noch auf kein einziges Geschäft mit Kleidung oder Schuhen gestoßen. Fröstelnd zog ich mein Handy aus der Tasche.
Google Maps bestätigte mir, dass ich mitten im Zentrum des Städtchens angelangt war, half mir aber bei meiner Suche nach einem Klamottenladen nicht weiter. Frustriert drehte ich mich um hundertachtzig Grad und blickte zurück. Der Regen war noch mal stärker geworden, und inzwischen war ich klitschnass.
Eine ältere Dame warf mir einen genervten Blick zu und rempelte mich im Vorbeigehen an. Hieß es nicht eigentlich, dass die Bewohner in Kleinstädten freundlicher zueinander waren als in Metropolen?
»Entschuldigen Sie bitte«, sprach ich einen älteren Herrn an. »Können Sie mir sagen, wo ich hier ein Schuhgeschäft finde?«
»Ein was?« Er musterte mich und mein durchweichtes Outfit argwöhnisch.
»Ein Schuhgeschäft«, wiederholte ich lauter.
»So was gibt es hier nicht.« Mit diesen Worten drehte sich der Mann um und stiefelte davon.
Das konnte doch nicht wahr sein! Es musste auf dieser Insel doch einen Schuhladen geben. Schließlich trugen die Einwohner alle wasserfeste Boots, und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie das Leder dafür selbst gegerbt hatten.
Ich beobachtete die Menschen um mich herum in der Hoffnung, eine etwas hilfsbereitere Person zu treffen. Doch die meisten Fußgänger warfen mir nur seltsame Blicke zu.
Wahrscheinlich hielten sie mich für eine ahnungslose Touristin, die sich nicht informiert hatte. Dabei war mir klar gewesen, dass ich keine passende Kleidung für das Klima in Alaska besaß. Aufgrund meiner spontanen Abreise hatte mir allerdings die Zeit zum Einkaufen gefehlt.
»Entschuldigung.« Jemand tippte mir auf die Schulter. »Kann ich dir helfen?«
Als ich mich umdrehte, stand mir eine junge Frau gegenüber. Ihre Haare waren unter der großen Kapuze ihres olivgrünen Regenmantels verborgen, doch ihre Augen leuchteten mich an.
Erleichtert lächelte ich die Frau an. »Ja, bitte! Kannst du mir verraten, wo ich einen Laden finde, der wetterfeste Klamotten verkauft?« Ich deutete an mir hinunter. Nicht, dass ich sie noch auf das Elend aufmerksam machen musste. Jeder Insulaner im Umkreis von dreihundert Metern lachte wahrscheinlich schon über mich.
»Versuch es mal bei Penn’s, die Straße hoch und dann gleich links.«
»Danke.« Sofort wandte ich mich in die Richtung, in die sie gezeigt hatte. Inzwischen gaben meine Schuhe bei jedem Schritt, den ich tat, ein Geräusch von sich wie ein Schwamm, der ausgewrungen wurde. Mit dem Unterschied, dass nicht ein Tropfen des Eiswassers aus meinen Schuhen zu verschwinden schien.
Nach ein paar Minuten erreichte ich endlich die Ecke, die die Frau beschrieben hatte, und entdeckte tatsächlich den Laden. Von außen wirkte er auf mich eher wie ein Geschäft, das Touristenausflüge anbot. Ein großer Aufsteller für Rafting- und Bear-Watching-Touren flatterte vor dem Eingang. Entschlossen trat ich auf die Schiebetür zu, und kaum dass ich eingetreten war, umfing mich wohlige Wärme.
»Puh«, murmelte ich und versuchte, meine Schuhsohlen auf dem großen Abtreter zu säubern.
»Willkommen bei Penn’s.« Die grummelige Stimme eines Mannes ließ mich hochsehen. Als Erstes nahm ich erfreut wahr, dass der kleine Verkaufsraum tatsächlich voller Kleiderständer mit warmen und vor allem trockenen Klamotten stand. Als Zweites traf mich der stechende Blick eines dickbäuchigen Verkäufers, der hinter dem rustikalen Holztresen stand. So freundlich seine Worte auch waren, sosehr hörte ich, dass er am liebsten etwas anderes gesagt hätte. Auch jetzt warf er meinen nassen Schuhen noch Blicke zu, die sie wohl hätten Feuer fangen lassen, wenn sie nicht so durchweicht gewesen wären.
Ich versuchte mich trotzdem an einem Lächeln in seine Richtung, ehe ich gemächlich auf die Kleiderständer zuging.
»Penny, übernimm mal, ich gehe essen!« Mit diesen Worten stiefelte der Verkäufer an mir vorbei und verschwand aus der Tür.
»Mach ich, Onkel Sam«, antwortete eine Frauenstimme. Einen Moment später trat eine zierliche junge Frau mit einer strubbeligen pinkfarbenen Kurzhaarfrisur aus dem Hinterraum. »Oder vielleicht auch nicht, es interessiert dich ja eh nicht.« Kopfschüttelnd sah sie durch die große Schiebetür auf die Straße, ihrem Onkel hinterher.
Ich schmunzelte, während ich die warmen Wollpullover an der Wand betrachtete. Genau so was suchte ich. Ich nahm das Oberteil vom Haken, um es aus der Nähe zu betrachten. Doch als ich es umdrehte, sah ich das riesige Logo des Kodiak-Touristenverbandes darauf abgebildet. Enttäuscht hängte ich das Kleidungsstück zurück. Ich wohnte von nun an auf Kodiak. Ich wollte nicht wie eine Touristin herumlaufen.
Auch der nächste Pullover, den ich mir anschaute, hatte das Logo in der Größe eines Verkehrsschildes auf dem Rücken aufgedruckt.
»Ich glaube, wenn ich so nass wäre wie du, würde ich auch darüber nachdenken, eins von diesen furchtbaren Dingern zu kaufen.« Die Verkäuferin, die ungefähr in meinem Alter sein musste, war um den Holztresen herumgekommen und musterte mich interessiert. Sie hatte eine schmale Nase, und ihr Gesicht schmückte ein Piercing in der linken Augenbraue und eines in der Unterlippe.
Ich lächelte sie vorsichtig an. »Ich könnte wirklich etwas wetterfestere Kleidung gebrauchen«, gestand ich, während ich ein Zittern unterdrückte. »Sonst werde ich wohl schneller mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus landen, als ich von einem Bären gefressen werde.«
Die junge Frau prustete undamenhaft los. »Wie lange bleibst du denn auf Kodiak?«
»Keine Ahnung.« Ich zuckte mit den Schultern, denn tatsächlich hatte ich den Gedanken an solche Fragen bisher gekonnt verdrängt. »Eine Weile. Am Montag fange ich in der Middle School an zu arbeiten.«
Überrascht hob die Verkäuferin die Augenbrauen. »Das ist ja cool! Na, dann willkommen auf und in Kodiak, der tratsch-süchtigsten Insel der Welt! Ich bin Penny, aber das hast du dir nach dem Kommentar meines Onkels vermutlich schon gedacht.« Sie verdrehte die braunen Augen und grinste mich gleichzeitig an. Penny war mir sympathisch, und so chaotisch mein Tag auch gestartet war, das machte ihn gleich um Längen besser.
»Ich bin Ruby. Freut mich, dich kennenzulernen.«
»Wo kommst du denn her?«
»Aus Florida, und das hier«, ich deutete an mir herunter, »nennen wir dort ›warme Kleidung‹.«
Wieder lachte Penny aus vollem Halse, und diesmal konnte ich nicht anders, als mit einzustimmen.
»Dann brauchst du vermutlich wirklich ein paar Dinge.«
Ich griff wieder nach dem Pullover, der mir ganz gut gefallen hatte. »Habt ihr den auch ohne Logo?«
Schlagartig verdüsterte sich Pennys Gesichtsausdruck. Sie warf einen prüfenden Blick in Richtung Tür, ehe sie mir antwortete. »Lass das bloß nicht meinen Onkel hören, aber ich fürchte, du wirst bei uns nicht fündig werden.« Penny beugte sich näher zu mir. »Wir sind die totale Touristenabzocke«, flüsterte sie verschwörerisch. »Wenn du shoppen gehen willst, musst du aufs Festland fliegen.«
»Aufs Festland fliegen?!« Entsetzt sah ich sie an. Wollte sie mich veralbern? Es musste doch irgendwo auf dieser Insel einen vernünftigen Laden geben, in dem ich Kleidung und Schuhe kaufen konnte.
»Ja, an den meisten Wochenenden fliegen ein paar Shuttle-Flugzeuge. Du kannst dich einfach in die Liste eintragen.«
Kopfschüttelnd sah ich an mir hinunter. Na, das konnte lustig werden. »Und ihr habt wirklich nichts ohne aufgedruckte Reklame?«
Bedauernd schüttelte Penny den Kopf und zeigte mir den Rücken einer quietschgelben Regenjacke. »Ich glaube, du solltest dich auch auf den Weg machen, bevor mein Onkel zurückkommt und das große Geschäft in dir wittert.« Sie sah mich entschuldigend an.
Bevor ich Pennys Rat nachkam, beschloss ich, wenigstens noch einen trockenen Pullover – so hässlich seine Rückseite auch sein mochte – und einen Regenschirm zu kaufen. Zwar schrie mein Outfit nun erst recht nach unbeholfener Touristin, aber immerhin war mir etwas wärmer. »War schön, dich kennenzulernen!«, verabschiedete ich mich schließlich von Penny.
Kaum, dass ich den Laden verlassen hatte, begegnete ich ihrem Onkel Sam, der mich und meine neu erworbene Regenabwehr abfällig beäugte und im Vorbeigehen deutlich hörbar murmelte: »Na, für einen Schirm ist es jetzt aber auch ein bisschen spät, oder?«
Ich erwiderte nichts, sondern verdrehte nur die Augen und machte mich zügigen Schrittes auf in Richtung meines Wagens.
Kapitel 3
Ächzend ließ ich die drei großen Tüten auf den Boden der Küche sinken. Nach meiner wenig erfolgreichen Shoppingtour hatte ich mich schnell in dem Haus – es fiel mir immer noch schwer zu denken: mein Haus – umgezogen, meine nassen Klamotten in den Trockner geworfen und war in den Supermarkt gefahren. Immerhin kann man auf dieser Insel Lebensmittel einkaufen, dachte ich leicht sarkastisch und sortierte die Zutaten in meine Schränke ein.
Währenddessen spähte ich immer wieder zu dem Nachbargrundstück. Owen Hendersons plötzlicher Abgang am Morgen beschäftigte mich mehr, als er sollte. Er hatte mir das Leben gerettet, und mehr als ein heiseres Dankeschön hatte ich nicht zustande gebracht. Deswegen beschloss ich, für Owen Cupcakes zu backen.
Am Abend war ich bei Tante Maddie und James zum Abendessen eingeladen, und bis dahin blieb mir noch etwas Zeit.
Während ich den Teig anrührte, ließ ich meine Lieblingsplaylist auf dem Handy laufen und bewegte mich im Takt der Musik. Ich rührte einen cremigen Schokoteig an, den ich später mit einer luftigen Creme verzieren wollte. Denn Schoko-Cupcakes aß schließlich jeder gern, oder?
Auf einmal klingelte mein Handy. Claire, zeigte das Display an.
Da musst du rangehen, Ruby. Der rationale Teil meines Gehirns gab mir eine klare Anweisung. Aber ich rührte mich trotzdem nicht. Ich starrte das kleine Gerät so lange an, bis das Klingeln verstummte. Sie würde mich sowieso nicht verstehen. In dem letzten halben Jahr hatten Claire und ich uns entfremdet. Früher hatten wir einander alles anvertraut, und es gab keinen Menschen, der mich besser kannte als sie. Doch heute lief sie einer Illusion nach, der ich nicht mehr gerecht werden konnte.
Ruby!
Wann hast du Zeit? Wann können wir telefonieren? Ich fasse es immer noch nicht … Alaska! Das ist soooo weit weg.
Schlechtes Gewissen fraß sich durch meine Adern wie kochendes Wasser durch Schnee, aber ich wollte gerade einfach nicht mit ihr sprechen. Morgen würde ich mir Zeit für sie nehmen! Das war ich ihr schuldig.
Sorry, Claire. Es ist echt viel los hier, ich muss noch einiges erledigen, und heute Abend bin ich bei Maddie eingeladen. Ich rufe dich morgen an, versprochen!
Ich tippte eine schnelle Antwort und zwang mich wieder, der Musik zu lauschen, während ich weiter backte. Nachdem der Teig im Ofen war, rührte ich alles für die Creme des Toppings zusammen. Dabei versuchte ich mich an einem neuen Farbton. Heute schwebte mir schon den ganzen Tag ein dunkles Blau durch den Kopf, und ich versuchte, es auf meinen Cupcakes einzufangen. Erst als die Farbmischung fertig war, fiel mir auf, dass es weniger Meeresblau war, sondern viel eher einem Sommergewitterhimmel glich – oder Owen Hendersons Augen.
Arrgh! Ich verbarg mein Gesicht in den Händen, nur um sie nach einer Sekunde wieder runterzureißen, damit ich mir die Haare nicht schmutzig machte.
Egal!, beschloss ich. Welchem Mann fiel es schon auf, wenn man ihm Cupcakes in seiner Augenfarbe backte? Außerdem konnte ich behaupten, ich sei vom Meer inspiriert gewesen – so groß war der Unterschied auch wieder nicht. Also schüttelte ich den Gedanken ab, und während ich mich daranmachte, die lecker duftenden Cupcakes zu verzieren, rief ich bei meiner Mutter an.
»Ruby, Schätzchen, schön, dass du dich meldest! Ich wollte dich auch gerade anrufen. Hat Tante Maddie dich gut in Empfang genommen?«
»Das hat sie, Mom.« Während ich mich konzentriert vorbeugte, um den perfekten Schwung in meine Cremehauben zu bekommen, berichtete ich meiner Mutter von meinem ersten Tag auf Kodiak Island. Dabei ließ ich die Begegnung mit meinem vierbeinigen Einbrecher natürlich nicht aus. Zum Glück neigte meine Mutter nicht dazu, mich krampfhaft überbehüten zu wollen. Mit meinen achtundzwanzig Jahren war ich dafür schließlich auch schon zu alt.
»Ach, Ruby. Du bist doch sonst immer so vorsichtig und hast mir noch lang und breit erklärt, dass du dir vor deiner ersten Wanderung Bärenspray zulegen willst.«
Ich stellte mir vor, wie sie kopfschüttelnd an ihrem Küchentisch saß und sich meine Geschichte anhörte.
»Ganz genau. Vor meiner ersten Wanderung! Nicht vor dem Betreten meines Gartens.« Ich lachte.
»Weißt du, wer heute bei uns vor der Tür stand?«, wechselte meine Mutter abrupt das Thema.
Sofort verkrampfte ich mich, und die Hälfte der Streusel, die ich gerade über den ersten Cupcake streuen wollte, landete auf meinem Küchentresen. »Nein«, beantwortete ich ihre ohnehin rhetorische Frage. Mit aller Macht versuchte ich, ein Krächzen in meiner Stimme zu unterdrücken. War er etwa …?
»Onkel Gary. Er wollte sich von dir verabschieden, dieser kopflose …«
Erleichtert atmete ich auf und steckte mir die runtergerollten Streusel in den Mund. Im Gegensatz zu meiner Tante Maddie war Onkel Garry mein leiblicher Onkel. Er war ein zerstreuter Professor, und es war nichts Ungewöhnliches, dass er zwei Tage zu spät zu einem Treffen kam.
Als ich meiner Mutter verkündet hatte, dass ich Flugtickets nach Kodiak gebucht hatte und wegziehen wollte, hatte sie besser reagiert, als ich erwartet hatte. Sie hatte mein Schweigen akzeptiert, mir beim Packen geholfen und gemeinsam mit mir meine kleine Wohnung leer geräumt. Nur über meinen Wunsch, mich von niemandem zu verabschieden, hatte sie sich hinweggesetzt und an meinem letzten Abend zu einer kleinen Feier im engsten Familienkreis eingeladen. So war ich nur meinen Freunden einen Abschied schuldig geblieben.
Ich platzierte die letzte Blaubeere auf dem Cupcake und bestaunte mein Werk, während ich meiner Mutter von Penn’s Touristenladen berichtete. Den Cupcake, bei dem ich mit den Streuseln abgerutscht war, stellte ich beiseite, um ihn später selbst zu genießen. Die restlichen drapierte ich auf einem Teller und beschloss, sie gleich rüberzubringen. Ich verabschiedete mich von meiner Mom und ging noch einmal ins Bad, um zu prüfen, ob ich noch Teigreste im Gesicht oder Streusel in den Haaren hatte. Ich hatte heute schließlich schon mal einen schlechten Eindruck auf meinen neuen Nachbarn gemacht.
An der Haustür sah ich mich dieses Mal gründlich nach Gefahren um, bevor ich zielstrebig auf das nebenstehende Haus zulief und klingelte.
Ich hörte es hinter der Tür poltern, dann öffnete Mr. Henderson die Tür. Er trug das gleiche schwarze T-Shirt wie am Morgen. Das sollte mich vermutlich nicht verwundern … und mir definitiv nicht so auffallen. Ich zwang mich sofort, von seiner breiten Brust in seine Augen zu sehen.
»Ms. Walsh«, begrüßte er mich stirnrunzelnd.
»Adams. Ich heiße Adams«, erklärte ich, während ich mich fragte, ob es hier üblich war, sich in unserer Generation mit dem Nachnamen anzusprechen. Aber vermutlich lag das eher an den formellen Dienstgraden der Coast Guard, die halb zur Navy gehörte.
»Ich wollte mich noch mal bei Ihnen bedanken. Sie haben mir heute Morgen vermutlich das Leben gerettet.« Ich hielt ihm den Teller mit den Cupcakes hin.
»Das ist mein Job.«
»Kopflose Menschen vor Bären zu beschützen?« Zaghaft lächelte ich ihn an.
»Leben retten.« Auch wenn er immer noch wortkarg war, konnte ich ein Schmunzeln über sein Gesicht huschen sehen, und er nahm mir die mitgebrachten Cupcakes ab.
Ich wollte etwas erwidern, unser Gespräch am Laufen halten, doch mir fiel keine passende Antwort ein. Owen Henderson musterte mich, als wartete er auf irgendetwas. Unsicher wippte ich auf den Füßen vor und zurück. Normalerweise fiel es mir nicht so schwer, Menschen, die ich kennenlernte, einzuschätzen. Als Lehrerin, die regelmäßig vor verschiedenen Klassen stand, war ich auch recht geübt darin, Körpersprache zu lesen. Aber jetzt …
Nach einem unangenehmen Moment der Stille atmete Mr. Henderson tief aus. »Haben Sie sich heute ein Bärenspray gekauft?«
Seine Worte hinterließen ein dumpfes Gefühl in meinem Bauch, auch wenn er mit seiner unausgesprochenen Kritik recht hatte.
»Natürlich. Ich weiß ja, dass es hier viele Kodiakbären gibt … Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass sie durch die Stadt streifen.« Irgendwie klang es so, als wollte ich mich verteidigen. Ich wusste nur nicht vor wem. Vor Owen Henderson, der mich sicherlich für ein ziemliches Naivchen aus einer Großstadt hielt, oder vor mir selbst? Eigentlich war ich nicht leichtsinnig, und wenn ich über das nachdachte, was heute alles hätte passieren können, brach mir immer noch kalter Schweiß aus.
»Passen Sie von nun an einfach besser auf«, ermahnte er mich. »Dass sich ein Bär so dicht in unser Wohngebiet traut, passiert recht selten. Aber gerade im Frühjahr muss man damit rechnen. Haben Sie immer ein Spray dabei. Sicher ist sicher.«
»Danke«, murmelte ich betreten. Bevor ich noch etwas hinzufügen konnte, hörte ich, wie sich uns Autos näherten.
Sofort nahm Mr. Henderson Haltung an. Seine rechte Hand lag an der Stirn, und er war gefühlt mehrere Zentimeter gewachsen, was umso bemerkenswerter war, da er mich sowieso schon überragte.
Neugierig drehte ich mich um. In der kleinen Straße, in der unsere Häuser standen, hatten zwei Autos gehalten. Aus dem einen stieg gerade James aus, Maddies Mann. Das erklärte Owen Hendersons Verhalten. Aus dem anderen stiegen eine Frau und ein kleiner Junge aus.
»Captain«, grüßte Mr. Henderson förmlich, während James auf uns zukam.
»Petty Officer. Ruby.« James nickte uns nacheinander zu.
»James!« Freudig hüpfte ich die Stufe, die zur Eingangstür des Hauses gehörte, herunter und lief direkt in die Arme von Maddies Mann.
»Ich habe gerade Feierabend gemacht und wollte sehen, ob ich dich gleich mitnehmen kann. Ich wusste nicht, ob du schon einen eigenen fahrbaren Untersatz gefunden hast.«
»Wenn du mich so mitnimmst, komme ich gern sofort mit.« Ich deutete an mir hinunter. Ich war in einfache Bluejeans und meinen dicksten logofreien Pulli gekleidet.
»Wir essen in der Familie, Ruby. Wir veranstalten kein Dinner.« James lächelte mich liebevoll an. Tante Maddie und er konnten keine Kinder bekommen und hatten auch sonst keine Familie. Ich war wohl das, was einer Tochter am nächsten kam.
»Dad!« Der kleine Junge, der bei genauerer Betrachtung gar nicht mehr so klein war, sondern durchaus schon im Middle-School-Alter sein konnte, lief freudestrahlend an mir vorbei. Etwas gemächlicher folgte ihm die Frau, die mich neugierig ansah.
Das musste wohl Mr. Hendersons Familie sein. Ein komisches Gefühl breitete sich in meinem Magen aus. Owen Henderson war ein gut aussehender Mann, der einen angesehenen Beruf ausübte. Dass er gebunden war und eine Familie hatte, sollte mich nicht überraschen.
Wir verabschiedeten uns, und nachdenklich folgte ich James zu seinem Auto. Bevor ich einstieg, beobachtete ich noch, wie Mr. Henderson seiner Frau einen zärtlichen Kuss auf die Wange gab. Als hätte er meinen Blick gespürt, schaute er noch mal zu mir.
»Danke für die Cupcakes, Ms. Adams!«
Kapitel 4
»Ruby! Endlich meldest du dich!« Claires Stimme am Telefon klang vorwurfsvoll. Zu Recht, denn ich hatte es wieder den halben Tag vor mir hergeschoben, sie anzurufen. »Was denkst du dir dabei, einfach abzuhauen, ohne auch nur irgendwem Bescheid zu geben?«
Früher hatten wir versucht, einander zu verstehen, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung waren. Ich weiß nicht mehr genau, wann sich das geändert hatte.
»Mir ist das alles zu viel geworden, Claire. Ich brauche etwas Abstand von … alldem.«
»Und da fliehst du einfach nach Alaska, ohne einem von uns etwas zu erzählen? Verdammt noch mal! Niemand aus der Clique wusste davon. Sarina, Daniel, Stan …«
Für einen Moment herrschte Stille in der Leitung. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Sie hatte ja recht …
»Ich weiß«, flüsterte ich. »Es tut mir leid.«
»Das bringt dich uns doch auch nicht zurück.« Claire senkte ebenfalls die Stimme. Sie sorgt sich nur um dich, Ruby. »Du hast das Hafenfest verpasst. Es war richtig seltsam ohne dich. Ich musste meine Papierlaterne ohne dich fliegen lassen.«
Meine Augen brannten, als ich an die leuchtenden Wunschträger dachte, die Claire und ich schon seit unserem letzten Schuljahr jedes Jahr am Hafen steigen ließen. Claire und ich. Durch dick und dünn, so war es immer gewesen.
»Ich weiß sowieso nicht, ob ich mitgekommen wäre. Außerdem hast du deine doch bestimmt gemeinsam mit Dan fliegen lassen.«
»Aber er ist nicht du.«
»Ich … Es tut mir wirklich leid, Claire. Ich konnte einfach nicht anders.« Ich knibbelte an meinem Daumen. Ich hatte das alles so lange ertragen und irgendwie versucht, unsere Freundschaften am Leben zu halten. Mein Aufbruch war eine Selbstschutzreaktion gewesen. Ich war einfach dem tiefen Bedürfnis meines Herzens gefolgt.
»Die anderen fragen nach dir, Süße. Du hast niemandem außer mir deine neue Handynummer gegeben.« Ich hörte Claires unausgesprochene Frage.
»Es ist … vielleicht erst mal besser, wenn die Nummer niemand bekommt.« Ich dachte daran, wie ich mich irgendwann kaum mehr getraut hatte, auf mein Handy zu blicken.
»Bei Instagram schaust du auch gar nicht mehr rein. Wie sollen sie dich denn erreichen?« Claire wollte mich einfach nicht verstehen. Wie oft hatte ich in den letzten Wochen versucht, ihr zu erzählen, was mich belastete! Genug war genug!
»Ich brauche einfach eine Pause. Ich hoffe, irgendwann verstehst du mich.« Meine Stimme klang fest.
»Das hoffe ich auch, Ruby.«