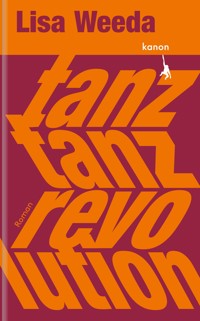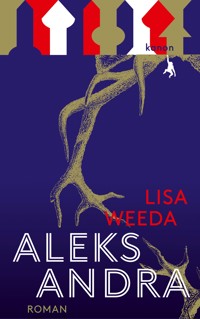
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Palast des verlorenen Donkosaken: Lisa Weeda erzählt vom Land ihrer Großmutter AleksandraLisa Weedas Großmutter heißt Aleksandra und stammt aus der Ostukraine. Über dieses Land, auf das heute alle Welt schaut, hat ihre Enkelin einen fulminanten Roman geschrieben. Die Nummer 1 aus den Niederlanden, übersetzt in zahlreiche Sprachen.Auf Geheiß ihrer 94-jährigen Großmutter Aleksandra reist die Erzählerin Lisa nach Luhansk, um das Grab ihres Onkels Kolja zu suchen, der seit 2015 verschwunden ist. Das verfluchte Geburtsland ihrer Oma sei gefährlich und kein Ort für Stippvisiten, warnt der Soldat am Checkpoint. Lisa gelingt die Flucht durchs Kornfeld – und landet plötzlich in der Vergangenheit: im magischen Palast des verlorenen Donkosaken. In seinen unzähligen Räumen entfaltet sich ein packendes Jahrhundertpanorama, das nicht nur die Geschichte ihrer Familie lebendig werden lässt, sondern die Historie dieses ganzen Landes, einer Region, die nie zur Ruhe kommt.»Meine Familie lebt in einem Gebiet, das seit hundert Jahren von Konflikten geprägt ist. Das Schreiben dieses Buches ist meine Art, mich an dem Kampf zu beteiligen. Es ist ein Denkmal für meine Familie, die durch all diese schrecklichen Ereignisse hindurch stark geblieben ist.« Lisa Weeda
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LISA WEEDA
ALEKSANDRA
ROMAN
Aus dem Niederländischen von Birgit Erdmann
kanon verlag
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Aleksandra bei Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds unterstützt.
Der Verlag dankt der Niederländischen Literaturstiftung für die Förderung der Übersetzung.
Dies ist Fiktion. Jegliche Ähnlichkeit mit Personen oder Ereignissen ist Zufall.
ISBN 978-3-98568-058-0
eISBN 978-3-98568-059-7
1. Auflage 2022
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2022
© Lisa Weeda, 2021
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Marco Stölk
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Inhalt
Anmerkungen
Stammbaum
Grenzübergang Ukraine – Volksrepublik Lugansk: AUGUST 2018
Palast des verlorenen Donkosaken
Lugansk: 17. APRIL 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Lugansk: 23. APRIL 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Lugansk: 27. APRIL 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 9. MAI 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 11. MAI 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 25. AUGUST 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 1. SEPTEMBER 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 14. SEPTEMBER 2014
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 9. JANUAR 2015
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 26. MÄRZ 2015
Volksrepublik Lugansk: 30. MÄRZ 2015
Palast des verlorenen Donkosaken
Volksrepublik Lugansk: 30. MÄRZ 2015
Grenzübergang Volksrepublik Lugansk – Ukraine: AUGUST 2018
Karte Ukraine und Donbas
Lisa Weeda
Aleksandra
Anmerkungen
Sascha ist der Rufname für Aleksandra – eigentlich lautet die weibliche Abkürzung Schura, doch weil Aleksandra in den Niederlanden scherzhaft Schura-Hur(e)-ha genannt wird, hat sie sich in Sascha umbenannt. Sascha ist normalerweise der Rufname für Aleksandr. Nastja ist der Rufname für Anastasija.
Und Kolja für Nikolaj. In diesem Roman kommen drei Nikolajs vor. Der älteste heißt durchgehend Nikolaj, der jüngste Kolja.
Ein vollständiger ukrainischer Name besteht aus einem Vornamen, dem Namen des Vaters und dem Familiennamen. Vatername und Familienname werden je nach Geschlecht gebeugt. So lautet der Familienname meines Urgroßvaters Krasnov und der meiner Großmutter Krasnova.
Die Stadt Lugansk hieß von 1935–1958 und von 1970–1990 Woroschilowgrad. Zur Zeit der Niederschrift des vorliegenden Romans war die Verwendung von Lugansk gebräuchlich. Seit dem 24.02.2022 wird verstärkt die ukrainische Transliteration von Städtenamen verwendet. Der Verlag dankt Kateryna Stetsevych von der Bundeszentrale für politische Bildung für die entsprechende Beschriftung des Kartenmaterials (S. 288).
Stammbaum
Für meine Oma Aleksandra
»And these are the trenches?«
»Yeah, these are the trenches. The final trenches of Europe.«
Reizen Waes, belgische Fernsehserie, S4E8 »Ukraine (2/2)«
Ich bin so kühn zu sagen, dass wir die Chance verpasst haben, die wir in den 90er Jahren hatten. Die Frage, was für ein Land wir wollen, ein starkes oder ein menschenwürdiges, in dem jeder gut leben kann, wurde zugunsten der ersten Antwort entschieden: Ein starkes Land. Es herrscht wieder eine Zeit der Stärke. Russen kämpfen gegen Ukrainer. Gegen Brüder. Mein Vater ist Weißrusse, meine Mutter Ukrainerin. Und so ist es bei vielen. […] Auf die Zeit der Hoffnung folgte eine Zeit der Angst. Die Zeit dreht sich zurück.
Swetlana AlexijewitschDankesrede Literaturnobelpreis 2015(übers. Ganna-Maria Braungardt)
Grenzübergang Ukraine – Volksrepublik Lugansk
AUGUST 2018
Selbst als ich am Checkpoint Aleksandras Namen, ihren Vaternamen Nikolajevna und ihren Familiennamen Krasnova nenne, lassen sie mich nicht durch. Ich nehme meinen Pass entgegen und deute auf die Brücke Richtung Lugansk.
»Als sie deportiert wurde, hieß die Stadt noch Woroschilowgrad«, sage ich.
Der ukrainische Soldat, der alle vor mir hat passieren lassen, schiebt sein Gewehr vom Bauch auf den Rücken und verschränkt die Arme vor der Brust. Die Brücke hängt wie ein entzweigehackter Baumstamm im Fluss, der die separierte Republik vom ukrainischen Boden, auf dem ich stehe, trennt. Die Holzkonstruktion, die schon knapp vier Jahre als Aufgang zur eingestürzten Brücke dient, sieht selbst von hier klapprig aus.
»Überall liegen Minen, es wird in einem fort geschossen, nachts fallen Bomben«, brummt der Soldat.
»Ja, das haben sie gesagt.«
»Wer, sie?«
»Meine Oma. Ihre Schwester Nina. Die wohnt hier, kennen Sie sie? Meine Großtante und ihr Sohn. In Odessa. Sie sagten: Du bist verrückt.«
Der Soldat schüttelt den Kopf.
»Deine Oma schickt dich in ein Kriegsgebiet? Ist sie plemplem?«
»Es ist wichtig, sie hat mich darum gebeten.«
»Das reicht mir nicht. Du hast zwar Papiere, bist aber allein. Such dir einen Helfer, jemanden, der mit dir geht.«
»Meine Großcousinen wohnen in Lugansk. Hier, ihre Telefonnummern.«
Ich halte ihm mein Handy unter die Nase und scrolle, bis die Namen Ira und Julija auftauchen. Er presst die verschränkten Arme noch fester an seine Brust, wodurch das blau-gelbe Emblem auf seinem Ärmel zerknautscht.
»Das kann ich nicht machen.«
Mit sehr ernster Miene hole ich ein längliches Leinentuch aus der Tasche und zeige es dem Soldaten.
»Dieses Tuch ist fast ein Jahrhundert alt. Es hat Tausende Kilometer zurückgelegt. Sie dürfen ihm nicht seine letzte Reise nach Hause verwehren.«
Das weiße Tuch ist mit schwarzen und roten Linien bestickt, die Ränder mit blauen, roten und schwarzen Blumenmustern. Ich deute mit dem Zeigefinger auf das Tuch. »Sehen Sie diese Linie hier, über der der Name Kolja steht, die Linie, die 2015 endet? Meine Oma Plemplem hat mich gebeten, das Tuch zu seinem Grab zu bringen, um die Zeit zu flicken. Sonst ist er verloren.«
Der Soldat sieht zu, wie ich das Tuch zusammenfalte. Langsam, erst einmal zur Hälfte, dann noch einmal, bis ich ein kleines Stoffquadrat in den Händen halte. Vorsichtig stecke ich es in meine Tasche. Möglichst dramatisch packe ich es langsam ein, als wäre es heilig.
»Das ist meine letzte Etappe. In ein paar Tagen bin ich wieder weg.«
Ich wühle noch einmal in meiner Tasche und hole das alte Foto von Aleksandra heraus, mein Trumpf. Das letzte, was ich bei mir habe, um ihn zu überzeugen. Ich halte ihm das Foto vors Gesicht, drücke es ihm beinahe an die Nase, so dass er es einfach betrachten muss. Aleksandra schaut ihn geradewegs an. Links und rechts von ihr sitzen Nusja und Dusja, ihre Cousinen, die wie sie im Krieg verschleppt wurden.
»Allmächtiger Gott!«, sagt der Soldat leise und blickt zum Himmel.
»Alle anderen Fotos aus ihrer Jugend sind verbrannt«, sage ich. »Ich habe mich überall erkundigt, meine Mutter hat herumgefragt, aber keiner in unserer Familie hat noch irgendwas. Alles weg. In Brand gesteckt. Von den Deutschen.«
Er nimmt das Foto und hält es neben mein Gesicht, kneift ein Auge zu, betrachtet mich, dann wieder das Foto. Ich ahme Aleksandras strengen Mund nach und kneife wie sie die Augen zusammen. Vielleicht hätte ich auch mein Zottelhaar flechten und mir den Zopf auf traditionelle Weise, wie eine Krone, um den Kopf schlingen sollen.
»Ihr seht euch ähnlich. Nur dein Haar … «
»Ja, ja«, murmele ich.
Ich reiße ihm das Foto aus der Hand und stecke es mit einer hitzigen Bewegung wieder ein. Der Höhepunkt meines kleinen Schauspiels. Hätte ich doch mehr Hitzköpfigkeit in mir, die Hitzköpfigkeit meiner ukrainischen Tanten, die jemanden endlos anblaffen können, ohne Atem zu holen.
»Lassen Sie mich durch«, versuche ich es wenigstens.
Die alte Frau hinter mir stöhnt inständig. Sie stellt ihre Plastiktüten mit einem theatralischen Seufzer ab und fragt, wie lange meine Vorstellung noch dauert.
»Schluss jetzt!«, sagt der Soldat und schiebt mich beiseite. »Raus aus der Schlange, zurück zur ukrainischen Flagge. Da drüben, hinter der Brücke, bist du trotz deiner Papiere, dem Sticktuch und dem lausigen Foto nicht sicher.«
»Ich habe es versprochen«, jammere ich, »lass mich einfach durch, dann bist du mich los.«
»Nein. Es wollen noch mehr Menschen über die Grenze, Menschen, die nach Hause müssen. Die hier wohnen«, sagt er laut. Die Frau nickt mürrisch.
»Ja, Menschen wie ich«, wettert sie, »dies ist kein Ort für dich. Komm wieder, wenn der Krieg vorbei ist. Dein toter Cousin läuft schon nicht weg, da bin ich mir sicher. Hopp, geh zur Seite, ich habe noch einen ewiglangen Weg vor mir, und kochen muss ich auch noch.«
»Kann ich nicht mit Ihnen kommen?«, quengle ich. »Wenn wir in Lugansk sind, gehe ich auch meinen eigenen Weg. Nachdem ich meine Familie angerufen habe.«
»Und wenn du niemanden erreichst? Bleibst du dann bei mir? Ich gehe abends in meinen Keller, immer noch, nach vier Jahren. Legst du dich dann zu mir, in mein schmales Bett? Soll ich dir etwa Geschichten von besseren Zeiten erzählen, bis du einschläfst?«
»Ihre Papiere«, sagt der Soldat und streckt die Hand aus.
»Ja, ja.«
Die Frau zischt mich an und hebt ihre Tüten auf den langen Tisch. Aus ihrem BH zieht sie einen ukrainischen Pass und einen der Volksrepublik Lugansk. Der Soldat blickt ihr ins Gesicht und vergleicht es mit den Fotos. Er ist nicht viel älter als ich, bemerke ich jetzt. Dann schaut er in eine Tüte nach der anderen, durchsucht den Inhalt. Ein Einweckglas mit Gurken, Milchtüten, geblümte Schlüpfer, in knisterndes Plastik eingepackte Strumpfhosen, ein Brokkoli, eine Artischocke, Bohnenkonserven, Knackwürste, schmale Sardinenbüchsen, gelb-blau gestreifte Plastikbecher, ein Schwarzbrot, Plastikteller mit knallrosa Blumenmuster.
»Warum waren Sie in der Ukraine?«
»Rente. Gemüse. Brot, Strumpfhosen. Neue Schlüpfer.«
»Warum wollen Sie einreisen?«
»Mann, Mann, Mann, du müsstest mich doch allmählich kennen. Du solltest mich über diese klapprige Brücke nach Hause tragen. Ja! Auf deinen starken Armen. Auf Händen. Die blättern sonst doch den ganzen Tag nur diese federleichten Pässe durch.«
»Gute Frau …«
»Ich habe es satt. So satt. Hast du es nicht satt? Diesen Zirkus, dieses ganze Theater?«
»Gute Frau, bitte, jetzt halten Sie hier alles auf. Wir machen mehr als nur die Ausweiskontrolle, das wissen Sie genau.«
»Ja, auf dieser Seite!«
Sie zeigt hinter sich, in Richtung Ukraine, und lacht verächtlich: »Was für ein Witz. Wie sie hier die Grenzschützer spielen. In all der Zeit, die ich hier lebe, hat sich überhaupt nichts verändert.«
»Nimm mich doch mit«, unterbreche ich das Gezänk, »meine Oma ist hier aufgewachsen, in einem Dorf an der russischen Grenze ist sie geboren, vielleicht kennen Sie sie ja.«
Wieder nehme ich mein Telefon, will es ihr auf der Landkarte zeigen.
»Oh!«, trötet die Frau. »Deine Großmutter ist hier in der Gegend geboren! Na, das ändert natürlich alles.«. Sie steckt ihre Pässe wieder ein und zerrt die Tüten vom Tisch.
»Dieses verfluchte Geburtsland deiner Oma ist kein Ort für Stippvisiten, es ist zu gefährlich. Do swidanija!«
Sie stößt mir demonstrativ die Tüten gegen den Bauch, wodurch ich einen Schritt zurückgehen muss, drängelt sich an mir vorbei und geht so würdevoll, wie sie es in ihren hellblauen Glitzerplastikpumps kann, am Grenzposten vorbei. Mürrisch grüßt sie die fünf Soldaten, die in aller Einsatzbereitschaft hin und her laufen. Zügig schreitet sie über die Asphaltstraße, die vor Hitze flimmert. Durch ihr Blümchenkleid verwandelt sie sich langsam in einen knallbunten Klecks, der auf die Brücke zuschwebt. Ich nehme meinen Rucksack und drehe mich um.
»Dann halt nicht«, sage ich laut, damit der Soldat es auch hört.
Ich gehe in die Ukraine zurück. Entlang der Straße leuchtet das Land golden. Das Getreide wiegt sich im Wind. Am Horizont rauchen Schlote, ihre weißen schlierigen Rauchwolken zerstückeln den hellblauen Himmel. In der Ferne ertönt ein Schuss. Noch zwei, dann vier, immer schneller hintereinander. Die Knallerei kommt von zwei Seiten, aus Ost und West. Erschrocken schaue ich zu den Menschen in der Schlange vor dem Checkpoint zurück. Alte, Männer und Frauen im Alter meiner Eltern, eine Handvoll junger Leute – niemand scheint beunruhigt. Sie starren weiter auf ihre Handys, verlagern nur das Gewicht von einem Bein auf das andere. Das Echo der Schüsse hallt über die Felder. Während sich das Geräusch langsam verflüchtigt, hält eine Schrottkarre hinter der Warteschlange. Ein alter Saporoshez, eckig und zusammengestückelt, die linke Hintertür ist rot statt weiß. Ein Mann steigt aus, schaut kurz auf seine Uhr und dann zu den Menschen, die sich unter dem Spanholzschutzdach drängen. Er nickt zufrieden und beugt sich zum geöffneten Fenster, um dem Fahrer noch etwas zu sagen. Dann geht er in das Kornfeld. Das Auto wendet ungeschickt, fährt mehrmals vor und zurück, und entfernt sich auf der staubigen Straße.
»Hey, warte mal.«
Der Soldat drückt einem Mädchen ihren Pass in die Hand. Er läuft zum Ende der Schlange, will nachsehen, was los ist. Alle verstummen, die Leute lassen die Handys sinken. Ihre Blicke verfolgen den Mann im Feld. Sein Körper taucht erst bis zu den Hüften, dann bis zu den Schultern und schließlich bis zum Scheitel in das Getreide ein.
»Wieso ist da jemand im Feld?«, blafft der Soldat einen schlaksigen Jungen an, der verschreckt zusammenzuckt.
»Er wollte pinkeln, glaube ich.«
»Verdammt, dieser Idiot«, flucht der Soldat.
Er rennt zum Rand des Feldes, wo ein schmaler Pfad entstanden ist. Als er einen Schritt auf den Boden setzen will, plärrt ein Klingelton: »Warum verlässt du mich?«, singt eine wollüstige Stimme. Sie übertönt alle Geräusche in der Umgebung. Jeder in der Schlange steht still, schaut.
»Hallo?«, klingt es aus dem Getreide.
Die Halme bewegen sich nicht mehr, der Staub legt sich. Die schwarze Erde verhält sich ruhig, wartet auf das, was noch kommt.
»Ja, ja natürlich, logisch«, sagt der Mann.
Sein Kopf bewegt sich kurz. Eine Frau wendet sich vom Feld ab, schließt die Augen, als wüsste sie, was gleich passiert. Ich höre ein seltsam saugendes Geräusch. Etwas schmatzt. Dann zerfetzt ein enormer Knall beinahe mein Trommelfell. Schwarze Erde und Getreidehalme fliegen durch die Luft. Der Kopf des Mannes verwandelt sich in einer Zehntelsekunde in eine Rauchwolke. Die Menschen in der Schlange gehen gleichzeitig in die Hocke. Durch das Pfeifen in meinen Ohren habe ich die Orientierung verloren. Ich sehe das wogende Getreide und die Soldaten. Mit den Maschinengewehren am Anschlag rennen sie zur Böschung vor der Explosionsstelle. Sie sprechen laut und in kurzen Sätzen.
»Tot?«
»Mausetot.«
»Unangenehm zu dieser Tageszeit.«
»Vollidiot, Männer, wieder so ein Vollidiot.«
Sie rücken auf der staubigen Straße näher zusammen und beratschlagen sich flüsternd.
»Stehenbleiben, alle! Niemand bewegt sich, bis wir den Ort gesichert haben.«
Die kleine Truppe marschiert in das Feld, die Gewehre im Anschlag. Ein Soldat bleibt am Feldrand stehen, um den Checkpoint im Auge zu behalten. Ein alter Mann beginnt leise zu weinen. Andere blicken auf ihre Uhren und Handys, schütteln ärgerlich den Kopf.
»Wann ist denn endlich Schluss damit, was für ein Irrer«, murmelt ein junger Mann in einem Lugansk-Fußballshirt. Er verschränkt seine tätowierten Arme und betrachtet das Feld, über dem die Helme der Soldaten schweben. Einer ruft, ein Krankenwagen soll kommen, woraufhin ein anderer sagt, dass ein Krankenwagen keinen Sinn mehr macht und sie besser die Gliedmaßen aufsammeln und die Ortspolizei verständigen sollten. Ich schaue zur Brücke in der Ferne und dann zu der Frau, die inzwischen telefoniert. Ihre Perlmutt-Swarovskihülle glitzert in der Sonne.
»Jaja, ich komme später«, sagt sie und seufzt. »Rate mal. Da steht extra ein Schild am Feldrand, bisschen besser aufpassen, tja, Fehlanzeige.«
Mittlerweile telefonieren alle um mich herum. Ich mache kehrt. Ich bin verrückt, denke ich, dann laufe ich los. Ich renne am Grenzposten vorbei und schlängle mich um die Betonblöcke, Richtung Holzprovisorium und Brücke.
»Tu’s nicht, Mädchen«, ruft ein alter Mann mir nach, »deine Oma würde sich dafür schämen, wie ihr Land heute aussieht!«
Rennend strecke ich den Arm in die Luft und mache eine Wegwerfgeste. Ich kann nicht mehr stoppen, nicht jetzt. Was würde passieren, wenn ich stehen bleibe? Was dürfen Soldaten eigentlich tun, bei einem illegalen Grenzübertritt? Während der Heimatboden meiner Oma näher kommt, muss ich an den Nachmittag denken, an dem mich meine Mutter schluchzend angerufen hat und nur einen Satz sagte: »Sie haben Kolja gefunden.« Und an Aleksandra, die das Tuch auseinanderfaltete und meinte, dass Kolja das Tuch nun am bitter nötigsten von uns allen hätte, und mir auftrug, eine kugelsichere Weste zu kaufen, die ich unter meinem T-Shirt tragen sollte – was ich nicht getan habe und es nun bereue, weil hinter mir ein Soldat ruft, ich solle auf der Stelle zurückkommen.
»Niemand holt deinen Leichnam, wenn es schiefgeht«, schreit er.
Ich renne an der Frau mit dem Blumenkleid vorbei, den maroden Aufgang hinauf. Kurz stelle ich mir vor, wie meine Oma am Esstisch in ihrer Seniorenwohnung bekümmert den Kopf schüttelt, und vergesse, auf die aufgerissene Straßendecke zu achten. Der Abgrund links zieht mich beinahe in den Donez, der Fluss, von dem sie immer spricht, in dem sie als Kind gebadet hat, in dem meine Mutter schwamm, als sie zum ersten Mal hier gewesen ist, der Fluss, den ich zum ersten Mal sehe und von dem ich denke: Wenn ich falle, war’s das. Ich finde das Gleichgewicht wieder, ergreife das Geländer. Am Ende steige ich unbeholfen eine Treppe hinunter, die nicht weniger provisorisch ist – nur ein Gestell aus schrägen Holzplatten, auf denen Latten montiert sind, um nicht in einem Rutsch nach unten zu schlittern.
»Immer mit der Ruhe!«, ruft ein Mann, der mir entgegenkommt. Er zieht einen Einkaufstrolley mit abgenutzten Rollen hinter sich her. Nach jeder Latte, über die er den Trolley ruckend zieht, bleibt er kurz stehen. Unter den Achseln seines Hawaiihemds zeichnen sich runde Schweißflecken ab, seine Haare sind ordentlich zur Seite gekämmt, er riecht nach süßem Eau de Cologne. Der Duft kribbelt in meiner Nase.
»Den alten Friedhof«, frage ich und bleibe stehen, stütze die Hände auf die Knie, um zu Atem zu kommen, »kennen Sie den?«
»Den alten Friedhof?«
Ich nicke.
»Geradeaus, immer geradeaus und dann irgendwann rechts. Es ist ein langer Weg, wirklich, täusch dich da nicht. Und wenn du gleich unten bist: nicht mehr rennen, das fällt auf.«
Ich danke ihm und nehme die Beine in die Hand, vorbei an alten Frauen und Männern. Ihre Schritte sind langsam. Sie ziehen sich an dem klapprigen Holzgeländer vorwärts. Die Hitze scheint sie nach hinten zu ziehen. Sie tupfen sich mit geblümten Taschentüchern den Schweiß von der Stirn, genau wie es Aleksandra an heißen Sommertagen tut, wenn sie in ihrem kleinen Vorgarten in der Sonne sitzt. Die Straße hinter ihnen ist lang und voller Schlaglöcher. Die Straße liegt vor mir und in der Ferne nur der Checkpoint der Volksrepublik. Doch wo genau beginnt Aleksandras altes Lugansk, frage ich mich.
»He, du kannst da echt nicht einfach hin!«
Der Soldat steht mittlerweile auf der Brücke. Seine großen Stiefelschritte klatschen dumpf auf dem Asphalt.
»Los, renn!«, spornt mich der Mann im Hawaiihemd weiter oben auf der Treppe an und legt seinen Trolley quer über die Stufen, während er so tut, als suche er etwas. Er öffnet den Deckel und zieht seine Einkäufe heraus: Tomaten, Kartoffeln, eine Melone.
»Das hält ihn nicht lange auf, dawai!«
Ich ziehe die Riemen meines Rucksacks fester und springe von der letzten Latte. Unten, in der staubigen Böschung, rutsche ich aus. Die Menschen, die aus dem Kriegsgebiet kommen, beobachten verwirrt meine ungeschickten Bewegungen.
»Haltet den Soldaten auf!«, rufe ich, »Bitte, ich muss zum Grab meines Cousins.«
Ich schaue mich kurz um. Bevor ich mir überlegen kann, wie ich es gleich noch durch den nächsten Grenzposten schaffen soll, höre ich einen Mann rufen, irgendwo links von mir.
»Hier, ins Feld!«
Ich überquere die Straße und renne der Stimme hinterher, an einem roten dreieckigen Schild vorbei: Achtung! Minen!
»O nein, Mist«, fluche ich und suche über den Halmen die Stimme, die mich gerade eben gerufen hat.
»Lauf weiter, mein Kind, weiter. Dir wird nichts zustoßen.«
Die Ähren peitschen mir ins Gesicht und hinterlassen dünne rote Striemen auf meinen Waden und Unterarmen. Ich wedle wie eine Irre mit den Händen, um die nächsten Meter Erde vor mir sehen zu können. Den Boden möchte ich möglichst wenig berühren, also spurte ich auf Zehenspitzen vorwärts.
»Wo muss ich denn hin?«, rufe ich.
»Hierher!«
Bei einem Schritt nach rechts stoße ich mir den Zeh an einem Stein. Ich verliere das Gleichgewicht und knalle vornüber auf eine gigantische weiße Treppe.
Palast des verlorenen Donkosaken
Breite Marmorstufen ragen über mir auf. Ich komme wieder auf die Beine und steige hastig hinauf. Die Stufen sind so hoch, dass ich springen muss. Als ich auf einem Treppenabsatz verschnaufe, sehe ich den riesigen Turm. Eine hysterische Geburtstagstorte, die schlanke Version des Turms von Babel. Das Ungetüm besteht aus sechs großen runden Geschossen. Ganz oben thront eine Leninstatue. Jedes Geschoss ist mit Säulen bekleidet, auf denen weitere Skulpturen stehen: Menschen, die fünfmal so groß sind wie ich. Sie tragen Fahnen und marschieren vorwärts, ich sehe Arbeiter und Kinder, Kolchosemädchen, Jungen mit Meißel und Hammer in den Händen. Sie tragen zweiteilige Arbeitsanzüge, Latzhosen, Schürzen über Kleidern, Kopftücher und Schirmmützen. Lenin nimmt etwa ein Viertel des Gebäudes ein und weist in die Ferne, Richtung ukrainischen Checkpoint, Richtung Westen, weg von dem Kriegsgebiet, weg von der russischen Grenze. Ich folge seinem Finger und entdecke den Helm des Soldaten, der am Rand des Weizenfelds entlangläuft. Verfolgt er mich etwa immer noch? Hinter mir geht knarrend eine Tür auf.
»Hey, sag mal«, zischt die Stimme, »was stehst du da herum?«
Im Türspalt erscheint ein Kopf. Ich erkenne das Gesicht von einem schwarz-weiß Porträt, das in dem Schlafzimmer meiner Oma über dem Bett hängt.
»Holy shit«, flüstere ich, »Nikolaj.«
Er scheint keinen Tag älter zu sein als auf dem Foto: ein paar lange Furchen auf der Stirn, Krähenfüße, frisierter Schnurrbart, dunkle Augenbrauen und eine stramme Kinnpartie. Mit seiner schmalen Hand winkt er mich zu sich. Ich werfe Lenin einen letzten Blick zu.
»Was tut der noch hier?«, rufe ich. »Ist der Mann nicht ein Jahrhundert zu spät dran?«
»Was soll’s«, sagt Nikolaj, »komm rein.«
Ich renne die restlichen Stufen hoch und schlittere über den glänzenden Treppenabsatz zur Tür. Weizenkörner strömen durch den Türspalt nach draußen.
»Die müssen alle wieder hinein«, sagt er besorgt.
Also gehe ich in die Hocke, forme mit meinen Händen eine Schale, schaufele die Körner peinlich genau zurück.
»Schneller, so schnell dein junger Körper kann, mein Mädchen!«
Während ich meine Hände als kleine Schneepflüge einsetze und das Getreide vor mir herschiebe, höre ich den Soldaten rufen, dass ich mitten in einem Minenfeld stehe.
»Ich weiß nicht, was du da tust, aber hör mir gut zu: Nicht. Bewegen!«
Einen Moment überlege ich, ob ich Nikolaj folgen oder die Augen zukneifen und mich nicht mehr rühren soll, wie es der Soldat sagt, mich einfach tot stellen, in dem Feld, bis mich jemand rettet. Doch als ich in die freundlichen blauen Augen meines Urgroßvaters blicke und hinter mir den Soldaten näher kommen höre, fege ich die letzten Weizenkörner zusammen und stapfe hinter ihm her. Einmal drinnen, drücke ich mit Nikolaj die schwere Tür zu. Er beugt sich vor und holt tief Luft. Ich lege meinen Rucksack ab und lasse mich rücklings ins Korn fallen. Die Gewölbedecke und die Wände sind voller Fresken: Menschen mit roten Fahnen in der Hand, Kinder in weißen Anzügen und roten Halstüchern. Sie marschieren über Boulevards, die genauso breit sind wie die sechsspurige Straße, die mitten durch Kiew verläuft und auf der die Militärparaden am 9. Mai abgehalten werden. Die Ecken der Decke sind mit Hämmern und Sicheln verziert, ich sehe rote Sterne, goldene Ornamente und steinerne Banner. Nikolaj reicht mir die Hand und zieht mich hoch.
»Endlich«, sagt er, »nach all der Zeit.«
Er schüttelt das Getreide aus den Falten meiner kurzen Hose und meines T-Shirts, hört aber abrupt damit auf, als er meine Schultern abgeklopft hat und mir ins Gesicht sieht. Irgendwie scheint er sich vor mir zu erschrecken. Vor meinen Augen, meiner Nase. Vor meinen Beinen und Armen, die er soeben noch väterlich tätschelte. Mir fällt plötzlich ein: Ich habe den Vater meiner Oma noch nie gesehen, nie berührt, er ist ja seit 1953 tot. Lange Zeit sehen wir uns schweigend an, dann schließt er die Augen und schüttelt den Kopf, lacht über sich selbst.
»Ich dachte kurz, du wärst Aleksandra.«
Sich durch die Getreidekörner zu bewegen ist umständlich. Die Masse reicht mir bis zu den Knien. Ich wate. Von allen Seiten kommen die Fresken auf mich zu, die Halle ist ein lebendes Propagandaplakat: Sie rufen mich in rot, weiß, gold an. Hierauf hat mich Aleksandra nicht vorbereitet, als sie sagte: »Hilf Kolja auf die andere Seite.« Kurz überlege ich, ob ich die Tür doch wieder öffnen sollte, um wie eine Irre zurück zu rennen, im Slalom, direkt in die Arme des Soldaten.
»Dies ist nicht der Ort, an dem ich sein sollte, glaube ich«, sage ich möglichst lässig. Meine Stimme verflüchtigt sich in der großen Halle.
»Mir scheinst du auch nicht diejenige zu sein, die hier sein sollte.«
Ich schaue ihn an, suche in seinen Augen, was er damit meint.
»Du lebst!«, ruft er. »Das ist hier noch nie vorgekommen, ein lebender Krasnov-Nachkomme im Palast! Ich dachte wirklich, du wärest Aleksandra, dass sie endlich gekommen ist, um mit mir auf die andere Seite zu gelangen.«
Seine Stimme klingt heiter, wenn er über sie spricht. Wartet er hier etwa seit knapp einem Dreivierteljahrhundert auf sie?
»Sie hat dafür mich geschickt«, sage ich entschuldigend.
»Ich gehe hier nicht weg, ich warte, bis sie vor der Tür steht.«
»Nein, beruhige dich. Es geht um Kolja. Sie träumt von ihm, sie meint, dass er keine Ruhe findet.«
Nikolaj reißt die Augen auf.
»Woher weiß sie das?«
»Sie sagte, dass er irgendwo feststeckt. Sie sprach von weißen Hirschen in ihrem Haus, von roten und schwarzen Linien. Sie gab mir ein altes Tuch mit, das mit diesen Linien bestickt ist. Du hast auch eine.«
Nikolajs Mund ist plötzlich so gerade wie ein Lineal, kein Kräuseln mehr in den Mundwinkeln. Auch Aleksandra kann so ein Gesicht ziehen: Wenn ich einen dreckigen Witz reiße; auf dem Begräbnis meines Großvaters, als der Sarg geschlossen wurde; vor vier Jahren beim Abschied von ihren drei Schwestern Lida, Klawa und Nina, nachdem sie als Überraschung zu Aleksandras neunzigsten Geburtstag in die Niederlande kamen. Im Hochsommer, der Krieg im Donbass tobte seit ein paar Monaten. Die Wochen mit den drei Schwestern vergingen wie im Fluge, es kam uns vor, als wären sie gerade mal zwei Tage zu Besuch und dann Hals über Kopf wieder abgereist. Ihre Blümchenkleider hingen doch gerade noch an unserer Wäscheleine, ihre Absatzschuhe standen noch im Flur, gerade hatten sie zwei alte Lieder gesungen, und schon waren sie wieder weg. Im Auto meines Onkels Peter, zum Flughafen, ich saß eingepfercht zwischen Lida und Nina auf der Rückbank. Die beiden verdrehten sich fast den Hals, um ihrer Schwester, die in ihrem Vorgarten stand, möglichst lange zuzuwinken.
»Wir müssen so lange wie möglich winken«, sagte Lida, den goldenen Eckzahn beinahe in meine Wange rammend, »so lange wie möglich. Vielleicht ist es das letzte Mal.«
Nikolaj ergreift meine Hände.
»Er ist hier. Kolja. Er verharrt auch noch im Dazwischen.«
Mein Urgroßvater deutet in die Luft, an der gewölbten Decke entlang. Ich folge dem Finger, der langsam immer weiter wandert, während Nikolaj auf den Zehenspitzen steht. Um uns herum versammeln sich Menschen, die breit grinsend vorwärtsmarschieren. Sie kommen auf uns zu, treiben Nikolaj und mich wie folgsames Vieh zusammen, um uns mit ihrer exorbitanten Freude anzustecken. Es sind nicht nur Fresken, wie ich jetzt bemerke, es sind auch Mosaike, aus Tausenden glänzenden Steinchen zusammengesetzt.
»Warum marschieren sie auf uns zu?«, frage ich. »Warum sehen wir nicht, wohin sie gehen?« Ich denke an Aleksandras Geschichten aus ihrer Kindheit, über den Komsomol, bei dem sie mit ihren Freundinnen Lieder über das starke Mutterland singen lernte, mit denen sie durch die Straßen zog.
»Ich habe gelernt, mit Schrot zu schießen und Verwundete zu versorgen«, erzählte sie mir einmal. Die vergnügten Geschichten aus ihrer Jugend nahmen mit einem Mal ganz andere Formen an.
Nikolaj führt mich weiter durch die Halle zu einem roten Sofa, das genau in der Mitte steht. Bei jedem Schritt füllen sich meine Schuhe mit den kitzelnden Körnern. Ich bemühe mich, nicht auszurutschen. Neben mir gleitet Nikolaj eher, als dass er geht. Er bewegt die Füße wie Skier im Schnee und stützt mich.
»Man gewöhnt sich daran«, sagt er. »Es dauert ein bisschen, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Ich betrachte dann immer die Wände und das glitzernde Interieur, das lenkt ab.«
Die lächelnden Mosaikmenschen ziehen jedes Mal, wenn ich sie ansehe, ein gequälteres Gesicht, als wüssten sie selbst, dass sie sich ihre Gesichtsmuskeln zerren. Einen Moment glaube ich, Aleksandra zu entdecken, sie kommt direkt auf mich zu, ihr rundes Gesicht, die dunklen Haare und die blauen Augen schwanken mit den wogenden Schritten der Menschenmenge mit. Nikolaj klopft auf die Sitzfläche des Sofas. Ich setze mich zu ihm.
»Was ist das für ein absurder Ort? Eine Zwischenstation für die Toten?«
»Im Prinzip ist es nichts. Diesen Palast gibt es nicht. Besser gesagt, es hätte ihn geben müssen, aber es blieb bei einem Traum auf dem Papier der Anführer aus dem Geburtsland deiner Oma. Es sollte das Hauptquartier für die Weltrevolution werden. Menschen riefen: Hier werden wir alle Reichtümer unseres Landes versammeln, alle Kreativität unserer Bauern und Arbeiter! Dieser Palast sollte allen Freunden und Feinden zeigen, dass wir in der Lage wären, wie drückten sie das noch aus, die sündige Erde mit einem Monument zu bedecken, von dem andere nur träumen könnten. Ein Ort für die Kongresse der Volkskommissare, mit einem kleinen und einem großen Theatersaal. Der große Theatersaal ließ sich auch in eine Eisbahn verwandeln. Es sollte riesige Kantinen und Speisesäle geben, ein Restaurant in einem der höheren Stockwerke eigens für die Anführer der Sowjetunion. Der Vorplatz sollte so groß sein, dass Massendemonstrationen abgehalten werden könnten, Aufmärsche, Paraden, wichtige Momente an Feiertagen, so was wie Der Tag des Sieges. Wenn man wissen wollen würde, wo all die deportierten Freunde abgeblieben waren, hätte man sich hier umschauen müssen.«
Er lacht. Nur kurz. Danach atmet er tief aus.
»Kleiner Scherz. Darauf hätte man auch in den allerschönsten Gebäuden keine Antwort gegeben. Kolja und ich nennen diesen Ort den Palast des verlorenen Donkosaken. Jedenfalls ich nenne ihn so, Kolja kann darüber immer noch nicht richtig lachen.«
Zwischen den glitzernden Wänden springt seine Stimme hin und her. Er streicht über den roten Stoff. Jetzt verstehe ich, warum der große Lenin oben auf dem zylinderförmigen Gebäude steht. Wieder atmet Nikolaj tief aus und blickt hoch zur Decke. Da ist Lenin wieder. Aus der Mitte eines Freskos deutet er, genau wie sein Standbild, in Richtung Westen.
»Sie hatten so viele Träume für diesen Ort, wie sie auch viele Träume für unser Land hatten. Mit den Jahren wurden sie immer gieriger. Diese Gier zog wie ein Schüttelfrost über unseren Boden. Wir bekamen es zu spüren, den Hunger nach Wachstum, der größer war als irgendein anderer Hunger. Wir fühlten es, im Winter, als sie die größte Kathedrale Russlands sprengten, um Platz für diesen Palast zu schaffen. Deine Oma, unsere Sascha, war damals noch klein, gerade sieben. Ein wunderbares Kind, sanfte blaue Augen, ein Lächeln, das mir guttat, auch als unser Leben immer finsterer wurde.«
Er weist mich auf die Bleiglasfenster hin, links und rechts der Tür, durch die ich hereingekommen bin. Auf der ganzen Länge ist eine glühende Landschaft zu sehen.
»Schau«, sagt er, »so sah unser Land in dem Sommer aus, bevor sie die Kathedrale gesprengt haben, um dieses Ungetüm zu bauen, Hunderte Kilometer von unserem Dorf entfernt.«
Ich betrachte die goldenen Felder, die hellbraunen Steppen und das schwarzgrüne Ackerland. In der Ferne stehen Menschen. Zunächst scheinen sie still zu stehen, dann setzen sie sich in Bewegung. Es sind Bauern. Sie gehen über die Hügel, tragen Getreidebündel auf dem Rücken, sitzen auf Pferdekarren mit Säcken voller Weizen, Mais, Bergen von Zwiebeln und Rüben. Auch Nikolaj spaziert über die Felder, ich erkenne seinen geraden dunklen Schnurrbart. Er trägt eine kurze Sense über der Schulter und geht Hand in Hand mit einer Frau.
»Schau, deine Urgroßmutter. Anna, meine Frau.«
Hinter ihnen laufen zwei Mädchen: Aleksandra und ihre ältere Schwester Nastja.
»Und da ist Baba Mari, meine Schwiegermutter, siehst du sie? Mit ihrem trägen schleppenden Gang? Sie kannte keine Eile.«
Genau wie meine Oma stemmt Baba Mari beim Gehen die Hand in die Hüfte, streichelt Pferde, Ziegen und Kühe, die ihre Köpfe für sie beugen. Manche Tiere schmiegen sich an sie, andere begleiten sie ein Stück. Aleksandra und Nastja klopfen einander auf den Rücken und ducken sich so schnell wie möglich, wenn sich die andere umdreht. Sie verstecken sich im Kornfeld, rennen über einen staubigen Sandweg zu einer Mühle. Die Flügel drehen sich im Wind. Ich kenne diese Mühle aus Aleksandras Erzählungen: Sie ist etwas kleiner als niederländische Windmühlen und vollkommen aus Holz. Als Aleksandra und Nastja vom Herumalbern erschöpft sind, schließen sie sich wieder Anna, Nikolaj und Baba Mari an. In einer Reihe laufen sie im Gleichschritt über das Land. Sie klatschen in die Hände, spornen die Pferde an, den Karren schneller zu ziehen, treiben die Ziegen zusammen. Die Farben des Bleiglases verändern sich, der hellblaue Himmel wird dunkler, rosig. Die Sonne geht in den ockergelben Feldern unter. Alle setzen sich, lehnen sich an ein Wagenrad, halten eine Tomate in der Hand. Die Tomaten sind genauso rot wie der Himmel. Die Erde ist pechschwarz.
»Was für ein schöner Landstrich«, sage ich und betrachte meine junge Oma, die langsam auf dem Schoß meines Urgroßvaters einschlummert.
»Dieses Stück Ukraine wurde jeden Tag als Erstes von der Sonne berührt. Morgens schimmerte dann eine dünne Schicht Rot am Horizont«, sagt Nikolaj.
»Es umgab uns immer, das Schwarz und Rot«, sagte Aleksandra am Tag vor meiner Abreise in die Ukraine. »Mit dem Sticktuch, das Baba Mari in meinen Koffer gestopft hat, an jenem eiskalten Novembertag 1942, als ich in Woroschilowgrad in den Zug nach Deutschland gesetzt wurde, fuhren das Rot und das Schwarz mit mir. Das Tuch, das ich dir mitgebe, ist Fluch und Segen zugleich. Unsere Familie ist durch das Rot und Schwarz miteinander verbunden. Durch Leben und Tod, durch die Linien, die es durchlaufen, ineinander fließen, gegeneinander prallen, sich voneinander fortbewegen, neue Linien entstehen lassen. Gibt es zu viel Schwarz, kommen wir zusammen und trauern. Gibt es viel Rot, lachen und singen wir, umarmen uns und tanzen. Im Leben eines Krasnov bewegen sich Schwarz und Rot fast immer gleichzeitig.«
Sie sagte das nahezu unbekümmert. Sehr gefasst, ruhig. Sie sprach über die beiden Farben, als hätte ich das schon immer wissen müssen, als Mädchen mit einer ukrainisch-russischen Großmutter. Danach gab sie mir drei Küsschen und umarmte mich kurz.
Ich nehme meinen Rucksack, öffne den Reißverschluss des kleinen oberen Fachs und hole das Sticktuch heraus. Nikolajs Augen leuchten, als er das Stoffstück sieht.
»Dass das noch da ist. Wir dachten, sie hätte es auf der Reise verloren. Einigen Mädchen wurde alles abgenommen, haben wir gehört.«
»Sie hat es immer in ihrem Koffer bei sich gehabt«, sage ich. »Der kam auch mit in die Niederlande. Dort versteckte sie das Tuch all die Jahre in einem Brotkasten. Sie holt es nur hervor, wenn sie allein ist, selbst mein Opa hat nie gesehen, dass sie daran stickt.«
»Baba Mari hat mit dem Tuch angefangen, in unserem Haus in der Stadt, das Haus, in das wir gezogen sind, nachdem wir dem Staat unseren Bauernhof überlassen mussten. Sie stickte immer in ihrem Zimmer. Man war seines Lebens nicht sicher, wenn man hereinkam und sie gerade mit ihren alten Fingern das Tuch bestickte. Dann zitierte sie dich hinaus.«
Nikolaj streckt mir die Hände entgegen. »Darf ich?«
Ich übergebe ihm das Tuch. An zwei Ecken faltet er es auseinander. Er betrachtet die Linien, die seine Schwiegermutter Mari in den dreißiger Jahren begonnen und die Aleksandra auf ihre Bitte in der Baracke in Griesheim und später in den Niederlanden fortgesetzt hat. »Vielleicht war es das Tuch, das mich am Leben gehalten hat«, hat sie einmal zu mir gesagt.
»Wo stehe ich? Ich kann es nicht gut lesen.«
Ich zeige ihm die Linie mit seinem Namen, die in einem grauen Viereck endet, über einem kleinen orthodoxen Kreuz steht sein Sterbedatum.
»Ah, ja, 1953, da steht es ja«, sagt er. Er betrachtet die anderen Linien, Verwandte für Verwandte: meine Prababa Varvara, Baba Mari, djed Stepan, Anna – sein Finger hält kurz inne, er streichelt die Buchstaben ihres Namens –, Nikolaj, Aleksandra, meine Großtanten Nastja, Lida, Klawa und Nina, mein Großonkel Kolja, Großonkel Sasja, Cousin Aleksandr, Igor, Kolja, Larissa, Andriy, Natasja, Witja. Ich weise ihn auf die Linien hin, die nach dem grauen Kreuz bei Koljas Namen weiterlaufen.
»Ihre Hände wurden langsam steif«, sage ich, »die Jahreszahlen sind manchmal etwas zittrig.«
»Das Leben in diesem Palast spielt sich ohne Jahreszahlen ab«, sagt Nikolaj. »Nach meiner Ankunft hier geschah sehr lange nichts. Der Erste, der mir sagte, welches Jahr wir hatten, war 1987 mein Enkel, dein Onkel Aleksandr. Da herrschte anscheinend Krieg. In Afghanistan, wie war das noch?«
Ich schüttele entschuldigend den Kopf. »Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass die Soldaten, die wieder nach Hause kamen, langsam verrückt wurden. Ich habe eine Geschichte über einen Mann gehört, der mit einem menschlichen Rumpf Fußball um ein großes Feuer im Truppenlager spielte, etwas über Piloten, die auf ihre eigenen Männer schossen, über unpassierbare Berge, Kinder ohne Hände und überall Hinterhalte.«
»Ach, was du da sagst, ist genauso unzusammenhängend wie die Geschichte, die Alexandr mir erzählte. Er konnte es nicht richtig erklären. Er war verwirrt, er konnte mir nicht einmal mehr sagen, wer sein Vater war. Gleichzeitig war er unglaublich stolz, in seiner Armeeuniform, mit seinen Schneestiefeln. Na ja, ich hatte im Großen Vaterländischen Krieg so viele stolze, völlig gebrochene Soldaten durch die Straßen unserer Stadt ziehen sehen, dass mich sein Heldentum nicht wirklich beeindruckte. Ich sagte immerzu, dass er ohne diesen Krieg nicht neben mir in diesem Palast sitzen würde, er hörte nicht auf, Dinge zu predigen, die ich längst vergessen hatte. Nach sechs Monaten war er verschwunden. Danach kam lange Zeit niemand aus unserer Familie in diese Lücke zwischen Leben und Tod. Dann schneite Igor herein, ein Blitzbesuch. Er war erschöpft und still. Er hielt den Kopf irgendwie schief, der baumelte stets zur Seite, als würde er nur noch an einem Nerv festsitzen. Um seinen Hals verlief rundherum eine lilablaubraune Strieme. Er wollte nicht darüber reden. Ich durfte mir seinen Hals nicht ansehen, ihn nicht anrühren. Er weinte manchmal, lautlos. Dann sah er mich an und schüttelte den Kopf. Das einzige Mal, als er endlich etwas sagte, war es das: ›Ich habe genug davon, wie düster alles auf unserem Boden ist, endlos wiederholt es sich, warum, Opa Krasnov? Wie eine Raupe, die sich immerzu in eine Motte verwandelt statt in einen Schmetterling.‹ Er war so schnell wieder weg, dass ich ihn nicht fragen konnte, welches Jahr wir hatten. Kolja kam kurz nach Igor. Als ich von ihm hörte, dass es 2015 war, erschrak ich. Ich bin hier schon zweiundsechzig Jahre. Kolja und ich haben bestimmt einen Monat lang die Tage mitgezählt: Er trägt eine Uhr. Das Glas ist gesplittert, wir konnten das Datum in dem viereckigen Kästchen kaum entziffern. Das Glas bekam immer mehr Risse, wurde matter, bis wir nichts mehr erkennen konnten.«
Er will das Tuch zusammenfalten, hält aber inne, faltet es wieder auseinander und betrachtet meine Linie, die größtenteils rot ist, mit ein paar wenigen schwarzen Stichen: der Tod von Igor und Kolja, von meinen Onkeln Peter und Nico, von einer Cousine, ganz plötzlich. Wo Koljas Linie aufhört, geht meine weiter, wie auch die meiner Mutter und Aleksandras, meiner Großtanten Nina, Lida und Klawa, meines Onkels Andriy, Tante Natasja, Onkel Witja, Tante Julija und Tante Larissa.
Das erste Mal, als ich mit meiner Mutter in Odessa war, im Mai 2015, war Kolja schon zwei Monate verschollen. Am Abend unserer Ankunft saßen wir alle in Großtante Klawas Wohnzimmer zusammen. Onkel Andriy erhob Wodka Nummer eins, odin.
»Vielen Dank, dass ihr gekommen seid«, sagte er. »In unser Land, in unsere Stadt. Wir hoffen, dass ihr, trotz der fragilen Situation hier, die Liebe zu unserem Land spüren werdet. So wie wir. Na sdorovje! Oder, ja budjmo! Was ihr wollt, Russisch, Ukrainisch, wir stecken irgendwo dazwischen, mit unseren Vorfahren, unseren ukrainischen Pässen.«
Wir stießen an. Nina schloss die Augen, tätschelte mein Knie, kippte den Wodka in einem Zug hinunter und knallte das Glas, auf dem ein holländisches Touristenstädtchen abgebildet war, auf den Tisch.
»Ai Ljesinka, hierfür bin ich einfach zu alt«, sagte sie.
Andriy nahm die Flasche und schenkte lässig nach. Der Wodka lief über die Teller mit Hering und Hühnchen, über Tomatenscheiben, Paprikastücken und gefüllten Eiern.
»Odin, dva, tri«, sagte er zu Nina und streckte Daumen, Zeige- und Mittelfinger in die Luft, genau wie Jesus hinter ihm auf der Ikone. »Sonst bringt es Unglück. Und das können wir uns gerade nicht leisten.«
»Ich auch?«, fragte Nina theatralisch und tippte sich an die Brust.
»Du auch!«, skandierte der Tisch.
Nummer zwei, dva. »Auf unsere Tjotja Nina. Dass sie so mutig war, ganz allein aus dem Osten hierher zu kommen. Sie ist unverwüstlich. Genau wie unser Land. Genau wie unsere Häuser. Möge sie immer wohlbehalten bleiben und der Krieg, der um ihr Haus tobt, schnell vorübergehen. Tjotja Nina, na sdorovje!«
Es ging zu wie in meiner Jugend bei Aleksandra zu Hause, an allen Geburtstagen und Feiertagen. Schaute ich auch nur einen Augenblick zur Seite, tauchten auf meinem Teller neue Berge von Essen auf: »Iss! Willst du mehr? Nimm noch etwas, das hier ist auch lecker!«
Unterdessen wurde Wodka nachgeschenkt, und während ich auf die goldene Uhr auf Klawas Fensterbank blickte, stellte ich fest: Wir saßen hier erst seit einer Viertelstunde, das Abendessen fing gerade erst an. Meine Tante Natasja stand auf und zwinkerte mir zu.
»Pass auf, pass auf«, sagte sie und zeigte auf mich, dann zwinkerte sie noch einmal, »jeder kommt an die Reihe.«
Sie zog ihr blaues Kleid mit den weißen Blümchen zurecht und rief vergnügt: »Tri! Nummer drei, um das Unglück zu bekämpfen. Hör zu. Ljesinka, Marie, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Ich hoffe, wir werden uns in Zukunft öfter besuchen. Dafür kommen wir in die Niederlande. Na sdorovje!«
Prost. Schluck. Schlag auf den Tisch. In unserer Familie heißt es: »Wenigstens drei Wodka gegen das Unglück.« Aber es bleibt nie dabei. Die ersten drei Gläser sind die Probefahrt, das Aufwärmen. Das Trinken kostet noch Mühe, mit Brennen in der Kehle, einem verschluckten Hüsteln. Die ersten drei Gläser Wodka sind die Dehn- und Streckübungen für den perfekten Rutsch am Ende, wenn der Schnaps durch die Kehle gleitet, wenn er nicht mehr im Magen kneift, sondern von innen wärmt. Nina räusperte sich. Links von mir schüttelte meine Mutter mit geschlossenen Augen den Kopf und sagte: »Oh, Jesus Christus, das ist lange her.«
Das nächste Glas ließ eine Weile auf sich warten. Andriy baute Spannung auf. Er grinste mich über den Tisch herausfordernd an, tätschelte mir väterlich die Hand. Wir aßen, Klawa schaufelte meinen Teller wieder voll mit Hering, Wurst und einer Scheibe Brot mit einem selbstgemachten Aufstrich.
»Vkusno«, sagte sie und wedelte mit der Hand neben dem Ohr hin und her: lecker. Ich nickte und nahm einen Bissen vom Brot und war überwältigt von der Mischung aus Mayonnaise, Käse und Knoblauch, die auf meiner Zunge kribbelte. Und dann kam plötzlich doch schon Nummer vier, chetyre, und bei Nummer vier war die Flasche fast leer, was bedeutete, dass jeder sein Glas während des Einschenkens auf dem Tisch stehen lassen musste. Andriy verteilte den Wodka sorgfältig auf die acht Gläser. Ehrlich, gewissenhaft. Er hielt die Flasche am Hals.
»Jetzt ein anderes wichtiges Ritual«, sagte er bedeutsam und zog seine Hose am Gürtel hoch, wodurch sich das adrette Hemd über seinem vorstehenden Bauch spannte. »Jemand muss sich etwas wünschen.«
Er blickte sich wie ein Showmaster um und reichte die Flasche seiner Tochter Anna. Sie nahm die Flasche, schloss die Augen und pustete hinein. Andriy nahm die Flasche und drehte den Verschluss schnell zu. Wir stießen auf den gehauchten Wunsch an. In den Niederlanden stoßen wir eher nachlässig an, das lernte ich an diesem ersten Abend in Odessa. Wir sagen zu selten, »was bin ich froh, dass ich hier mit euch sitze, was bin ich froh, dass du da bist«. An diesem ersten Abend lernte ich auch, wie man auf die Toten anstößt: Die Flasche wurde still herumgegeben. Wir hielten die Gläser nicht in unserer rechten, sondern in unserer linken Hand. Wir sagten nicht »Prost«.
»Fünf.« Pyat.
Klawa ergriff das Wort. Sie stand auf, strich sich den Rock glatt und spitzte die Lippen, bevor sie ansetzte.
»Trinken wir auf Neffe Igor, auf unsere Mutter Anna, unseren Vater Nikolaj, unseren Bruder Kolja, auf Ninas Mann Aleksandr, unseren Neffen Aleksandr. Auf unsere Schwestern Anastasija, Elena und Nadja.’
Ich dachte an Aleksandra und daran, was sie antwortete, wann immer ich sie fragte, ob wir nicht zusammen reisen wollten, zu ihrem Geburtshaus, in ihr altes Land. »Was soll ich da noch? Bei jedem Besuch musste ich Gräber anstarren. Und es wurden immer mehr.«
Wir erhoben die Gläser schweigend.
»Und auf Kolja?«, ergänzte meine Mutter vorsichtig. Jeder am Tisch erschrak, schüttelte den Kopf.
»Allmächtiger«, lamentierte Klawa und blickte zum Himmel.
»Auf keinen Fall, das ist nicht erlaubt«, sagte Nina. »Marie, wir wissen nicht, ob er tot ist. Wir dürfen ihn nicht in den Tod treiben.«
»Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass er noch lebt«, sagte Natasja. »Auf Kolja zu trinken, würde Unglück bringen.«
Wir tranken, aber nicht auf Kolja. Danach kam gleich Nummer sechs an die Reihe.
»Nach den Toten trinken wir auf das Glück und die Gesundheit, auf die Liebe, die gute Arbeit, ein schönes Haus, die Zukunft der Kinder. Na sdorovje budjmo na sdorovje