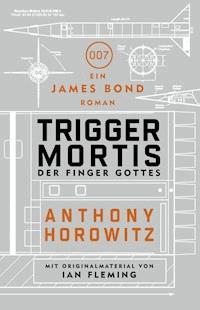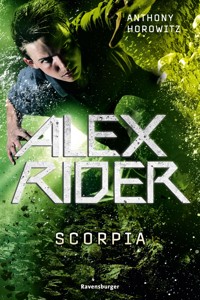
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alex Rider
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Der Bestseller ALEX RIDER – die Vorlage zur actiongeladenen TV-Serie! Für seine Mitschüler ist die Fahrt nach Venedig eine ganz normale Klassenfahrt. Für Alex Rider ist es die Chance, endlich mehr über seinen Vater zu erfahren. Denn wie er von einem Auftragskiller weiß, soll sein Vater dort für Scorpia gearbeitet haben. Seine Spuren führen Alex in den Palast einer skrupellosen Millionärin, die statt eines Wachhundes einen weißen Tiger hält … Band 5 der actionreichen Agenten-Reihe von Bestseller-Autor Anthony Horowitz Alex Riders Vergangenheit: eine einzige Lüge. Seine Zukunft: liegt in den Händen des MI6. Denn als jüngster Agent aller Zeiten ist er Englands stärkste Geheimwaffe! Erlebe alle Abenteuer von "Alex Rider": Band 1: Stormbreaker Band 2: Gemini-Project Band 3: Skeleton Key Band 4: Eagle Strike Band 5: Scorpia Band 6: Ark Angel Band 7: Snakehead Band 8: Crocodile Tears Band 9: Scorpia Rising Band 10: Steel Claw Vorgeschichte: Russian Roulette
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2018Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH©2018 Ravensburger Verlag GmbHDie englische Originalausgabe erschien 2004unter dem Titel Scorpia by Walker Books Ltd.,87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ.Published by arrangement with Anthony HorowitzText © 2004 Stormbreaker Productions Ltd.Die deutsche Erstausgabe erschien unter dem Titel Scorpia2007 im Ravensburger Verlag GmbHCover © Digital Art by Larry RostantVerwendet mit freundlicher Genehmigung von Penguin Books USA.Übersetzt aus dem Englischen von Werner SchmitzAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN978-3-473-38467-9www.ravensburger.de
Für die zwei Diebe auf der 200er-Vespa war es das falsche Opfer am falschen Ort am falschen Sonntagmorgen im September.
Man konnte meinen, die halbe Menschheit habe sich auf der Piazza Esmeralda, einige Kilometer außerhalb von Venedig, versammelt. Familien gingen nach der Messe im strahlenden Sonnenschein spazieren: die Erwachsenen in Schwarz, Jungen und Mädchen in ihren Sonntagskleidern und Kommunionsanzügen. Cafés und Eisdielen hatten geöffnet und Gäste strömten unablässig ein und aus.
Von einem gewaltigen Springbrunnen, der von mehreren nackten Göttern und Schlangen geziert wurde, stieg eine kühle Fontäne in die Luft.
An einigen Ständen wurden Kinderdrachen und getrocknete Blumen verkauft sowie alte Postkarten und Tüten mit Futter für die unzähligen Tauben, die überall gurrend umherstolzierten.
Mitten in diesem Gewühl standen ein Dutzend englische Schulkinder.
Pech für die zwei Diebe, dass eines von ihnen ausgerechnet Alex Rider war.
Weniger als ein Monat war inzwischen vergangen seit Alex’ entscheidender Konfrontation mit Damian Cray in der Air Force One, dem Flugzeug des amerikanischen Präsidenten. Es war das dramatische Ende eines Abenteuers gewesen, das Alex Rider nach Paris, Amsterdam und schließlich auf den Londoner Flughafen Heathrow geführt hatte, kurz nachdem fünfundzwanzig Atomraketen auf Ziele in aller Welt abgefeuert worden waren. Alex war es gerade noch rechtzeitig gelungen, diese Raketen zu zerstören. Und er war dabei gewesen, als Cray starb.
Mit unzähligen Schrammen und Kratzern übersät, war er dann endlich müde nach Hause zurückgekehrt, wo allerdings schon Jack Starbright mit grimmigem Gesicht auf ihn wartete. Jack war Alex’ Haushälterin, aber sie war auch seine Freundin, und wie immer hatte sie sich große Sorgen um ihn gemacht.
»So geht das nicht weiter, Alex«, sagte sie. »Nicht nur, dass du dein Leben aufs Spiel setzt, du fehlst außerdem ständig in der Schule. In Skeleton Key hast du das halbe Sommerhalbjahr verpasst und in Cornwall und dann in Point Blanc einen großen Teil des Winterhalbjahrs. Wenn du so weitermachst, rasselst du durch sämtliche Prüfungen. Und dann? Was soll dann werden?«
»Das ist nicht meine Schuld …«, fing Alex an.
»Ich weiß, dass es nicht deine Schuld ist. Aber ich habe dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder vorkommt, und deshalb wirst du für den Rest der Sommerferien Nachhilfe bekommen.«
»Das ist nicht dein Ernst!«
»Und ob. Du hast immerhin noch mehrere Wochen übrig. Und du kannst sofort anfangen.«
»Ich will aber keine Nachhilfe«, protestierte Alex.
»Ich fürchte, dir wird nichts anderes übrig bleiben. Und komm mir nicht mit irgendwelchen Tricks und Ausreden – diesmal behalte ich das letzte Wort!«
Alex hätte Jack gern widersprochen, aber im Grunde wusste er, dass sie recht hatte. Der MI6 versorgte ihn zwar mit ärztlichen Attesten, die seine langen Abwesenheiten von der Schule erklären sollten, aber eigentlich hatten ihn die Lehrer schon längst aufgegeben. Sein letztes Zeugnis war deutlich genug gewesen:
Alex verbringt mehr Zeit außerhalb als innerhalb des Schulgebäudes, was sich drastisch in seinen immer schlechter werdenden Noten widerspiegelt. Auch wenn man ihm seine zahlreichen gesundheitlichen Probleme nicht zum Vorwurf machen kann, wird er, wenn seine Leistungen weiterhin abnehmen, die Schule wohl nicht erfolgreich beenden können.
Na super! Alex hatte einen wahnsinnigen, stinkreichen Popstar daran gehindert, die halbe Welt zu zerstören – und was hatte er davon? Mehrarbeit!
Nur widerwillig ließ er sich auf Jacks Vorschlag ein. Zu allem Überfluss stellte sich auch noch heraus, dass der Nachhilfelehrer, den Jack ihm besorgt hatte, an der Brookland-Schule unterrichtete. Alex gehörte zwar nicht zu seinen Schülern, aber auch so war es peinlich, einen Lehrer von der eigenen Schule als Nachhilfelehrer zu haben, und er konnte nur hoffen, dass die anderen nichts davon mitbekamen. Er musste allerdings zugeben, dass Mr Grey seine Sache gut machte. Charlie Grey war noch relativ jung – ein lässiger Typ, der mit dem Fahrrad kam und eine mit Büchern vollgestopfte Satteltasche mitbrachte. Er unterrichtete Englisch und Geschichte, schien sich aber in allen Fächern gut auszukennen.
»Wir haben nur ein paar Wochen«, sagte er. »Das mag dir nicht viel erscheinen, aber du wirst staunen, was man alles durch intensiven Einzelunterricht erreichen kann. Ich werde sieben Stunden am Tag mit dir arbeiten, und zusätzlich bekommst du von mir auch noch Hausaufgaben. Am Ende der Sommerferien wirst du mich wahrscheinlich hassen, aber immerhin wirst du dann einigermaßen fit ins neue Schuljahr gehen.«
Alex hasste Charlie Grey nicht. Im Gegenteil. Woche für Woche arbeiteten sie mehrere Stunden täglich – Mathe, Geschichte, Physik … Übers Wochenende gab ihm der Lehrer Prüfungsaufgaben, und nach und nach wurde Alex immer besser, sodass Mr Grey eines Tages überrascht sagte: »Das hast du sehr gut gemacht, Alex. Ich wollte dir eigentlich nichts davon erzählen, aber hättest du vielleicht Lust, zum Ferienende mit auf unseren Schulausflug zu kommen?«
»Wo fahren Sie denn hin?«
»Letztes Jahr waren wir in Paris, das Jahr davor in Rom. Wir sehen uns Museen an, Kirchen, Paläste … solche Sachen. Dieses Jahr geht es nach Venedig. Und? Was sagst du?«
Venedig.
Alex hatte immer wieder daran denken müssen – an die letzten Minuten im Flugzeug, nachdem Damian Cray gestorben war. Yassen Gregorovich war da gewesen, der russische Attentäter, der Alex so lange das Leben zur Hölle gemacht hatte. Yassen war von einer tödlichen Kugel getroffen worden, aber kurz bevor er die Augen für immer schloss, hatte er Alex noch ein Geheimnis anvertraut, das er seit vierzehn Jahren mit sich herumgetragen hatte.
Alex’ Eltern waren kurz nach seiner Geburt gestorben. Aufgewachsen war er bei Ian Rider, dem Bruder seines Vaters. Doch vor einigen Monaten war auch sein Onkel unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen – angeblich bei einem Autounfall. Für Alex war es der größte Schock seines Lebens, als er erfuhr, dass sein Onkel in Wirklichkeit ein Spion war und bei einem Einsatz in Cornwall getötet worden war. Und dann war plötzlich der MI6 in sein Leben getreten. Irgendwie war es dem britischen Geheimdienst gelungen, Alex für sich zu gewinnen, und seitdem arbeitete er für diese Leute.
Alex wusste nur wenig über seine Eltern, John und Helen Rider. Auf dem Schreibtisch in seinem Zimmer stand ein Foto von ihnen: ein gut aussehender Mann mit Stoppelhaarschnitt, der eine hübsche Frau im Arm hielt. Sein Vater war früher bei der Armee gewesen und sah Jahre später noch aus wie ein Soldat. Seine Mutter hatte als Krankenschwester in der Röntgenabteilung eines Krankenhauses gearbeitet. Aber für Alex waren die beiden Fremde. Er hatte absolut keine Erinnerung an sie, denn er war noch ein Baby, als sie starben – bei einem Flugzeugabsturz. So hatte man es ihm jedenfalls später erzählt.
Doch der Flugzeugabsturz seiner Eltern war genauso eine Lüge gewesen wie der Autounfall seines Onkels. Das wusste Alex nun. Von Yassen Gregorovich hatte er die Wahrheit erfahren. Alex’ Vater war ein Mörder gewesen, genau wie Yassen selbst. Die zwei hatten zusammengearbeitet und John Rider hatte Yassen einmal das Leben gerettet. Aber dann war sein Vater vom MI6 getötet worden – von genau denselben Leuten, die Alex nun schon dreimal gezwungen hatten, für sie zu arbeiten, die ihn getäuscht und belogen und schließlich, als er nicht mehr gebraucht wurde, fallen gelassen hatten. Und schließlich hatte ihm Yassen sogar verraten, wie er Beweise dafür finden könnte.
Geh nach Venedig. Suche nach Scorpia. Dort findest du dein Schicksal …
Alex wollte unbedingt wissen, was vor vierzehn Jahren geschehen war. Die Wahrheit über John Rider, das wäre auch die Wahrheit über ihn selbst. Denn wenn sein Vater wirklich ein bezahlter Killer gewesen war – wozu machte das ihn selbst? Alex war wütend, unglücklich … und durcheinander. Er musste Scorpia finden, ganz egal, wer oder was sich hinter diesem Namen verbarg. Von Scorpia würde er erfahren, was er wissen wollte.
Ein Schulausflug nach Venedig hätte also zu keiner besseren Zeit stattfinden können. Und Jack hatte auch nichts dagegen. Im Gegenteil, sie riet ihm sogar dazu.
»Das ist jetzt genau das Richtige für dich, Alex. Ein wenig Zeit für deine Freunde, damit du endlich mal wieder ein ganz normaler Junge sein kannst. Und Venedig ist wunderschön, es wird dir bestimmt großartig gefallen.«
Alex schwieg. Er belog Jack nicht gern, aber andererseits konnte er ihr unmöglich die Wahrheit sagen. Sie hatte seinen Vater nie kennengelernt; die ganze Geschichte ging sie also nichts an.
Während sie ihm beim Packen half, dachte Alex darüber nach, dass diese Fahrt für ihn wahrscheinlich wenig mit Kirchen und Museen zu tun haben würde. Stattdessen würde er sich in der Stadt umsehen und versuchen, möglichst viel über Scorpia in Erfahrung zu bringen. Fünf Tage waren nicht viel Zeit. Aber es wäre immerhin ein Anfang. Fünf Tage in Venedig. Fünf Tage, um Scorpia zu finden …
Und jetzt war er da. Auf einer Piazza mitten in Italien. Drei Tage waren bereits vergangen, aber Alex hatte immer noch nichts herausgefunden.
»Alex, hast du Lust auf ein Eis?«
»Nein, danke.«
»Mir ist total heiß. Ich hol mir eins von diesen Dingern, von denen du mir erzählt hast. Wie hieß das noch? Granada?«
Alex stand neben einem anderen vierzehnjährigen Jungen, seinem besten Freund auf der Brookland-Schule. Es hatte ihn überrascht, dass Tom Harris die Fahrt mitmachte, denn Kunst und Geschichte waren nicht gerade Toms Lieblingsfächer. Genau genommen interessierte sich Tom überhaupt nicht für Schule und er war in allen Fächern ziemlich schlecht. Aber das Gute an ihm war, dass ihm das nichts ausmachte. Er war immer gut gelaunt, und sogar die Lehrer mussten zugeben, dass man sich in seiner Gesellschaft wohlfühlte. Und was Tom im Klassenzimmer fehlte, machte er auf dem Sportplatz locker wieder wett. Er war Kapitän der Schulfußballmannschaft und Alex’ größter Rivale in der Leichtathletik – beim Hürdenlauf, bei den vierhundert Metern und beim Stabhochsprung schlug er ihn jedes Mal um Längen. Tom war etwas klein für sein Alter, hatte stachlige schwarze Haare und hellblaue Augen. Ausgeschlossen, dass er freiwillig ein Museum betreten würde – warum also war er mitgekommen? Alex hatte es schnell herausgefunden. Toms Eltern ließen sich gerade scheiden, und sie hatten ihn auf die Fahrt geschickt, um ihn aus dem Weg zu haben.
»Granita«, sagte Alex. Das kaufte er sich immer, wenn er in Italien war: zerstoßenes Eis mit frischem Zitronensaft. Ein Mittelding zwischen Zitroneneis und Limonade und unglaublich erfrischend.
»Kannst du das nicht für mich bestellen, Alex? Wenn ich die Leute hier was auf Italienisch frage, starren die mich immer bloß an, als ob ich verrückt wäre.«
Alex konnte auch nur ein paar Sätze. Italienisch gehörte nicht zu den Dingen, die ihm Ian Rider beigebracht hatte. Trotzdem ging er mit in die Eisdiele am Markt und bestellte zwei Eis, eines für Tom und eines – Tom bestand darauf – für sich selbst. (Toms Eltern hatten ihm jede Menge Geld mit auf die Reise gegeben.)
»Kommst du nach den Ferien wieder in die Schule?«, fragte er.
Alex zuckte mit den Schultern. »Klar.«
»Letztes Jahr hast du dauernd gefehlt.«
»Ich war krank.«
Tom nickte. Er trug eine Diesel-Sonnenbrille, die er sich im Duty-free-Shop in Heathrow gekauft hatte. Sie war viel zu groß für sein Gesicht und rutschte ihm ständig von der Nase. »Das glaubt dir niemand«, sagte er.
»Warum denn nicht?«
»Weil kein Mensch so krank sein kann. So was gibt’s doch gar nicht.« Tom senkte seine Stimme. »Manche Leute sagen, du bist ein Krimineller.«
»Was?«
»Sie glauben, dass du deswegen so oft fehlst. Weil du Ärger mit der Polizei hast.«
»Glaubst du das etwa auch?«
»Nein. Aber Miss Bedfordshire hat mich nach dir gefragt. Sie weiß, dass wir befreundet sind. Sie sagt, du hattest mal Ärger, weil du einen Kran geklaut hast oder so was. Angeblich hat ihr das ein Psychiater erzählt, bei dem du in Therapie sein sollst, sagt sie.«
»Ein Psychiater?« Alex war baff.
»Ja. Du tust ihr echt leid. Sie meint, deswegen bist du selten da. Weil du zum Psychiater musst.«
Jane Bedfordshire war die Schulsekretärin, eine attraktive Frau in den Zwanzigern. Sie war auch mit auf dem Schulausflug, wie jedes Jahr. Alex sah sie auf der anderen Seite des Platzes mit Mr Grey reden. Manche behaupteten, die beiden hätten was miteinander, aber Alex vermutete, dass an diesem Gerücht so wenig dran war wie an den Gerüchten über ihn.
Eine Kirchturmuhr schlug zwölf. In einer halben Stunde gab es Mittagessen in dem Hotel, in dem sie wohnten. Brookland war eine gewöhnliche Gesamtschule im Westen Londons, und um Kosten zu sparen, hatte man ein Hotel außerhalb von Venedig genommen. Grey hatte eines in der Kleinstadt San Lorenzo ausgesucht. Von dort waren es mit dem Zug nur zehn Minuten. Sie kamen morgens am Bahnhof an und fuhren dann gemeinsam mit dem Wasserbus zu irgendeiner Besichtigung ins Stadtzentrum. Heute, am Sonntag, allerdings nicht. Da hatten sie den Vormittag frei.
»Du bist also …« Tom verstummte plötzlich.
Es war alles sehr schnell gegangen, aber die beiden Jungen hatten es dennoch genau gesehen.
Auf der anderen Seite des Platzes war plötzlich ein Motorrad aufgetaucht. Eine 200er-Vespa-Granturismo, noch ganz neu. Darauf zwei Männer in Jeans und weiten langärmligen Hemden. Der hintere trug einen Helm, nicht nur als Kopfschutz, sondern auch, um nicht erkannt zu werden. Der Fahrer – mit dunkler Sonnenbrille – raste auf Miss Bedfordshire zu, als wollte er sie über den Haufen fahren. Erst unmittelbar vor ihr schwenkte er aus, und im selben Moment riss sein Beifahrer ihr die Handtasche weg. So reibungslos, wie das Ganze ablief, erkannte Alex sofort, dass die beiden Profis waren – Scippatori, wie man diese Leute in Italien nannte. Handtaschenräuber.
Einige der anderen Schüler hatten den Vorfall auch gesehen. Ein paar von ihnen schrien aufgeregt durcheinander, konnten aber nichts machen. Das Motorrad sauste schon davon. Der Fahrer bückte sich tief über den Lenker, sein Partner hielt die Handtasche auf dem Schoß umklammert. Sie jagten quer über den Platz, genau auf Tom und Alex zu. Nur Sekunden vorher war alles voller Leute gewesen, aber jetzt war die Piazza plötzlich wie leer gefegt, und niemand stellte sich den Dieben entgegen.
»Alex!«, schrie Tom.
»Bleib«, sagte Alex. Er überlegte kurz, ob er der Vespa den Weg versperren sollte, aber das war aussichtslos. Der Fahrer würde einfach um ihn herumkurven, und wenn nicht, würde Alex das nächste Schuljahr wirklich im Krankenhaus verbringen müssen. Das Motorrad hatte bestimmt schon dreißig Kilometer die Stunde drauf, und sein Einzylinder-Viertakt-Motor trug die beiden Diebe mühelos auf ihn zu.
Alex hatte keine Zeit, lange zu überlegen.
Er sah sich nach irgendetwas um, was er nach den beiden werfen könnte. Ein Netz? Ein Eimer Wasser? Aber er konnte nirgendwo etwas Derartiges entdecken.
Die Vespa war keine zwanzig Meter mehr entfernt und wurde immer schneller. Alex sprintete los, schnappte sich einen Eimer von einem Blumenstand, kippte die Blumen darin aufs Pflaster und füllte ihn mit Vogelfutter vom Stand nebenan. Beide Standbesitzer brüllten ihn wütend an, aber Alex ignorierte sie. Noch im Laufen drehte er sich um und schleuderte den Inhalt des Eimers nach der Vespa, die gerade an ihm vorbeisauste.
Tom beobachtete das alles aus der Ferne. Zuerst war er verwundert, dann enttäuscht. Wenn Alex gedacht hatte, er könnte die beiden kräftigen Männer mit einer Dusche Vogelfutter von der Vespa hauen, hatte er sich getäuscht. Sie fuhren unbeeindruckt weiter.
Aber Alex hatte dabei etwas anderes im Sinn gehabt.
Auf dem Platz liefen Hunderte Tauben herum, und sie alle hatten die Ladung Vogelfutter aus dem Eimer fliegen sehen. Die beiden Diebe waren nun von oben bis unten damit eingedeckt. Das Zeug hing in den Falten ihrer Kleider, in Kragen und Schuhen und in den Haaren des Fahrers.
Für die Tauben hatten sich die Handtaschenräuber in ein Essen auf Rädern verwandelt. Wie auf Kommando hob sich der graue Schwarm in die Luft und schoss aus allen Richtungen auf die beiden Männer hinab. Plötzlich hatte der Fahrer einen Vogel an der Wange kleben, der ihm mit seinem Schnabel auf dem Kopf herumpickte. Eine andere Taube krallte sich an seinen Hals, eine dritte stocherte an der empfindlichsten Stelle zwischen seinen Beinen herum. Seinem Partner saßen zwei der Tiere im Nacken, ein weiteres machte sich an seinem Hemd zu schaffen. Eine Taube verschwand sogar mit dem Kopf in der gestohlenen Handtasche. Und es wurden immer mehr. Mindestens zwanzig Tauben flatterten aufgeregt um die beiden herum, bearbeiteten sie mit ihren Klauen und Schnäbeln und deckten sie mit flüssigen weißen Geschossen ein.
Durch die Vögel konnte der Fahrer kaum etwas sehen. Mit einer Hand hielt er den Lenker umklammert, mit der anderen fuchtelte er wild vor seinem Gesicht herum. Plötzlich wendete die Vespa um hundertachtzig Grad und kam jetzt wieder genau auf Alex zu, noch schneller als zuvor. Er blieb stehen, um erst im letzten Moment wegzuspringen. Für einige Sekunden sah es so aus, als würden sie ihn überfahren. Dann aber schwenkte der Roller ein zweites Mal herum und knatterte jetzt auf den Brunnen zu. Die beiden Diebe waren in der flatternden Wolke kaum noch zu erkennen. Sekunden später krachte das Vorderrad gegen die Treppenstufe am Fuße des Brunnens, der Roller ging hinten hoch und schleuderte die Männer in hohem Bogen von der Maschine. Doch kurz bevor der Beifahrer in den Brunnen platschte, ließ er kreischend die Handtasche los, die fast wie in Zeitlupe durch die Luft segelte. Alex trat einen Schritt nach vorn und fing die Tasche auf.
Und plötzlich war alles vorbei. Die Diebe wälzten sich schwer angeschlagen im Wasser und die Vespa lag verbeult am Boden. Zwei Polizisten, die erst jetzt auftauchten, liefen auf die beiden Verbrecher zu. Die Markthändler lachten und applaudierten begeistert, Tom stand da wie vom Blitz getroffen, und Alex ging zu Miss Bedfordshire, um ihr die Tasche zurückzugeben.
»Ich glaube, die gehört Ihnen«, sagte er.
»Alex …« Miss Bedfordshire war sprachlos. »Wie …?«
»Das habe ich bei meinem Psychiater gelernt«, sagte Alex, drehte sich um und ging zu seinem Freund zurück.
»Dieses Gebäude hier ist der Palazzo Contarini del Bovolo«, erklärte Mr Grey. »Bovolo nennt man in Venedig ein Schneckenhaus, und wie ihr seht, erinnert die Form dieser wunderbaren Treppe tatsächlich ein wenig daran.«
Tom unterdrückte ein Gähnen. »Noch ein einziges Museum, noch ein einziger Palast oder Kanal«, knurrte er, »und ich werfe mich unter den nächsten Bus.«
»In Venedig gibt es keine Busse«, erinnerte ihn Alex.
»Dann eben vor einen Wasserbus. Wenn er mich nicht überfährt, hab ich ja vielleicht Glück und ertrinke.« Tom stöhnte. »Weißt du, was das Blöde ist an dieser Stadt? Die ist wie ein Museum. Ein einziges riesiges Museum. Kommt mir vor, als wäre ich schon mein halbes Leben lang hier.«
»Morgen geht’s ja wieder nach Hause.«
»Keinen Tag zu früh, Alex.«
Alex sah das anders. An einem Ort wie Venedig war er vorher noch nie gewesen, und es gab nichts auf der Welt, was sich mit dieser Stadt vergleichen lassen konnte: dieses komplizierte Gewirr aus engen Gassen und Kanälen, diese unzähligen prachtvollen Gebäude, eines spektakulärer als das andere. Ein kleiner Spaziergang führte einen durch vier Jahrhunderte, hinter jeder Ecke wartete eine Überraschung: ein Markt am Rand eines Kanals, auf den Verkaufstischen große Fleischstücke und Fische, deren Blut auf die Pflastersteine tropfte; oder eine Kirche, die wie ein Schiff mitten im Wasser stand; ein vornehmes Hotel oder ein winziges Restaurant. Sogar die Geschäfte waren kleine Kunstwerke – in den Schaufenstern exotische Masken, grellbunte Glasvasen, köstliche Pasta und Antiquitäten. Die Stadt mochte tatsächlich ein Museum sein, aber ein sehr lebendiges.
Trotzdem konnte Alex Tom verstehen. Nach vier Tagen hatte auch er das Gefühl, genug gesehen zu haben. Genug Statuen, genug Kirchen, genug Mosaiken. Und genug Touristen, die sich unter der sengenden Septembersonne durch die Stadt schoben. Wie Tom fühlte er sich allmählich etwas übersättigt.
Und was war mit Scorpia?
Das Ärgerliche war, dass er absolut keine Ahnung hatte, was Yassen Gregorovich mit seinen letzten ominösen Worten gemeint haben konnte. War Scorpia vielleicht eine bestimmte Person? Alex hatte im Telefonbuch nachgesehen und nicht weniger als vierzehn Leute mit diesem Namen gefunden, die in und um Venedig lebten. Es könnte aber auch der Name einer Firma sein. Oder der eines Gebäudes. Scuole waren Häuser, in denen Arme wohnten. La Scala war ein Opernhaus in Mailand. Aber Scorpia konnte alles Mögliche sein. Keine Schilder wiesen darauf hin; keine Straßen waren danach benannt.
Erst jetzt, fast schon am Ende der Reise, sah Alex ein, dass es von Anfang an hoffnungslos gewesen war. Wenn Yassen ihm die Wahrheit gesagt hatte, waren die beiden Männer – er selbst und John Rider – bezahlte Killer gewesen. Hatten sie für Scorpia gearbeitet? Falls ja, musste Scorpia sich irgendwo im Verborgenen aufhalten … vielleicht in einem dieser alten Paläste. Alex betrachtete noch einmal die Treppe, die Mr Grey ihnen erklärte. Wie konnte er wissen, ob diese Treppe nicht direkt zu Scorpia führte? Scorpia konnte überall sein. Buchstäblich überall. Und Alex war nach vier Tagen in Venedig immer noch nirgendwo.
»Wir gehen jetzt die Frezzeria hinunter zum Markusplatz«, verkündete Mr Grey. »Dort können wir unsere Sandwiches essen, und anschließend besichtigen wir die Basilika St. Markus.«
»Toll!«, rief Tom. »Noch eine Kirche!«
Sie brachen auf, ein Dutzend englische Schulkinder, angeführt von Mr Grey und Miss Bedfordshire, die sich angeregt miteinander unterhielten. Alex und Tom trödelten hinterher, beide schlecht gelaunt. Nur noch ein Tag war übrig, und das war, wie Tom gesagt hatte, ein Tag zu viel. Tom hatte von Kultur die Nase voll, aber er würde nicht mit den anderen nach London zurückfahren. Sein älterer Bruder lebte in Neapel, und er würde die letzten Tage der Sommerferien bei ihm verbringen. Für Alex bedeutete die Abreise morgen, dass er versagt hatte. Er würde nach Hause fahren, dann würde das neue Schuljahr beginnen und …
Und dann sah er es. Einen Sonnenreflex, der silberhell am Rand seines Blickfeldes aufblitzte. Er drehte sich um, aber nichts. Nur ein Kanal. Und ein zweiter Kanal, der den ersten kreuzte. Ein Motorboot, das unter einer Brücke hindurchfuhr. Die üblichen alten Fassaden, braune Mauern mit Fensterläden. Die Kuppel einer Kirche über den roten Dächern. Wahrscheinlich hatte er sich das nur eingebildet.
Aber dann wendete das Motorboot, und jetzt sah er es wieder und wusste, dass es wirklich da war: ein silberner Skorpion an der Seite des Boots, vorn am Bug. Das Boot bog gerade in den anderen Kanal ein, und Alex starrte ihm nach. Es war keine Gondel oder ein tuckernder Wasserbus, sondern ein elegantes Sportboot. Glänzendes Teakholz, Vorhänge an den Fenstern, Ledersitze. Zwei Mann Besatzung in tadellosen weißen Jacken und Shorts. Einer stand am Steuer, der andere servierte dem Passagier an Bord gerade einen Drink.
Der Passagier war eine Frau. Sie saß kerzengerade und blickte starr nach vorn. Alex konnte gerade noch ihre schwarzen Haare, eine Stupsnase und ein ausdrucksloses Gesicht erkennen. Und dann war das Boot auch schon außer Sicht.
Ein Skorpion am Bug eines Motorboots.
Scorpia.
Der Zusammenhang war äußerst dürftig, aber plötzlich war Alex entschlossen herauszufinden, wohin dieses Boot fuhr. Fast kam es ihm so vor, als habe man den silbernen Skorpion geschickt, um ihn zu irgendeinem bestimmten Ort zu führen.
Und da war noch etwas. Wie unbewegt diese Frau dagesessen hatte. Wie konnte man sich durch diese unglaubliche Stadt kutschieren lassen, ohne in irgendeiner Weise darauf zu reagieren, ohne auch nur wenigstens einmal den Kopf nach links oder rechts zu drehen? Alex musste unwillkürlich an Yassen Gregorovich denken. Der hätte sich genauso verhalten. Er und diese Frau waren dieselbe Sorte Mensch.
Alex wandte sich an Tom. »Du musst mir helfen!«
»Was ist denn?«, fragte Tom.
»Sag ihnen, ich hab mich nicht gut gefühlt. Sag, ich bin schon ins Hotel gegangen.«
»Wo willst du denn hin?«
»Erzähl ich dir später.«
Und damit verschwand Alex in einer schmalen Gasse und lief in die Richtung, in die das Boot gefahren war.
Aber dann erkannte er, dass er ein Problem hatte. Venedig war auf über hundert Inseln gebaut. Das hatte ihnen Mr Grey gleich am ersten Tag erzählt. Im Mittelalter war das ganze Gebiet praktisch nur ein Sumpf gewesen. Deswegen gab es hier keine festen Straßen – nur Wasserstraßen und seltsam geformte Stückchen Land, die durch Brücken miteinander verbunden waren. Die Frau fuhr auf dem Wasser; Alex lief auf festem Boden. Ihr nachzulaufen war ungefähr so unmöglich, als befänden sie sich beide in einem Labyrinth, dessen Gänge sich an keiner Stelle kreuzten.
Schon hatte er sie aus den Augen verloren. Die Gasse, in die er gelaufen war, hätte geradeaus weiterführen müssen, schwenkte aber plötzlich in weitem Bogen um einen Häuserblock. Er lief um die Ecke, beobachtet von zwei Italienerinnen in schwarzen Kleidern, die vor einer Haustür auf Schemeln saßen. Dann stand er wieder vor einem Kanal, aber da war niemand. Eine Steintreppe führte ins trübe Wasser hinab, doch dort ging es nicht weiter … es sei denn, er wollte schwimmen.
Als er allerdings nach links blickte, erspähte er gerade noch das schäumende Kielwasser des Motorboots, das an einigen Gondeln vorbeiraste, die an einem modrigen Steg festgemacht waren. Die Frau saß immer noch bewegungslos am Heck, jetzt mit einem Glas Wein in der Hand. Das Boot schoss haarscharf unter einer niedrigen Brücke hindurch.
Alex blieb nur eines. Er rannte, so schnell er konnte, den Weg zurück, den er gekommen war. Vorbei an den zwei Frauen, die missbilligend den Kopf schüttelten. Erst jetzt merkte er, wie warm es war. Die engen Straßen waren von der Sonne aufgeheizt, und selbst im Schatten war es brütend heiß.
Schweißgebadet kam er wieder an der Straße an, von der er losgelaufen war. Mr Grey und die anderen waren zum Glück schon weitergezogen.
Wohin jetzt?
Plötzlich sahen alle Straßen und Gassen gleich aus. Alex verließ sich auf seinen Orientierungssinn und wandte sich nach links, rannte an einem Obstladen vorbei, einem Kerzengeschäft und einem Restaurant, vor dem die Kellner draußen schon die Tische fürs Mittagessen deckten. Er bog um eine Ecke und gelangte auf eine Brücke – so klein, dass er mit fünf Schritten auf der anderen Seite gewesen wäre. Er blieb jedoch in der Mitte stehen und spähte den schmalen Kanal entlang. Der Gestank von abgestandenem Wasser stach ihm in die Nase. Nichts zu sehen. Das Boot war weg.
Aber Alex wusste, in welche Richtung es sich bewegte. Noch war es nicht zu spät, falls ihm nichts in den Weg kam. Er rannte weiter. Ein japanischer Tourist fotografierte gerade seine Frau und seine Tochter. Alex hörte noch das Klicken der Kamera, als er zwischen ihnen hindurchlief. Auf dem Display des Geräts würden sie sich das Foto eines schlanken, sportlichen Jungen mit blonden Haaren anschauen können, bekleidet mit Kakishorts und Billabong-T-Shirt, das Gesicht schweißnass, die Augen wild entschlossen. Nettes Urlaubsandenken.
Ein Haufen Touristen. Ein Straßenmusikant mit Gitarre. Noch ein Café. Kellner mit silbernen Tabletts. Alex arbeitete sich durch das Gewühl, ohne auf die wütenden Rufe der Leute zu achten. Die Straße schien kein Ende zu nehmen. Aber weiter vorne musste doch endlich wieder ein Kanal kommen …
Und da war er auch schon. Die Straße senkte sich und graues Wasser schwappte an die Kante. Alex hatte den Canal Grande erreicht, die größte Wasserstraße Venedigs. Und dort entdeckte er auch wieder das Motorboot mit dem silbernen Skorpion am Bug. Es war ungefähr dreißig Meter entfernt und bewegte sich mit jeder Sekunde weiter von ihm weg.
Alex wusste, wenn er es jetzt verlor, würde er es niemals wieder finden. Links und rechts gab es einfach zu viele Seitenkanäle, in die es verschwinden konnte. Es konnte am privaten Liegeplatz eines Palasts festmachen oder vor einem der eleganten Hotels anlegen.
Dann entdeckte Alex weiter vorne einen Landesteg, eine der vielen Haltestellen der Wasserbusse. Davor der Fahrkartenschalter und jede Menge Leute. Auf einem gelben Schild prangte der Name der Haltestelle: SANTA MARIA DEL GIGLIO. Ein großes Boot mit vielen Leuten an Bord legte gerade ab. Ein Wasserbus der Linie 1. In genau so ein Boot waren sie am Tag ihrer Ankunft am Hauptbahnhof eingestiegen, und daher wusste Alex, dass es den Kanal in seiner gesamten Länge befuhr.
Alex sah sich um. Keine Chance, das Motorboot durch dieses Straßenlabyrinth zu verfolgen. Der Wasserbus war seine einzige Hoffnung. Doch er war bereits zwei Meter vom Landesteg entfernt. Alex musste schnell reagieren!
In diesem Moment fuhr eine Gondel mit einer ausländischen Touristenfamilie langsam an ihm vorbei, und der Gondoliere sang für seine grinsenden Passagiere ein italienisches Lied. Alex überlegte, ob er die Gondel kapern sollte, aber dann hatte er eine bessere Idee.
Er beugte sich vor, packte das Ruder und riss es dem Gondoliere aus den Händen. Der stieß einen überraschten Schrei aus, fuhr herum und verlor das Gleichgewicht. Die Touristen mussten entsetzt mit ansehen, wie er rücklings ins Wasser stürzte. Unterdessen hatte Alex das Ruder getestet. Es war ungefähr fünf Meter lang und ziemlich schwer. Der Gondoliere hatte es senkrecht gehalten und sein Fahrzeug mit dem breiten Paddelende durchs Wasser gesteuert. Alex nahm Anlauf, stach die Ruderstange in den Canal Grande und konnte nur hoffen, dass das Wasser nicht allzu tief war.
Er hatte Glück. Es war gerade Ebbe, und der Boden des Kanals war mit allen möglichen Sachen vollgemüllt – mit alten Waschmaschinen, Fahrrädern und Schubkarren, die die Venezianer unbekümmert und ohne Gedanken an Umweltverschmutzung einfach so da reingeworfen hatten. Das Ende der Ruderstange traf auf etwas Festes, und Alex stieß sich ab, riss die Beine in die Luft und flog in hohem Bogen nach vorn. Er benutzte dieselbe Technik wie beim Stabhochsprung in der Schule, und nachdem er so ein paar Meter über den Canal Grande gesegelt war, schoss er durch den offenen Eingang des Wasserbusses und landete mit beiden Füßen auf dem Deck. Er ließ die Ruderstange fallen und sah sich um. Die anderen Passagiere starrten ihn fassungslos an. Aber er war an Bord.
Auf den Wasserbussen wurden nur sehr selten die Fahrkarten kontrolliert, und auch jetzt war niemand da, der Alex wegen seines ungewöhnlichen Einstiegs zur Rede stellte oder gar verlangte, dass er bezahlen sollte. Er beugte sich über die Reling und genoss die kühle Brise, die ihm vom Wasser ins Gesicht wehte. Das Motorboot fuhr jetzt in Richtung Stadtzentrum.
Vor dem Schiff schwang sich eine schlanke Holzbrücke über den Kanal, die Alex sofort als die Akademie-Brücke erkannte, über die man in die größte Kunstgalerie Venedigs gelangte. Er hatte einen ganzen Vormittag dort verbracht und sich die Werke von Tintoretto, Lorenzo Lotto und zahllosen anderen Künstlern angesehen, deren Namen alle auf o zu enden schienen. Kurz fragte er sich, was er hier eigentlich machte. Er hatte die anderen allein weitergehen lassen. Mr Grey und Miss Bedfordshire telefonierten wahrscheinlich schon mit dem Hotel, wenn nicht gar mit der Polizei. Und wozu das alles? Was hatte er denn schon in der Hand? Einen silbernen Skorpion an einer kleinen Motorjacht. Er musste den Verstand verloren haben.
Der Wasserbus wurde langsamer und näherte sich dem nächsten Landesteg. Alex spannte sich an. Wenn er jetzt abwartete, bis die einen Passagiere aus- und die anderen eingestiegen wären, würde er das Motorboot nie wieder sehen. Er befand sich jetzt auf der anderen weniger stark bevölkerten Seite des Kanals. Alex holte tief Luft und fragte sich, ob er wohl besser wieder rennen sollte.
Und dann sah er zu seiner unendlichen Erleichterung, dass das Boot jetzt auch sein Ziel erreicht hatte. Nicht sehr weit von ihm entfernt steuerte es einen Palast an und hielt schließlich hinter einer Reihe Holzpfähle, die schräg aus dem Wasser ragten wie Speere, die man dort wahllos hineingeworfen hatte. Alex sah zwei uniformierte Dienstboten aus dem Palast kommen. Einer vertäute das Boot, der andere streckte einladend eine Hand in einem weißen Handschuh aus. Die Frau griff danach und stieg an Land. Sie trug ein enges cremefarbenes Kleid und eine Jacke, die in Höhe des Bauchnabels endete. An einem Arm baumelte eine Handtasche. Sie sah aus wie ein Model vom Cover eines Hochglanzmagazins. Während die Diener ihre Koffer vom Boot holten, schritt sie bereits die Eingangstreppe hoch und verschwand hinter einer Säule.
In diesem Moment legte der Wasserbus wieder ab und Alex sprang gerade noch rechtzeitig auf den Landesteg. Wieder musste er umständlich um die Gebäude herumlaufen, die dicht an dicht stehend das Ufer des berühmten Canal Grande säumten. Aber diesmal wusste er, wonach er suchte. Und wenige Minuten später hatte er sein Ziel erreicht. Ein typischer venezianischer Palast, rosa und weiß gestrichen, die schmalen Fenster umrahmt von kleinen Säulen, Bögen und Balustraden – wie ein Haus aus Romeo und Julia. Besonders imposant aber war seine Lage. Es stand nicht bloß am Canal Grande, sondern wuchs förmlich daraus empor. Die Frau aus dem Boot war durch eine Art Fallgatter geschritten, wie man sie von Schlössern kennt. Das hier aber war ein schwimmendes Schloss. Oder ein versinkendes. Unmöglich zu sagen, wo das Wasser aufhörte und der Palast anfing.
Dennoch hatte der Palast mindestens eine Seite, die man trockenen Fußes erreichen konnte. Alex stand an einem weiten Platz mit Bäumen und Sträuchern in großen Töpfen. Dazwischen liefen Dienstboten umher, stellten Absperrseile und große Fackeln auf und entrollten einen roten Teppich. Zimmerleute montierten etwas, was wie eine kleine Bühne aussah. Andere Männer trugen Kisten und Schachteln in den Palast. Champagner, Feuerwerk, Fleisch, Gemüse. Offensichtlich wurde hier eine größere Party vorbereitet.
Alex sprach einen der Männer an. »Entschuldigen Sie«, sagte er. »Können Sie mir sagen, wer hier wohnt?«
Der Mann sprach kein Englisch. Und er gab sich auch keine Mühe, freundlich zu sein. Alex fragte einen zweiten Mann, mit demselben Erfolg. Eine solche Reaktion war für ihn nichts Neues: Es war nicht das erste Mal, dass er so etwas erlebte. Die Wächter in Point Blanc. Die Techniker bei Cray Software. Leute, die für jemanden arbeiteten, vor dem sie Angst hatten. Sie wurden dafür bezahlt, bestimmte Dinge zu tun, und tanzten niemals aus der Reihe. Hatten sie etwas zu verbergen? Wahrscheinlich.
Alex verließ den Platz und ging um die Ecke. An dieser Seite des Gebäudes lief ein zweiter Kanal entlang, und diesmal hatte er mehr Glück. Eine ältere Frau in einem schwarzen Kleid und mit weißer Schürze fegte den schmalen Pfad zwischen Mauer und Kanal. Er trat auf sie zu.
»Sprechen Sie Englisch?«, fragte er. »Können Sie mir helfen?«
»Si, con piacere, mio piccolo amico.« Die Frau nickte und stellte den Besen ab. »Ich habe viele Jahre in London gelebt. Ich spreche gut Englisch. Was kann ich tun?«
Alex zeigte auf den Palast. »Was ist das für ein Haus?«
»Das ist der Ca’ Vedova.« Sie versuchte zu erklären. »Ein Palast heißt in Venedig casa, oder ca’. Und vedova …«, sie suchte nach dem Wort, »… vedova heißt Witwe. Das ist der Palast der Witwe. Ca’ Vedova.«
»Und was geschieht hier?«
»Heute Abend gibt es eine große Party. Eine Geburtstagsparty. Mit Masken und Kostümen. Da sind viele bedeutende Leute eingeladen.«
»Wer hat denn Geburtstag?«
Die Frau zögerte. Alex stellte offensichtlich zu viele Fragen, und er merkte, dass sie misstrauisch wurde. Aber dann wurde ihr Blick weich. Wieder einmal half ihm sein Alter. Er war ja erst vierzehn. Und mit vierzehn war es normal, dass man neugierig war! »Signora Rothman. Eine sehr reiche Dame. Ihr gehört das Haus.«
»Rothman? Wie die Zigarettenmarke?«
Aber die Frau antwortete nicht mehr, ihre Augen blickten ängstlich um sich. Alex sah auf und erkannte an der Ecke des Gebäudes einen der Dienstboten, die auf dem Vorplatz gearbeitet hatten. Der Mann beobachtete ihn aufmerksam. Alex lungerte offenbar schon zu lange hier herum.
Alex unternahm einen letzten Versuch. »Ich suche nach Scorpia«, sagte er.
Die alte Frau starrte ihn an, als habe er sie ins Gesicht geschlagen. Dann nahm sie den Besen und blickte verstohlen zu dem Mann, der sie beobachtete. Zum Glück hatte er von ihrem Gespräch nichts mitbekommen. Er spürte, dass etwas nicht stimmte, blieb aber, wo er war. Doch auch so begriff Alex, dass er jetzt besser verschwinden sollte.
»Schon gut«, sagte er. »Danke für Ihre Hilfe.«
Er ging schnell an dem Kanal entlang, und bald tauchte wieder eine Brücke vor ihm auf. Er ging hinüber und war froh, den Witwenpalast hinter sich zu lassen, auch wenn er selbst nicht wusste, warum.
Sobald Alex außer Sichtweite war, blieb er stehen und dachte darüber nach, was er erfahren hatte. Ein Boot mit einem silbernen Skorpion hatte ihn zu einem Palast geführt, der einer schönen und reichen Frau gehörte, die nicht lächelte. Der Palast wurde von misstrauischen Männern bewacht, und kaum hatte er einer Putzfrau gegenüber den Namen Scorpia erwähnt, hatte man ihn plötzlich behandelt wie einen Aussätzigen.
Das war zwar nicht viel, aber es reichte. Heute Abend sollte ein Maskenball stattfinden, eine Geburtstagsparty. Dazu waren wichtige Leute eingeladen. Alex war keiner von ihnen, aber sein Plan stand bereits fest. Er würde trotzdem hingehen.
Der vollständige Name der Frau, die den Palazzo betreten hatte, lautete Julia Charlotte Glenys Rothman. Sie wohnte im Palast – jedenfalls unter anderem. Außerdem besaß sie eine Wohnung in New York, ein Haus in London und eine Villa in der Karibik, genau genommen auf der Insel Tobago, mit Aussicht auf den weißen Strand der Turtle Bay.
Mrs Rothman ging durch einen freundlich erhellten Korridor, der vom Landesteg bis zu einem privaten Aufzug durch das ganze Gebäude führte. Ihre Stöckelschuhe klapperten auf den Terrakottafliesen. Kein einziger Diener ließ sich blicken. Kurz berührte ihr Finger in dem weißen Seidenhandschuh den silbernen Aufzugknopf, und schon öffnete sich die Tür. Der Lift war klein, gerade geeignet für eine Person – Mrs Rothman bewohnte das riesige Anwesen ganz allein und die Dienstboten benutzten die Treppe.
Der Aufzug brachte sie in die dritte Etage, direkt in ein modernes Konferenzzimmer ohne Teppich, ohne Bilder an den Wänden, ohne irgendwelchen Schmuck. Noch seltsamer war, dass es in diesem Raum kein einziges Fenster gab – dabei musste man von hier eine der schönsten Aussichten der ganzen Welt haben. Aber wenn niemand hinaussehen konnte, konnte natürlich auch niemand hereinsehen. Und Sicherheit war hier offenbar das einzig Entscheidende. In die Wände waren Halogenlampen eingelassen, und die einzigen Möbel waren ein langer Glastisch und mehrere Lederstühle. Gegenüber dem Lift gab es eine Tür, die allerdings verschlossen war. Auf der anderen Seite standen zwei bewaffnete Wächter, die jeden töten würden, der sich hier in der nächsten halben Stunde blicken ließ.
Um den Tisch saßen acht Männer, die auf Mrs Rothman gewartet hatten. Einer hatte graue Haare und mochte schon über siebzig sein, er atmete keuchend, hatte rote Augen und trug einen zerknitterten grauen Anzug. Der Mann neben ihm kam offenbar aus China, und der Blonde im offenen Hemd gegenüber war Australier.
Die hier Versammelten kamen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt, aber eines hatten sie alle gemeinsam: eine ihnen innewohnende Ruhe oder eher eine Kälte, die diesem Raum die Atmosphäre einer Leichenhalle verlieh. Nicht einer von ihnen grüßte Mrs Rothman, als sie am Kopfende des Tischs Platz nahm. Und niemand von ihnen sah auf die Uhr. Sie wussten: In diesem Augenblick musste es genau eins sein. Denn exakt um diese Zeit hatte die Besprechung anfangen sollen. Und Mrs Rothman war pünktlich.
»Guten Tag«, begann sie.
Einige Männer nickten, aber keiner von ihnen sagte etwas. Grüße waren Zeitverschwendung.
Die neun Personen um den Glastisch in der dritten Etage des Witwenpalasts bildeten den Vorstand einer der skrupellosesten und erfolgreichsten kriminellen Organisationen der Welt. Der Name des alten Mannes war Max Grendel; der Chinese hieß Dr. Three. Der Australier hatte überhaupt keinen Namen. Sie alle hatten sich in diesem fensterlosen Raum versammelt, um die letzten Einzelheiten einer Operation zu besprechen, die sie innerhalb weniger Wochen um satte einhundert Millionen britische Pfund reicher machen sollte.
Die Organisation hieß Scorpia.
Das war ein sonderbarer Name, das wussten sie alle, wahrscheinlich von jemandem erfunden, der zu viele James-Bond-Filme gesehen hatte. Aber irgendwie mussten sie sich ja nennen, und am Ende hatten sie sich für diesen Namen entschieden, den man auch als Abkürzung ihrer vier wichtigsten Tätigkeitsfelder sehen konnte.
Sabotage. Corruption oder zu Deutsch Korruption. Informationsbeschaffung. Attentate.
Scorpia. Ein Name, der in erstaunlich vielen Sprachen funktionierte und sich von jedem, der ihre Dienste beanspruchte, gut aussprechen ließ. Scorpia. Sieben Buchstaben, die längst in den Datenbanken der Polizeien und Nachrichtendienste aller Länder der Welt gespeichert waren.
Gegründet wurde die Organisation Anfang der Achtzigerjahre im sogenannten Kalten Krieg, jenem heimlichen Krieg, den die Sowjetunion, China, Amerika und Europa jahrzehntelang miteinander geführt hatten. Jede Regierung der Welt besaß ihr eigenes Heer von Spionen und Attentätern, die allesamt bereit waren, für ihr Land zu töten oder zu sterben. Nur auf eines waren sie nicht vorbereitet, nämlich dass sie alle plötzlich nicht mehr gebraucht wurden; und zwölf von ihnen hatten diese Gefahr frühzeitig erkannt. Sie hatten das Ende des Kalten Krieges und damit das Ende ihrer Arbeit vorausgesehen. Und deshalb hatten sie beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
An einem Sonntagmorgen trafen sie sich zu ihrer ersten Besprechung in Paris, im Maison Berthillon, einem bekannten Eiscafé auf der Ile St. Louis, nicht weit von Notre-Dame. Sie kannten einander alle gut, denn sie hatten oft genug versucht, sich gegenseitig umzubringen. Aber in dem hübschen alten Lokal mit den holzvertäfelten Wänden und den alten Spiegeln und Spitzenvorhängen aßen die zwölf einträchtig Berthillons weltberühmtes Walderdbeereis und entwickelten einen Plan, wie sie zusammenarbeiten und alle miteinander reich werden könnten. Das war die Geburtsstunde von Scorpia.
Und das Geschäft hatte sich großartig entwickelt. Scorpia agierte auf der ganzen Welt. Die Organisation hatte zwei Regierungen gestürzt und einer dritten durch Manipulation zu ihrem Wahlsieg verholfen. Sie hatte Dutzende von Konzernen zerstört, Politiker und Beamte bestochen, mehrere große Umweltkatastrophen herbeigeführt und jeden getötet, der sich ihr in den Weg stellte. Inzwischen gingen zehn Prozent aller Terroranschläge in der Welt auf ihr Konto. Scorpia führte diese Anschläge im Auftrag aus und sah sich selbst als Großkonzern des Verbrechens – nur dass die meisten Großkonzerne im Vergleich zu Scorpia kleine Fische waren.
Von den ursprünglich zwölf Mitgliedern waren nur noch neun übrig. Einer war an Krebs gestorben; zwei waren ermordet worden. Aber nach zwanzig Jahren Schwerkriminalität war das kein schlechtes Ergebnis. Die Geschäftsführung von Scorpia war so organisiert, dass alle neun Mitglieder gleichberechtigte Partner waren und für jedes neue Projekt einer von ihnen zum Leiter ernannt wurde, und zwar in alphabetischer Reihenfolge.
Das Projekt, um das es an diesem Nachmittag ging, trug den Codenamen Unsichtbares Schwert und wurde von Julia Rothman geleitet.
»Ich kann dem Vorstand mitteilen, dass alles nach Plan verläuft«, erklärte sie.
Sie war in Aberystwyth geboren und sprach mit einem leichten walisischen Akzent. Ihre Eltern hatten als walisische Nationalisten Brandanschläge auf Häuser verübt, die von Engländern in Wales als Ferienhäuser gekauft worden waren. Dabei hatten sie leider auch ein Haus abgefackelt, das gerade bewohnt gewesen war, und als ihre Eltern für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis gesteckt wurden, kam Julia in das städtische Kinderheim. Und das war der Beginn einer außergewöhnlichen kriminellen Karriere, ihrer eigenen.
»Es ist jetzt drei Monate her«, fuhr sie fort, »seit unser Klient aus dem Nahen Osten an uns herangetreten ist. Zu behaupten, er sei ein reicher Mann, wäre eine Untertreibung. Er ist Multimilliardär. Er hat sich die Welt angeschaut, die vorherrschenden Machtverhältnisse, und ist zu dem Schluss gekommen, dass da etwas nicht stimmt. Er hat uns gebeten, für eine neue Ordnung zu sorgen. Kurz gesagt: Unser Klient ist der Überzeugung, dass der Westen zu mächtig geworden ist. Vor allem Großbritannien und Amerika. Die Freundschaft dieser beiden Länder hat den Ausgang des Zweiten Weltkriegs bestimmt. Und dieselbe Freundschaft erlaubt es den Ländern des Westens jetzt, in jedes beliebige Land einzumarschieren und sich alles zu nehmen, was sie haben wollen. Unser Klient hat uns gebeten, die britisch-amerikanische Allianz ein für alle Mal zu beenden. Was kann ich Ihnen über unseren Klienten sagen?«, fragte Mrs Rothman lächelnd. »Vielleicht ist er ein Träumer, der den Weltfrieden herbeisehnt. Vielleicht ist er aber auch komplett verrückt. Wie auch immer, uns kann das gleichgültig sein. Er hat uns einen enormen Betrag dafür angeboten – einhundert Millionen britische Pfund, um genau zu sein –, dass wir seinen Wunsch erfüllen: Großbritannien und Amerika demütigen und dafür sorgen, dass sie nicht mehr als Weltmacht zusammenarbeiten. Und ich kann Ihnen berichten, dass die erste Rate, zwanzig Millionen Pfund, gestern auf unserem Schweizer Bankkonto eingetroffen ist. Wir können daher also zu Phase zwei übergehen.«
Niemand sagte etwas. Während die Männer warteten, dass Mrs Rothman weitersprach, war nur das Summen der Klimaanlage zu hören. Von draußen kein Ton.
»Phase zwei – die Endphase – wird in weniger als drei Wochen abgeschlossen sein. Ich kann Ihnen versichern, dass Briten und Amerikaner sich sehr bald an die Gurgel gehen werden. Und mehr noch: Am Ende des Monats werden beide Staaten erledigt sein. Die ganze Welt wird Amerika hassen; und die Briten werden einen Horror erleben, der ihre schlimmsten Albträume weit übertreffen wird. Wir alle werden sehr viel reicher sein. Und unser Freund aus dem Nahen Osten wird sich freuen, sein Geld so gut angelegt zu haben.«
»Entschuldigen Sie, Mrs Rothman, aber ich habe noch eine Frage …«
Dr. Three verneigte sich höflich. Sein Gesicht sah aus wie aus Wachs, und seine pechschwarzen Haare wirkten zwanzig Jahre jünger als alles andere an ihm. Die waren garantiert gefärbt. Er war sehr klein und hätte ein pensionierter Lehrer sein können. Genau genommen hätte er alles Mögliche sein können, tatsächlich aber war dieser Mann der weltbeste Experte in Sachen Folter und Schmerz. Er hatte bereits mehrere Bücher über dieses Thema geschrieben.
»Wie viele Leute beabsichtigen wir zu töten?«, fragte er.
Julia Rothman überlegte. »Es ist schwer, genaue Angaben zu machen, Dr. Three«, antwortete sie. »Aber ich denke, es werden sicher einige Tausend sein. Viele Tausend.«
»Und ausschließlich Kinder?«
»Ja. Hauptsächlich zwischen zwölf und dreizehn Jahre alt.« Sie seufzte. »Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ich liebe Kinder, auch wenn ich froh bin, dass ich selber keine habe. Aber so ist nun einmal der Plan. Und ich muss sagen, die psychologische Wirkung der Ermordung so vieler junger Menschen wird uns von Nutzen sein, denke ich. Macht Ihnen das Sorgen?«
»Nicht im Geringsten, Mrs Rothman.« Dr. Three schüttelte den Kopf.





![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
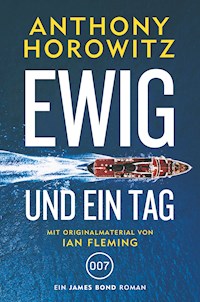

![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)
![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Snakehead [Band 7] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18daaba796e373f6fd5944e2f667ed7b/w200_u90.jpg)