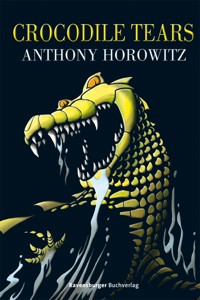
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alex Rider
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller ALEX RIDER – die Vorlage zur actiongeladenen TV-Serie! Alex Rider wäre gern ein ganz normaler Jugendlicher. Doch egal, wohin er geht, er zieht das Verbrechen magisch an. Als er in einem Genlabor auf McCain trifft, den millionenschweren Gründer einer Hilfsorganisation, schrillen bei ihm alle Alarmglocken. Was plant der angesehene Geschäftsmann? Alex heftet sich an seine Fersen, aber dann wird er entführt und nach Afrika verschleppt. Seine Aussichten, dort lebend wegzukommen: nahezu null. Band 8 der actionreichen Agenten-Reihe von Bestseller-Autor Anthony Horowitz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2019Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2019 Ravensburger Verlag GmbHDie englische Originalausgabe erschien 2009unter dem Titel Crocodile Tearsby Walker Books Ltd., 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ.Copyright © by Anthony Horowitz 2009Published by arrangement with Stormbreaker Productions Ltd.Die deutsche Erstausgabeerschien unter dem Titel Crocodile Tears2010 im Ravensburger Verlag GmbHCover © Digital Art by Larry RostantVerwendet mit freundlicher Genehmigung von Penguin Books USA.Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN 978-3-473-38399-3www.ravensburger.de
Krokodilstränen: falsche, scheinheilige Tränen. Angeblich täuschen Krokodile Tränen vor, um ihre Opfer anzulocken – und beim Fressen weinen sie dann wirklich.
Ravi Chandra würde bald ein reicher Mann sein.
Schon der Gedanke machte ihn schwindlig. Er würde in den nächsten Stunden mehr verdienen als in den vergangenen zwanzig Jahren, eine unvorstellbare Summe, bar auf die Hand. Es war der Beginn eines neuen Lebens. Er würde seiner Frau die Kleider kaufen, die sie sich wünschte, außerdem ein Auto und einen richtigen Diamantring statt des dünnen Reifs, den sie seit der Hochzeit trug. Mit seinen beiden kleinen Söhnen wollte er Disneyland in Florida besuchen. Und er wollte nach London fliegen, um sich ein Spiel der indischen Kricketmannschaft im Lord’s Stadium anzusehen – diesen Traum träumte er schon sein ganzes Leben, aber er hatte ihn immer für unerfüllbar gehalten.
Bis jetzt.
Bewegungslos saß er am Fenster des Busses, der ihn tagtäglich zur Arbeit brachte. Die Hitze war mörderisch. Die Lüftung war wieder einmal kaputt und die Firma hatte natürlich keinerlei Eile, sie zu reparieren. Schlimmer noch, es war Ende Mai. In Südindien hieß diese Jahreszeit Agni Nakshatram, Feuerstern. Die Sonne kannte kein Erbarmen. Man bekam keine Luft. Die feuchte Hitze klebte von morgens bis abends an einem dran und die ganze Stadt stank.
Wenn er das Geld endlich hatte, wollte er umziehen. Er würde die enge Zweizimmerwohnung in Perambur, dem lautesten und vollsten Stadtteil, verlassen und sich ein ruhigeres, kühleres Apartment mit mehr Platz suchen. Er würde einen mit Bier gefüllten Kühlschrank haben und einen großen LCD-Fernseher. Seine Wünsche waren bescheiden.
Der Bus wurde langsamer. Ravi war die Strecke schon so oft gefahren, dass er sogar mit geschlossenen Augen wusste, wo sie sich befanden. Sie hatten die Stadt verlassen. In der Ferne ragten steile, mit üppig grüner Vegetation bedeckte Berge auf. Aber die Gegend, durch die sie fuhren, erinnerte mehr an eine Wüste. Auf dem steinigen Boden wuchsen nur ein paar Palmen und überall standen Strommasten. Gleich würden sie am ersten Sicherheitstor anhalten.
Ravi war Mechaniker. Auf seinem Werksausweis mit Foto und vollem Namen – Ravindra Manpreet Chandra – stand Kernkraftwerkstechniker. Er arbeitete im Atomkraftwerk Jowada wenige Kilometer nördlich von Chennai, Indiens viertgrößter Stadt, dem früheren Madras.
Er hob den Kopf und sah das Kraftwerk vor sich, eine Reihe großer bunter Würfel innerhalb eines kilometerlangen Sicherheitszauns aus Draht. Draht schien überhaupt der wichtigste Bestandteil der ganzen Anlage zu sein. Es gab Widerhakensperrdraht und Stacheldraht, Zäune aus Draht und den Draht der Telefonleitungen. Der Strom, den das Kraftwerk produzierte, wurde über weitere Tausende Kilometer Draht in ganz Indien verteilt. Es war schon eine seltsame Vorstellung, dass der Strom für den Fernseher in Puducherry oder für die Nachttischlampe in Nellore von hier kam.
Der Bus hielt am Eingangstor, das durch Kameras und bewaffnetes Personal gesichert wurde. Nach den Anschlägen vom elften September in New York City und Washington D.C. war auf der ganzen Welt die Angst gewachsen, auch Kernkraftwerke könnten zu Zielen der Terroristen werden. Man hatte zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen und das Wachpersonal aufgestockt. Lange Zeit war das alles furchtbar lästig gewesen. Man brauchte nur zu niesen und schon wurde man fast verhaftet. Doch die Wachsamkeit hatte nachgelassen. Zum Beispiel beim alten Suresh, dem Wachmann am äußeren Tor. Er kannte alle Passagiere im Bus. Schließlich sah er sie täglich um dieselbe Zeit – um halb acht, wenn sie kamen, und um halb sechs, wenn sie wieder abfuhren. Manchmal begegnete er ihnen auch beim Einkaufen in der Rannganatha Street. Sogar ihre Frauen und Freundinnen kannte er. Nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, sie nach ihren Ausweisen zu fragen oder den Inhalt ihrer Taschen zu überprüfen. Er winkte den Bus durch.
Zwei Minuten später stieg Ravi aus. Er war klein und mager, hatte Pickel im Gesicht und einen Schnurrbart, der ihm ein wenig schief an der Oberlippe hing. Er trug bereits seinen Monteursanzug und die Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen. In der Hand hielt er einen schweren Werkzeugkasten. Niemand fragte, warum er ihn mit nach Hause genommen hatte. Vielleicht hatte er ja etwas in seiner Wohnung reparieren müssen. Oder er hatte unter der Hand einige Arbeiten für Nachbarn erledigt, um sich ein paar Rupien dazuzuverdienen. Ravi hatte immer irgendwelches Werkzeug dabei. Der Kasten war geradezu ein Teil von ihm, wie ein Arm oder ein Bein.
Der Bus hatte vor einer Tür in einer Ziegelwand endgültig angehalten. Sie bestand wie alle Türen in Jowada aus massivem Stahl und sollte Rauch, Feuer oder sogar einem Raketenangriff standhalten. Ein zweiter Sicherheitsbeamter und weitere Kameras überwachten, wie die Passagiere ausstiegen und durch die Tür gingen. Dahinter lag ein kahler, weiß getünchter Gang, der zu einem Umkleideraum führte, einem der wenigen Orte des Kraftwerks ohne Klimaanlage. Ravi öffnete seinen Spind. An der Innenseite der Tür hing ein Foto des Bollywood-Stars Deepika Padukone. Er holte einen Schutzhelm, eine Schutzbrille, Ohrenstöpsel und eine reflektierende Jacke heraus, außerdem einen dicken Schlüsselbund. Es gab in Jowada wie in den meisten Atomkraftwerken nur wenige elektronische Türschlösser oder Magnetstreifenkarten. Das war ebenfalls eine Sicherheitsmaßnahme. Manuelle Schlösser und Schlüssel funktionierten auch bei Stromausfall noch.
Mit dem Werkzeugkasten in der Hand marschierte Ravi einen weiteren Gang entlang. An seinem ersten Arbeitstag hatte er gestaunt, wie sauber hier alles war – verglichen mit der Straße, in der er wohnte. Dort lag überall Müll herum, die vielen Schlaglöcher waren mit Schmutzwasser gefüllt und die Ochsen, die mit ihren Karren zwischen Autos und motorisierten Rikschas unterwegs waren, ließen ihren Kot fallen. Er bog um eine Ecke und stand vor dem nächsten Kontrollpunkt, dem letzten Hindernis, das er überwinden musste, bevor er drinnen war.
Zum ersten Mal verspürte er Nervosität. Er wusste, was sich in seinem Werkzeugkasten befand und was er gleich tun würde. Wenn er nun kontrolliert wurde? Man würde ihn einsperren, vielleicht für den Rest seines Lebens. Er hatte üble Geschichten vom Gefängnis in Chennai gehört, von Insassen, die in winzigen unterirdischen Zellen dahinvegetierten, und vom Essen, das so ekelhaft schmeckte, dass einige lieber verhungerten. Aber für einen Rückzieher war es zu spät. Wenn er jetzt zögerte oder etwas Verdächtiges tat, fiel er erst recht auf.
Er gelangte an ein massives Drehkreuz mit Stäben so dick wie Baseballschläger. Es konnte immer nur eine Person durchgehen. Man musste sich langsam hindurchschieben wie auf einem Förderband, auf dem man weiterverarbeitet wurde. Außerdem gab es dort einen Röntgenscanner, einen Metalldetektor und weitere Sicherheitsbeamte.
»He, Ravi!«
»Ramesh, mein alter Freund. Hast du das Kricketspiel gestern Abend gesehen?«
»Ja. Was für ein Spiel!«
»Wir lagen zwei Tore zurück und haben wieder aufgeholt. Ich dachte schon, wir seien erledigt!«
Egal ob Kricket, Fußball oder Tennis, Sport war der tägliche Gesprächsstoff der Angestellten. Ravi hatte das Spiel am Vorabend extra angesehen, um mitreden zu können. Obwohl es im Gang kühl war, schwitzte er. Er spürte, wie ihm Schweißperlen auf die Stirn traten, und wischte sie mit dem Handrücken ab. Bestimmt hielt ihn gleich jemand an und fragte, warum er den Werkzeugkasten in der Hand behielt. Alle kannten den korrekten Ablauf. Der Werkzeugkasten musste geöffnet und durchsucht und seine Fächer mussten herausgenommen werden.
Doch keiner forderte ihn dazu auf. Im nächsten Augenblick war er durch. Nicht einmal eine Frage hatte er beantworten müssen. Alles war so abgelaufen, wie er gehofft hatte. Niemand hatte den oberen Einsatz des Kastens angehoben und die darunter versteckten zehn Kilogramm des plastischen Sprengstoffs C4 entdeckt.
Ravi ging weiter und blieb vor einer Reihe von Regalen stehen. Er zog ein kleines Gerät aus Kunststoff heraus, das wie ein Piepser aussah. Es handelte sich um sein elektronisches Personendosimeter zur Messung der Strahlung, der er ausgesetzt war. Das Instrument gab einen Warnton von sich, sobald er mit radioaktivem Material in Berührung kam. Es war mit seiner persönlichen Kennnummer und Geheimzahl versehen. Jowada war in vier Sicherheitsstufen unterteilt, in denen das Kontaminierungsrisiko unterschiedlich hoch war. Ravis Dosimeter war an diesem Tag ausnahmsweise auf die höchste Stufe eingestellt, denn er sollte das Herz des Kraftwerks betreten, die Reaktorhalle.
In ihr brannte die tödliche Flamme des Atomkraftwerks. Sechzigtausend mit Uran gefüllte, 3,85 Meter lange und zu Bündeln zusammengefasste Brennstäbe enthielt der Reaktordruckbehälter. Tag und Nacht wurden zwanzigtausend Tonnen Frischwasser pro Minute durch die Rohre gepumpt. Der dadurch erzeugte Dampf – zwei Tonnen pro Sekunde – trieb die Turbinen an und die Turbinen produzierten Strom. So funktionierte das Kraftwerk, so einfach war das im Grunde.
Ein Kernkraftwerk ist der sicherste und zugleich gefährlichste Ort der Welt. Ein Unfall hätte so schreckliche Folgen, dass es ihn schlichtweg nicht geben darf. Die Reaktorhalle von Jowada bestand aus Stahlbeton. Die Mauern waren anderthalb Meter dick. Die Kuppel über der Anlage hatte die Ausmaße einer Kathedrale. Im Fall einer Betriebsstörung konnte der Reaktor innerhalb von Sekunden abgeschaltet werden. Was auch passierte, aus dieser Halle durfte nichts nach draußen entweichen.
Bau und Betrieb der Anlage unterlagen Tausenden von Sicherheitsbestimmungen. Doch ein Mann, der davon träumte, in London ein Kricketspiel zu sehen, stand im Begriff, sie in die Luft zu sprengen.
Sechs Wochen zuvor hatten ihn zwei Männer an einer Straßenecke in der Nähe seiner Wohnung angesprochen. Der eine war Europäer, der andere kam aus Delhi. Er war, wie sich herausstellte, ein Freund von Ravis Cousin Jagdish, der in der Küche eines Fünfsternehotels arbeitete. Danach war es ganz selbstverständlich gewesen, das Gespräch bei Tee und Samosas fortzusetzen – zumal der Europäer zahlte.
»Was verdienst du in Jowada? Nur fünfzehntausend Rupien im Monat? Davon kann nicht einmal ein Kind leben und du hast Frau und Familie. Diese Gauner! Sie betrügen ehrliche Arbeiter. Denen sollte man wirklich eine Lektion erteilen …«
Geschickt hatten die beiden Männer das Gespräch in die gewünschte Richtung gelenkt. Zum Abschied schenkten sie Ravi eine falsche Rolex. Warum auch nicht? Jagdish hatte ihnen in der Vergangenheit hin und wieder einen Gefallen getan, sie kostenlos mit Essen bewirtet, das er aus der Küche gestohlen hatte. Jetzt revanchierten sie sich dafür eben bei Ravi. Bei ihrem nächsten Treffen eine Woche später schenkten sie ihm ein iPhone – ein echtes. Die Geschenke waren allerdings nur als Vorgeschmack auf die Reichtümer gedacht, die er sich verdienen konnte, wenn er einen Auftrag für sie erledigte. Der Auftrag war gefährlich. Es konnte dabei sogar Verletzte geben.
»Aber für dich, mein Freund, wäre es der Anfang eines neuen Lebens. Alle deine Wünsche könnten in Erfüllung gehen …«
Um Punkt acht Uhr betrat Ravi Chandra die Reaktorhalle des Kernkraftwerks Jowada. Fünf weitere Techniker begleiteten ihn. Hintereinander mussten sie eine Luftschleuse passieren, einen weißen, runden Gang mit einer automatischen Schiebetür an beiden Enden. Das Ganze sah aus wie eine Schleuse auf einem Raumschiff und diente auch einem ähnlichen Zweck. Der Ausgang ging erst auf, wenn der Eingang sich geschlossen hatte. Aus der Halle durfte keine radioaktive Strahlung nach draußen gelangen. Die Männer trugen die gleichen Anzüge, Helme und Schutzbrillen. Alle hielten Werkzeugkästen in der Hand. Sie sollten an diesem Tag eine Reihe von Instandhaltungsarbeiten durchführen, darunter so gewöhnliche wie ein Ventil zu ölen oder eine Glühbirne zu wechseln. Auch die modernste Technik muss regelmäßig gewartet werden.
Von der Luftschleuse gelangten sie in die Reaktorhalle. Unter der riesigen Kuppel mit ihren leuchtend gelben Stegen und Balkonen, Hebebühnen und Kabeln und zwischen den gewaltigen Maschinen, Brennstab-Transportbehältern und Generatoren wirkten sie winzig und verloren. Scheinwerfer strahlten vom Rand der Kuppel herunter und in der Mitte der Halle öffnete sich eine Art zwölf Meter tiefes, leeres, auf allen vier Seiten mit Edelstahl verkleidetes Schwimmbecken – der eigentliche Reaktor. Unter einem hundertfünfzig Tonnen schweren Stahldeckel wurden fortwährend Millionen von Uranatomen gespalten und erzeugten dabei eine unvorstellbare Hitze. Vier metallene Türme wachten über das Ganze. Sie sahen aus wie kleine Raketen. Raketen, die nie fliegen würden. Jeder Turm war in einem eigenen stählernen Gehäuse eingeschlossen und durch ein Netz dicker Rohre mit dem Rest der Anlage verbunden. Es handelte sich um die Kühlmittelpumpen des Reaktors, die das Kühlwasser durch die Rohre beförderten. Innerhalb des Metallgehäuses drehte sich ein fünfzig Tonnen schwerer Motor mit fünfzehnhundert Umdrehungen pro Minute.
Es gab eine Nord-, Süd-, Ost- und Westpumpe. Die Südpumpe war Ravis Ziel. Doch zuerst ging er quer durch die Halle zu einer Tür mit der Aufschrift NOTAUSGANG. Die beiden Männer hatten ihm alles ganz genau erklärt. Ein Anschlag auf den Reaktordeckel war sinnlos, ihn konnte nichts durchdringen. Genauso sinnlos war ein Angriff auf die Reaktorhalle, solange sie hermetisch abgeriegelt war. Jede Explosion und jedes radioaktive Leck würde aufgefangen werden. Deshalb musste ein Auslass gefunden werden. Die Kraft des Reaktors musste freigesetzt werden.
Auf einem Plan hatten sie Ravi gezeigt, wie. Die als Notausgang gedachte Luftschleuse war die Achillesferse des Sicherungssystems von Jowada. Sie hätte nie gebaut werden dürfen. Man brauchte sie nicht und sie war auch noch nie benutzt worden. Der Gang führte durch die Rückwand der Turbinenhalle und endete auf einem Stück Brachland in der Nähe des Umfassungszauns. Er diente allein der Beruhigung der Arbeiter. Im Notfall konnten sie hier direkt ins Freie gelangen. Doch ein solcher direkter Ausgang war gefährlich. In gewisser Weise entsprach er dem Lauf eines Gewehrs. Er musste nur noch geöffnet werden.
Niemand sah Ravi zum Notausgang gehen. Und selbst wenn ein Kollege ihn gesehen hätte, hätte er sich nichts dabei gedacht. Jeder hatte ein anderes Arbeitsblatt. Er hätte geglaubt, dass Ravi nur die ihm zugewiesenen Aufgaben verrichtete.
Ravi öffnete die innere Tür aus massivem Metall und schlüpfte in den Korridor. Er ging ihn zur Hälfte entlang und gelangte zu einem Steuerkasten, der an der Wand unterhalb der Decke angebracht war. Er stellte sich auf die Zehenspitzen und schraubte die Abdeckung mithilfe eines Schraubenziehers ab, eines der wenigen echten Werkzeuge, die er mitgebracht hatte. Dahinter kam ein Gewirr von Drähten zum Vorschein, aber Ravi wusste genau, was er zu tun hatte. Er schnitt zwei Drähte durch und verband sie miteinander. Es war ganz leicht. Vor ihm glitt die äußere Tür auf und zeigte hinter einem Maschendrahtzaun ein Stück blauen Himmel. Schwüle Luft schlug ihm entgegen. Irgendwo, vielleicht im Kontrollraum, würde jemand merken, was geschehen war. Wahrscheinlich blinkte jetzt ein rotes Lämpchen auf einer der großen Schalttafeln. Aber es würde eine Weile dauern, bis jemand kam, um nachzusehen, was los war. Und dann wäre es schon zu spät.
Ravi kehrte in die Reaktorhalle zurück und ging zur nächstgelegenen der vier Kühlmittelpumpen. Ein Anschlag auf das Kernkraftwerk konnte nur gelingen, wenn man einen sogenannten Kühlmittelverluststörfall herbeiführte. Ein solcher Störfall hatte die Katastrophe von Tschernobyl verursacht und im amerikanischen Reaktor Three Mile Island in Pennsylvania fast ein ähnliches Unglück ausgelöst. Die Pumpe war zwar in ein Gehäuse eingeschlossen, doch Ravi besaß den Schlüssel. Auch deshalb hatten die beiden Männer ihn ausgewählt. Er war der richtige Mann am richtigen Ort.
Vor der zylindrischen, über zwanzig Meter hohen Wand blieb er stehen. Aus ihrem Inneren drang Motorenlärm, ein ohrenbetäubender, unaufhörlicher Krach. Ravi dachte daran, was er gleich tun würde, und sein Mund war wie ausgetrocknet. War er verrückt? Was wäre, wenn man den Anschlag zu ihm zurückverfolgte? Aber zugleich dachte er an das Kricketspiel in London, an seine Frau Ajala, an Disneyland, an ein neues Leben. Seine Familie war an diesem Tag nicht in Chennai. Er hatte sie zu Freunden nach Bangalore geschickt. Dort konnte ihnen nichts passieren. Was er tat, tat er für sie. Er musste es für sie tun.
Einen kurzen Moment lang hielten sich Angst und Gier die Waage, dann neigte sich die Waagschale. Ravi kniete sich hin, stellte den Werkzeugkasten ab, öffnete ihn und hob den oberen Einsatz heraus. Der Raum darunter wurde fast vollständig von dem Plastiksprengstoff ausgefüllt. Daneben war gerade noch Platz für den Zeitzünder: eine digitale, auf zehn Minuten eingestellte Anzeige, einige Drähte und ein Schalter.
Zehn Minuten – das verschaffte ihm ausreichend Zeit, die Halle vor der Bombenexplosion zu verlassen. Er wollte denselben Weg nehmen, den er gekommen war. Auf der anderen Seite der Luftschleuse war er in Sicherheit. Wenn ihn jemand anhielt, würde er sagen, er müsse dringend auf die Toilette. Nach der Detonation würde Panik ausbrechen, der Alarm würde losgehen und das Kraftwerk würde evakuiert werden, wie sie es schon so oft geprobt hatten. Alle müssten Strahlenschutzanzüge anziehen. Er würde die Anlage einfach zusammen mit den anderen verlassen. Niemand konnte die Bombe zu ihm zurückverfolgen. Nichts wies auf eine Verbindung hin.
Aber vielleicht gab es Tote, Menschen, die er kannte. Konnte er das wirklich verantworten?
Die Uhr mit dem Schalter lag direkt vor ihm. Sie war so klein. Er brauchte sie nur zu berühren und der Countdown lief.
Ravi Chandra holte tief Luft, streckte den Finger aus – und drückte den Schalter.
Es war die letzte Handlung seines Lebens. Die Männer von der Straßenecke hatten ihn angelogen. Es gab keine zehnminütige Verzögerung. Die Bombe explodierte sofort und Ravi verdampfte förmlich. Er war augenblicklich tot, ohne zu begreifen, dass man ihn betrogen hatte, dass seine Frau jetzt Witwe war und dass seine Kinder Micky Maus nie kennenlernen würden. Auch die Folgen seiner Tat bekam er nicht mehr mit.
Die Bombe riss wie geplant ein Loch in die Kühlmittelpumpe und zerstörte ihre Rotoren. Mit einem hässlichen metallischen Knirschen flog der ganze Turm auseinander. Ein Kollege Ravis – der Mann, mit dem er sich eben noch über Kricket unterhalten hatte – war augenblicklich tot und wurde in die Reaktorgrube geschleudert. Die anderen Techniker erstarrten. Auf ihren Gesichtern zeichnete sich blankes Entsetzen ab. Dann suchten sie schleunigst Deckung, doch zu spät. Bei der zweiten Explosion sausten Metall- und Maschinenteile wie tödliche Geschosse durch die Luft. Die beiden Männer, die der Pumpe am nächsten waren, wurden in Stücke gerissen. Die anderen rannten zur Luftschleuse.
Keiner erreichte sie. Sirenen schrillten, Lichter blinkten und Chaos brach aus. Die Reaktorhalle verwandelte sich in eine schwarz-rote Hölle. Ein Kabel fiel Funken sprühend von oben herunter. Drei weitere Explosionen erfolgten. Rohre rissen sich los, Flammen schlugen hoch und tosend wie ein Schnellzug schoss sengend heißer Dampf aus den Rohren. Der allerschlimmste Fall war eingetreten. Messerscharfe, gezackte Metallstücke hatten die Rohre aufgeschlitzt. Obwohl sich der Reaktor innerhalb von Sekunden selbst abschaltete, konnten einige Tonnen des radioaktiven Dampfes entweichen. Ein Techniker wurde mit voller Wucht vom Dampf getroffen und verschwand mit einem einzigen, furchtbaren Schrei.
Donnernd strömte der Dampf aus den Rohren und füllte die gesamte Reaktorhalle. Unter normalen Umständen hätten Wände und Kuppel ihn aufgehalten. Doch Ravi Chandra hatte kurz vor seinem Tod die für Notfälle gedachte Luftschleuse geöffnet. Der Dampf fand sie und brach mit elementarer Gewalt hindurch und nach draußen. Es wurden zwar sofort sämtliche Systeme heruntergefahren und Notfallmaßnahmen aktiviert, aber es war zu spät.
Die Einwohner von Chennai sahen die gewaltige weiße Dampfwolke und hörten Sirenen. Arbeiter des Kernkraftwerks riefen ihre Angehörigen in der Stadt an und rieten ihnen, im Haus zu bleiben. Panik machte sich breit. Über eine Million Männer, Frauen und Kinder ließen alles stehen und liegen und versuchten, über die Straßen zu fliehen. Der Verkehr kam zum Erliegen. Es herrschten kriegsähnliche Zustände. An einem Dutzend Kreuzungen und Ampeln krachten Fahrzeuge ineinander. Niemand konnte in dem allgemeinen Tumult die Stadt verlassen, bevor der aus Norden kommende Wind die radioaktive Wolke über die Stadt blies.
Am selben Abend berichtete das Fernsehen weltweit über die Katastrophe. Schätzungen zufolge waren in der ersten Stunde nach der Explosion mindestens hundert Menschen gestorben. Es hatte Tote im Kernkraftwerk gegeben, aber weitaus mehr waren bei der Massenflucht aus Chennai ums Leben gekommen. Am folgenden Morgen sprachen die Schlagzeilen der Zeitungen von einem NUKLEAREN ALBTRAUM – natürlich in Großbuchstaben. Die indischen Behörden behaupteten zwar, die Dampfwolke sei nur schwach radioaktiv gewesen, es bestehe daher kein Anlass zur Panik, doch genauso viele Experten waren anderer Meinung.
Vierundzwanzig Stunden später wurde im Fernsehen zur Hilfe für die Bevölkerung von Chennai aufgerufen. Von weiteren Opfern wurde berichtet. Wohnungen und Läden waren geplündert worden. Auf den Straßen kam es immer noch zu Ausschreitungen und die Armee war gerufen worden, um die Ordnung wiederherzustellen. Die Krankenhäuser waren mit verzweifelten Menschen überfüllt. Eine britische Hilfsorganisation namens First Aid legte einen umfassenden Plan zur Verteilung von Nahrungsmitteln, Decken und vor allem Kaliumjodidtabletten an alle Einwohner der Stadt vor. Mit den Tabletten sollte die Strahlenkrankheit bekämpft werden.
Die Briten zeigten sich wie immer sehr großzügig. Gegen Ende der Woche hatten sie bereits eineinviertel Millionen Pfund gesammelt. Natürlich hätten sie, wenn die Katastrophe größer gewesen wäre, noch viel mehr gespendet.
Alex Rider warf einen letzten Blick in den Spiegel, stutzte und sah noch einmal hin. Seltsam, aber er war sich nicht sicher, ob er den Jungen kannte, der seinen Blick erwiderte. Der Junge hatte dieselben schmalen Lippen, dieselbe markante Nase, dasselbe ausgeprägte Kinn und dieselben blonden Haare, die ihm über die dunkelbraunen Augen fielen. Alex hob eine Hand und sein Spiegelbild tat gehorsam dasselbe. Trotzdem stimmte etwas an diesem zweiten Alex Rider nicht mit ihm überein.
Natürlich trug er ein anderes Outfit als sonst. In wenigen Minuten wollte er zu einer Silvesterparty aufbrechen, die in einer Burg am Ufer von Loch Arkaig im schottischen Hochland steigen sollte. Kleidung:Smoking hatte ausdrücklich auf der Einladung gestanden. Nur widerstrebend hatte Alex sich auf den Weg in die nächste Stadt gemacht und einen vornehmen Anzug gemietet: Jackett, schwarze Hose und weißes Hemd mit einem Stehkragen, der zu eng war und am Hals scheuerte. Nur die auf Hochglanz polierten Schnürschuhe, die laut dem Verkäufer unbedingt dazugehörten, hatte er nicht angezogen. Schwarze Turnschuhe mussten genügen.
Wem sah er in diesen Klamotten ähnlich?, überlegte er, während er die Fliege zum zehnten Mal gerade rückte. Einem jungen James Bond. Ein dummer Vergleich, aber er drängte sich auf.
Doch es lag nicht nur an den Kleidern. Forschend musterte Alex sich im Spiegel. Im vergangenen Jahr war viel passiert. So viel, dass er manchmal gar nicht mehr richtig wusste, wer er war. Es kam ihm so vor, als sei er gerade aus dem Karussell ausgestiegen, in das sich sein Leben verwandelt hatte. Er selbst drehte sich nicht mehr, aber dafür drehte sich die Welt um ihn.
Erst vor zwei Monaten war er in Australien gewesen. Nicht auf Urlaub oder Verwandtschaftsbesuch, sondern – so unglaublich es klang – als Mitarbeiter des australischen Geheimdienstes. Verkleidet als afghanischer Flüchtling hatte er in die Verbrecherorganisation Snakehead eindringen sollen, die im großen Stil Menschenschmuggel betrieb, doch dann war auf einmal noch viel mehr im Spiel gewesen. Alex hatte mit Major Winston Yu zu tun gehabt und mit der schrecklichen Bedrohung durch eine Bombenexplosion in der Erdkruste. Dabei war er auch seinem Paten begegnet, einem Mann, den er nur als Ash kannte. Alex sah, dass bei dem Gedanken an Ash ein Funkeln in seine Augen getreten war. War es Wut? Trauer? Er hatte seine Eltern nie kennengelernt und gehofft, Ash könnte ihn über seine Vergangenheit aufklären. Doch sein Pate hatte nichts dergleichen getan. Stattdessen hatte ihre Begegnung Verrat und Tod zur Folge gehabt.
Und hier lag der Hund begraben. Das wollte der Junge im Spiegel ihm sagen. Er war erst vierzehn Jahre alt, aber das vergangene Jahr – dessen Ende sie nachher feiern würden – wäre fast sein letztes gewesen. Wenn er die Augen schloss, spürte er wieder Major Yus Spazierstock, der ihn seitlich am Kopf getroffen hatte, das erdrückende Gewicht des Wassers der Bora-Fälle und die Bestrafung, die er im Boxring in Bangkok über sich hatte ergehen lassen müssen. Und das waren nur die letzten seiner vielen schlimmen Erlebnisse.
Wie oft war er schon getreten und zusammengeschlagen worden? Und angeschossen. Die Wunden waren verheilt, aber er wurde beim Ausziehen jedes Mal an sie erinnert. Die Narbe der Kugel, mit der ein Scharfschütze ihn von einem Dach aus in die Brust getroffen hatte, würde ihn immer begleiten. So wie die Erinnerung an die erlittenen Schmerzen – die vergaß man angeblich auch nie.
Hatte ihn das alles verändert? Natürlich. Niemand war nach solchen Erlebnissen noch derselbe. Und trotzdem …
»Alex! Hör auf, dich im Spiegel zu bewundern, und komm runter!«
Das war Sabina. Alex drehte sich um. Sabina stand in der Tür und trug ein silbernes Kleid, an dessen Halsausschnitt kleine Steine glitzerten. Die schwarzen Haare, die sie hatte lang wachsen lassen, waren zurückgebunden. Dazu trug sie Make-up, was untypisch für sie war – hellblauen Lidschatten und pink schimmernden Lippenstift.
»Dad wartet. Wir wollen los.«
»Ich komme schon.«
Alex rückte die Fliege noch mal zurecht. Wie konnte er eigentlich verhindern, dass sich das blöde Ding ständig verschob? Er sah albern aus. Niemand unter fünfzig sollte einen Smoking anziehen müssen. Wenigstens hatte er Sabinas Vorschlag abwehren können, im Schottenrock zur Party zu gehen. Sabina hatte ihn seit Weihnachten damit aufgezogen.
Trotzdem hatte Alex Rider die letzten anderthalb Monate in vollen Zügen genossen. Angefangen hatte es damit, dass Sabina und ihre Eltern überraschend in England aufgetaucht waren. Edward Pleasure war Journalist. Bei seinen Recherchen zu einem Popstar namens Damian Cray wäre er fast ums Leben gekommen. Alex hatte sich damals die Schuld daran gegeben. Als Sabina dann, nachdem alles vorbei war, nach Amerika geflogen war, hatte er geglaubt, sie nie mehr wieder zu sehen. Jetzt war sie in sein Leben zurückgekehrt und obwohl sie ein Jahr älter war als er, standen sie sich sehr nahe. Dazu trug vielleicht bei, dass Sabina eine der wenigen war, die von seiner Verbindung zum MI6 wussten.
Noch überraschter war Alex gewesen, als die Pleasures ihn über Neujahr in das Haus eingeladen hatten, das sie im schottischen Hochland gemietet hatten. Hawk’s Lodge war ein stattliches viktorianisches Anwesen, einst benannt nach einem unbekannten Dichter namens »Hawk«. Das dreistöckige Gebäude lag am Waldrand und dahinter ragte der Ben Nevis auf. Zu einem solchen Haus gehörten lodernde Kaminfeuer, heiße Schokolade, altmodische Brettspiele und Essen im Überfluss. Liz Pleasure, Sabinas Mutter, hatte seit ihrer Ankunft für all das und mehr gesorgt. In den vergangenen Tagen hatten sie zu viert Wanderungen unternommen, sich einsame Dörfer und Burgruinen angeschaut. Sie waren Fischen gewesen und den berühmten weißen Sandstrand von Morar entlangspaziert. Sabina hatte auf Schnee gehofft – in den Cairngorms konnte man Ski fahren und sie hatte ihre Ausrüstung mitgebracht –, doch trotz der eisigen Kälte waren bisher nur einige Flocken vom Himmel gefallen. Einen Fernseher gab es nicht und Edward hatte Sabina verboten, ihren Nintendo mitzubringen. Sie hatten an den Abenden Scrabble oder Perudo gespielt, das peruanische Würfelspiel, bei dem man bluffen muss. Alex gewann fast immer. Denn wenn er im Leben eins gelernt hatte, dann zu bluffen.
Jack Starbright, Alex’ Haushälterin und in vieler Hinsicht engste Freundin, war über Neujahr nach Washington geflogen. Die Pleasures hatten sie auch nach Schottland eingeladen, doch sie hatte lieber ihre Eltern besuchen wollen. Alex hatte sie zum Abschied vor das Haus begleitet. Eines Tages würde sie endgültig nach Amerika zurückkehren. Dort lebten ihre Eltern und der Rest ihrer Familie. Aber was sollte dann aus ihm werden? Jack kümmerte sich seit dem Tod seines Onkels um Alex und für ihn war sie unersetzbar. Als hätte sie seine Gedanken gelesen, drückte sie ihn an sich. Der Taxifahrer lud ihre Koffer ein.
»Keine Sorge, Alex, in einer Woche sehen wir uns wieder. Viel Spaß in Schottland. Hoffentlich überstehst du Silvester, ohne dich in ein gefährliches Abenteuer zu stürzen. Vergiss nicht, die Schule beginnt am Sechsten.«
Auch das war ein Grund zum Feiern. Alex hatte anderthalb Monate an der Brookland-Schule hinter sich gebracht, ohne von einem Geheimdienst entführt, erschossen oder angeworben zu werden. Er kam sich langsam wie ein ganz normaler Schüler vor, der geschimpft wurde, wenn er unerlaubt den Mund aufmachte, der über seinen Hausaufgaben schwitzte und der die Pausenglocke herbeisehnte.
Er warf einen letzten Blick in den Spiegel. Jack hatte recht. Vergiss James Bond. Davon hatte er genug gehabt. Das gehörte der Vergangenheit an.
Alex stieg die Treppe zur holzgetäfelten Eingangshalle hinunter, in der düstere Gemälde von Tieren des schottischen Hochlands hingen. Edward Pleasure wartete zusammen mit Sabina auf ihn. Er kam Alex sehr viel älter vor als bei ihrem letzten gemeinsamen Abenteuer. Jedenfalls hatte er mehr Falten im Gesicht und trug seine Brille nun die ganze Zeit. Und er hatte deutlich abgenommen. Außerdem hinkte er und stützte sich beim Gehen auf einen schweren Spazierstock mit eiserner Spitze und einem Messinggriff, der wie ein Entenschnabel geformt war. Seine Frau hatte ihm den Stock in einem Londoner Antiquitätengeschäft besorgt.
»Wenn dich je wieder einer von den Leuten, über die du schreibst, angreifen sollte, kannst du dich damit wenigstens verteidigen«, hatte sie gescherzt.
Das gefiel Alex an dieser Familie am besten: Alle hielten zusammen und waren immer guter Dinge – egal was passierte.
Alex kam hervorragend mit ihnen aus und hatte sich schnell bei ihnen eingelebt. Er stellte sich gern vor, dass seine Eltern genauso gewesen wären wie Edward und Liz.
Auch der Journalist hatte für den Abend einen Smoking angezogen. Doch Alex spürte sofort, dass etwas nicht stimmte.
»Was ist?«, fragte er.
»Mum kommt nicht mit«, sagte Sabina. Sie klang enttäuscht. Alex wusste, dass sie sich stundenlang auf die Party vorbereitet hatte. Jetzt war im letzten Moment etwas schiefgegangen.
»Sie fühlt sich nicht gut«, erklärte Edward. »Es sei nichts Ernstes, sagt sie, nur ein Anflug von Grippe.«
»Dann sollten wir alle hierbleiben«, meinte Sabina.
»Unsinn! Ihr drei geht hin und vergnügt euch.« Liz Pleasure war hinter sie getreten. Sie hatte eine herzliche, unbekümmerte Art und lange, nach allen Seiten abstehende Haare. Sie scherte sich nicht um ihr Aussehen und stellte in ihrem Haus keine Regeln auf. Jetzt trug sie einen ausgebeulten Pullover und Jeans und hielt eine Packung Papiertaschentücher in der Hand.
»Ich mache mir sowieso nicht viel aus Partys und bei dem Wetter setze ich ganz sicher keinen Fuß vor die Tür.«
»Aber du willst an Silvester doch auch nicht allein sein, Mum.«
»Ich nehme ein heißes Bad mit dem teuren Öl, das dein Vater mir zu Weihnachten geschenkt hat. Und dann gehe ich ins Bett. Wenn die Uhr zwölf schlägt, schlafe ich längst.« Sie legte den Arm um Sabina. »Wirklich, Sab, es macht mir nichts aus. Wir können morgen Neujahr feiern und dann erzählt ihr mir, was ich verpasst habe.«
»Aber ohne dich macht es keinen Spaß.«
»Quatsch. Du magst doch Partys. Und ihr seht beide umwerfend aus.« Liz Pleasures Entschluss war gefasst. »Ihr müsst hingehen. Die Karten sind ein Vermögen wert.« Sie strahlte Alex an. »Du passt auf meine Tochter auf. Und denkt dran, ihr feiert auf einer echten schottischen Burg. Heute ist Hogmanay, ein wichtiger schottischer Festtag. Es wird bestimmt ganz toll.«
Widerstand war zwecklos und zwanzig Minuten später saßen Alex, Sabina und Edward im Auto. Sie fuhren die kurvige Landstraße entlang, die nach Norden zum Loch Arkaig führte. Das Wetter hatte sich verschlechtert. Inzwischen fiel der Schnee, den Sabina herbeigesehnt hatte, und es war dunkel geworden. Dicke Flocken wirbelten durch die Scheinwerferkegel. Edward Pleasure fuhr einen Nissan X-Trail, den er am Flughafen von Inverness gemietet hatte. Alex war froh über den Allradantrieb. Sie würden ihn bald brauchen, denn der Schnee blieb bereits auf der Fahrbahn liegen.
Sabina hatte es sich mit ausgestreckten Beinen auf dem Rücksitz bequem gemacht und entwirrte die Kopfhörerkabel ihres iPod, Alex saß vorn. Er war seit der Zeit in Südfrankreich zum ersten Mal allein mit Edward Pleasure und fühlte sich ein wenig unbehaglich. Bestimmt wusste Sabinas Vater längst von seiner Zusammenarbeit mit dem MI6. Sabina hatte ihm wahrscheinlich alles erzählt. Trotzdem hatten sie nie darüber gesprochen, als sei das irgendwie taktlos.
»Schön, dass du bei uns bist, Alex«, sagte Edward leise. Er hatte die Stimme gedämpft, damit Sabina, die inzwischen in die Musik von Coldplay eingetaucht war, sie nicht hörte. »Sab hat sich wirklich gefreut, dass du kommen konntest.«
»Ich bin auch sehr gerne bei euch.« Alex überlegte kurz und fügte hinzu: »Das mit heute Abend tut mir leid.«
Edward lächelte. »Wir brauchen ja nicht so lange zu bleiben, wenn ihr nicht wollt. Aber Liz hat vollkommen recht. Silvester wird nirgends so gefeiert wie hier in Schottland. Und Kilmore Castle ist etwas Besonderes. Das Gebäude stammt aus dem dreizehnten Jahrhundert und fiel dem ersten Jakobineraufstand zum Opfer. Danach war es eine Ruine, bis Desmond McCain es gekauft hat.«
»Ist das nicht der Mann, über den Sie gerade schreiben?«
»Stimmt. Reverend Desmond McCain. Wir gehen hauptsächlich seinetwegen dorthin.« Edward streckte die Hand aus und drückte einen Schalter. Warme Luft blies über die Windschutzscheibe. Die Scheibenwischer gaben zwar ihr Bestes, aber der Schnee blieb trotzdem am Glas kleben. Im Auto war es im Unterschied zu draußen gemütlich warm. »Ein interessanter Mann, Alex. Kennst du ihn?«
»Nicht wirklich.«
»Ich dachte, du hättest vielleicht was über ihn in der Zeitung gelesen. Er wuchs in einem Waisenhaus im Londoner Osten auf. Keine Eltern, keine Familie, nichts. Als Baby wurde er in einem Einkaufswagen ausgesetzt, eingewickelt in eine Plastiktüte von McCains Pommes frites. Daher hat er seinen Namen. Ein Ehepaar aus Hackney hat ihn aus dem Heim geholt und von da an ging es aufwärts. Er war gut in der Schule – zumindest in Sport. Mit achtzehn war er ein bekannter Boxer. Er gewann zweimal den Titel der WBO im Mittelgewicht. Alle Welt glaubte, dass er ihn auch das dritte Mal gewinnen würde, aber 1983 ging er im Madison Square Garden schon in der ersten Runde gegen Buddy Sangster k.o.«
»Ist Sangster nicht irgendwas zugestoßen?«, fragte Alex. Er hatte den Namen schon mal gehört.
»Richtig, Sangster starb im Jahr darauf. Er wurde in New York von der U-Bahn überfahren. Die Beerdigung kam im Fernsehen. Ein Fan schickte hundert schwarze Tulpen. Damals meinte jemand …« Edward schüttelte den Kopf. »Jedenfalls war McCains Boxkarriere beendet. Sangster hatte ihm den Unterkiefer übel zugerichtet. McCain ließ sich von einem Schönheitschirurgen in Las Vegas operieren, aber der hat schlampig gearbeitet und der Kiefer wuchs nie mehr zusammen. McCain kann bis heute nicht richtig kauen und nur noch pürierte Speisen zu sich nehmen. Doch er ließ sich nicht unterkriegen. Er wechselte in die Immobilienbranche und bewies ein geschicktes Händchen. Er konnte ein Dutzend Familien in Rotherhithe an der Themse dazu überreden, ihre Häuser billig an ihn zu verkaufen. Anschließend riss er alle Gebäude ab, baute einige Wolkenkratzer und verdiente ein Vermögen.
Ungefähr zur selben Zeit erwachte sein Interesse für Politik. Er spendete mehrere Tausend Pfund an die Konservativen und gab dann plötzlich bekannt, er wolle sich ins Parlament wählen lassen. Die Konservativen hießen ihn natürlich mit offenen Armen willkommen. Er war reich, erfolgreich – und schwarz. Auch das spielte eine Rolle. Gleich im ersten Anlauf gewann er die Mehrheit der Stimmen in einem Londoner Wahlkreis, der seit dem neunzehnten Jahrhundert nicht mehr konservativ gewählt hatte. McCain war beliebt. Das bekannte Märchen: vom Tellerwäscher zum Millionär. Er hatte in der Partei viele Anhänger und ein Jahr später war er Staatssekretär im Sportministerium. Man redete sogar schon davon, er könnte eines Tages unser erster schwarzer Premierminister werden.«
»Was kam dazwischen?«
Edward seufzte. »Alles! Wie sich herausstellte, liefen seine Geschäfte doch nicht so gut, wie allgemein angenommen. Einige Projekte wurden nicht termingerecht fertig und er geriet in Geldnot. Die Banken rückten ihm auf die Pelle und der Bankrott drohte – und dann hätte er natürlich nicht mehr Parlamentarier sein können. Gott allein weiß, was ihn geritten hat, jedenfalls setzte er eine seiner Immobilien in Brand, um die Versicherungssumme zu kassieren. So wollte er sich retten. Bei der Immobilie handelte es sich um ein vierundzwanzigstöckiges Bürogebäude mit Blick auf St. Pauls. Es brannte eines Nachts bis auf die Grundmauern nieder. Am nächsten Tag erhob McCain Anspruch auf fünfzig Millionen Pfund. Problem gelöst.«
Die Straße machte einen Knick und Edward Pleasure bremste. Inzwischen war die komplette Fahrbahn mit einer weißen Schneeschicht bedeckt. Rechts und links ragten schwarze Kiefern auf.
»Glaubte er wenigstens«, fuhr Edward fort. »Leider roch die Versicherungsgesellschaft den Braten und stellte unbequeme Fragen. Warum hatte jemand die Alarmanlage ausgeschaltet? Wieso hatte man das Sicherheitspersonal an diesem Abend früher nach Hause geschickt? Die Gerüchteküche in der Presse brodelte – und dann tauchte plötzlich ein Zeuge auf. Wie sich herausstellte, hatte in dem unterirdischen Parkhaus ein Obdachloser geschlafen. Er hatte McCain mit sechs Benzinkanistern und einem Feuerzeug ankommen sehen. Glücklicherweise konnte er sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. McCain aber wurde verhaftet. Ein aufsehenerregender Prozess folgte und er wurde zu neun Jahren Haft verurteilt.«
Alex hatte stumm zugehört. »Sie haben vorhin von Reverend McCain gesprochen«, sagte er jetzt.
»Ja, klingt seltsam, aber sein ganzes Leben ist seltsam. Im Gefängnis trat er zum Christentum über. Er absolvierte ein Fernstudium und wurde Priester einer Kirche, von der nie jemand gehört hatte. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis – das war vor fünf Jahren – kehrte er nicht ins Geschäftsleben oder in die Politik zurück. Er sagte, er wolle sich in Zukunft um andere Menschen kümmern und nicht mehr nur an sich selbst denken. Deshalb gründete er eine Wohltätigkeitsorganisation. Sie heißt First Aid und stellt bei Katastrophen weltweit schnellstmöglich Hilfe zur Verfügung.«
»Wie weit ist es noch?«, fragte Sabina, ohne ihre Kopfhörer abzunehmen.
Edward Pleasure hob die Hand. Er öffnete und schloss sie zweimal. Zehn Minuten.
»Und Sie haben ihn interviewt?«, hakte Alex nach.
»Ja. Ich habe für GQeinen großen Artikel über ihn geschrieben. Er erscheint nächsten Monat.«
»Und …?«
»Du lernst ihn heute kennen, dann kannst du dir selbst ein Urteil bilden. Der Mann sprüht vor Energie und jetzt verwendet er sie darauf, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie ihm. Er hat Millionen gesammelt, um den Hunger in Afrika zu bekämpfen, Buschfeuer in Australien, Flutkatastrophen in Malaysia. Auch für die Unglücksopfer in Südindien hat er gesammelt. In Jowada.«
Alex erinnerte sich. Alle Medien hatten darüber berichtet. »Das Atomkraftwerk.«
Edward nickte. »Eine Zeit lang sah es so aus, als sei die Stadt völlig verseucht. Zum Glück war es nicht ganz so schlimm. Allerdings kamen in der anschließenden Massenpanik viele Menschen ums Leben. First Aid war bereits am nächsten Tag vor Ort und versorgte Frauen und Kinder mit Medikamenten gegen die Strahlung und Nahrungsmitteln. Niemand weiß, wie die Organisation das geschafft hat, aber ihr erklärtes Ziel ist die Soforthilfe. Sie will als erste Hilfsorganisation zur Stelle sein.«
»Meint dieser McCain es ehrlich?«
»Äh … ob ich glaube, dass er ein zweiter Damian Cray sein könnte?« Edward lächelte kurz. Der Artikel, in dem er Cray als Wahnsinnigen entlarvt hatte, hatte ihn fast das Leben gekostet. »Bei unserer ersten Begegnung hatte ich noch meine Zweifel, aber sei unbesorgt, Alex. Ich habe seine Organisation auf Herz und Nieren geprüft, ihn selbst interviewt und mit Leuten geredet, die ihn kennen. Außerdem habe ich mit der Polizei gesprochen und Einsicht in alte Akten genommen. Ich konnte beim besten Willen nichts Schlechtes über ihn finden. Er scheint einfach nur ein reicher Mann zu sein, der einen schlimmen Fehler begangen hat, den er wiedergutmachen will.«
»Wie kommt es, dass er eine Burg besitzt? Er war doch bankrott …«
»Gute Frage. Als er ins Gefängnis ging, verlor er sein gesamtes Vermögen. Aber er hatte mächtige Parteifreunde, die ihn nach Kräften unterstützten. Dank ihnen konnte er Kilmore Castle behalten. Zudem hat er noch eine Wohnung in London und ist Teilhaber eines Unternehmens in Kenia.«
Ein Auto tauchte plötzlich hinter ihnen auf und überholte sie. Edward bremste, um es vorbeizulassen. Der wirbelnde Schnee hatte es schon bald wieder verschluckt.
»Ich bin gespannt, was du von McCain hältst«, sagte Edward.
»Stammt die Einladung von ihm?«
»Ja. Bei unserem Interview erwähnte ich, dass ich Neujahr in Schottland verbringen wollte, und er schenkte mir vier Karten. Kein kleines Geschenk. Die kosten nämlich jeweils dreihundert Pfund.«
Alex pfiff durch die Zähne.
»Tja, aber alle Einnahmen fließen wohltätigen Zwecken zu. Der gesamte Erlös geht an First Aid. Heute Abend werden viele reiche Leute versammelt sein und es werden einige Zehntausend Pfund zusammenkommen.« Wieder entstand ein kurzes Schweigen. Die Straße führte steil bergauf und Edward schaltete in einen niedrigeren Gang. »Wir haben nie über Damian Cray gesprochen.«
Alex wand sich ein wenig. »Da gibt es nichts zu sagen.«
»Mein Buch über Cray hat sich eine Million Mal verkauft. Aber du wirst darin nicht mit einem Wort erwähnt.«
»Das ist mir auch lieber so.«
»Du hast Sabina das Leben gerettet.«
»Und sie mir meins.«
»Darf ich dir einen Rat geben, Alex?« Edward warf ihm einen kurzen Blick zu, dann konzentrierte er sich wieder auf die Straße. »Halte dich da raus, also aus dem Geheimdienst, dem MI6. Ich kann mir in etwa vorstellen, was im vergangenen Jahr passiert ist. Sabina hat mir einiges erzählt und ich habe Kontakte bei der CIA und höre so manches. Ich will nichts Genaueres wissen, aber glaub mir, es ist besser, die Finger davon zu lassen.«
»Keine Sorge, der MI6 interessiert sich nicht mehr für mich. Die haben mir nicht mal eine Karte zu Weihnachten geschickt. Dieser Teil meines Lebens ist abgeschlossen und ich bin froh darüber.«
Die Straße wurde steiler und auf einer Seite wichen die Bäume einer schwarzen Wasserfläche: Loch Arkaig. Auch in diesem See lebte angeblich ein Ungeheuer – ein riesiges Wasserpferd. Alex glaubte es gern. Loch Arkaig war ein Überrest urzeitlicher Gletscher, zwanzig Kilometer lang und teilweise hundert Meter tief. Wer hätte also sagen können, welche Geheimnisse es seit einer Million Jahren barg?
Kilmore Castle tauchte als vager Schatten hinter dem Schneegestöber auf. Die Burg stand auf einer felsigen Kuppe über dem See und beherrschte ihre Umgebung in jeder Hinsicht. Kilmore Castle war eine gewaltige, aus grauem Stein erbaute Festung mit Türmen und Zinnen, schmalen Fensterschlitzen und massiven, abweisenden Toren. Annehmlichkeiten hatten bei ihrer Erbauung keine Rolle gespielt. Ihr einziger Zweck bestand darin, ihre Bewohner an der Macht zu halten. Es war schwer vorstellbar, wie sie hatte erobert, ja überhaupt erst erbaut werden können. Sogar der Nissan X-Trail mit seinem 2,2-Liter-Vierzylinder-Turbodiesel hatte seine Mühe mit den engen Kurven, dem einzigen Zugang zur Burg. Waren die Soldaten früher mit Pferden hinaufgeritten? Und wie hatten sie die mächtigen Mauern überwunden?
Inzwischen fuhren sie in einer Schlange teurer Autos. Hinter den beschlagenen Scheiben waren die anderen Gäste nur undeutlich zu erkennen. Sie bogen um eine letzte Kurve und erreichten eine große, in einen Parkplatz umgewandelte Freifläche, auf der Parkwächter in reflektierenden Westen die Ankömmlinge heftig gestikulierend einwiesen. Rechts und links des Haupteingangs brannten Fackeln, die sich nur schwer gegen das Schneetreiben behaupten konnten. Männer und Frauen in dicken Mänteln und mit von Schals verhüllten Gesichtern hasteten über den Kies und verschwanden durch das Tor. Die Szenerie erinnerte an einen Albtraum. Von einem Fest war nichts zu spüren. Die Menschen hätten genauso gut auf der Flucht vor einer Naturkatastrophe sein können.
Edward Pleasure parkte den Wagen und Sabina schaltete ihren iPod ab.
»Wir brauchen nicht bis Mitternacht zu bleiben«, sagte ihr Vater. »Gebt mir einfach Bescheid, wenn ihr fahren wollt.«
»Ich wünschte, Mum wäre doch mitgekommen«, murmelte Sabina.
»Ich auch. Aber wie du weißt, möchte sie nicht, dass wir uns unnötig Sorgen um sie machen. Genießen wir den Abend.«
Sie stiegen aus. Im Auto war es warm gewesen und die eisige Kälte ging Alex sofort durch Mark und Bein. Schneeflocken tanzten vor seinen Augen und er spürte den Wind in den Haaren. Da er keinen Mantel anhatte, begann er zu laufen. Er schlang die Arme um den Oberkörper und zog den Kopf zwischen die Schultern, um den Elementen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Der Winter schien sich hier von seiner schlimmsten Seite zu zeigen. Die Fackeln am Eingang flackerten unruhig. Jemand rief etwas, doch die Worte gingen im Wind unter.
Dann waren sie am Tor angekommen. Sie traten hindurch und gelangten in einen Innenhof, der sie zumindest vor dem Wind schützte. Der Hof war von hohen Mauern umschlossen und hatte einen unebenen Boden. In den Ecken standen einige Kanonen und es gab ein großes Feuer. Um die Flammen drängte sich rund ein Dutzend Gäste und wärmte sich. Lachend schüttelten sie sich den Schnee von den Mänteln. Vor Alex öffnete sich ein zweites Tor, das von steinernen Adlern bewacht wurde. Darüber war eine gälische Inschrift zu lesen, deren Buchstaben im Licht der Fackeln rötlich funkelten.
CHA DÈANAR SGRIOS AIR NÀIMHDEANGUS AM BITHEAR FIOS AIR CÒ IAD
»Was heißt das?«, fragte Sabina.
Edward zuckte die Schultern, aber ein anderer Gast neben ihm hatte die Frage gehört. »Das ist das Motto des Kilmore-Clans«, erklärte er. »Die Burg war dreihundert Jahre lang sein Stammsitz.«
»Und wissen Sie, was es bedeutet?«
»Ja. Erst wenn man seine Feinde kennt, kann man sie besiegen.« Der Mann ging an ihnen vorbei und verschwand in der Burg.
Alex starrte die Inschrift an. Er hatte das Gefühl, dass die Worte ihm galten. Doch dann schob er den Gedanken beiseite. Ein neues Jahr stand bevor und mit ihm ein neuer Abschnitt seines Lebens. Ohne Feinde. Das hatte er für sich beschlossen.
»Komm, Alex.«
Sabina fasste ihn am Arm und zusammen traten sie ein.
Eine solche Party hatte Alex noch nie erlebt.
Obwohl der Festsaal von Kilmore Castle riesig war, herrschte Gedränge. Fünf- bis sechshundert Gäste waren geladen worden und eine derartige Einladung lehnte man nicht ab, auch wenn sie dreihundert Pfund kostete. Alex hatte auf Anhieb ein halbes Dutzend Prominente aus Film und Fernsehen, einige Politiker, zwei Starköche und einen Popstar ausgemacht. Die Männer trugen einen Smoking oder Kilt, die Frauen versuchten, einander mit meterweise Samt und Seide, tiefen Ausschnitten und funkelnden Juwelen zu übertreffen.
Eine Armee von traditionell schottisch gekleideten Kellnern schob sich mit Tabletts durch die Menge und servierte Champagner. Auf einer Galerie spielten drei Männer Dudelsack. Elektrisches Licht gab es nicht. In zwei gewaltigen Kronleuchtern flackerten über hundert Kerzen, an eisernen Wandhalterungen brannten Fackeln. Die rückwärtige Wand wurde von einem steinernen Kamin eingenommen, in dem ein gigantisches Feuer loderte. Die Flammen warfen rote Schatten über die Steinfliesen des Bodens.
Obwohl die Kilmores schon seit Jahrhunderten nicht mehr in der Burg wohnten, waren sie allgegenwärtig. An den Wänden hingen ihre lebensgroßen Porträts – grimmig dreinblickende Männer mit Schwertern und Schilden und stolze Frauen, die das schottische Karo und Hauben trugen. In den zahlreichen Nischen des Saals standen Rüstungen, über den Türen waren gekreuzte Schwerter angebracht. Die Köpfe der von den Kilmores erlegten Hirsche, Füchse und Wildschweine blickten mit glasigen Augen auf das Treiben herunter. Wände, Kamin und sogar die Fenster waren mit Wappen geschmückt.
Desmond McCain musste ein Vermögen für die Party ausgegeben haben. Die Gäste sollten für ihr Geld etwas geboten bekommen. Auf dem Büfetttisch, der sich quer durch den Saal zog, türmten sich Salate, Wild, Rindfleisch und ganze Lachse. Ein Spanferkel lag mit böse funkelnden Augen auf einem Silbertablett, einen Apfel im Maul. Zu trinken gab es unzählige Weine und Spirituosen, mit Punsch gefüllte Schüsseln und nicht weniger als fünfzig Sorten Malt Whisky in unterschiedlich geformten Flaschen.
Durch eine Tür gelangte man auf die Tanzfläche, durch eine andere in das Billardzimmer, in dem bereits ein Turnier im Gang war. In einem weiteren Raum parkte ein neues Mini-Cooper-Cabrio, der erste Preis einer Tombola. Zudem konnte man einen Kawasaki-Ultra-310LX-Jetski und eine zweiwöchige Kreuzfahrt in der Karibik gewinnen. Alle Preise waren von reichen Sponsoren von First Aid gestiftet worden.
Draußen schneite es immer noch und der eisige Wind schnitt wie ein Skalpell durch die Nacht. Drinnen war nichts davon zu spüren. Die Gäste waren festlich gestimmt und plauderten angeregt miteinander. Mitternacht rückte näher.
Alex und Sabina fühlten sich fehl am Platz. Nur wenige Jugendliche waren eingeladen worden und von ihnen kamen die meisten aus der näheren Umgebung, waren mindestens einen Meter achtzig groß und interessierten sich nicht für sie. Die beiden aßen und tranken etwas und begaben sich dann zur Tanzfläche, aber selbst dort konnten sie ihre Befangenheit nicht ablegen. Um sie drehten und wiegten sich Erwachsene im Rhythmus einer Musik, die älter war als Alex.
»Mir reicht’s«, verkündete Sabina, als die Band einen Klassiker von ABBA anstimmte.
Alex konnte sie gut verstehen. Drei glatzköpfige Männer in Kilts hüpften über die Tanzfläche und stachen zur Melodie von Money, Money, Money mit den Fingern in die Luft. Er sah auf die Uhr. Erst zehn nach elf.
»Ich glaube, wir können noch nicht gehen«, sagte er.
»Weißt du, wo Dad ist?«
»Er hat sich vorhin mit einem Politiker unterhalten.«
»Wahrscheinlich, um an eine Story zu kommen. Er kann es nicht lassen.«
»Kopf hoch, Sabina. Dieses Gemäuer ist viele Hundert Jahre alt. Sehen wir uns doch ein wenig um.«
Sie drängten sich zum Rand der Tanzfläche und folgten einem Flur. Hinter einer Kurve verstummten Musik und Stimmenlärm abrupt. Ein zweiter Gang zweigte vom ersten ab. An seinen Wänden hingen Wandteppiche und Spiegel mit vergoldeten Rahmen und vom Alter geschwärzten Scheiben.
Sie erreichten eine Treppe und stiegen zu einem der Türme hinauf. Unvermutet traten sie ins Freie. Zwischen steinernen Zinnen blickten sie in die schwarze, vom Schnee weiß gefleckte Nacht hinaus.
»Endlich frische Luft«, sagte Sabina. »Ich bin fast erstickt.«
»Ist dir nicht kalt?«, fragte Alex. Der Schnee fiel lautlos auf ihren Nacken und die bloßen Schultern.
»Für eine Minute geht’s.«
»Hier.« Alex zog sein Jackett aus und gab es ihr.
»Danke.« Sabina schlüpfte hinein. Sie schwiegen eine Weile.
»Ich wünschte, ich müsste nicht nach Amerika zurück«, sagte sie schließlich.
Ihre Worte rissen Alex aus seinen Gedanken. Er hatte ganz vergessen, dass Sabina in wenigen Tagen abreisen würde. Sabinas Schule war in San Francisco, wo ihre Familie wohnte, und sie würden sich eine Zeit lang nicht sehen. Schade, dass sie ging. Er würde sie sehr vermissen.
»Vielleicht besuche ich dich in den Osterferien«, sagte er.
»Warst du schon mal in San Francisco?«
»Einmal. Mein Onkel hat mich auf eine Geschäftsreise mitgenommen. Zumindest hat er das behauptet. Wahrscheinlich arbeitete er damals für die CIA und spionierte jemanden aus.«
»Denkst du manchmal an Damian Cray?«
»Nein.« Alex schüttelte den Kopf. Die Frage war unvermutet gekommen. Er streifte Sabina mit einem Blick und bemerkte zu seiner Überraschung, dass sie ihn wütend ansah.
»Aber ich. Die ganze Zeit. Es war alles so schrecklich. Cray war verrückt. Und wie er starb! Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.«
Das leuchtete ein. Sabina hatte Crays aufsehenerregendes Ende miterlebt und trug daran immerhin eine Teilschuld.


![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
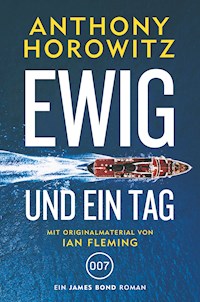

![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Snakehead [Band 7] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18daaba796e373f6fd5944e2f667ed7b/w200_u90.jpg)









