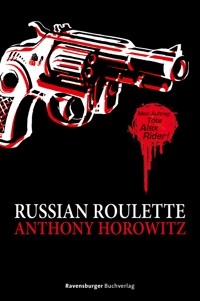
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Alex Rider
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller ALEX RIDER - die Vorlage zur actiongeladenen TV-Serie! Yassen Gregorovich ist vierzehn Jahre alt, als ein Bombenhagel alles vernichtet: sein Dorf, seine Eltern und seine Träume. Und das nur, weil russische Geschäftsmänner ein Chemieunglück vertuschen wollen. Yassen flieht nach Moskau, doch auch dort ist er nicht sicher. Denn die mächtigen Männer versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass Yassen ihr finsteres Geheimnis ans Licht bringt … Die Vorgeschichte zur actionreichen Agenten-Reihe von Bestseller-Autor Anthony Horowitz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2014Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH© 2014 der deutschsprachigen AusgabeRavensburger Verlag GmbH Die englische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel RussianRoulette by Walker Books Ltd., 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ.Copyright © 2013 by Stormbreaker Productions Coverillustration: Stefani KampmannÜbersetzung: Wolfram StröleRedaktion: Beate SpindlerAlle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN978-3-473-47534-6www.ravensburger.dewww.alex-rider.de
FürJ,N&C –abernichtL.DerKreisschließtsich.
PrologVordemMord
Er hatte das Hotelzimmer sorgfältig ausgewählt.
Als er durch das Foyer zu den Aufzügen ging, nahm er sämtliche Personen in seiner Umgebung wahr. Die beiden Empfangsdamen, eine davon am Telefon, den japanischen Gast, der gerade eincheckte und seinem Akzent nach zu schließen aus Miyazaki im Süden stammte, den Portier, der für zwei Touristen einen Stadtplan ausdruckte, und den Sicherheitsbeamten an der Tür, einen gelangweilten Osteuropäer. Er sah alles. Wenn das Licht plötzlich ausgegangen wäre oder er die Augen zugemacht hätte, hätte er seinen Weg fortsetzen können, ohne langsamer zu werden.
Umgekehrt bemerkte ihn niemand. Auch das war eine Fähigkeit, die er sich erworben hatte, die Kunst, nicht gesehen zu werden. Die Kleider, die er trug – teure Jeans, grauer Kaschmirpullover und weiter Mantel –, hatte er gewählt, weil sie nichts über ihn aussagten. Es handelte sich zwar um bekannte Marken, aber er hatte die Etiketten herausgeschnitten. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Polizei ihn festnahm, hätte sie nur mit größten Schwierigkeiten nachverfolgen können, wo er sie gekauft hatte.
Er war achtundzwanzig Jahre alt und hatte blonde, kurz geschnittene Haare. Seine kalten, eisgrauen Augen zeigten nur eine winzige Spur von Blau. Obwohl weder groß noch athletisch gebaut, wirkte er geschmeidig. Er bewegte sich wie ein Sportler – wie ein Läufer auf dem Weg an den Start. Zugleich ging etwas Bedrohliches von ihm aus. Er vermittelte einem das Gefühl, dass man ihm besser nicht zu nahe kam.
In seiner Geldbörse steckten drei Kreditkarten und ein in Swansea ausgestellter Führerschein. Alle liefen auf den Namen Matthew Reddy. Eine Überprüfung durch die Polizei hätte ergeben, dass er als Personal Trainer in einem Londoner Fitnessstudio arbeitete und in Brixton wohnte. Nichts davon stimmte. In Wirklichkeit hieß er Yassen Gregorovich und tötete für Geld.
Das Hotel lag in der Nähe von King’s Cross, wo sich keiner länger aufhielt als nötig, denn hier gab es nur wenige gute Restaurants und keine angesagten Läden.
Es hieß Traveller, gehörte zu einer Kette und war komfortabel eingerichtet, aber trotzdem nicht zu teuer. Solche Hotels hatten keine Stammgäste. Die meisten Gäste waren Geschäftsleute auf der Durchreise und die Rechnungen wurden von ihren Firmen beglichen. Sie saßen abends an der Bar und morgens im hell erleuchteten Beefeater Restaurant, um zu frühstücken. In der Regel hatten sie keine Zeit für längere Gespräche und kamen niemals wieder.
Yassen war das nur recht. Er hätte auch im Zentrum absteigen können, im Ritz oder im Dorchester, aber dort war das Empfangspersonal darin geschult, sich die Gesichter der Gäste zu merken. Eine Art von Aufmerksamkeit, die er zu meiden versuchte.
Eine Überwachungskamera filmte ihn, als er sich den Aufzügen näherte. Er nahm ihr Blinken über seiner linken Schulter aus den Augenwinkeln wahr. Das war ärgerlich, aber unvermeidlich.
Yassen hielt den Kopf gesenkt. Erst wenn man in eine Kamera blickt, fällt man auf. Vor den Aufzügen blieb er nicht stehen, sondern schlüpfte durch die Feuertür, die zur Treppe führte.
Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, sich mit fremden Menschen in einen engen Metallkasten zu zwängen, dessen Tür er nicht öffnen konnte. So etwas zu tun, erschien ihm vollkommen absurd. Notfalls wäre er auch in den fünfzehnten Stock hinaufgestiegen – und oben nicht einmal außer Atem gewesen. Denn seine Kondition war exzellent. Er verbrachte täglich zwei Stunden im Fitnessstudio, und wenn ihm dieser Luxus nicht zur Verfügung stand, trainierte er für sich.
Doch diesmal lag sein Zimmer im zweiten Stock. Er hatte das Hotel im Internet gründlich überprüft, bevor er die Reservierung machte, und nur vier Zimmer hatten seinen Anforderungen entsprochen. Dazu gehörte das Zimmer Nummer 217. Es lag so hoch, dass man von der Straße aus nicht einsteigen konnte, aber auch so tief, dass er notfalls aus dem Fenster springen konnte – sobald er das Glas aus dem Rahmen geschossen hatte. Und obwohl es benachbarte Gebäude gab, war sein Zimmer von außen nicht einsehbar. Wenn Yassen schlafen ging, ließ er die Vorhänge stets offen. Er sah gern nach draußen und behielt die Straße im Blick. Jede Stadt hat einen natürlichen Rhythmus und alles, was diesen Rhythmus störte – ein an einer Ecke stehender Mann oder ein zum zweiten Mal vorbeifahrendes Auto –, konnte ein Hinweis darauf sein, dass er schleunigst verschwinden musste. Außerdem schlief er sowieso nie länger als vier Stunden, auch wenn das Bett noch so bequem war.
Er bog um die Ecke und näherte sich der Zimmertür mit dem BITTE-NICHT-STÖREN-Schild. Hatten sich alle daran gehalten?
Er schob die Hand in die Hosentasche und holte ein kleines silberfarbenes Instrument heraus, das von seiner Größe und Form her an einen Füller erinnerte. Dann drückte er auf das vordere Ende und sprühte Diazafluoren auf den Türgriff – eine einfache chemische Substanz. Anschließend drehte er den Füller um, drückte auf das hintere Ende und schaltete eine Leuchtstofflampe ein.
Auf dem Türgriff waren keine Fingerabdrücke. Wenn jemand das Zimmer in seiner Abwesenheit betreten hatte, hatte er den Griff abgewischt.
Yassen steckte den Füller wieder ein, kniete sich hin und überprüfte den unteren Türspalt. Vor dem Weggehen hatte er ein Haar quer darübergelegt, eine uralte und dennoch zweckmäßige Methode. Das Haar lag immer noch an seinem Platz.
Yassen richtete sich auf und betrat das Zimmer mithilfe seiner elektronischen Schlüsselkarte.
Er brauchte keine Minute, um festzustellen, dass alles unverändert war. Die Aktentasche lag noch 4,6 Zentimeter vom Schreibtischrand entfernt, der Koffer stand in einem 95-Grad-Winkel zur Wand. Auf keinem der beiden Schlösser fanden sich Fingerabdrücke.
Er nahm das digitale Aufnahmegerät ab, das er mit einem Magnet am Kühlschrank befestigt hatte, und warf einen Blick auf die Anzeige. Das Gerät hatte nichts aufgenommen. Es war niemand hier gewesen.
Die meisten Menschen hätten die vielen Vorsichtsmaßnahmen lästig und zeitraubend gefunden, aber für Yassen waren sie so alltäglich wie das Zähneputzen.
Um zwölf nach sechs setzte er sich an den Schreibtisch und klappte seinen Laptop auf, ein ganz gewöhnliches Apple MacBook. Sein Passwort hatte sechzehn Stellen und er änderte es jeden Monat.
Er zog die Uhr aus und legte sie neben sich auf die Tischplatte. Dann öffnete er eBay, klickte mit der linken Maustaste auf »Sammeln« und scrollte durch die Münzen. Er fand bald, wonach er suchte: eine Goldmünze mit dem Kopf des Kaisers Caligula aus dem Jahre elf nach Christus. Für die Münze gab es noch keine Gebote. Kein Wunder, denn jeder Sammler wusste, dass sie gar nicht existierte. Im Jahre elf war der verrückte römische Kaiser noch nicht einmal geboren gewesen.
Die komplette Website war gefälscht und das sah man ihr auch an. Der Name des Münzenhändlers – Mintomatic – war bewusst so gewählt, dass er Gelegenheitskäufer abschreckte. Mintomatic arbeitete angeblich in Schanghai und seine Händlerbewertung war nicht sonderlich gut. Alle Münzen seines Angebots waren entweder gefälscht oder wertlos.
Yassen wartete bis Viertel nach sechs. Exakt in dem Moment, in dem der Sekundenzeiger seiner Uhr auf die Zwölf vorrückte, drückte er auf »Bieten«. Anschließend tippte er einen Benutzernamen, sein Passwort und ein Gebot in Höhe von 2518,15 Pfund ein. Die Zahlen setzten sich aus dem aktuellen Datum und der genauen Uhrzeit zusammen.
Als er auf Enter drückte, öffnete sich ein Fenster, das mit eBay und römischen Münzen nichts zu tun hatte. Niemand sonst konnte das Fenster mit der Nachricht sehen und niemand hätte es zu seinem Urheber zurückverfolgen können. Bevor die Nachricht Yassen erreichte, war sie durch ein Dutzend Länder geschickt und dabei anonymisiert worden. Diese Methode hieß Onion-Routing, weil die Nachricht wie eine Zwiebel in verschiedene Schichten unterteilt wurde. Zusätzlich wurde sie durch einen verschlüsselten Tunnel geschickt, ein Verfahren, das sicherstellte, dass nur Yassen sie lesen konnte. Wäre jemand durch Zufall im selben Fenster gelandet, hätte er bloß irgendein Kauderwelsch gesehen. Außerdem wäre innerhalb von drei Sekunden ein Virus in seinen Computer eingedrungen und hätte den gesamten Inhalt gelöscht.
Yassens Apple-Computer dagegen war autorisiert, die Nachricht zu empfangen. Die Botschaft bestand aus drei Worten:
TÖTE ALEX RIDER
Genau damit hatte er gerechnet. Er hatte schon immer gewusst, dass seine Auftraggeber den Agenten bestrafen wollten, der die millionenschwere Operation Stormbreaker zum Scheitern gebracht hatte. Yassen hatte sich sogar gefragt, ob man womöglich auch ihn in den Ruhestand versetzen wollte, in den ewigen Ruhestand. Das wäre nur eine logische Konsequenz gewesen. Wer einen Fehler machte, wurde eliminiert.
Yassen hatte Glück gehabt, weil er nur anderen zugearbeitet und nicht die Verantwortung getragen hatte. Insofern konnte man ihm auch keine Schuld geben. Aber an Alex Rider mussten sie ein Exempel statuieren. Dass der Junge erst vierzehn war, fiel nicht ins Gewicht. Morgen musste er sterben.
Yassen starrte noch eine Weile auf den Bildschirm, dann fuhr er den Laptop herunter.
Er hatte noch nie ein Kind getötet, empfand jedoch auch keine Skrupel. Alex Rider hatte freiwillig mitgemacht. Er hätte besser zur Schule gehen sollen, statt sich vom MI6 anwerben zu lassen. Vom Schüler zum Spion, wirklich eine ungewöhnliche Karriere – und dabei erwies sich der Junge auch noch als bemerkenswert erfolgreich. Man hätte es für Anfängerglück halten können, aber das war es nicht. Alex Rider hatte eine Operation sabotiert, die jahrelang von Meisterhand geplant worden war. Zudem war er für den Tod zweier Mitarbeiter der Operation verantwortlich und hatte einige äußerst mächtige Leute verärgert. Der Junge hatte es verdient zu sterben.
Und doch …
Yassen blieb vor dem Computer sitzen. In seinem Gesicht ging keine Veränderung vor, abgesehen von einem leichten Flackern seiner Augen. Draußen sank die Sonne und der Abendhimmel färbte sich bleigrau. Nach Hause eilende Pendler verstopften die Straßen. Sie befanden sich nicht nur auf der anderen Seite des Hotelfensters, sondern in einer ganz anderen Welt. Yassen wusste, dass er niemals zu ihnen gehören würde.
Für einen Moment schloss er die Augen und dachte an das, was passiert war. An Stormbreaker. Warum war die Operation nur so katastrophal gescheitert?
Aus Yassens Sicht war es ein Routineauftrag gewesen. Ein libanesischer Geschäftsmann namens Herod Sayle hatte zweihundert Liter des tödlichen Pockenvirus R5 kaufen wollen und sich an die einzige Organisation gewandt, die das Virus in dieser großen Menge beschaffen konnte: Scorpia.
Die Buchstaben des Namens standen für Sabotage, Korruption, Informationsbeschaffung und Attentate, die Hauptbetätigungsfelder der Organisation. R5 war ein chinesisches Produkt, illegal hergestellt in einer Fabrik in der Nähe von Guiyang. Und zufällig war ein Vorstandsmitglied von Scorpia Chinese.
Dr. Three hatte seine umfassenden Kontakte nach Ostasien genutzt, um den Kauf in die Wege zu leiten. Yassen sollte den Transport nach Großbritannien organisieren.
Vor sechs Wochen war er nach Hongkong geflogen. Einige Tage später war die Ware in einem Privatflugzeug, einer Turboprop Xian MA60, aus Guiyang in Hongkong eingetroffen. Dort sollte sie auf ein Containerschiff nach Rotterdam gebracht werden, getarnt als Teil einer Bierladung der chinesischen Marke Drachenglück.
In einem Lagerhaus in Kowloon hatte man Spezialfässer mit Behältern aus verstärktem Glas für die virenhaltige Flüssigkeit gebaut. Auf den Meeren sind ständig einige Tausend Containerschiffe unterwegs und jährlich werden weltweit um die siebzehn Millionen Ladungen transportiert. Keine Zollbehörde der Welt kann das alles kontrollieren.
Yassen rechnete deshalb auch nicht mit Problemen. Er hatte einen falschen Pass und Papiere erhalten, laut denen er Erik Olsen war, ein Kaufmann aus Kopenhagen, und er sollte die R5-Viren zu ihrem Bestimmungsort begleiten.
Aber wie so oft hatte es Komplikationen gegeben. Einige Tage bevor die Fässer verschifft werden sollten, hatte Yassen bemerkt, dass das Lagerhaus observiert wurde. Er hatte Glück gehabt. Eine Zigarette, die hinter dem Fenster eines eigentlich leer stehenden Gebäudes angezündet wurde, hatte es ihm verraten.
Im Schutz der Dunkelheit war er durch Kowloon gehuscht und hatte ein Team von drei Agenten des AIVD ausgemacht – des niederländischen Geheimdiensts Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Die Agenten mussten von irgendwoher einen Tipp bekommen haben. Sie wussten nicht, nach was sie suchten, nur dass eine verdächtige Ladung ihr Land ansteuerte.
Yassen hatte alle drei mit einer schallgedämpften Beretta 92 töten müssen, einer Pistole, die er aufgrund ihrer Genauigkeit besonders schätzte. Das Virus konnte jetzt natürlich nicht mehr in einem Containerschiff transportiert werden. Eine Alternative musste her.
Zufällig lag um diese Zeit ein chinesisches Atom-U-Boot der Han-Klasse für Wartungsarbeiten in Hongkong und es sollte demnächst zu einer Übung im Nordatlantik aufbrechen.
Yassen lernte den Kapitän in einem privaten Club mit Blick auf den Hafen kennen und bot ihm zwei Millionen amerikanische Dollar Bestechungsgeld an, wenn er das R5 beim Auslaufen mitnähme. Scorpia hatte er vorab informiert. Dort wusste man, dass der Gewinn entsprechend niedriger ausfallen würde, und doch hatte das neue Arrangement auch seine Vorteile. Der Transport des R5 von Rotterdam nach Großbritannien wäre schwierig und gefährlich gewesen. Da Herod Sayles Firma in Cornwall saß und einen direkten Zugang zur Küste hatte, konnte man die Ware per U-Boot gleich direkt bei ihm abliefern.
Zwei Wochen später, in einer klaren, wolkenlosen Aprilnacht, tauchte das U-Boot vor der Küste Cornwalls auf.
Yassen war mitgereist, immer noch unter dem Namen Erik Olsen. Er hatte es genossen, in einer stählernen Röhre lautlos durch die Tiefen des Meeres zu gleiten. Der chinesischen Besatzung war strengstens untersagt worden, mit ihm zu sprechen, was ihm nur recht war.
Erst als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, übernahm er das Kommando und beaufsichtigte das Ausladen des Virus und anderer von Herod Sayle bestellter Güter.
Das Ganze musste sehr schnell vonstattengehen, weil der Kapitän des U-Boots nicht bereit war, länger als eine halbe Stunde zu warten. Auch wenn er inzwischen zwei Millionen Dollar auf einem Schweizer Bankkonto liegen hatte, wollte er auf keinen Fall einen internationalen Zwischenfall provozieren. Mit dem Risiko, dass man ihn schnappte, vor ein Militärgericht stellte und nach der Verurteilung hinrichtete.
Dreißig Wachen schleppten die Kisten über den Strand zu den wartenden Lkw, deren Scheinwerfer einen perfekt geformten Halbmond bildeten und ihnen den Weg wiesen.
Das zur Hälfte aus dem schwarzen Meer aufgetauchte U-Boot wirkte merkwürdig fehl am Platz, wie ein Ungetüm aus grauer Vorzeit.
Yassen hatte von Anfang an gespürt, dass etwas nicht stimmte. Er wurde beobachtet, dessen war er sich sicher. Andere mochten von einem animalischen Instinkt sprechen, für Yassen war es viel einfacher. Er war seit neun Jahren im Einsatz und in dieser Zeit ständig in Gefahr gewesen. Überlebt hatte er nur, weil seine Sinne auf die leisesten Veränderungen reagierten. Obwohl er weder etwas gesehen noch etwas gehört hatte, warnte ihn eine innere Stimme, dass sich hinter einem Felsen am Rand des Strands, in etwa zwanzig Metern Entfernung, jemand versteckte.
Er hatte gerade nachsehen wollen, da ließ einer von Sayles Männern, der auf dem hölzernen Anlegesteg stand, eine Kiste fallen. Das Scheppern des auf das Holz treffenden Metalls zerriss die Stille.
Yassen wirbelte herum und schlagartig war alles andere vergessen. Da im U-Boot nur beschränkt Platz gewesen war, hatte man das R5 aus den Bierfässern in die weniger sicheren Aluminiumkisten umladen müssen. Wenn das Glasfläschchen in der Kiste zerbrochen war und die Gummidichtung der Kiste leckte, würden alle am Strand versammelten Männer noch vor Sonnenaufgang tot sein. Das wusste Yassen mit absoluter Gewissheit.
Er stürzte zum Steg und beugte sich über die Kiste, um den Schaden zu begutachten. Seitlich hatte die Kiste eine kleine Delle, doch die Dichtung war unbeschädigt.
Der Wächter sah ihn mit einem schwachen Lächeln an. Er war deutlich älter als Yassen, vermutlich ein ehemaliger Gefängnishäftling. Und er hatte Angst, versuchte allerdings, den Vorfall herunterzuspielen.
»Das wird mir nicht noch mal passieren«, sagte er.
»Nein«, antwortete Yassen, »das wird dir nicht noch mal passieren.« Die Beretta hielt er schon in der Hand. Er schoss dem Mann in die Brust und stieß ihn ins Wasser. Es war notwendig gewesen, ein Exempel zu statuieren, damit kein weiteres Missgeschick die Mission gefährdete.
Yassen erinnerte sich noch genau an jene Nacht, als er jetzt im Hotel vor seinem Computer saß. Er war inzwischen fest davon überzeugt, dass sich Alex Rider hinter dem Felsen versteckt hatte. Wenn der Unfall nicht passiert wäre, hätte er ihn schon damals erwischt.
Alex war als angeblicher Gewinner eines Zeitschriftenwettbewerbs bei Sayle Enterprises eingeschleust worden. Dann hatte er sich irgendwie an Wachen und Scheinwerfern vorbei aus seinem Zimmer geschlichen und war mit dem Lastwagenkonvoi zum Strand gefahren. Eine andere Erklärung konnte es nicht geben.
Später war er Herod Sayle nach London gefolgt. Er war trotz mangelnder Ausbildung und fehlender Erfahrung bereits für den Tod zweier Mitarbeiter von Sayle verantwortlich: für den von Nadia Voles sowie den des entstellten Dieners Mr Grin. Es war seine erste Mission gewesen. Trotzdem hatte er praktisch im Alleingang die Operation Stormbreaker torpediert. Sayle hatte Glück gehabt und noch kurz vor Eintreffen der Polizei verschwinden können.
TÖTE ALEX RIDER
Der Junge hatte es verdient. Er hatte sich in einen Einsatz von Scorpia eingemischt und die Organisation mindestens fünf Millionen Pfund gekostet – die letzte Rate, die Herod Sayle ihr schuldig geblieben war. Schlimmer noch, er hatte ihren internationalen Ruf geschädigt. Dafür musste er nun büßen.
Es klopfte an der Tür. Yassen ließ sich das Essen aufs Zimmer bringen. Im Hotel zu essen war nicht nur einfacher, sondern auch sicherer. Warum sich unnötig fremden Blicken aussetzen?
»Stellen Sie es draußen hin!«, rief er in perfektem Englisch. Genauso gut und akzentfrei sprach er Französisch, Deutsch und Arabisch.
Im Zimmer war es nahezu dunkel. Sein Abendessen stand auf einem Tablett draußen im Gang und wurde rasch kalt. Trotzdem blieb er bewegungslos vor dem Computer sitzen.
Morgen Vormittag würde er Alex Rider töten. Den Befehl zu missachten, kam nicht infrage. Dass zwischen ihnen eine besondere Verbindung bestand, von der Alex nichts wissen konnte, spielte dabei keine Rolle. Diese Verbindung hieß John Rider. Und John war Alex’ Vater.
Ihre damaligen Decknamen: John war »Hunter« gewesen und Yassen »Cossack« – Jäger und Kosak.
Yassen konnte nicht anders, er griff in seine Hosentasche und holte einen Autoschlüssel heraus, einen mit zwei Fernbedienungstasten zum Öffnen und Schließen der Türen. Nur dass dieser Schlüssel nicht zu einem Auto gehörte.
Yassen drückte zweimal auf ÖFFNEN und anschließend dreimal auf SCHLIESSEN. Ein versteckter Memorystick sprang heraus und fiel ihm in die Hand.
Er warf einen kurzen Blick darauf. Er wusste, dass es verrückt war, den Stick bei sich zu tragen. Wie oft schon war er versucht gewesen, ihn zu vernichten? Aber jeder Mensch hat eine Schwachstelle und das war seine. Er fuhr den Laptop wieder hoch und schob den Stick ins USB-Fach.
Auch für diese Datei brauchte er ein Passwort. Er tippte es ein und auf dem Bildschirm erschien ein Text. Nicht in englischen, sondern in kyrillischen Buchstaben, den Buchstaben des russischen Alphabets.
Sein privates Tagebuch. Die Geschichte seines Lebens.
Er lehnte sich zurück und begann zu lesen.
ДOMAZuHause
»Yasha! Wir haben kein Wasser mehr. Geh zum Brunnen!«
Die Stimme meiner Mutter klingt mir heute noch in den Ohren. Es ist seltsam, mich in den vierzehnjährigen Jungen von damals zurückzuversetzen, das Einzelkind, aufgewachsen in einem Dorf, das tausend Kilometer von Moskau entfernt lag.
Da stehe ich, spindeldürr, mit langen blonden Haaren und blauen Augen, die immer ein wenig erschrocken dreinblicken. Alle sagen, ich sei klein für mein Alter, und drängen mich, mehr Eiweiß zu essen. Als ob es hier so etwas wie frisches Fleisch oder Fisch gäbe.
Ich habe noch nicht Hunderte von Stunden trainiert und meine Muskeln gestählt. Stattdessen mache ich es mir im Wohnzimmer bequem und sehe fern.
Es gibt nur einen Fernseher im Haus, einen großen, hässlichen Kasten mit wenigen Programmen. Das Bild flimmert oft, aber noch schlimmer sind die häufigen Stromausfälle. Jedes Mal wenn ein Film oder eine Informationssendung interessant wird, beginnt das Bild zu flackern. Dann wird die Mattscheibe schwarz und man sitzt im Dunkeln.
Trotzdem sehe ich mir bei jeder Gelegenheit Dokumentarfilme an. Ich verschlinge sie förmlich. Sie sind mein einziges Fenster zur Außenwelt.
Ich schreibe über das Russland um 1990. Über ein Russland, das es nicht mehr gibt. Der Wandel, der in den großen Städten begann, wurde zu einem Tsunami, der das gesamte Land verschlang, obwohl es natürlich einige Zeit dauerte, bis er das Dorf erreichte, in dem ich lebte.
Bei uns hatte kein Haus fließendes Wasser, deshalb musste ich dreimal am Tag mit einem hölzernen Joch über den Schultern und zwei Metalleimern, die mir fast die Arme ausrenkten, zum Brunnen gehen. Ich klinge wie ein Bauer und muss in meinem ausgeleierten, kragenlosen Hemd und der Weste auch wie einer ausgesehen haben.
Dabei hatte ich sogar eine amerikanische Jeans, ein Geschenk von einem Verwandten in Moskau. Ich weiß noch, wie alle mich angestarrt haben, als ich sie angezogen habe. Jeans! Das war wie etwas von einem anderen Planeten. Und ich hieß Yasha, nicht Yassen. Zu der Namensänderung kam es durch einen Zufall.
Wenn ich erklären will, wie ich zu dem Menschen wurde, der ich heute bin, muss ich hier anfangen, in Estrov. Den Namen kennt heute niemand mehr, er ist auf keiner Karte verzeichnet. Den russischen Behörden zufolge hat es das Dorf nie gegeben, aber ich erinnere mich noch gut daran.
Ein Dorf mit achtzig Holzhäusern, umgeben von Feldern. Wir hatten eine Kirche, einen Laden, eine Polizeiwache, ein Badehaus und einen Fluss, der im Sommer blau leuchtete, aber das ganze Jahr über eiskalt war.
Mitten durch das Dorf führte die einzige Straße, die allerdings nur selten gebraucht wurde, da es kaum Autos gab.
Unser Nachbar Vladimov besaß einen Traktor, der oft an unserem Haus vorbeiratterte und öligen schwarzen Rauch in die Luft pustete, aber meist wurde ich von dem Hufgetrappel der Pferde geweckt.
Das Dorf lag eingezwängt zwischen einem undurchdringlichen Wald im Norden und Bergen im Süden und Westen. Der Blick aus dem Fenster war mehr oder weniger immer derselbe. Manchmal flogen Flugzeuge über uns hinweg und dann stellte ich mir die Menschen vor, die darin saßen und auf die andere Seite der Welt reisten.
Wenn ich im Garten arbeitete, richtete ich mich auf und sah ihnen und ihren im Sonnenlicht aufblitzenden Metallflügeln nach, bis sie verschwanden und nur noch das Echo ihrer Triebwerke in der Luft hing. Sie erinnerten mich daran, wer ich war. Meine Welt war Estrov und in dieser Welt brauchte man gewiss kein Flugzeug.
Das Haus, in dem ich mit meinen Eltern wohnte, war klein und einfach. Die Holzbretter waren farbig angestrichen, vor den Fenstern hingen Fensterläden und auf dem Dach stand eine Wetterfahne, die bei viel Wind die ganze Nacht quietschte.
Es lag in der Nähe der Kirche, mit etwas Abstand zur Hauptstraße und ähnlichen Häusern auf beiden Seiten. An den Wänden wuchsen Blumen und Brombeerbüsche rankten gen Himmel.
Es gab nur vier Zimmer. Meine Eltern schliefen im Obergeschoss. Mein Zimmer ging nach hinten hinaus, aber ich musste es teilen, wenn jemand bei uns übernachtete.
Meine Großmutter, die bei uns wohnte, hatte das Zimmer neben meinem, schlief aber lieber in einer Wandnische über dem Küchenherd. Sie war sehr klein und hatte eine dunkle Haut. Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, dass sie von den Flammen geröstet wurde.
Einen Bahnhof gab es in Estrov nicht. Dafür war das Dorf nicht wichtig genug. Es gab auch keinen Bus oder andere Transportmöglichkeiten.
Meine Schule lag im nächstgrößeren Dorf, das sich Stadt nannte und drei Kilometer weit weg war. Im Sommer war der Weg staubig und mit Schlaglöchern übersät, im Winter matschig oder mit Schnee bedeckt.
Das Städtchen hieß Rosna. Den Schulweg ging ich täglich und bei jedem Wetter. Wenn ich zu spät kam, wurde ich geschlagen.
Die Schule war in einem großen Backsteingebäude mit drei Stockwerken untergebracht. Die Klassenzimmer hatten alle dieselbe Größe und es gab ungefähr fünfhundert Schülerinnen und Schüler. Ein Teil davon kam mit dem Zug. Bei ihrer Ankunft auf dem Bahnsteig waren ihre Augen vor Müdigkeit noch halb geschlossen.
Rosna hatte einen Bahnhof, auf den man sehr stolz war und den man an Feiertagen mit Blumen schmückte. Dabei handelte es sich nur um eine mickrige, heruntergekommene Haltestelle, an der neun von zehn Zügen vorbeirauschten.
Wir Schüler waren immer fein herausgeputzt. Die Mädchen trugen schwarze Kleider mit grünen Schürzen und hatten die Haare mit Bändern nach hinten gebunden. Die Jungen sahen in ihren grauen Uniformen mit den roten Halstüchern aus wie kleine Soldaten.
Für die guten Schüler gab es Fleißabzeichen. Was ich damals lernte, habe ich größtenteils wieder vergessen. Das geht sicher vielen ähnlich. Wichtig war die Geschichte, die russische Geschichte natürlich. Und wir lernten ständig Gedichte auswendig und mussten sie an unseren Pulten stehend aufsagen. Außerdem wurden wir in Mathematik und Naturwissenschaften unterrichtet. Die meisten Lehrer waren Frauen, unser Direktor aber war ein Mann namens Lavrov mit einem aufbrausenden Temperament. Er war klein, hatte aber breite Schultern und lange Arme. Ich sah oft, wie er einen Jungen am Kragen packte und gegen die Wand drückte.
Dann brüllte er so etwas wie: »Du bist ein miserabler Schüler, Leo Tretyakov! Reiß dich zusammen oder lass dich hier nicht mehr blicken!«
Sogar die Lehrer fürchteten ihn. Dabei war er im Grunde ein herzensguter Mensch. In Russland werden wir dazu erzogen, unsere Lehrer zu achten, und ich hielt seine cholerischen Anfälle für etwas völlig Normales.
Ich ging sehr gerne zur Schule und war ein guter Schüler. Leistung wurde mit Sternen honoriert – die Lehrer benoteten uns alle zwei Wochen – und ich war immer ein Fünf-Sterne-Schüler, ein pyatiorka.
Am besten war ich in Physik und Mathematik, beides Fächer, die bei den Obrigkeiten des Landes viel zählten. Wir wurden ständig daran erinnert, dass Russland den ersten Menschen – Yuri Gagarin – ins Weltall geschickt hatte. Am Haupteingang hing sogar ein Foto von ihm, das man beim Betreten der Schule grüßen sollte.
Ich war auch in Sport gut und weiß noch, wie die Mädchen aus meiner Klasse mir zuschauten und klatschten, wenn ich ein Tor schoss. Damals interessierte ich mich noch nicht besonders für Mädchen. Ich plauderte zwar gerne mit ihnen, war aber nicht unbedingt scharf darauf, auch meine Freizeit mit ihnen zu verbringen. Mein bester Freund war der eben erwähnte Leo. Wir waren unzertrennlich.
Leo Tretyakov war klein und mager. Er hatte abstehende Ohren, Sommersprossen und rötlich blonde Haare. Leo sagte oft zum Spaß, er sei der hässlichste Junge des ganzen Bezirks, und ich konnte dem nicht widersprechen. Mit Intelligenz konnte er auch nicht punkten. Er war ein Zwei-Sterne-Schüler, ein trauriger dvoyka, und eckte ständig bei den Lehrern an. Sie gaben es schließlich auf, ihn zu bestrafen, weil dies keinerlei Wirkung zeigte. Von da an saß er nur noch still vor sich hin träumend in der letzten Reihe.
Zugleich war er jedoch der Star des NVP-Unterrichts, des militärischen Trainings, an dem alle Klassen teilnehmen mussten. Leo konnte eine Kalaschnikow in zwölf Sekunden zerlegen und in fünfzehn Sekunden wieder zusammenbauen. Außerdem war er ein hervorragender Schütze.
Zweimal im Jahr fanden militärische Spiele statt, bei denen wir gegen andere Schulen antreten und uns mit Karte und Kompass im Wald zurechtfinden mussten. Leo war immer unser Anführer und wir gewannen jedes Mal.
Ich mochte ihn, weil er vor nichts Angst hatte und mich ständig zum Lachen brachte. Wir machten alles gemeinsam. Wir aßen zusammen unsere Pausenbrote auf dem Schulhof und spülten sie mit einem Schluck Wodka hinunter, den Leo zu Hause geklaut und in einem alten Parfümfläschchen seiner Mutter mitgebracht hatte. Wir rauchten in dem Wäldchen hinter dem Hauptgebäude Zigaretten und mussten fürchterlich husten, weil der Tabak so trocken war.
In den Toiletten gab es keine Trennwände, sodass wir unser Geschäft oft nebeneinander verrichteten. Das klingt vielleicht eklig, aber so war es eben. Klopapier musste man selbst mitbringen, was Leo nur immer vergaß. Dann riss er mit schlechtem Gewissen einige Seiten aus seinem Übungsheft. Auf diese Weise verlor er stets seine Hausaufgaben. Andererseits hatten diese wahrscheinlich auch nichts Besseres verdient – wie er sogar selbst sagte.
Am schönsten waren die Sommer. Dann rasten wir mit unseren Fahrrädern stundenlang über die Landstraßen, bretterten hangabwärts und strampelten wie besessen rückwärts, weil man nicht anders bremsen konnte. Alle Kinder fuhren dasselbe Modell, ein tödliches Gefährt ohne Federung, Licht und Bremse. Wir hatten kein bestimmtes Ziel, aber genau darin bestand der Reiz.
In unserer Fantasie brausten wir durch eine von Wölfen, Vampiren, Gespenstern und Kosaken bevölkerte Welt. Wenn wir danach ins Dorf zurückkehrten, schwammen wir im Fluss, obwohl das Wasser Parasiten enthielt, die einen krank machen konnten, gingen ins Badehaus und schlugen in der Schwitzstube mit Birkenzweigen aufeinander ein, weil das der Haut angeblich guttat.
Leos Eltern arbeiteten in derselben Fabrik wie meine, aber mein Vater, der an der Staatlichen Universität Moskau studiert hatte, bekleidete einen höheren Posten. In der Fabrik waren rund zweihundert Menschen beschäftigt, die mit Bussen in Estrov, Rosna und vielen anderen Orten abgeholt wurden.
Die Fabrik war mir ein Rätsel. Warum lag sie mitten im Nirgendwo? Wieso hatte ich sie noch nie gesehen? Sie war von einem Stacheldrahtzaun umgeben und am Tor standen bewaffnete Soldaten. Auch das verstand ich nicht. Die Fabrik produzierte doch nur Pestizide und andere Chemikalien für Bauern.
Wenn ich meine Eltern danach fragte, wechselten sie das Thema. Leos Vater war für das Transportwesen und die Busse zuständig. Mein Vater arbeitete als Chemiker in der Forschung, meine Mutter als Sekretärin in der Hauptverwaltung. Mehr wusste ich nicht.
An den Sommerabenden saßen Leo und ich oft am Fluss und sprachen über die Zukunft. Eigentlich wollte jeder nur weg aus Estrov. Abgesehen von der Arbeit gab es kaum etwas zu tun und die Hälfte der Einwohner war ständig betrunken.
In den Wintermonaten durfte der Dorfladen erst um zehn Uhr morgens öffnen, sonst hätten die Leute schon im Morgengrauen ihren Wodka gekauft. Im Dezember und Januar sah man oft Bauern draußen liegen, halb zugedeckt vom Schnee und halb tot nach dem Leeren einer ganzen Flasche.
Die sich so schnell verändernde Welt ließ uns zurück. Warum meine Eltern überhaupt hergekommen waren, war für mich ein weiteres Rätsel.
Leo war es egal, ob er später in der Fabrik arbeitete oder nicht. Aber ich hatte andere Pläne. Auch wenn ich nicht wusste warum, hielt ich mich immer für anders als alle anderen. Vielleicht lag es daran, dass mein Vater an einer großen Universität unterrichtet hatte und das Leben außerhalb des Dorfes kannte. Und wenn ich sah, wie die Flugzeuge in der Ferne verschwanden, hatte ich das Gefühl, sie wollten mir etwas mitteilen. Mir sagen, dass ich zu ihnen gehörte. Es gab ein Leben außerhalb von Estrov, das ich vielleicht eines Tages kennenlernen würde.
Über meinen Traum hatte ich bisher nur mit Leo gesprochen. Ich wollte Hubschrauberpilot beim Militär werden, oder, wenn das nicht ging, beim Seenotrettungsdienst.
Im Fernsehen hatte ich eine Sendung darüber gesehen, die mich nicht mehr losließ. Von da an verschlang ich alles, was ich über Hubschrauber in die Hände bekam. Ich holte mir Bücher aus der Schulbücherei und schnitt Artikel aus Zeitschriften aus. Mit dreizehn konnte ich alle beweglichen Teile eines Hubschraubers benennen. Ich wusste genau, wie er die verschiedenen Kräfte zum Fliegen nutzte. Ich hatte nur noch nie in einem gesessen.
»Glaubst du, du gehst irgendwann weg von hier?«, fragte Leo mich eines Abends. Wir lagen nebeneinander im hohen Gras und teilten uns eine Zigarette. »Und wohnst in einer Stadt, in deiner eigenen Wohnung und hast ein eigenes Auto?«
»Und wie soll das gehen?«
»Du bist intelligent. Du kannst nach Moskau ziehen und eine Ausbildung zum Piloten machen.«
Ich schüttelte den Kopf. Leo war mein bester Freund. Egal was ich mir im Stillen ausmalte, ich wollte nicht darüber sprechen, dass wir eines Tages getrennt sein könnten. »Meine Eltern würden es wahrscheinlich sowieso nicht erlauben. Und warum sollte ich von hier weg? Hier ist mein Zuhause.«
»Estrov ist ein Kaff.«
»Nein.« Ich sah dem Wasser im Fluss nach, wie es an den Steinen aufspritzte, betrachtete den Wald und die staubige Piste, die durch unser Dorf führte. Dann ließ ich den Blick zum Turm von Sankt Nikolaus schweifen.
Das Dorf hatte keinen Priester und die Kirche war geschlossen. Aber ihr Schatten reichte fast bis zu unserer Haustür und sie war ein fester Bestandteil meiner Kindheit.
Vielleicht hatte Leo Recht. Estrov war wirklich nichts Besonderes, aber trotzdem war es meine Heimat.
»Ich bin hier glücklich«, sagte ich. Und in diesem Moment glaubte ich es sogar selbst. »So schlecht ist es hier doch gar nicht.«
An diese Worte erinnere ich mich bis heute. Und ich rieche immer noch den Rauch eines Feuers irgendwo auf der anderen Seite des Dorfes und höre das Glucksen des Wassers.
Leo verdreht einen Grashalm zwischen den Fingern, ich sehe ihn noch vor mir. Unsere Räder liegen aufeinander. Einzelne kleine Wolken ziehen träge über den Himmel. Ein Fisch bricht durch die Wasseroberfläche, die Schuppen glitzern silbern in der Sonne. Es ist ein warmer Nachmittag Anfang Oktober. Und in vierundzwanzig Stunden wird alles anders sein, wird Estrov nicht mehr existieren.
Als ich nach Hause kam, machte meine Mutter schon das Abendessen. Essen war bei uns im Dorf ein ständiges Gesprächsthema, weil es so wenig davon gab und alle selbst Nahrungsmittel anbauten.
Wir hatten Glück. Wir besaßen nicht nur einen Gemüsegarten, sondern auch ein Dutzend fleißige Hennen. Deshalb hatten wir immer viele Eier – wenn uns die Nachbarn keine klauten.
Meine Mutter machte einen Eintopf aus Kartoffeln, Rüben und Dosentomaten, die in der Woche zuvor im Laden aufgetaucht und sofort ausverkauft gewesen waren. Genau das gleiche Essen hatte es schon am vergangenen Abend gegeben. Dazu gab es Schwarzbrotscheiben und natürlich mit Wodka gefüllte Schnapsgläser. Ich trank Wodka, seit ich neun war.
Meine Mutter war eine schlanke Frau mit leuchtend blauen Augen. Einst war sie so blond gewesen wie ich. Doch jetzt, mit gerade einmal Mitte dreißig, hatte sie bereits graues Haar. Sie band es straff zurück, sodass die Krümmung ihres Halses frei lag.
Sie lächelte jedes Mal, wenn sie mich sah, und ergriff immer für mich Partei. Einmal zum Beispiel wären Leo und ich fast verhaftet worden, weil wir vor der Polizeiwache Bomben gezündet hatten.
Wir waren im ersten Morgengrauen aufgestanden, hatten Löcher in den Boden gegraben und diese mit Reißnägeln und dem Schießpulver von ungefähr fünfhundert Streichhölzern gefüllt. Anschließend hatten wir uns hinter der Friedhofsmauer versteckt und abgewartet.
Es dauerte zwei Stunden, bis ein Polizeiauto über unseren versteckten Sprengsatz fuhr und die Explosion auslöste. Es gab einen Mordsknall. Das Vorderrad wurde zerfetzt. Das Auto geriet außer Kontrolle und fuhr durch ein Gebüsch.
Wir lachten, wie schon lange nicht mehr, aber als ich nach Hause kam, verflog meine gute Laune. Im Wohnzimmer saß Wachtmeister Yelchin und fragte, wo ich gewesen sei. Als ich sagte, ich habe für meine Mutter eine Besorgung gemacht, bestätigte meine Mutter das, obwohl sie wusste, dass ich log. Später schimpfte sie mich aus, aber ich merkte, dass sie unseren Streich insgeheim auch lustig fand.
Bei uns zu Hause redeten vor allem meine Mutter und meine Großmutter. Mein Vater war ein sehr nachdenklicher Mensch, der genauso aussah, wie man sich einen Wissenschaftler vorstellt. Er hatte graue Haare, ein ernstes Gesicht und eine Brille. Auch wenn er in Estrov lebte, gehörte sein Herz immer noch Moskau.
Er bewahrte seine alten Bücher auf, und sobald ein Brief aus der Stadt kam, zog er sich zurück, um ihn zu lesen. Beim Essen war er mit seinen Gedanken dann meilenweit weg von uns.
Ich hätte ihn mehr fragen sollen, denke ich jetzt, aber wahrscheinlich geht das allen so. Als Kind akzeptiert man seine Eltern so, wie sie sind, und glaubt, was sie einem erzählen.
Die Gespräche beim Essen verliefen oft etwas schleppend, weil meine Eltern nicht über ihre Arbeit in der Fabrik reden wollten und ich ihnen auch nicht alles über meinen Schultag sagen konnte.
Meine Großmutter lebte gedanklich immer noch in der Vergangenheit vor zwanzig Jahren. Sie sagte viel, aber das hatte überhaupt keinen Bezug zur Gegenwart.
An diesem Abend war es anders. Es hatte offenbar einen Unfall gegeben, ein Feuer in der Fabrik – nichts Ernstes. Mein Vater machte sich trotzdem Sorgen und äußerte ausnahmsweise einmal seine Meinung.
»Daran sind die neuen Investoren schuld«, sagte er. »Sie denken nur ans Geld. Sie wollen die Produktion steigern und dabei sind ihnen die Sicherheitsvorkehrungen völlig egal. Heute hat es bloß den Generator getroffen, aber einmal angenommen, das Feuer wäre in einem der Labore ausgebrochen …«
»Du solltest mit ihnen sprechen«, sagte meine Mutter.
»Sie würden nicht auf mich hören. Alles wird von Moskau aus geregelt und dort hat man keine Ahnung.« Er leerte sein Wodkaglas in einem Zug. »Das ist das neue Russland, Eva. Wir gehen dabei vor die Hunde, aber das kümmert sie nicht. Hauptsache, sie bekommen ihr Geld.«
Das ergab keinen Sinn. Die Herstellung von Düngern und Pestiziden konnte für Estrov doch nicht gefährlich werden, oder?
Meine Mutter schien dasselbe zu denken, denn sie sagte: »Du machst dir zu viele Sorgen.«
»Wir hätten da niemals mitmachen dürfen.« Mein Vater schenkte sich erneut ein. Er trank weniger als viele andere im Dorf und meist dann, wenn er mit dem Rest der Welt nichts mehr zu tun haben wollte. »Je schneller wir von hier verschwinden, desto besser. Wir waren lange genug hier.«
»Die Schwäne sind zurückgekehrt«, sagte meine Großmutter. »Sie sind um diese Jahreszeit so schön.«
Im Dorf gab es keine Schwäne. Und soweit ich weiß, hatte es auch nie welche gegeben.
»Gehen wir wirklich fort von hier?«, fragte ich. »Nach Moskau?«
Meine Mutter streckte den Arm aus und legte ihre Hand auf meine. »Eines Tages vielleicht, Yasha. Dann kannst du an der Universität studieren wie dein Vater. Aber bis dahin musst du tüchtig lernen …«
Der nächste Tag war ein Sonntag und ich hatte keine Schule. Die Fabrik dagegen machte nie zu und meine Eltern waren beide für die Wochenendschicht eingeteilt. Sie arbeiteten bis vier Uhr nachmittags und ich sollte in dieser Zeit das Haus putzen und meiner Großmutter das Mittagessen geben.
Nach dem Frühstück kam Leo vorbei, aber wir hatten beide viele Hausaufgaben zu erledigen, deshalb wollten wir uns um sechs Uhr abends am Fluss treffen und vielleicht mit einigen anderen Jungs Fußball spielen.
Mittags lag ich auf meinem Bett und arbeitete mich durch ein Kapitel aus VerbrechenundStrafe – ein dickes Meisterwerk der russischen Literatur, das wir lesen sollten.
Wie Leo gesagt hatte, wussten wir zwar nicht, was wir verbrochen hatten, aber dieses Buch zu lesen war ganz sicher eine Strafe. Die Geschichte hatte mit einem Mord begonnen, aber seitdem war nichts mehr passiert und ich hatte noch sechshundert Seiten vor mir.
Ich lag also mit dem Kopf zum Fenster da und die Sonne schien auf die Buchseiten. Es war ein stiller Tag. Selbst die Hühner hatten ihr ewiges Gegacker aufgegeben und ich hörte nur das Ticken der Uhr an meinem linken Handgelenk, einer Pobeda mit schwarzen Zahlen auf weißem Zifferblatt und fünfzehn Steinen.
Sie war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt worden und hatte früher meinem Großvater gehört. Ich zog sie nie aus und sie war im Laufe der Jahre zu einem Teil von mir geworden.
Ich sah, dass es fünf Minuten nach zwölf war, und hörte im selben Augenblick die Explosion. Eigentlich war ich mir nicht sicher, ob es sich wirklich um eine Explosion handelte. Es klang eher, als würde eine aufgeblasene Papiertüte platzen.
Ich stand vom Bett auf und blickte durch das offene Fenster nach draußen. Einige Menschen gingen über die Felder, ansonsten gab es nichts zu sehen.
Ich wandte mich wieder dem Buch zu. Wie hatte ich das Gespräch meiner Eltern vom Abend zuvor so schnell vergessen können?
Ich las weitere dreißig Seiten. Eine halbe Stunde mochte vergangen sein, als ich wieder etwas hörte – leise und weit entfernt, aber eindeutig: Schüsse und das Knattern eines Sturmgewehrs. Aber das konnte nicht sein. Manchmal ging jemand im Wald auf die Jagd, jedoch nicht mit einem Sturmgewehr. Und Truppenübungen hatte es in dieser Gegend noch nie gegeben.
Ich blickte wieder aus dem Fenster. Hinter den Bergen im Süden von Estrov stieg Rauch auf. Da wusste ich, dass ich mir die Geräusche nicht eingebildet hatte. Es war etwas passiert. Der Rauch kam aus der Fabrik.
Ich sprang vom Bett auf, ließ das Buch fallen, rannte die Treppe hinunter und raus aus dem Haus.
Das Dorf lag vollkommen verlassen da. Unsere Hühner stolzierten über den Rasen und pickten im Gras. Irgendwo bellte ein Hund. Alles war so absurd normal.
Doch dann hörte ich Schritte und hob den Kopf. Unser Nachbar Vladimov rannte die Straße entlang und wischte sich dabei die Hände an einem Lappen ab.
»Herr Vladimov!«, rief ich. »Was ist passiert?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte er keuchend. Wahrscheinlich hatte er gerade seinen Traktor repariert, denn er war über und über mit Öl beschmiert. »Es sind schon alle da, um es sich anzusehen. Ich gehe jetzt auch hin.«
»Was meinen Sie mit alle?«
»Das ganze Dorf! Es gab einen Unfall!«
Bevor ich noch etwas fragen konnte, war er schon wieder verschwunden.
Kaum war er weg, ging der Alarm los. Ein ohrenbetäubender Lärm, wie ich ihn noch nie zuvor gehört hatte. Es hätte nicht schlimmer sein können, wenn ein Krieg ausgebrochen wäre.
Und während mir vom Lärm noch der Kopf dröhnte, begriff ich, dass er aus der Fabrik kommen musste, die anderthalb Kilometer vom Dorf entfernt lag. Wie konnte er dann so laut sein? Nicht einmal der Feueralarm unserer Schule konnte da mithalten.
Das schrille Geheul der Sirene breitete sich überallhin aus, über Wald, Berge und Himmel. Zugleich schien die Sirene direkt neben mir zu stehen, vor unserem Haus.
Offenbar hatte es wieder einen Unfall gegeben. Aber das war vor einer halben Stunde gewesen. Warum hatte man den Alarm erst jetzt ausgelöst?
Die Sirene verstummte. Und in der plötzlichen Stille verwandelten sich die Gegend und das Dorf, in dem ich mein ganzes bisheriges Leben verbracht hatte, zu fotoartigen Ansichten, die ich von außen betrachtete. Abgesehen von mir war keine Seele auf der Straße. Der Hund hatte aufgehört zu bellen, die Hühner waren in alle Richtungen geflohen.
Dann hörte ich das Geräusch eines Motors. Ein Auto ruckelte über die löchrige Straße auf mich zu. Als Erstes stellte ich fest, dass es sich um einen schwarzen Lada handelte. Dann entdeckte ich unzählige Einschusslöcher im Blech und die zerborstene Windschutzscheibe. Doch erst als das Auto anhielt, fuhr mir der Schrecken in die Glieder.
Auf dem Beifahrersitz saß mein Vater, hinter dem Steuer meine Mutter.
KPOKOДИЛЬIKrokodile
Ich hatte nicht einmal gewusst, dass meine Mutter fahren konnte. In Estrov bekamen wir nur selten ein Auto zu Gesicht, weil niemand sich eines leisten und man auch nirgendwo hinfahren konnte. Der schwarze Lada gehörte wahrscheinlich einem der Firmenchefs.
Nicht, dass mir diese Gedanken damals durch den Kopf gegangen wären. Die Fahrertür ging auf und meine Mutter stieg aus. Ich sah gleich die Panik in ihren Augen. Sie bedeutete mir mit erhobener Hand zu bleiben, wo ich war. Dann eilte sie um das Auto herum und half meinem Vater beim Aussteigen. Er trug einen weiten weißen Mantel über seinen normalen Kleidern und war verletzt.
Mir wurde vor Angst ganz anders. Der weiße Stoff war mit seinem Blut getränkt. Sein linker Arm hing schlaff herunter, die rechte Hand hielt er an die Brust gedrückt. Das Gesicht war eingefallen und bleich, sein Blick leer und glasig vor Schmerzen.
Meine Mutter legte den Arm um ihn und stützte ihn beim Gehen. Sie war zwar nicht verletzt, doch sie sah aus, als wäre sie aus einem Kriegsgebiet geflohen. Ihr Gesicht war schmutzig, die Haare zerzaust. Kein Kind sollte seine Eltern so sehen müssen. Nichts von dem, was ich geglaubt und für selbstverständlich gehalten hatte, galt noch.
Die beiden blieben vor mir stehen. Dann verließen meinen Vater die Kräfte. Er sank zu Boden und lehnte sich mit dem Rücken an den Gartenzaun.
Obwohl mir eine Million Fragen auf der Zunge lagen, brachte ich kein Wort heraus. Die Zeit schien nur noch aus Fragmenten zu bestehen. Die Explosion, die Schüsse und der Rauch, die Stille vor dem Haus, der Anblick des Autos – vier verschiedene Ereignisse, die für mich nicht zusammenpassten. Meine Eltern sollten mir alles erklären, vielleicht ergab es dann einen Sinn.
»Yasha!« Mein Vater sprach als Erster. Er klang anders als sonst, seine Stimme war vor Schmerzen verzerrt.
»Was ist denn? Was ist passiert? Wer hat dich verletzt? Jemand hat auf dich geschossen!« Sobald ich angefangen hatte zu sprechen, konnte ich nicht mehr aufhören. Wirres Zeug sprudelte aus mir heraus.
Mein Vater streckte die Hand nach mir aus und umfasste meinen Arm. »Ich bin so froh, dass du hier bist. Ich hatte Angst, du könntest irgendwo draußen sein. Du musst uns jetzt genau zuhören, Yasha. Wir haben nur wenig Zeit.«
»Yasha, mein Lieber …« Meiner Mutter liefen plötzlich Tränen über die Wangen. Sie weinte, weil sie mich sah, nicht wegen dem, was in der Fabrik passiert war.
»Ich will versuchen, dir alles zu erklären«, sagte mein Vater. »Aber du darfst mir nicht widersprechen, hast du verstanden? Du musst das Dorf sofort verlassen.«
»Was? Nein! Ich gehe nirgendwo hin.«
»Du musst. Wenn du hierbleibst, werden sie dich töten.« Er verstärkte den Druck auf meinen Arm. »Sie sind schon unterwegs. Hast du mich verstanden? Sie kommen hierher. Gleich.«
»Wer? Warum?«
Mein Vater hatte so große Schmerzen, dass er nicht weitersprechen konnte, deshalb übernahm meine Mutter.
»Wir haben dir nie von der Fabrik erzählt«, sagte sie. »Man hat es uns verboten. Aber nicht nur deshalb. Wir wollten nicht, dass du es weißt. Wir haben uns furchtbar geschämt.« Energisch wischte sie sich die Tränen ab. »Es stimmt, dass wir Chemikalien und Pestizide für die Bauern entwickelt haben, aber wir mussten auch andere Sachen herstellen. Für das Militär.«
»Waffen«, sagte mein Vater. »Chemische Waffen. Verstehst du, was ich meine?« Als ich schwieg, fuhr er mit schwacher Stimme fort. »Wir hatten keine Wahl, Yasha. Deine Mutter und ich, wir bekamen schon vor langer Zeit, als wir noch in Moskau waren, Schwierigkeiten mit den Behörden und wurden hierhergeschickt. Das war noch vor deiner Geburt. Es war alles meine Schuld. Wir durften nicht mehr unterrichten und man hat uns gedroht. Irgendwie mussten wir unseren Lebensunterhalt verdienen und es gab keine andere Möglichkeit.«
Seine Worte rasten durch meinen Kopf wie eine in Panik geratene Herde Pferde. Ich wollte sie anhalten, verlangsamen. Jetzt kam es doch vor allem darauf an, Hilfe für meinen Vater zu holen. Das nächste Krankenhaus war viele Kilometer entfernt, aber in Rosna wohnte ein Arzt. Ich hatte den Eindruck, dass mein Vater immer schwächer wurde und sich das Blut auf seinen Kleidern ausbreitete. Doch meine Eltern redeten einfach weiter.
»Heute Morgen gab es einen Unfall im Zentrallabor«, sagte meine Mutter. »Dabei trat etwas aus. Wir hatten die Betreiber gewarnt, dass dies passieren könne. Du weißt, wir haben gestern Abend darüber gesprochen. Aber sie haben unsere Einwände abgetan. Sich nur für den Profit interessiert. Tja, jetzt ist es vorbei. Das ganze Dorf wurde kontaminiert. Wir auch. Wir haben den Erreger mitgebracht. Wobei das gar keine Rolle spielt. Er ist in der Luft. Überall.«
»Was denn? Wovon sprecht ihr?«
»Von einer Art Anthrax.« Meine Mutter spuckte die Worte förmlich aus. »Einem Bakterium, das modifiziert wurde und deshalb sehr ansteckend ist und rasend schnell wirkt. Man könnte damit eine komplette Armee auslöschen! Und vielleicht haben wir dieses Ende auch verdient. Wir sind dafür verantwortlich. Wir haben bei seiner Herstellung mitgewirkt …«
Mein Vater ließ mich los und langte ungeschickt in seine Hosentasche. Er zog ein etwa fünfzehn Zentimeter langes Metallkästchen heraus, das wie ein Fülleretui aussah. »Gib ihm das! Mach schon!«
Meine Mutter nahm es ihm ab und sah mich dabei unverwandt an. »Sobald wir wussten, was passiert war, haben wir nur noch an dich gedacht. Eigentlich durfte niemand die Fabrik verlassen. Sie mussten uns dort festhalten, um den Schaden zu begrenzen. Aber dein Vater und ich, wir hatten schon einen Plan – nur für den Fall. Wir haben ein Auto gestohlen und sind damit durch den Zaun des Fabrikgeländes gebrettert. Wir mussten unbedingt zu dir fahren.«
»Und die Sirene …?«
»Hat mit dem Unfall nichts zu tun. Sie wurde erst danach ausgelöst. Man hat unsere Flucht bemerkt.« Sie holte tief Luft. »Die Wachen feuerten mit ihren Gewehren auf uns und lösten Alarm aus. Dein Vater wurde getroffen. Wir hatten solche Angst, wir würden dich nicht zu Hause antreffen …«
»Gott sei Dank bist du hier!«, keuchte mein Vater. Er griff wieder nach meinem Arm.
Meine Mutter öffnete das Kästchen. Ich wusste nicht, was es enthielt und was daran so wichtig sein sollte. Mit dem, was ich dann sah, hatte ich allerdings überhaupt nicht gerechnet. Auf einem grauen Samtpolster lag eine Injektionsspritze.
»Man muss sich vor einer Waffe schützen können«, fuhr meine Mutter fort. »Wir haben ein Gift hergestellt, aber auch ein Gegenmittel. Es steckt in dieser Spritze, Yasha. Wir hatten nur eine ganz kleine Menge, aber die haben wir geklaut und dir mitgebracht. Es wird dich schützen …«
»Ich will das nicht! Nehmt ihr es!«
»Es reicht nur für einen.« Mein Vater hielt meinen Arm unter Aufbietung all seiner Kraft umklammert, sodass ich mich nicht losreißen konnte. »Gib sie ihm, Eva«, drängte er.
Meine Mutter hielt die Spritze ins Licht, klopfte mit dem Finger dagegen und betrachtete die Flüssigkeit in der gläsernen Ampulle. Sie drückte mit dem Daumen auf den Kolben, bis am Ende der Nadel ein Tropfen austrat.
Ich zerrte an meinem Arm, fassungslos, dass meine Mutter mir eine Spritze geben wollte. Aber mein Vater hielt mich weiter fest.
Meine Mutter trat vor mich. Es ist bestimmt für alle Kinder ein Albtraum, von den eigenen Eltern attackiert zu werden, und in diesem Moment vergaß ich vollends, dass sie ja nur mein Bestes wollten. Sie wollten mir das Leben retten, nicht mich umbringen, aber genau so kam es mir vor.
Ich sehe das Gesicht meiner Mutter noch vor mir, die kalte Entschlossenheit, mit der sie zustach. Sie machte sich nicht einmal die Mühe, meinen Ärmel hochzukrempeln.
Die Spritze stach durch den Stoff in meinen Arm. Es tat weh. Mir war, als würde ich spüren, wie die Flüssigkeit, das Gegengift, sich in meinem Blutkreislauf ausbreitete.
Meine Mutter zog die Nadel heraus und ließ die leere Spritze auf den Boden fallen.
Ich blickte auf meinen Arm und sah Blut, diesmal mein eigenes: ein wachsender Fleck auf meinem Hemd.
Da ließ mein Vater mich los.
Meine Mutter schloss kurz die Augen. Als sie sie wieder öffnete, lächelte sie. »Yasha, mein Schatz. Uns ist egal, was aus uns wird. Verstehst du das? Im Moment machen wir uns nur Sorgen um dich. Nur du bist wichtig.«
Einen Moment lang verhielten wir drei uns wie Schauspieler, die ihren Text nicht wussten. Wortlos angesichts der Gewalt der Ereignisse.
Ich kam mir vor wie in einem Wachtraum. Stille umgab uns, über den Bergen stieg langsam Rauch auf. Und das Dorf lag verlassen da. Kein Mensch weit und breit.
Schließlich sagte mein Vater: »Geh rein. Du musst etwas zum Anziehen mitnehmen und alles, was du an Essen finden kannst. Sieh im Küchenschrank nach und steck es in deinen Rucksack. Hol auch eine Taschenlampe und einen Kompass. Am wichtigsten ist aber die Kassette in der Küche. Du weißt schon wo, neben dem Herd … Bring sie mir.«
Als ich zögerte, legte er seine ganze Autorität in seine Stimme. »Wenn du das Dorf nicht in fünf Minuten verlassen hast, stirbst du mit uns. Trotz des Gegengifts. Die Behörden werden nicht zulassen, dass jemand herumerzählt, was hier passiert ist. Sie werden dich verfolgen und töten. Wenn du überleben willst, musst du tun, was wir sagen.«
Wollte ich denn überleben? In diesem Augenblick wusste ich das selbst nicht. Aber ich wollte auf keinen Fall meine Eltern enttäuschen, nachdem sie alles getan hatten, um mich zu retten.
Meine Mutter wagte es nicht, etwas zu sagen. Sie sah mich nur mit einem flehenden Blick an.
Da riss ich mich los und lief mit brennender Kehle in Richtung Haus. Mein Vater saß immer noch mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden. Über die Schulter beobachtete ich, wie meine Mutter zu ihm ging und sich neben ihn kniete. Fast wäre ich über meine eigenen Füße gestolpert.
Ich rannte durch Garten und Haustür und gleich hoch in mein Zimmer. Wie betäubt holte ich die Uniform aus dem Schrank, die ich beim Zelten mit den Jungen Pionieren, der russischen Pfadfinderorganisation, getragen hatte. Ich hatte einen dunkelgrünen Anorak und wasserdichte Hosen bekommen. Unsicher, ob ich sie mitnehmen oder sofort anziehen sollte, zog ich sie schließlich über meine normalen Kleider. Dann schlüpfte ich in meine Lederstiefel, an denen getrockneter Schlamm klebte, und holte meinen Rucksack, eine Taschenlampe und einen Kompass unter dem Bett hervor.
Ich sah mich um, warf einen letzten Blick auf die Bilder an der Wand – eine Fußballmannschaft, verschiedene Hubschrauber und ein aus dem All aufgenommenes Foto der Erde. Das Buch, das ich gelesen hatte, lag noch auf dem Boden. Meine Schuluniform lag zusammengefaltet auf einem Stuhl. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass ich das alles zurücklassen sollte und nie wieder sehen würde.
Ich raste zurück nach unten. Jedes Haus im Dorf hatte ein Geheimversteck. Unseres befand sich in der gemauerten Wand neben dem Herd. Drei Ziegel waren lose. Ich zog sie heraus und legte dadurch einen Hohlraum frei, in dem eine Kassette aus Blech stand. Die nahm ich an mich. Erst als ich mich wieder aufrichtete, bemerkte ich meine Großmutter, die an der Spüle stand und Kartoffeln schälte. Die Schürze hatte sie sich ordentlich um die Hüften gebunden.
Sie sah mich strahlend an. »Ich kann mich nicht erinnern, dass wir je eine bessere Ernte gehabt hätten«, sagte sie. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, was passiert war.
Ich ging zum Küchenschrank und steckte einige Konserven, Tee, Zucker, eine Schachtel Streichhölzer und zwei Tafeln Schokolade in meinen Rucksack. Dann füllte ich ein Glas mit dem Wasser, das ich vom Brunnen geholt hatte.
Zum Abschied küsste ich meine Großmutter noch rasch auf die Schläfe, dann eilte ich nach draußen und überließ sie wieder ihrer Arbeit.
Während meiner Abwesenheit hatte sich der Himmel verdunkelt. Wie war das möglich? Ich war doch höchstens ein paar Minuten weg gewesen. Jetzt sah es aus, als würde gleich einer der heftigen Wolkenbrüche auf uns niedergehen, wie wir sie in den Monaten vor dem Winter oft hatten.
Mein Vater saß immer noch an derselben Stelle, an der ich ihn zurückgelassen hatte, und schien zu schlafen. Die Hand hatte er auf die Wunde in seiner Brust gedrückt.
Ich wollte ihm die Kassette bringen, aber meine Mutter trat mir in den Weg. Ich hielt ihr das Glas Wasser hin.
»Das habe ich mitgebracht. Für Vater.«
»Das ist lieb von dir, Yasha. Aber er braucht es nicht.«
»Aber …«
»Nein, Yasha, versteh doch.«
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was sie mir damit sagen wollte, und dann öffnete sich plötzlich der Boden unter mir und ich stürzte in einen Abgrund unbeschreiblicher Schmerzen.
Meine Mutter nahm die Kassette und klappte den Deckel auf. Sie enthielt eine Rolle Geldscheine – insgesamt zehn Zehn-Rubel-Scheine. Mehr Geld, als ich je gesehen hatte. Offenbar hatten meine Eltern es von ihren Gehältern abgespart für den Tag ihrer Rückkehr nach Moskau. Dazu würde es jetzt nicht mehr kommen.
Meine Mutter gab mir das ganze Geld und meinen Inlandspass, ein Dokument, das jeder russische Staatsbürger besitzen musste, auch wenn er nicht reiste. Dann gab sie mir noch einen kleinen Beutel aus schwarzem Samt.
»Das ist alles«, sagte sie. »Jetzt musst du gehen.«


![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
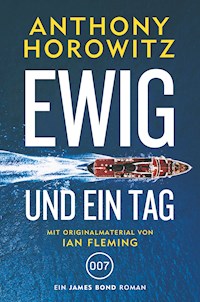
![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Mord stand nicht im Drehbuch. Hawthorne ermittelt [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/048a0a8d746eaaf2e78653d44c492732/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)









