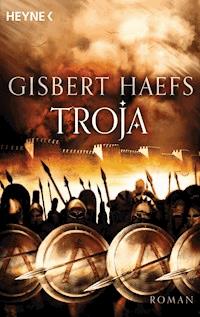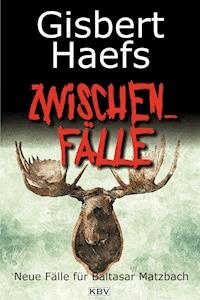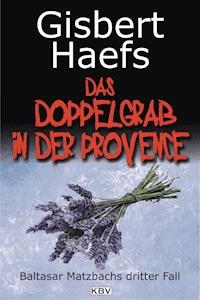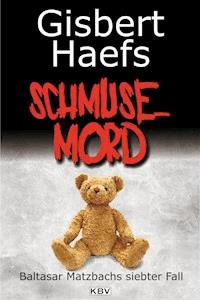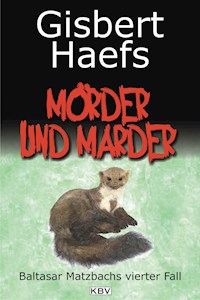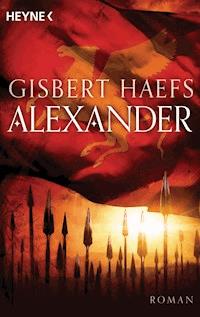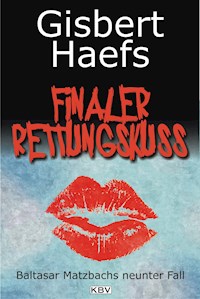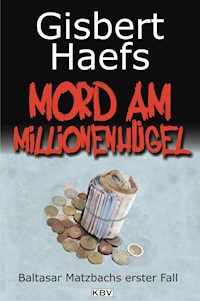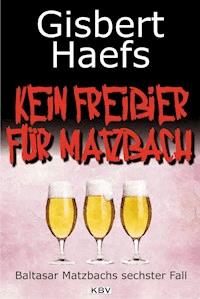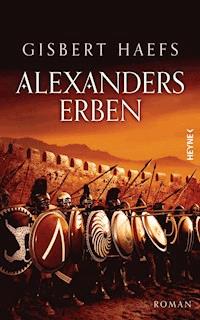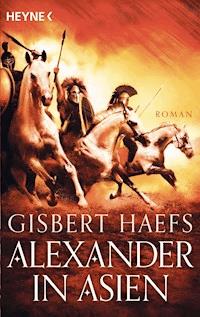
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexander der Große gilt als der mächtigste Heerführer aller Zeiten und fasziniert uns bis heute. Mit seinen monumentalen Alexander-Romanen setzt Gisbert Haefs dieser legendären, rätselhaften Gestalt ein Denkmal, das seinesgleichen sucht. Der zweite Band des großen Epos' erzählt Alexanders Perser-Feldzüge, die angetrieben sind von seiner Vision, Asien zu erobern und damit ein Weltreich zu errichten. In faszinierenden Bildern entwirft Haefs ein mitreißendes Panorama voller Schlachten und Intrigen, das die Antike wieder zum Leben erweckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 1997 by Gisbert Haefs
Copyright © 1997 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München Copyright © dieser Ausgabe 2004 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlagillustration: Bridgeman Giraudon, Berlin unter Verwendung eines Ausschnitts aus dem Gemälde ALEXANDER UND PORUS IN DER SCHLACHT VON HYDASPES von Charles Le Brun, 1673, Louvre, Paris Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
ISBN 978-3-641-10759-8V002
http://www.heyne.de
Das Buch
In Alexander in Asien, dem zweiten und letzten Band in Gisbert Haefs historischem Romanepos über das Leben des großen Feldherrn, wird das spannende Monumentalgemälde zu Ende geführt. Beleuchtete der erste Roman Alexander dessen frühe Jahre und seinen Aufstieg zum Staatsmann und König, so geht es im zweiten Band um die Eroberung Asiens und die Errichtung des ersten Weltreichs der Geschichte bis zu seinem Tod. Neben der faszinierenden Schilderung einer hochinteressanten Zeit in der Antike, beschäftigt sich Haefs vor allem auch mit der vielschichtigen Persönlichkeit Alexanders, der viele begeistert mitziehen konnte, mit zunehmendem Alter für seine Umgebung jedoch immer rätselhafter und unberechenbarer wurde.
Nach Erscheinen seines historischen Romans Hannibal erhielt Haefs 1990 aus Hollywood das Angebot, ein Drehbuch für eine geplante Alexander- Verfilmung mit Sean Connery in der Hauptrolle zu schreiben. Das Filmprojekt wurde letztlich fallen gelassen, doch dafür legte Gisbert Haefs im Herbst des Jahres 1992 den ersten Teil seiner Alexander-Biografie vor.
»Gisbert Haefs kennt sich im Universum der Antike inzwischen wie in seinem Hausgarten aus. Wenn er ein hellenisches Landgut malt, eine vorstädtische Weinkneipe durchstöbert oder eine Liebesstunde König Philipps mit der Heldenmutter Olympias zungenfertig protokolliert, trägt seine kräftig zupackende Prosa, die weder auf die heute so geschätzten Naturalia noch auf verwegene Bilder verzichtet, den Leser mühelos davon.«
DIE WELT
Der Autor
Gisbert Haefs, 1950 in Wachtendonk am Niederrhein geboren, studierte Anglistik und Hispanistik und war fahrender Chansonnier und Komponist, ehe er mit dem Schreiben von Büchern begann. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Bonn. Bekannt wurde Haefs neben seiner Tätigkeit als Übersetzer und Herausgeber der Werkausgaben u.a. von Ambros Bierce und Jorge Luis Borges als Autor großer historischer Romane wie Hannibal, Alexander, Troja, Hamilkars Garten oder Roma.
Inhaltsverzeichnis
1. HERR DER ZEHNTAUSEND WESEN
Klarer kühler Morgen; durch Tür und Fenster drangen vom Innenhof das Schnarchen der alten Sklavin, ein Hauch von Salz und betauten Gräsern, Flügelschläge großer Vögel und der vielfältige Gesang der kleinen.
Pythias bat wortlos um Hilfe; Peukestas ging zur Mitte des Raums und verschränkte die Hände. Sie trat hinein, hielt sich einen Moment am Kopf des Makedonen fest und langte zur Decke hinauf. Ihre Sohlen waren hart und rissig.
Aristoteles folgte seiner Tochter mit den Augen, als sie die Luke aufstieß. Der Holzdeckel quietschte in den Angeln und krachte auf das flache Dach. Einige Vögel flatterten kreischend auf; im Innenhof endete das Schnarchen jäh in einem Gurgeln.
Vorhin, in der matten Helligkeit, die aus dem ummauerten Hof durch Tür und Fenster in den Raum spülte, war das Gesicht des Philosophen voller gewesen, kräftiger als während der Nacht. Nun, im scharfumrissenen Lichtbalken aus der Luke, sah Peukestas einen Sterbenden. Die Augen waren verglimmende Holzkohlen in unwirklicher Ferne, die Haut eine runzlige Wachsschicht, in deren Tönung die Fahlheit des Todes näherrückte. Wie ein fransiger Schatten huschte die Sklavin in ihren dunklen Gewändern durch den Raum und verschwand in der Küche, wo sie die Holzplatte der Hintertür aushakte; mehr Licht und ein Ruch von Gartenkräutern, Gemüse und Abfall füllten das Haus.
Pythias zupfte ihren weißen Chiton zurecht, ehe sie vor der Liege niederkniete. Sie blickte über die linke Schulter zurück zu Peukestas, ein trübes Flehen in den Augen. Die Sklavin erschien mit dem Abort-Bottich. Der Makedone nickte, wandte sich ab und ging in den Innenhof, nahm die Holzblenden aus dem Tor, trat unter den gemauerten Bogen und dann vor das Haus.
Es war kühl und feucht im Schatten. Die Sonne hing noch tief im Osten, jenseits des weißen Gebäudes, in dem der größte Denker der Hellenen auf den Tod wartete. Ein Adler kreiste über der dunkelgrünen Ebene, geleitet von einem Krähenschwarm. Peukestas’ Pferd graste hinter dem hochgemauerten Brunnen am Fuß des Hügels. Einen Moment kamen ihm die Bewegungen des Tieres seltsam vor; dann bedachte er die zusammengebundenen Vorderbeine. Schwacher Südwestwind kräuselte die Küstenebene. Das Gemenge aus Müdigkeit, Erregung und äußerster Anspannung ließ Peukestas alles überscharf wahrnehmen. Er sah Huflattich und Löwenzahn am Hang, jedes Blatt des Strauchs neben dem Brunnen, jede Schattenmaserung des Farns darunter, jeden einzelnen Grashalm der Ebene; er hörte Ameisen hasten, unterschied das Zirpen trockener Grillenbeine von dem feuchter und den leichten Flug der hungrigen Lerche vom schweren des Vogels, der einen Wurm im Schnabel trug; er roch die Ausdünstung seines Reittiers, das feuchte Leder des Zügels, die verschlossene Süße der Strauchblüten. Der überscharfe Morgen starb stumpf in der Dunstschicht über dem Meeresarm – Eos war spröde, so früh; noch hatte sie mit ihren Rosenfingern den Ziegenbart des dösenden Poseidon nicht ausreichend gezaust.
Pythias rief ihn zurück ins Haus. Als er eintrat, breitete sie frische Decken und ausgeschüttelte Felle über ihren Vater. Die Sklavin kauerte vor der Feuerstelle. Sie hatte den Rost gereinigt, die Asche entfernt und streute Späne und Bastkringel auf zwei große Holzstücke. Aus der Küche brachte sie einen Wasserkrug, Brot und Fleisch auf einem Brett, eine Schale mit Früchten, eine Holzscheibe mit bräunlichen Würfeln. Wortlos huschte sie wieder hinaus, in den Küchengarten.
Pythias wies auf die Lukenöffnung; Peukestas verschränkte abermals die Hände. Als das Dach verschlossen war, holte sie ein paar Rollen Papyros. Aristoteles räusperte sich schwach.
»Nicht die, meine Tochter. Leg sie zurück und nimm aus dem Fach darunter.«
»Er ist jetzt bis zum Bauch wie Eis«, sagte Pythias leise. »Hilfst du mir beim Verschließen der Öffnungen?«
Peukestas unterdrückte ein Ächzen; er dachte an den kühlen Morgen, die Hitze des Tages, den stickigen Raum. Langsam, übergründlich brachte er die Blenden in Tür und Fenster an.
Pythias machte Feuer; danach stützte sie den Vater, damit er aus dem Metallbecher trinken konnte.
»Einen Würfel?« sagte sie.
Aristoteles zögerte, ließ sich in die Felle sinken. »Ich weiß nicht, ob dieser Trümmerhaufen einer Kräftigung bedarf... Nun ja, ich will es versuchen. Es rettet die Süße der Nacht in die Bitternis des letzten Tags. Vielleicht.«
Pythias reichte ihm einen der bräunlichen Würfel.
»Was ist das?« Peukestas hockte sich auf den Schemel und goß Wasser in seinen Becher.
»Kydonische Äpfel, zu Mus zerstoßen, mit Honig vermengt, an der Luft getrocknet und mit Sesam bestreut.«
Peukestas kostete. Ein Zahn begehrte auf. Als der Makedone mit kaltem Wasser nachspülte, wurde aus dem Aufbegehren ein Aufstand.
»Ahhh. Mein Vater pflegte zu sagen, gegen Zähne sei nur die Zange wirksamer als Süßes. Ich glaube, er hatte recht.«
»Drakon, Hüter der Zähne ... Wo hatten wir die Geschichte unterbrochen, Sohn meines Freundes?«
»Wir sprachen von Alexanders Ende und Übergang nach Asien, und von Bagoas und den Amuletten. Aber das, sagtest du, sei eine andere Geschichte.«
Aristoteles lutschte an dem süßen Würfel, den er in der Linken hielt. Mit der Rechten zog er das Amulett aus dem Gewand und ließ es baumeln. Er starrte ins Auge des Horos; das goldene ankh glomm und leuchtete plötzlich, als das Feuer aufflackerte.
»Eine andere Geschichte, ja ...« Die Stimme des Sterbenden war matt, aber noch nicht kraftlos; sie war aschebedecktes Feuer, nicht ganz erloschen, das angefacht werden will. »Laß uns bei dem Übergang und seiner Vorgeschichte verweilen.« Aristoteles steckte das Amulett fort; Pythias breitete ein Fell auf dem Boden aus und setzte sich, den Rücken an die Wand gelehnt, neben den Durchgang zur Küche.
»Laß uns reden von dem, was die Menschen erzählen, und dem, was wirklich geschah.«
»Was meinst du?« Peukestas riß ein Stück vom Brotfladen ab und streckte die Hand nach dem Fleisch aus. »Die Vorbereitungen? Die königlichen Geschenke?«
»All dies. Es ist eine schöne Geschichte – Alexander, der viele Menschen war und viele Rätsel, verteilt und verschenkt die neugewonnenen Länder, und Perdikkas, hetairos des Königs, gibt das Geschenk zurück, weil auch er nicht mehr besitzen will als Alexander, dem die Freunde und die Hoffnung bleiben. Eine schöne, eine rührende Geschichte für die Menschen, die in bösen Tagen schöne Dinge erzählen wollen. Und obwohl noch immer viele leben, die damals dabeiwaren, läuft diese Fassung der Vorgänge bereits um. Eine befriedigende, gut ausgemünzte Lüge, Peukestas, ist weit kostbarer und einträglicher als der abgegriffene Obolos der Wahrheit.«
»Was ist denn in diesem Fall die Wahrheit?«
»Daß Alexander, Antipatros, Parmenion und nicht zuletzt Demaratos der Korinther, beraten von der Versammlung der wichtigsten Berater und Offiziere, den Schritt nach Asien jahrelang vorbereitet hatten. Das Netz der Kundschafter, von Demaratos über Asien geworfen, barg geschwätzige Fische. Sie erzählten, daß der neue Großkönig Dareios Mühe hatte, sich in den fernen Gebieten seines Reichs durchzusetzen. Daß die Herren der westlichen Satrapien zunächst allein mit Parmenions Heer fertigwerden mußten, das schon unter Philipp nach Asien gekommen war. Daß die meisten hellenischen Städte an der asiatischen Küste nicht bereit waren, einen Aufstand gegen die Perser zu wagen, solange Persiens Macht nicht gebrochen war.«
Der sterbende Philosoph schloß die Augen, als könne er so besser die Schätze seiner Erinnerung überprüfen. Schnell, halblaut, mit wohlerwogenen Sätzen schilderte er die Lage, die Alexander zwölfeinhalb Jahre zuvor hatte erkennen und verändern müssen.
Nach der Hinrichtung des Verräters Attalos war Parmenion, nun alleiniger Befehlshaber des Heers in Asien, weit nach Süden vorgestoßen. Die Satrapen des Westens ließen sich Zeit mit dem Gegenstoß; zu klein war Parmenions Heer, als daß es sie allzu sehr beunruhigt hätte, trotz der List und Kühnheit des Feldherrn. Persische Kerntruppen, verstärkt von Aushebungen in den Küstenländern und einer großen Anzahl hellenischer Söldner unter der Führung des erfahrenen Memnon, brachten Parmenion zum Stehen und trieben ihn langsam zurück nach Norden, zum Hellespont, wo er sich mit seinen Kämpfern für den Winter verschanzte. Die persischen Kräfte, auf verschiedene Winterlager verteilt, waren zu weit entfernt, um Alexanders Übergang zu behindern; und Alexander kam früher als erwartet, als das Frühjahr kaum begonnen hatte. Wären sie näher gewesen, hätten sie den Übergang dennoch kaum verhindern können – Parmenions Heer konnte ihn abschirmen, oder es konnte aufbrechen und die Perser hinter sich herziehen.
»All dies«, sagte Aristoteles, »war zwei Jahre lang in allen Einzelheiten vorbereitet und geplant worden. Mit Landkarten, auf denen die Wege und Höhenzüge und Pässe verzeichnet waren, mit genauer Kenntnis aller Brunnen, aller Dörfer, aller Städte und ihrer Befestigungen; mit eingehenden Erforschungen der Familienverhältnisse und des Besitzes aller persischen Fürsten. Mit Berechnungen darüber, wieviel Vorrat und Kriegsgerät zu welcher Zeit an welchen Ort geliefert, welche Festungen und befestigten Häfen zuerst erobert, eh, befreit werden sollten. Und mit den Zielen.«
»Was waren diese Ziele – deiner Meinung nach?«
Aristoteles lächelte spöttisch. »Meiner Meinung nach? Frag nach meinem Wissen, Freund, nicht nach Vermutungen. Bei einigen Beratungen war ich anwesend, da ich einige Landstriche südlich der Troas – Mysien und Lydien – gut kannte. Von anderen Beratungen weiß ich, weil mir davon berichtet wurde. Nein, keine Meinung – Wissen, Peukestas. Ziel des großen hellenischen Rachefeldzugs gegen Persien zur Tilgung der alten Schmach – Rache für die Entweihung hellenischer Heiligtümer durch Xerxes – war von Anfang an die Eroberung oder Befreiung der hellenisch besiedelten Küstenlande, bis ins nördliche Syrien, zum Oberlauf des Euphrat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.«
Peukestas kaute darauf, und auf kaltem Fleisch. Er schluckte schwer. »Alexander hat aber doch von Anfang an ...«
Aristoteles unterbrach mit einer ruckartigen Handbewegung. »Er hat davon gesprochen – er und einige seiner jungen Freunde. Aber: Alle Vorbereitungen, alle Planungen endeten irgendwo in Kilikien. Niemand hat wirklich daran gedacht, nach Babylon oder gar Persepolis zu gehen. Der große hellenische Rachefeldzug, auf Betreiben Philipps und des alten, toten Isokrates vom Bundesrat in Korinth beschlossen, sollte nicht ins persische Herzland führen, sondern die Barbaren aus den hellenisch besiedelten Teilen Asiens vertreiben. Außerdem war für alles andere kein Geld da. Nicht einmal für den Beginn.«
»Ich weiß. Alexander hat später davon gesprochen. Daß er beim Übergang nur ein paar hundert Talente hatte, aber zweimal soviel Schulden.«
Aristoteles stieß ein trockenes Kichern aus. »Dann, junger Freund, vergiß die hübschen Erzählungen und bedenk die Vergabe neueroberten Landes in Thrakien noch einmal. Alexander wußte genau, wie die Leute denken. Wenn er diese neuen Königsländer seinen Freunden und Fürsten, oder auch reichen Händlern, verkauft hätte, um Geld für den Feldzug zu bekommen, hätten wahrscheinlich alle gesagt, das ist in Ordnung, wir verstehen das, es muß so sein; es hätte aber keinerlei Glanz darauf gelegen, und keine Tugend. Deshalb, Peukestas, hat er seinen Fürsten und Freunden, Gefährten und Offizieren die Ländereien geschenkt. Eine wahrlich königliche Handlung. Glanz, Ruhm, Preis und edelste Tugendhaftigkeit. Und nachdem er sie beschenkt hatte, konnten die Empfänger sich kaum weigern, ihm Geld zu leihen. Geld, Waffen, Vorräte. Das war Alexanders Großmut – in diesem Fall.«
Peukestas leerte seinen Becher, füllte ihn wieder aus dem Wasserkrug, den er in der Hand behielt. Einige Augenblicke spielte er scheinbar zerstreut mit dem Gefäß; dann setzte er es ab und sagte: »Ich kann ihn nicht tadeln.«
»Wer spricht von Tadel? Er hat klug gehandelt. Kluge Handlungen sind oft jene, die sich am wenigsten für schöne Geschichten zur Erbauung der Leute eignen. Aber auch die schönen Geschichten entspringen einer sehr klugen Handlung.«
Peukestas lächelte flüchtig. »Du meinst Kallisthenes?«
»Mein Neffe. Eitel, selbstgefällig, scharfzüngig und in das Drechseln feiner Sätze verliebt. Ihm hat es nichts ausgemacht, Vorgänge ein wenig zu verändern, solange sich das Ergebnis gut las. In seinen Briefen nach Athen hat er die Dinge so dargestellt, wie Alexander sie dargestellt haben wollte; dafür hat der König ihn nicht daran gehindert, hier und da bissige Bemerkungen einzuflechten; sie machten alles ja nur wahrscheinlicher. Kallisthenes, lorbeerbekränzter Historiograph, Neffe des Aristoteles – wer hätte den Hellenen besser die Taten des Makedonen verkaufen können? – Aber ich bin müde ... müde. Der Schatten schwarzer Schwingen.«
Aristoteles wies auf das Gestell mit Rollen, die nicht verbrannt werden sollten. »Nimm die aus dem oberen Fach. Schreiben von Dymas, Drakon, Kallisthenes, Ptolemaios. Lies; und dann frag.«
Am Nordufer des Hellespont, bei Sestos, liefen einige Tage lang alle Fäden zusammen. Die Stadt lag Parmenions Brückenkopf in Asien gegenüber; im Hafen und den angrenzenden Buchten hatten sich die Schiffe zur Versorgung und Beförderung des Heers gesammelt.
Dymas überbrachte Grüße an Parmenion: von Antipatros und Aristoteles. Er tat dies am ersten Abend, als Alexander und seine wichtigsten Berater im Lager außerhalb von Sestos mit dem alten Strategen zusammentrafen. Zu Beginn des nicht eben üppigen Mahls – Brotfladen, Trockenobst, Trockenfisch, Wein und Wasser – im schmucklosen Zelt des Königs sang Dymas, von Demaratos bedrängt, zwei oder drei Tanzlieder mit spöttischen Versen. Er beobachtete den Korinther, der Parmenion etwas zuflüsterte; wahrscheinlich etwas über Dymas’ Vorleben, denn der alte Stratege musterte ihn anschließend aufmerksamer, als die bloße Musik es verlangt hätte, und lud ihn ein, »drüben in Asien« die Gastfreundschaft seines Zelts zu genießen.
Alexander wirkte zerstreut, in Gedanken längst auf dem jenseitigen Ufer. Er aß kaum, trank nur Wasser, hörte zu, schlüpfte dann – wie ein Schauspieler die Masken wechselt – nacheinander in mehrere Rollen: der junge König, der besorgte Männerführer, der gute Freund (Hephaistion saß neben ihm), der Bedächtige, der Verwegene, der Vorausblickende, der Zaudernde. Parmenion und Demaratos tauschten Kenntnisse und Ergebnisse der Fernaufklärung aus. Arsites, der Satrap des Hellespontischen Phrygien, Arsamenes aus Kilikien und Spithridates, Herr der lydischen und ionischen Satrapie, hatten sich mit dem rhodischen Söldnerführer Memnon und den übrigen wichtigen Beratern in Zeleia versammelt, jenseits des Flusses Granikos. Der größte Teil der hellespontischen Küste, von Perkote über Arisbe und das Sestos gegenüberliegende Abydos bis hinab zur Ebene von Ilion war gesichert, hellenisch, freundlich und von kleinen makedonischen Besatzungen gehalten; Parmenions verschanztes Winterlager befand sich an einer Bucht außerhalb von Abydos. Das Heer der Satrapen beherrschte das Hinterland und die Küste im Nordosten, ab der Stadt Lampsakos. Die fast ausschließlich phönikische Flotte des Großkönigs war weit entfernt: Nichts und niemand würde den Übergang nach Asien hemmen oder gar verhindern können. Alexander, der eben noch mit schmachtendem Blick an Hephaistions Lippen gehangen hatte, wurde zum kühlen Strategen; halblaut, aber scharf sagte er etwas zu Demaratos und Parmenion. Der alte Makedone hob die Brauen, der Korinther zuckte zusammen, dann lachten beide und nickten, wobei sie sich keine Mühe gaben, ihr Erstaunen zu verbergen.
Dymas verließ die Versammlung bald; draußen war es noch nicht völlig dunkel. Er hätte zu gern gewußt, was Alexander gesagt hatte, aber im Lärm der übrigen Zechgäste war es nicht zu hören gewesen. Er suchte Tekhnef und fand sie bei den Pferden. Sie hockte auf ihrem ledernen Gepäckbeutel und spielte leise auf der Doppelflöte; es klang nach neuen, noch nicht ausreichend biegsamen Stimmblättchen.
Die große, schlanke Frau mit schwarzer Haut, kurzem Kraushaar und tiefen Stammeskerben auf den Wangen erregte einiges Aufsehen in den Hafenschänken von Sestos. Nach der langen Zeit mit Alexanders Heer – seit Pella hatten sie nur die Kämpfer und den Troß gesehen – wollten Dymas und Tekhnef die Vorzüge der Stadt nutzen. Der Hafen wimmelte von Seeleuten und Händlern, die Geschäfte mit den Truppen beiderseits des Hellespont machten, aber für gute Musiker gab es Platz. In einem zweistöckigen Gasthaus am Kai fanden sie ein Zimmer, das fast nur aus dem breiten lederbespannten Bettgestell bestand, dazu Wein und Essen für ihre Musik, die Gäste anlockte, und viele der Zuhörer warfen Münzen in die Schale auf dem Tisch, hinter dem Tekhnef den Doppelaulos zu Dymas’ Kithara blies: schnelle, fröhliche, abwechslungsreiche Tanzweisen mit verwickelten Rhythmusänderungen. Ein Fischer setzte sich zu ihnen; er schlug eine fellbespannte Trommel und folgte ihnen durch die rhythmischen Labyrinthe, ohne sich oder sein schwarzzahniges Grinsen zu verlieren.
Am übernächsten Tag brach Alexander mit makedonischen Kerntruppen, etwa sechstausend Mann, nach Südwesten auf; das verwickelte, aufwendige, aber auch langwierige und langweilige Unternehmen des Übersetzens gab er in die Hände Parmenions und der beiden Stäbe. Dymas und Tekhnef schlossen sich dem König an, der nach Elaios zog, um von der gleichen Stelle wie die homerischen Helden nach Asien zu gelangen.
Es wurden Altäre errichtet, Trankopfer dargebracht, der Seher Aristandros verhieß unendliche Triumphe aufgrund der Lebern von Opfertieren und der Flugrichtung eines Vogelschwarms. Alexander und Hephaistion salbten und ölten sich, um tanzend den Gräbern von Achilles und Patroklos die gebührenden Ehren zu erweisen. Tekhnef wollte dem Schauspiel unbedingt beiwohnen; Dymas hatte weniger hochfliegende Wünsche und verabredete sich mit ihr für den Abend in Parmenions Zelt, etwa zwei Reitstunden nordöstlich im Winterlager. Als er aufbrach, sprach Alexander eben von den Vorzügen des großen Homeros, der – wiewohl Hellene – auch die edlen Gegner zu preisen vermocht hatte und den Sieg der Hellenen ja noch erhöhte, indem er darauf verzichtete, die besiegten Trojaner als asiatische Barbaren zu bezeichnen. Alexander schwor den versammelten Sechstausend, da zu beginnen, wo Achilles geendet hatte, und sie von Sieg zu Sieg zu führen; nur eines, sagte er, neide er dem Vieledlen Zornmütigen: daß er einen Sänger wie Homeros gehabt habe, denn was seien unsterbliche Taten, wenn sie nicht in würdiger Weise unsterblich bedichtet würden. Worauf Kallisthenes, wie üblich das Herz auf der Zunge, ein wenig spitz sagte, er wolle Prosa dreschen aus des Königs Großtaten – Verse seien für Halbgötter.
Dies trug sich kurz nach Sonnenaufgang zu. Als Dymas das Hügelgelände erreichte, in dem, unweit von Parmenions Winterlager, die neuen Kämpfer ihre Zelte aufgeschlagen hatten, waren dort viele erst beim Morgenmahl. Vor einem größeren Zelt mit purpurgesäumten Eingangsflügeln saß Alexanders Halbbruder Arridaios, von dem es hieß, er sei in seiner Jugend von Olympias vergiftet worden, damit er nicht als Erstgeborener, Sohn Philipps und der Tänzerin Philinna, Thronrechte beanspruchen könne. Arridaios galt als schwachsinnig oder bestenfalls halben Sinnes; Dymas hatte ihn sich immer als sabberndes Wrack vorgestellt. Er beobachtete ihn, vom Pferd aus, einen Moment lang sehr aufmerksam. Das Gesicht wirkte verschlossen, die Bewegungen beherrscht, und der Musiker fragte sich, ob nicht Arridaios ein weiterer Schauspieler war, einer von vielen, der die Maske des Blöden trug, um zu überleben, anders als viele edle Makedonen, Nebensprosse der königlichen Sippe.
Langsam ritt Dymas durch das geordnete Chaos des See-Lagers. Am mittleren Vormittag ging es eher ruhig zu. Die Morgenmahlzeit beendet, das Mittagessen noch nicht bereitet, zahlreiche Abteilungen zu Fuß, zu Pferd und mit Karren unterwegs, um im ausgebluteten Land noch etwas aufzutreiben, andere Einheiten zu besonderen Übungen irgendwo im Gelände; Fußkämpfer mit Schanzgeräten zerlegten Verhaue, lockerten und säuberten Pfosten, um sie auf Karren zu stapeln, und füllten an mehreren Stellen die zu Beginn des Winters ausgehobenen tiefen Gräben auf. In der Ebene außerhalb der Wälle suchten Tausende Reit- und Zugtiere nach übersehenen Halmen oder knabberten an Sträuchern und jungen Bäumen, deren Laub und Rinde sie längst abgeknabbert hatten. Um ins Lager zu gelangen, mußte Dymas den kleinen Bach durchqueren, der Parmenions Leute den Winter über mit Trinkwasser versorgt hatte und in die kleine Bucht mündete; jenseits des Lagers mündete dort auch der andere Bach, der, vom ersten abgeleitet, durch die Latrinen floß. Die Zelte des Berg-Lagers waren weißgraue und braune Tupfer in der Ferne.
Zwischen beiden Lagern verkehrten Meldereiter; und Leute vom jeweiligen Troß kamen und gingen, mit Fragen, Aufträgen, Listen, Gegenständen. Einige Feldbäckereien waren noch in Betrieb; zwei wurden, da sie genug ausgekühlt waren, für den morgigen Aufbruch zerlegt, Steine, Eisenplatten und Roste auf Karren geschleppt. Der Musiker schätzte, daß nicht einmal ein Drittel von Parmenions Leuten im Lager weilte; dennoch war es ein brodelndes, wimmelndes Chaos.
Ein Zug Troßsklaven, die Getreide, Früchte und Fisch zu einem der großen Kochplätze trugen, versperrte ihm den Weg. Dymas tätschelte den Hals seines Pferdes und spähte mit zusammengekniffenen Augen über die Träger hinweg. In der Mitte des Lagers, vor einem mit Holz verstärkten und verkleideten Zelt, sah er Parmenion an einem Tisch sitzen.
Als er endlich den kleinen Platz vor der Behausung des Strategen erreichte, glitt er von der Reitdecke, nahm den Sack, der all sein Gepäck enthielt, und die gefütterte Tasche mit der Kithara vom Rücken des Tiers und überließ es einem der halbwüchsigen Burschen. Nun erkannte er auch einige der anderen, die – mit dem Rücken zum Lager an Parmenions Tisch saßen: Philotas war dabei, der Sohn des Strategen, ein paar Schreiber, ein älterer makedonischer Reiterführer namens Lysandros, und der rundliche Hellene Eumenes. Auf dem Tisch, umgeben von Rollen und Schreibzeug, standen Becher und zwei Krüge, Wein und Wasser.
Parmenion blickte auf. »Ah, der edle Kitharode. Woher kommst du?«
Dymas deutete mit dem Daumen hinter sich. »Von Ilions trüben Auen, Herr der Schwerter.«
Parmenion grinste kurz. »Trübe Auen? Regnet es da, oder was?«
Dymas legte Sack und Kithara in eine Nische des Zelteingangs, setzte sich auf einen Hocker und goß Wasser und Wein in einen unbenutzten Becher.
»Auf dein Wohlergehen und deinen unsterblichen Ruhm, Stratege. Nein, es regnet nicht. Alexander hat heute früh Altäre errichten lassen; jetzt tanzen er und Hephaistion nackt und mit Kränzen im Haar um die Gräber von Achilles und Patroklos. Kallisthenes brüllt dazu Verse aus den Werken des hehren Homeros, und Aristandros zählt Krähen oder derlei.«
»Welch edles Tun«, sagte Eumenes. »Haben sie wenigstens zahlreiche Zuschauer?«
»Einige tausend Mann, ja. Rhythmisches Klatschen und alles, was dazugehört. Zum Lobe der Götter und Heroen. Inzwischen sind sie wahrscheinlich mit dem Tanzen fertig und plündern den Tempel der Athene.«
»Spotte nicht.« Parmenion faltete die Hände hinter dem Kopf, ächzte und drückte den Rücken durch. »Es sind die großen Gebärden, die das Heer liebt. Das Volk, ganz allgemein. Dann wird er also etwa jetzt seine Rüstung und seine Waffen der Athene weihen und zum Ausgleich dieses große Schwert empfangen, das man dort im Tempel gehütet hat? Das Schwert des Achilles?«
»Ich nehme an, damit sind sie inzwischen auch fertig. Was weißt du von diesem Schwert?«
Parmenion hob die Schultern; Philotas betrachtete seinen Vater von der Seite und lachte.
»Er mag es nicht sagen, also hörst du es von mir. Es gab da ein riesiges, rostiges, schartiges Ungeheuer von Schwert. Vor eineinhalb Jahren traf es sich, daß der Priester, der den Tempel hütete, sterbenskrank wurde; zufällig zu einem Zeitpunkt, als einer der vielen Freunde des Korinthers in der Nähe war. Da das Gebiet ...«
»... unter unserer Aufsicht stand«, sagte Parmenion, »und die Krankheit des Priesters eine war, die durch gewisse Kräuter bewirkt worden sein könnte ... Nun ja. Jedenfalls gab es einen neuen Priester, und durch die Wunder der Götter auch ein neues Schwert – nicht ganz so riesig, dafür aber ein scharfes, neues Wunderwerk der Kunst meines besten Waffenschmieds.«
Dymas schüttelte langsam den Kopf; dabei lächelte er. »Weiß er das?«
»Wer? Alexander?« Parmenion runzelte die Stirn. »Es war sein Einfall. Ein sehr guter dazu. Demaratos hat nur dafür gesorgt, daß die Idee durchgeführt werden konnte. – Dann werden sie also am mittleren Nachmittag hier sein, nehme ich an. Und wo ist deine schwarze Göttin?«
»Sie ergötzt sich am Anblick nackter Makedonenfürsten, der mich vertrieb. Sie wird mit ihnen herkommen. Ist für die Nacht vor dem Aufbruch Raum in einem der Zelte hier?«
Parmenion grunzte. »Seid meine Gäste. – Weiter, Eumenes.«
Der Hellene tippte mit dem zerkauten Schreibried auf eine Rolle. »Die Bedürfnisse der Heiler – vor allem Kräuter und reine Tücher. Es sind Berechnungen für die Zukunft; in den nächsten Tagen kann man sich darum kümmern. Die Schmiede jammern über zu wenig Eisen ...«
»Alle jammern immer.« Parmenion klang beinahe heiter. »Was ist das Nächste?«
Dymas stand auf, den Becher in der Hand. Er nickte den anderen zu und machte sich auf den Weg zu den Latrinen, um sich zu erleichtern. Bevor der Lagerlärm zu laut wurde, hörte er Eumenes über den Mangel an Brennstoff für Kochfeuer sprechen.
Als er von den Latrinen zum kleinen Hügel oberhalb der Bucht ging, ließ er sich den Becher neu füllen, an einem langen Tisch, wo Sklaven und Köche die Speisung der Offiziere vorbereiteten.
Vom Hügel hatte er sich einen weiten Blick auf den Hellespont erhofft, aber es war ein dunstiger Tag. In der Bucht lagen einige kleinere Lastkähne, teils im Wasser, teils halb auf dem Strand. Weiter draußen glitzerten zahlreiche Segel durch den dünnen Dunst nahe dem asiatischen Ufer; wie viele Schiffe es insgesamt sein mochten, ließ sich nicht schätzen. Zum ersten Mal bedachte Dymas die ungeheuren Schwierigkeiten der Versorgung. Das Heer befand sich nicht auf feindlichem Gebiet; das nördliche, Hellespontische Phrygien unterstand persischen Satrapen, war aber größtenteils von Hellenen besiedelt. Abydos und Arisbe, ebenso Perkote weiter nordöstlich, waren hellenische Gründungen mit hellenischer Bevölkerung und kleinen makedonischen Besatzungen, die Parmenion dorthin geschickt hatte. Städte, auf deren Hilfe und guten Willen man angewiesen war, und auf deren Lieferungen; Städte, deren fruchtbares Umland von Bauern bearbeitet wurde, die ebenfalls Hellenen waren. Unmöglich, zu Beginn eines großhellenischen Feldzugs solche Gebiete zu plündern. Außerdem war das Frühjahr noch jung; abgesehen von Gras für die Tiere gab es kaum etwas, das man hätte plündern können. Die Erntezeit war weit.
An Bord eines Kahns in der Bucht meckerten Schafe und Ziegen. Ein älterer Mann beugte sich über die Bordwand, winkte zu Dymas herauf, lupfte seinen Chiton und pißte einen scharfen Strahl ins Uferwasser.
Vor Parmenions Zelt hatten sich die Schreiber bis auf einen verzogen; Parmenion und Eumenes gingen die Mannschaftslisten durch, Philotas und Lysandros redeten leise über Vorfälle bei der Überfahrt. Dymas packte die Kithara aus, setzte sich auf den Schemel und begann zu stimmen, während Eumenes und Parmenion ihre Zahlen verglichen. Sie waren gleichermaßen schwindelerregend wie unglaubwürdig.
Parmenions Heer bestand noch aus 11 000 Fußkämpfern und 1000 Reitern, sämtlich Makedonen; nun kamen die Truppen Alexanders dazu. An Fußkämpfern waren es 12 000 Makedonen; 7000 Stammeskrieger – Odrysen, Triballer und andere – von den Grenzen Makedoniens, bewaffnet und ausgebildet wie die makedonischen Kämpfer; 5000 Söldner; 1000 Bogenschützen und Agrianen, die zähen Schleuderer und Speerkämpfer aus dem Norden; und 7000 Krieger aus Städten des hellenischen Bundes. Bei den Berittenen waren nur 600 Hellenen, davon 200 Athener; ferner 1800 Makedonen, 1800 Thessalier und 900 thrakische und paionische Krieger, leichte Reiter für Erkundungen und Aufklärung. Zusammen 43 000 Fußkämpfer und 6100 Reiter.
Dymas hatte nach dem Stimmen begonnen, ein kleines leichtes Tanzstück zu spielen; er brach in einem schrillen Mißklang ab. Eumenes drehte sich zu ihm um und fletschte die Zähne; Parmenion blickte auf.
»Es tut weh«, sagte der dicke Hellene.
»Mir auch.« Dymas schob die Kithara in die Ledertasche. »Wo sind all die makedonischen Krieger der letzten Jahre geblieben? Und – zweihundert Reiter aus Athen, die paar Bundeskrieger aus anderen Gegenden: Ist das der große gesamthellenische Rachefeldzug?«
Eumenes grinste. »Ich als Hellene weiß sehr gut, weshalb dies so ist, wie es ist.« Er wandte sich wieder zum Tisch und zu den Rollen.
»Warum ist es so? Edles Mißtrauen?«
Parmenion zuckte mit den Schultern. »Edel? Nichts an alledem ist geheim; sonst könntest du nicht hier sitzen. Auch das Mißtrauen ist nicht geheim, Dymas. Alexander hat zwölftausend erfahrene Fußkämpfer und tausendfünfhundert Berittene bei Antipatros zurückgelassen, dazu etwa fünf- oder sechstausend Mann, die in hellenischen Städten als Besatzungen liegen. Das ist wegen der großen Liebe zwischen Hellenen und Makedonen. Wir haben eine Flotte zusammengekratzt, die uns, so gut es geht, den Rücken freihalten soll. Zehn makedonische Trieren, hundertdreißig Schiffe von überall her, und zwanzig aus Athen ...«
»Athen hat doch allein mehr als zweihundert Kriegsschiffe!«
»Möchtest du von einer Flotte abhängig sein, deren Treue nicht sicher ist? Was, wenn die guten Kampfschiffe der Perser kommen, gebaut und bemannt von erfahrenen phönikischen Seeleuten, und zweihundert athenische Trieren beschließen, daß ihnen die Perser eigentlich doch lieber sind als die Makedonen? Vielleicht, nachdem sie ein liebevolles Schreiben von Demosthenes erhalten haben?« Der Stratege beugte sich vor und hieb mit einer Papyrosrolle auf den Tisch. »Möchtest du, wenn du König oder Stratege wärst, durch Asien ziehen, Dymas, mit einer großen Menge unzuverlässiger Kämpfer? Die Perser haben fast zehntausend hellenische Söldner, gute Männer, geführt von einem guten und klugen Strategen, Memnon. Wenn es zur Schlacht kommt, können wir uns auf unsere Söldner, die Stammeskrieger und die Makedonen verlassen. Und die Thessalier, natürlich. Die Hellenen? Wir werden sie gut aufteilen, so, daß sie vielleicht keinen Nutzen bringen, aber jedenfalls keinen Schaden anrichten können. Wenn ich zehntausend hellenische Hopliten hätte, würde ich gar nicht in den Kampf ziehen; dann könnten wir uns gleich ergeben. Sie würden nämlich sofort überlaufen.«
»Weiter!« Eumenes fuchtelte mit Rollen und Schreibried. »Wir haben noch viel zu erledigen.«
Lysandros und Philotas hatten aufmerksam gelauscht; nun redeten sie wieder leise miteinander, während Parmenion und Eumenes die übrigen Listen verglichen, abstimmten und fortlegten. Dymas hörte zu, überwältigt von Zahlen und Notwendigkeiten. Für die 6100 berittenen Kämpfer gab es etwas mehr als 8000 Pferde, dazu je 2000 Zug- und Packtiere des Trosses. Die Anzahl der Köche, Sklaven, Bäcker, Schmiede, Lederwerker, Heiler, Helfer, Knaben, Treiber, Dirnen, Priester, Schreiber, Schreiner, Landvermesser, Musiker, Gaukler, Kräutersammler, Straßenbauer, Baumeister, Schauspieler, Bader, Belagerer, Bartscherer und all der anderen Nichtkämpfer belief sich auf fast 15 000 Menschen – zusammengefaßt unter Troß. Nach Eumenes’ Berechnungen brauchte ein Mann etwa eineinhalb choinikes Getreide am Tag, ein Pferd oder Maultier fünf choinikes; je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit mußten Gras oder Grünfutter in gleicher Menge für die Tiere beschafft werden, falls sie nicht grasen konnten, und für die Menschen brauchte man Früchte, Gemüse, Fisch, Fleisch: Dinge, die nicht lange aufbewahrt und deshalb immer nur durch Zukauf oder Plünderung beschafft werden konnten. Im fruchtbaren, grünen Nordphrygien war auch im Frühjahr Weideland ebenso reichlich vorhanden wie Wasser, so daß die Versorgung vor allem Getreide betraf. 12 000 Tiere brauchten jeden Tag etwa 60 000 choinikes Korn, 65 000 Menschen noch einmal 100 000 oder etwas weniger – zusammen über 3000 Medimnen für einen Tag.
»Wir werden morgen früh noch etwa dreißigtausend Medimnen haben, zehn Tage Vorrat, wie gewünscht«, sagte Eumenes. Er schien zufrieden. »Solange wir den Hellespont entlangziehen, können wir die Schafe und Rinder, die auf den Kähnen lärmen, nach Bedarf schlachten, und mit ein wenig Glück liefern uns Abydos, Arisbe und Perkote noch ein wenig dazu. Gut. Was ...«
Dymas berührte ihn an der Schulter. »Zehn Tage? Warum nicht mehr?«
Eumenes seufzte. »Es wäre schön, wenn du einfach schweigend zuhören könntest, Kitharode. Um mehr mitzunehmen, braucht man entsprechend mehr Tiere, die wieder mehr zu fressen brauchen. Das Verhältnis wird dann ungünstig. Noch etwas? Oder können wir jetzt weitermachen?«
Dymas lachte. »Eines noch, edler Eumenes. Warum nehmt ihr keine großen Herden mit – Rinder, Schafe, Ziegen?«
»Die fressen nur bei Tag. Aber wir brauchen die Tage, um Strecken zurückzulegen. Klar? Also, wie steht es mit dem Geld, Parmenion?«
Der Stratege knurrte leise. »Schlecht, wie sonst? Wie es sich für edle Makedonen gehört, denen der Fürstendienst eine Lust ist, leben die meisten Offiziere von eigenem Vermögen. Parmenion bezieht keinen Sold. Mich könnte sowieso keiner nach Wert bezahlen.« Er grinste schwach. »Die Soldkiste ist so gut wie leer, Eumenes. Bis jetzt sind die Männer bezahlt, und vielleicht reicht es noch einmal für drei oder vier Tage. Meine Männer, wohlgemerkt. Wieviel hat Alexander mitgebracht?«
»Siebzig Talente«, sagte Eumenes leise, fast verschämt.
Lysandros sog scharf die Luft zwischen den Zähnen ein; Philotas nickte langsam, und Parmenion schloß einen Moment die Augen.
»Siebzig Talente?« sagte er dann. »Laß mich rechnen.«
Er runzelte die Stirn; Eumenes kritzelte mit dem Ried auf einem Papyrosfetzen, und Dymas überschlug die Zahlen. Die Söldner mochten eineinhalb Drachmen am Tag bekommen, die einfachen Hopliten eine, die Reiter zwei, mit Abzügen für unerfahrene Hellenen und Zuschlägen für Altgediente.
»Etwa sechzigtausend – zehn Talente am Tag. In sieben Tagen, oder in acht, können wir also keinen Sold mehr zahlen?« Parmenion klang weniger erstaunt als müde.
»So ist es, edler Stratege.« Eumenes stand auf und klemmte Rollen unter den Arm; die übrigen nahm sein Schreiber. »Nun denn. Nachdem wir also alles abgeglichen und vereinigt haben ... Wir sehen uns.«
Parmenion nickte. »Wird sich nicht vermeiden lassen, Hellene.« Er blickte den beiden nach; Lysandros räusperte sich.
»Darf ich sprechen?«
»Natürlich; warum mußt du fragen?«
Philotas lachte. »Weil du der Stratege bist, Vater, und ich einer von Alexanders Gefährten, und Lysandros hat vermutlich etwas Unerfreuliches auf dem Herzen.«
Parmenion hob die Schultern. »Sprich. Das ist immer das Recht der Edlen und der Offiziere gewesen. Der König ist nur einer von uns.«
Lysandros wies auf das Lager allgemein. »Es gibt einige Unruhe unter den Männern.«
Parmenion kniff die Augen zusammen. »Ich dachte, ihr wärt alle ausgeruht.«
»Kein Scherz, Herr. Den Männern ist vieles gleichgültig, aber einige, und fast alle Offiziere, sind nicht glücklich darüber, daß all diese Hellenen jetzt zum Heer gehören.«
Philotas lächelte, aber als er sprach, war seine Stimme scharf. »Du meinst also, wir sollten sie alle wegschicken, Dymas und Eumenes auch, und nur vollblütige Makedonen behalten? Vielleicht Alexander als Ausnahme zulassen, weil er zwar nur halb Makedone ist und halb Molosser, aber immerhin ganz König? Was sind denn die anderen für dich – Vieh?«
Lysandros verzog keine Miene. »Natürlich nicht. Aber sie sollten höchstens als Kämpfer mitmachen, Hopliten, Peltasten, was auch immer, keinesfalls als Offiziere. Ich meine, am Schluß, wer weiß, kommt vielleicht noch jemand auf den Gedanken, Perser oder Ägypter oder überhaupt Barbaren zu Offizieren zu machen, und das wäre das Ende.«
»Ach, wäre es das?« sagte Parmenion. »Das Ende wovon genau?«
»Das Ende dieses großen und ruhmreichen Heeres.«
»Sorg dich nicht um dieses Heer, Freund. Heere enden in der Regel durch Niederlagen, oder durch Zersetzung, nicht aber dadurch, daß sie gute Kämpfer aufnehmen, die zufällig eine andere Sprache sprechen. Noch was?«
Lysandros nickte und beugte sich vor; er sprach nun fast vertraulich, mit einem schrägen Seitenblick auf den Musiker. »Ja, noch was. Seit zwanzig Jahren kämpfen wir jetzt zusammen, Parmenion. Kämpfen, marschieren, bluten, sterben ...«
Philotas gluckste. »Persönlich gestorben bist du aber selten.«
Pharmenion schüttelte den Kopf. »Sei still, Junge. – Was ist mit diesen zwanzig Jahren?«
»In dieser ganzen Zeit haben wir immer gewußt, was wir tun, worum es geht. Makedoniens Grenzen sichern, den Frieden sicherer machen, derlei. Und wir haben immer unseren Sold erhalten, früher oder später. Jetzt wissen wir nicht, um was es geht. Dieses Gerede, von wegen Rachefeldzug gegen Persien im Auftrag aller Hellenen, bah. Wir haben keine Ahnung, was auf uns wartet, aber wir wissen genau, daß bald kein Geld mehr da ist.«
Philotas öffnete den Mund, wütend, schwieg aber, als Parmenion ihn scharf ansah. Der Stratege schien ungerührt, fast heiter.
»Also, was Geld angeht – hast du Hunger, Durst, fehlt dir was? Nein? Gut, dann kann es ja nicht so schlimm sein, edler Fürst, Offizier, Makedone Lysandros. Und – um was es geht, wohin wir gehen? Eines ist: Geld. Alles Gold Persiens. Das Gold, das die Perser genommen haben, als sie die hellenischen Städte Asiens eroberten, als sie Hellas und Makedonien und die Tempel überall geplündert haben. Seit fast zweihundert Jahren waren sie eine Bedrohung, für uns alle, Hellenen und makedonische Hellenen, um es sauber auszudrücken. Wir werden diese Bedrohung jetzt beseitigen und alle befreien, die von den Persern unterdrückt waren. Und das, Freund Lysandros, wird uns Ehre einbringen, unsterblichen Ruhm, und mehr als unsterbliche Mengen Gold. Überleg mal – geh zwanzig Jahre zurück. Was warst du damals?«
Lysandros lächelte. »Jünger.«
»Ah, wohl wahr, gilt für uns alle. Du hast in einer schäbigen kleinen Burg an der sumpfigen Grenze gehockt; die meisten deiner Mitkämpfer waren Schafhüter, Söhne von Schafhütern und dazu verurteilt, Väter und Großväter von Schafhütern zu sein, die immer ängstlich Ausschau halten nach dem nächsten Essen, immer in Sorge wegen des nächsten Barbareneinfalls, der das Dorf zerstören würde. Philipp hat Krieger aus euch gemacht, die Grenzen und die Dörfer sind sicher. Kein Barbar wagt Makedonien anzugreifen. Und jetzt sehnst du dich nach deinen alten Lebensumständen? Noch etwas. Es ist kaum ein Jahr her, da gab es hier zwei Heere. Weißt du noch?«
Lysandros nickte langsam. »Ich hatte es fast vergessen.«
»Attalos und seine Männer, alle Makedonen, aber mehr einer bestimmten Sippe und ihren Absichten verbunden. Und wir. Jetzt, nach etwas mehr als einem Jahr mit Märschen, Angriffen, Rückschlägen, sehe ich keinen Unterschied mehr; ich sehe nur noch Makedonen. Und das« – er wies ungefähr nach Südwesten – »ist Troja. Das heilige Ilion. Wo Hellenen und asiatische Barbaren zehn Jahre lang kämpften. Unsere Vorfahren haben zehn Jahre gebraucht, um eine einzige Stadt zu erobern. Wir werden nicht einmal fünf Jahre benötigen, um alle Länder bis zum Euphrat zu befreien. In fünf Jahren werdet ihr alle reich sein, ihr werdet in Gold baden und nach Silber stinken. Dann, in fünf Jahren, komm wieder und erzähl mir vom Unterschied zwischen Makedonen und Hellenen im Heer. Heute bin ich sehr mild, mein Freund. Wenn du es bis dahin nicht besser weißt, in fünf Jahren, Lysandros, werde ich dir eigenhändig den Arsch aufreißen und geschmolzenes Gold hineingießen. Und jetzt geh mir aus den Augen.«
Als Lysandros gegangen war, begann Philotas leise zu lachen.
»Was erheitert dich, Sohn?«
Philotas stand auf, kam zum Tisch und legte die Rechte auf seines Vaters Schulter. »Ich habe selten einen so überzeugend etwas vertreten hören, woran er nicht glaubt.«
Parmenion ächzte leise. »Ich fürchte, du wirst mich noch oft Dinge verkaufen hören, die ich selbst nicht haben will.«
Philotas wurde ernst. »Was denn?«
»Diese wunderbare, biegsame, tödliche Waffe ...« Er blickte über das Lager, zu den kaum sichtbaren Zelten am Hang der Hügelkette. »Noch ist es das Heer, das Philipp, Antipatros und Parmenion geschmiedet und geführt haben. Mit den alten Offizieren und der alten Kampfkraft. Noch. Du kennst ihn doch besser, Junge. Weißt du, was er plant? Mit euch?«
»Wen meinst du – wer ist ›euch‹?«
»Die jungen Gefährten. Die Zöglinge von Mieza. Die hetairoi Alexanders. Nicht die hetairoi des Königs; das sind alle edlen Makedonen. Ich meine euch, die jungen Löwen.«
Philotas lachte, versuchte ein Löwengebrüll auszustoßen, wie er es bei den Vorführungen wandernder Tierbändiger gehört hatte, ließ sich dann auf einen der Schemel fallen.
»Nichts hat er mit uns vor, Vater. Er wägt die Dinge und entscheidet nach Sinn und Ziel, nicht nach Vorlieben. Aber das weißt du doch ebenso gut wie ich.«
»Ich weiß es? Vielleicht wage ich nicht, zu glauben, was ich nicht genau weiß.«
Philotas beugte sich vor und starrte in die Augen seines Vaters. Dymas blickte wie gefesselt hin. Für einen Moment wirkte Parmenion unendlich alt, unendlich müde.
»Dann will ich es dir sagen. Einer, ich weiß nicht mehr wer, Leonnatos oder Meleagros, vielleicht auch Perdikkas, hat ihn gefragt – noch drüben, vor dem Übergang –, was unsere Aufgabe im Heer der Alten sein solle. Und Alexander sagte: ›Gehorchen und euch empordienen. Im Krieg gibt es keine Freunde, nur gute und schlechte Offiziere. Wer Antigonos oder gar Parmenion ersetzen will, muß sie erst einmal übertreffen.‹ Reicht dir das?«
Parmenion nickte. »Vorläufig.«
Dymas räusperte sich. »Der dumme Musiker bittet, fragen zu dürfen ...«
»Frag.«
»Was ist die Treue des edlen Parmenion?«
Der Stratege betrachtete ihn lange und eindringlich; dann sagte er, beinahe tonlos: »Parmenions Treue gehört Makedonien. Und dem König, der Makedonien verkörpert.«
Philotas holte Luft, schwieg aber. Dymas sog Fleisch der rechten Wange zwischen die Backenzähne und kaute einen Moment darauf. Dann lachte er.
»Eine gute Antwort auf eine schlechte Frage, Herr. – Ich nehme an, du legst keinen Wert darauf, daß ich die Zahlen und Überlegungen der edlen Herren Parmenion und Eumenes in Verse gieße und in den Lagern singe.«
Parmenion hob nur kurz die Brauen.
»Und nun?« sagte Dymas leise. »Zehn Tage Vorräte, sieben Tage Sold. Was wird dann?«
Philotas rümpfte die Nase. »Das entscheidet der König.«
»Was könnt ihr tun?«
Parmenion bleckte die Zähne; sie waren nicht mehr vollzählig, und einige sahen finster aus. »Tun? Warten. Marschieren. Hoffen.«
»Hoffen? Worauf?«
»Auf die persischen Satrapen. Daß sie uns schnell eine Schlacht liefern.«
»Und wenn nicht?«
Parmenion breitete die Arme aus. »Sind wir erledigt.«
Parmenion war die halbe Nacht mit Alexander in den Lagern unterwegs. Dymas und Tekhnef nutzten die Zeit, das Zelt und die Nähe. Die schwarze Südägypterin fühlte sich allerdings nicht besonders wohl in der rein makedonischen Umgebung des Strategen, wie sie sagte; sie zöge es vor, die nächsten Tage und Nächte bei anderen Heeresteilen zu verbringen. Dymas stimmte zu; ihm war es gleichgültig.
Das Zelt Parmenions, des Fürsten und Strategen, war karg. Die für den Winter an der Wetterseite angebrachte Holzverschalung und der hölzerne Vorbau stellten die einzigen Formen von Schwelgerei dar. Im Inneren gab es strohgefüllte Säcke, zusammengenähte Häute und ein paar Felle; leichte Truhen – Holzrahmen, mit Leder bespannt – zur Aufbewahrung von Kleidung, Schreibzeug und anderen notwendigen Dingen; Klappstühle und Klapptische; und Waffen. Auf einem der Tische standen ein Krug mit einem Viertel Wein und drei Vierteln Wasser, ein paar Becher, ein Brettchen mit Brot, kaltem Fleisch und Trockenobst, und ein Öllicht.
Dymas und Tekhnef hatten fast geschlafen, als der Stratege kam. Er knurrte etwas, trank ohne abzusetzen einen Becher leer, wickelte sich in seinen Umhang und streckte sich auf Säcken und Häuten aus. Als der Lagerlärm sie weckte, war Parmenion schon wieder verschwunden.
Dymas hatte einen umfangreichen Haushalt erwartet: Köche, Bader, Sklaven, vor allem eine Gruppe von Fürstenknaben: Söhne der edlen Gefährten des makedonischen Herrschers, die im Leibdienst zugleich auch ihre Ausbildung als künftige Offiziere und hetairoi erhielten, Unterpfand der Treue ihrer Väter und gelegentlich Gefäße der Lust des jeweiligen Herrn und Besitzers. Aber Parmenion vertraute seinen Schlaf, seine Ernährung und seine Sicherheit ergrauten Kriegern an, zumeist Thessaliern, zum Kämpfen zu alt und zur Heimkehr zu heimatlos. Einer von ihnen brachte Dymas und Tekhnef ein kleines Metallbecken mit kaltem Wasser, zur Reinigung, und trug das Tischchen mit dem nächtlichen Essensvorrat hinaus, unter das Vordach.
Das Feldherrnzelt war eine Insel im Chaos des Aufbruchs. Mindestens die Hälfte aller Abteilungen war bereits abmarschiert, aber dadurch schien sich die Zahl der im Lager befindlichen Kämpfer verdoppelt zu haben. Melder zu Fuß und zu Pferd woben ein undurchschaubares Gewirk von Fäden zwischen Einheiten, die schon unterwegs waren, Truppenteilen, die erst losmarschieren sollten, Troß und Versorgung, den Lastschiffen, die sämtlich noch in der Bucht lagen, den Verbänden in den Hügeln, den Reitergruppen, die mit dunklen Aufträgen in der Ebene umherzogen, den Stäben, die nicht dort waren, wo sie sein sollten ...
Tekhnef setzte sich mit dem Rücken zum Lager; sie trank verdünnten Wein und aß Brot, kaltes Fleisch und ein wenig Obst. Dymas, stehend, war zu neugierig und zu aufgeregt, zwang sich aber zu einer Art Frühstück, wobei er den alten Thessalier mit Fragen löcherte.
Als Parmenion erschien, mit einem Schweif aus Offizieren, Helfern, Meldern und Männern des Trosses, tauchte ein großer, schlanker, dunkelhaariger Mann auf, mit dem Dymas schon einmal flüchtig zu tun gehabt hatte: Kleitos der Schwarze, einer der Führer der Hetairenreiter, aus Alexanders engstem Stab, hoher Offizier schon unter Philipp. Er nickte dem Musiker zu, lächelte Tekhnef an und schnippte mit den Fingern, um Parmenions Aufmerksamkeit zu erhalten.
Der Stratege hob die Hand, erteilte noch ein paar Befehle, entließ dann alle anderen und kam zum kleinen wackligen Tisch, auf dem ein Metallnapf stand. Er enthielt vielleicht eine halbe choinix Getreide; die Körner schwammen in einer Brühe aus Wein, Wasser und Kräutern und hatten zu quellen begonnen: Parmenions Morgenmahl.
»Gut geschlafen?« Er zwinkerte Dymas und Tekhnef zu. »Ihr müßt die geringe Gastlichkeit vergeben, aber ...« Dann wandte er sich an Kleitos. »Was gibt’s? Alles unterwegs?«
Kleitos ließ sich von dem Thessalier einen Becher reichen, nippte, runzelte die Stirn. »Dünnes Gesöff. – Ja, alles unterwegs. Das Hauptlager bei Arisbe ist aufgelöst; Alexander ist jetzt wahrscheinlich vor Perkote.«
»Neuigkeiten?« Parmenion schlürfte aus dem Napf, kaute gründlich, schluckte; all dies, ohne sich zu setzen oder das Lager einen Moment aus den Augen zu verlieren.
»Alles wie gewünscht.« Kleitos grinste. »Sind wir unter uns?«
Parmenion warf Dymas einen Blick zu. »Sind wir?«
Dymas deutete mit dem Becher auf Tekhnef. »Sie weiß, was ich weiß.«
»Gut.« Kleitos sah sich nach einem Stuhl oder Schemel um, setzte sich und blinzelte zu Parmenion auf. »Ein Schnellsegler. Die Güter von Arsites bei Daskyleion sind niedergebrannt; die von Memnon bei Lampsakos werden gehütet wie... ach, wie auch immer. Demaratos schwört, daß die besprochenen Mitteilungen inzwischen in Zeleia sind; die Perser wissen jetzt alles, was sie wissen sollen.«
»Sind das die geheimen Reden, die ihr drüben, bei Sestos, ausgetauscht habt?« sagte Dymas.
Parmenion rümpfte die Nase. »Du bist sehr aufmerksam. Ja, darum ging es – teilweise. Aber du hast doch bestimmt noch mehr, oder?«
Kleitos kicherte. »Kluger alter Parmenion. Alexander will, daß du mit dem Hauptheer südlich an Lampsakos vorbeiziehst. Ich soll deinen Belagerungszug übernehmen und nach Lampsakos führen. Diades und Charias sind mit ihren Geräten schon vorausgeeilt.«
Parmenion kniff die Brauen zusammen. »Will er ernsthaft ...?«
»Nein, will er nicht. Wir haben keine Zeit – kein Geld – kein was auch immer. Wie du weißt. Er will die Perser nur ein bißchen kitzeln.«
»Gut. Und dann?«
»Wie geplant. Wenn die Perser tun, was sie tun sollen, heißt das.«
»Und wenn nicht?«
Kleitos hob die Schultern. »Wenn sie sich trotz allem an das halten, was Memnon zweifellos vorschlagen wird, kenne ich einen, der sehr enttäuscht ist.«
»Wieso ist Alexander eigentlich so sicher, daß Arsites und die anderen Satrapen nicht auf den Rhodier hören werden?«
Kleitos blickte Dymas an. »Du kennst die Perser doch.«
»Ein wenig.«
»Was glaubst du?«
»Ich weiß nicht, über welche düsteren Geheimnisse ihr redet.«
Parmenion gluckste, kaute und deutete mit dem Kinn auf Kleitos.
Der Offizier leerte seinen Becher, rülpste und verschränkte die Arme. »Es ist ganz einfach. Und sehr schwierig«, sagte er langsam. »Hast du dich nie gefragt, warum wir gerade jetzt hier sind? Statt ein wenig früher oder viel später?«
Dymas schob die Unterlippe vor. »Gefragt schon, aber ich dachte, es wäre einfach eine Sache der Vorbereitung gewesen.«
»Du kennst unseren kleinen listigen daimon nicht.« Kleitos schüttelte den Kopf; einen Moment lang verrieten seine Augen so etwas wie Staunen, oder Bewunderung. »Er ... sein Vater, Philipp, hat nie etwas getan, ohne mindestens drei Dinge mit einem Schlag erledigen oder bewirken zu können. Alexander ist genauso, nur noch besser. Vorbereitungen sind eines – die Truppen, die Schiffe, die Vorräte. Das zweite, was er berechnet hat, sind ... deine früheren Mitarbeiter.«
»Die Kundschafter und Spitzel des Korinthers?«
»Und die der Perser. Es mußten bestimmte Kenntnisse so geschickt verteilt werden, daß sie die Perser nach und nach erreichen, gewissermaßen unauffällig. Eine Verwandte von Memnon, die auf Rhodos lebt, hat ein Geschenk des makedonischen Königs erhalten. Zum Beispiel. Oder jetzt die neueren Dinge – die Güter des Satrapen brennen, die von Memnon werden verschont. Wir haben hellenische Bundestruppen, wie ihr wißt; Memnons hellenische Söldner im Dienst des Großkönigs wollen angeblich zu uns überlaufen. Wollen sie natürlich nicht, aber Demaratos sorgt dafür, daß die Perser es glauben. Er sorgt auch dafür, daß sie ihre Reiterei überschätzen – weil angeblich Persiens Lanzenreiter das einzige sind, was Alexander wirklich fürchtet.« Er lachte. »Wir werden sehen ... Dann waren der Boden und das Wetter zu bedenken. Die Perser mußten schon aus den Winterlagern heraus, aber noch nicht völlig versammelt sein. Wir sind für sie zu früh, als daß sie Parmenions Brückenkopf hätten angreifen können, nach dem Winter, aber so spät, daß sie ihr Heer schon in der Nähe zusammengezogen haben. Wären wir früher gekommen, hätten sie vielleicht den Norden Phrygiens geräumt; wir brauchen aber die Schlacht sehr bald. Wenn sie sich stellen, wird bald danach das erste Getreide reif sein – sobald unsere Vorräte und die der Perser aufgezehrt sind. All dies und mehr war zu bedenken.«
»Ich dachte immer, Krieg besteht daraus, daß zwei Heere sich treffen und messen«, sagte Dymas. »Aber dieses Bild ...«
»Die Ernten, das Wetter, die Bewegungen des Gegners. Was wir im Moment versuchen ist, Mißtrauen zu säen, um den Sieg zu ernten. Memnon ist der beste Stratege des Großkönigs. Wir müssen ihn möglichst ausschalten, bevor es zum Kampf kommt.«
»Was könnte er tun? Was könnte er anders tun als die Satrapen?«
Parmenion stellte den leeren Napf auf den Tisch. Mit den Fingerspitzen strählte er sich den grauen Bart; dabei grinste er leicht. »Wenn ich Memnon wäre und im Heer des Großkönigs zu sagen hätte, wüßte ich, was ich täte.«
»Nun sag es schon.«
»Die Vorräte des Landes wegschaffen oder zerstören. Die Lagerhäuser niederbrennen. Die Felder vernichten. Mit einem kleinen Heer immer gerade außer Reichweite bleiben. Und mit der großen Flotte und den besten Truppen nach Makedonien übersetzen.« Er beugte sich vor. »Dieser Feldzug, unserer, wäre in drei Monden erledigt.«
Dymas schloß die Augen. »Sie werden nicht auf ihn hören, wenn er das vorschlägt.«
»Warum?« Kleitos’ Stimme klang drängend.
Der Musiker öffnete die Augen wieder. »Alexander weiß es, nehme ich an. Hat er nicht als Knabe lange mit ... ah, Artabazos gesprochen?«
»Das hat er. Er beruft sich auf den edlen Perser. Und?«
»In den Ländern, aus denen sie kommen, in den iranischen Kemländern, sind guter Boden und Wasser heilig. Auch das Feuer ist heilig und darf nicht verunreinigt werden. Es ist die heilige Pflicht der Verwalter und der Krieger, den Landbau zu schützen.«
Kleitos seufzte auf; er schien erleichtert. »Das sagt Alexander auch, aber es ist gut, dies von einem anderen zu hören, der sich auskennt.«
»Du meinst also, sie werden nicht auf Memnon hören?« sagte Parmenion.
Dymas nickte. »Ein Satrap, der das verbrennt, was er schützen soll, kann sich gleich in sein Schwert stürzen.«
Einige Einheiten, vor allem Reitertrupps und Aufklärer, legten große Entfernungen zurück, schwärmten immer wieder aus, sicherten meilenweit voraus und nach Süden, während die Hauptmasse zunächst nach Nordosten den Hellespont entlangzog, abgeschirmt von den schnellen Truppen zur Rechten und den Trieren zur Linken. Neben den Kampf schiffen hielten sich, teils unter Segeln, teils gerudert, die zahllosen Lastkähne und Frachter in Ufernähe; abends versorgten sie das Heer mit Fleisch, Fisch und Trockenfrüchten. Die Hauptmasse – Troß und Fußtruppen – legte am Tag vielleicht sechzig Stadien zurück, eine Entfernung, die ein guter Marschierer in zwei Stunden bewältigen konnte. Wenn die ersten Zelte abgebrochen wurden, begannen die Bewohner der letzten mit dem Frühstück, und wenn die zuerst Aufgebrochenen mit dem Lagern begannen, meistens am frühen Nachmittag, setzten sich die letzten gerade in Bewegung.
Dymas und Tekhnef schlossen sich jeden Tag einer anderen Gruppe an. Auf dem Weg von Arisbe nach Perkote zogen sie mit den Wegmessern und Geographen, die Landkarten verfertigten und alles erreichbare Wissen über die Gegend sammelten. Die Männer gingen paarweise neben den Karren her, auf denen ihre Habseligkeiten und Werkzeuge lagen. Die Schrittzähler – immer zu zweit – trugen Schnüre mit Tonperlen verschiedener Farben und Größen. Ein kleiner Karren, dessen Räder höchstens zwei Fuß Durchmesser hatten, wurde von Sklaven hinter einem großen Karren hergezogen. An einem der Räder des kleinen Wagens war ein Sporn oder dicker Nagel angebracht, der nach innen wies und bei jeder Umdrehung des Rads mit hellem ping gegen einen von der Karrenkante baumelnden Eisenstab stieß. Auf dem großen Wagen saßen Männer mit Wachstafeln und Ritzstiften; einer machte bei jedem ping einen Strich auf sein Täfelchen, ein anderer kritzelte auf Zuruf der Schrittmesser Dinge auf sein Wachsbord. Dymas hätte gern mit dem berühmtem Baiton gesprochen, aber der Führer der Geometer und Bematisten ließ sich nicht blicken.
»Er ist beim König«, sagte ein junger Mathematiker, der einen der zahlreichen Meßtrupps beaufsichtigte. Er hatte einen starken athenischen Zungenschlag.
»Was macht er da? Sollte er nicht arbeiten?«
Der junge Mann lachte. »Dafür hat er doch uns. Du bist Dymas, nicht wahr? Ich habe dich vor Jahren in Athen gehört. Als du gegen Demosthenes gesungen hast – Spottverse.«
Dymas neigte übertrieben den Kopf. »Ich bin geehrt, daß die Männer der Wissenschaft schnöden Zeitvertreib in Wirtshäusern und gewisse Begleitumstände nicht vergessen. Wie kommst du aus Athen hierher?«
»Ich bin zu jung, als daß ich noch unter dem großen Platon, dem ich gelauscht habe, vieles hätte lernen können, wohl aber unter seinen Nachfolgern. Über gemeinsame Bekannte geriet ich auch an Aristoteles, der das Sammeln und Messen dem Bau schwebender Gedankenpaläste vorzieht.« Er gluckste. »Er schrieb mir, aus Mieza, daß Alexander auch allerlei Wissenschaftler mitnehmen wolle, und er hat mir die Möglichkeit vermittelt, meine Kenntnisse praktisch zu erproben.«
Dymas deutete auf die Schrittzähler, dann auf den kleinen Karren, dessen ping ihm in den Ohren weh tat. »Was hat es damit auf sich, Freund? Wie heißt du, damit ich dich anreden kann?«
»Eukleides. Also, der König will möglichst genaue Landbilder von uns haben. Entfernungen, Höhen, Tiefen, genauer Verlauf der Flüsse und Bergketten, Anzahl der Bewohner, Umfang und Anlage von Städten und Dörfern, Art des Bodens und seiner Nutzung, Pflanzen, Nutztiere – einfach alles. Dies hier ist die Meßabteilung; für Tiere und Menschen sind andere zuständig.«
Er berichtete von den Vorbereitungen, den nötigen Vereinheitlichungen der Maße, erklärte Tekhnef und Dymas einige der Hilfsmittel.
»Wir stehen«, sagte er, »zum Beispiel auf einer Straße und wollen wissen, wie hoch ein Berg ist, der rechts von uns aufragt, und wie weit er von der Straße entfernt ist. Diese Lederschnur« – er deutete auf einen Pflock, um den vielfach gefärbtes Leder von der Dicke eines kleinen Fingers gewickelt war – »ist ein Stadion lang. Wir legen sie auf die Straße und peilen den angenommenen Mittelpunkt des Berges am Boden, also auf Höhe der Ebene an. Mit Hilfe von Peilstangen richten wir das Band dann so aus, daß die von beiden Enden des Bandes zum Berg führenden gedachten Strecken mit dem Band den gleichen Winkel bilden. Wenn wir die Grundstrecke und die beiden Winkel haben, können wir die Länge der Seitenstrecken berechnen – der Schenkel. Wo sie sich schneiden, den dritten Winkel bilden, liegt der Berg.«
Er hielt ein Gerät hoch, das aus mehreren mit engen Ringen und Schnüren verbundenen Holzstöcken bestand, die jeweils durch Kerben und bunte Striche vielfach unterteilt waren.
»Das ist zur Bestimmung der Höhe. Ein Mann preßt die Wange an den Boden, unmittelbar am Lederband; ein zweiter zieht dieses Gerät so weit auf, daß der Liegende den Gipfel des Bergs genau zehn Schritte entfernt hinter oder neben der Spitze des Meßstocks sieht. Wir bestimmen den Winkel, und da wir wissen, wie weit der Berg entfernt ist, können wir – jedenfalls ungefähr – die Strecke vom Gipfel zum Boden berechnen: die Höhe.«
Ein größeres Problem war die Vereinheitlichung der Wegmaße gewesen. Aus seiner Kenntnis der verschiedenen Meßweisen hatte Aristoteles bei den vorbereitenden Beratungen folgende Einheiten vorgeschlagen: Grundlage solle sein das attische Stadion, bestehend aus einhundert Orgyien; eine Orgyia bestehe aus sechs Fuß, der Fuß aus sechzehn Daktylen oder Fingerbreiten. Dreißig Stadien wiederum sollten ergeben eine Parasange, das ursprünglich nur ungefähre persische Maß der Wegstunde eines guten Marschierers.
»Das Rad des kleinen Karrens hat nicht ganz zwei Fuß Durchmesser; wenn es sich einmal dreht, hat es genau eine Orgyia zurückgelegt. Wir« – er kicherte leise – »bezeichnen diese Einheit inzwischen als ein ping. Man gewöhnt sich dran, übrigens; nach ein paar Tagen lassen die Ohrenschmerzen nach. Die Schrittzähler haben lange Zeit Ketten um die Fußknöchel getragen, mit Messerklingen vom. Wenn ihr eure empfindsamen Nasen und Augen über ihre Füße beugt, könnt ihr bei allen viele kleine Narben sehen. So haben sie sich daran gewöhnt, Schritte einer bestimmten Länge zu machen – drei Schritte für eine Orgyia, die ursprünglich als ein Doppelschritt galt. Aber gerade auf unebenem Boden ist es oft unmöglich, regelmäßig lange Schritte zu machen.«
»Und die Perlenschnüre?« sagte Tekhnef. »Zum Zählen?«
»Ja. Eine Perle für dreißig Schritte, zehn Orgyien. Zehn Perlen für ein Stadion; nach zehn Perlen folgt auf den Schnüren jeweils eine dickere. Die Schnüre reichen immer für drei Stadien; dann rufen die Bematisten es den Männern auf dem großen Karren zu, die Striche auf ihre Wachstafeln machen. Abends werden die Ergebnisse auf Papyros übertragen, zusammen mit den Aufzeichnungen der Männer, die sich um Biegungen, Wasserläufe, Berge und Ortschaften kümmern.«
Die Grundlagen für die Berechnungen, sagte Eukleides, hätten vor Jahrzehnten schon Männer wie Pythagoras oder Thales geschaffen; er selbst habe sie mit Aristoteles’ Hilfe für die tägliche Verwendung vereinfacht.
»Ich werde nicht mehr lange hierbleiben«, sagte er schließlich. »Was ich feststellen wollte, weiß ich jetzt. Im Herbst will ich wieder in Athen sein. – Macht ihr heute abend Musik?«
An diesem Abend unterhielten sie die Geometer und andere Wissenschaftler; Eukleides kannte erstaunlich viele schäbige Verse über einzelne Körperteile und ihre Verwendung zu Lust oder Schmach; Dymas prägte sie sich ein, und Tekhnef entzückte die Zuhörer, die nicht mit schrägen Bemerkungen geizten, durch ihr Flötenspiel ebenso wie durch wüste Erzählungen aus ihrer Heimat im Süden Ägyptens.
Am nächsten Tag banden sie die Zügel ihrer Pferde an den Karren, auf dem Drakon der Heiler saß und wie immer Kräuter, Zweige oder Halme kaute. Als sie sich zu ihm gesellten, war es ein Kirschzweig; er nahm ihn aus dem Mund, grinste sie mit starken, weißen Zähnen an und hielt den Zweig hoch.
»Was ihr hier seht, ist nicht nur gut für meine Zähne, sondern es wird uns auch den Sieg gegen die Perser sichern.«
»Was hast du vor?« Dymas half Tekhnef auf die Karrenfläche und zog sich selbst hoch. »Willst du einen Kirschblütenzauber machen, um die Satrapen zu blenden?«
Drakon lachte schallend. »Ich werde es erwägen, obwohl für derlei Unsinn Aristandros zuständig ist. Nein – was ihr hier seht, ist das kleine Geschwist des großen Baums, der festes, schweres Holz liefert. Übrigens auch guten Bast; in Gordion hat man ihn verwendet, um die Deichsel an einem bestimmten Karren zu befestigen. Von diesem Holz schleppen wir, zur Freude der Lanzenschäfter und Waffenschmiede, große Vorräte mit uns herum.«
»Quassel nicht so gelehrt«, sagte jemand, der hinter Drakon auf dem Karren lag. »Was ist mit dem Holz?«
»Wie wir wissen, o mein dummer Freund, besteht die Bewaffnung der edlen persischen Reiter aus gekrümmten Schwertern und vor allem aus jeweils zwei leichten Wurfspeeren. Leicht, gut in der Hand, aber schlecht zum Stoßen. Die Sarissen der Phalanx und die Speere der makedonischen Reiter sind aus diesem besonderen Kirschbaumholz – härter, schwerer; und die Reiterspeere sind auch länger als die der Perser. Woran ihr sehen könnt, daß ich durchaus kriegstüchtig kaue.«
»Bah«, sagte der Liegende. Er richtete sich auf, stützte sich auf die Ellenbogen. »Wann ist mein Fuß wieder heil? Ich kann dein Gerede nicht mehr ertragen, Drakon.«
»Oh, steig ab, lauf, entspann dich, und viel Vergnügen.«
»Was fehlt ihm?« sagte Tekhnef.
Drakon schob den Zweig in den Mundwinkel. »Zwei, nein, drei Dinge. Das geringste Übel ist, daß dieser Trottel sich einen Dorn in den Fuß getreten hatte, und er kam damit erst zu den Heilern, als die Entzündung fortgeschritten war.«