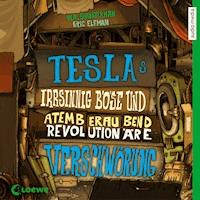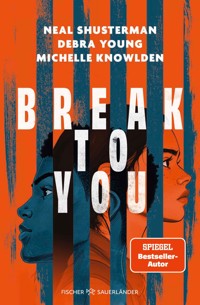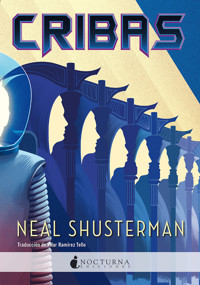16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die All-Now-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Gefährlich, ansteckend und voller Glück Ein beispielloses Virus breitet sich auf dem Planeten aus. Diejenigen aber, die überleben, sind … glücklich. Stress, Depression, Einsamkeit – alle negativen Gefühle sind plötzlich verschwunden. Immer mehr Genesene genießen das neue Glücksgefühl. Doch längst nicht alle, denn innere Zufriedenheit ist schlecht fürs Geschäft. Wirtschaftsbosse und Politiker brauchen die Unzufriedenheit ihrer Kunden oder Wähler. Und so beginnt ein gefährlicher Wettlauf um einen Impfstoff, der das Unglück zurückbringen soll. Mariel lebt mit ihrer Mutter in einem verbeulten Ford Fiesta und wünscht sich nichts sehnlicher, als glücklich zu sein. Rons Vater ist Milliardär, doch obwohl ihm jeglicher Luxus offen steht, erscheint Ron das Leben sinnlos. Der Zufall bringt Mariel und Ron zusammen, und das Schicksal schleudert sie mitten hinein in den Machtkampf um eine neue Weltordnung. Dystopisch und utopisch zugleich - und ultraspannend! In einem erschreckend realistischen Szenario konfrontiert Shusterman seine Leser*innen mit den ganz großen Fragen: Glücklich oder unglücklich, was würdest Du wählen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Neal Shusterman
All Better Now
Über dieses Buch
Band 1: All Better Now
Band 2: All Over Now (erscheint voraussichtlich im Herbst 2027)
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Neal Shusterman ist der New York Times-Bestseller und preisgekrönte Autor von mehr als fünfzig international erfolgreichen Büchern. Für sein Gesamtwerk wurde er mit dem renommierten Margaret A. Edwards Award ausgezeichnet. Online ist er zu finden unter storyman.com.
Impressum
Erschienen bei Fischer Sauerländer E-Book
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »All Better Now« bei Simon & Schuster Books for Young Readers, einem Imprint von Simon & Schuster Children's Publishing Division, New York.
Copyright Text © 2025 Neal Shusterman
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2025 Fischer Sauerländer GmbH,
Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Dahlhaus & Blommel Media Design, Vreden nach einer Idee von Matt Roeser und Chloë Foglia, Simon & Schuster, Inc
ISBN 978-3-7336-0936-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Teil Eins
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Teil Zwei
Anderswo: Tokio
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Teil Drei
Anderswo: Brasilien
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Teil Vier
Anderswo: Staatliches Hochsicherheitsgefängnis Louisiana
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil Fünf
Anderswo: Osteuropa
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Teil Sechs
Chicago
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Teil Sieben
Anderswo: Köln, Deutschland
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Teil Acht
Objekt 48
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Anderswo: Barentsburg, Norwegen
Danksagung
Für die Familien Kirton, Ingham und Lewis und all die anderen Verwandten, von deren Existenz ich nichts geahnt habe! Es ist so schön, euch kennenzulernen!
Teil Eins
Crown Royale
1
Mariels Fahrt mit Space Mountain
Es war einfach der falsche Zeitpunkt für ein Leben auf der Straße.
Nicht dass es einen richtigen Zeitpunkt gab, aber angesichts dieser neuen Krankheit – die sich immer weiter ausbreitete und fast Ausmaße erreichte wie eine Pandem… Nein. Nein, Mariel wollte das »P«-Wort nicht ins Spiel bringen. Als würde es Realität werden, wenn man nur daran dachte.
»So schlimm ist es gar nicht, Baby«, sagte ihre Mutter. »Wir haben doch gar keinen engen Kontakt mit anderen. Selbst hier draußen können wir Möglichkeiten finden, uns zu isolieren. Wir müssen uns mit niemandem treffen, wenn wir nicht wollen.«
Mariels Mutter lebte in Leugnung. Wohnte da regelrecht. Wenn Leugnung ein echtes Stück Erde wäre, würde Gena Mudroch sich dort ein Haus bauen. Oder zumindest eine Garage, damit sie endlich einen sicheren und legalen Platz hätten, an dem sie ihren verbeulten Ford Fiesta parken könnten.
Im Augenblick war er auch geparkt. Gewissermaßen. Hinter einem Zaun auf dem Abschlepphof. Genau aus dem Grund standen Mariel und Gena mitten in der Nacht in einer dunklen Straße im schäbigsten Industriegebiet der Stadt und warteten auf jemanden, der ihnen theoretisch helfen könnte, ihren Wagen rauszuholen.
Anders als ihre Mutter lebte Mariel nicht in dieser ständigen Leugnung. Sie war praktisch veranlagt. Eine Realistin. Das musste sie auch sein: Der Sinn fürs Praktische war mehr als eine Überlebensstrategie, es war ihre Superpower. Ohne diese Eigenschaft wäre ihre Mom vermutlich längst tot, und Mariel wäre bereits vor Jahren im System der staatlichen Jugendhilfe verschüttgegangen.
»Vielleicht …«, begann Mariel. »Vielleicht sollten wir mehr unter Leute gehen.«
»Wie, und uns dieses Zeug einfangen? Auf gar keinen Fall!«
»Vielleicht sollten wir es schnell hinter uns bringen. Weißt du, solange die Krankenhäuser noch nicht überfüllt sind und wir noch behandelt werden.«
Ihre Mom strich sich das strähnige Haar aus den Augen. »Ich weiß, was du meinst«, sagte sie und sah Mariel mit diesem misstrauischen Blick an – den sie sonst für andere reserviert hatte. »Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, was die Verrückten da draußen sagen?«
»Ich weiß, es klingt … abwegig … Trotzdem besteht die Chance, dass es stimmt.«
»Seit wann nimmst du Gerüchte ernst, hm? Gerade du, die sonst für alles unter der Sonne einen wissenschaftlichen Beweis haben will!«
Ihre Mutter hatte recht – Gerüchte waren die Währung der Dummheit. Aber einzelne Hinweise konnten trotzdem in eine Richtung deuten. »Ich habe Interviews mit Genesenen gesehen«, berichtete Mariel. »Die wirkten … keine Ahnung … irgendwie verändert.«
»Wie willst du wissen, ob sie sich verändert hatten, wenn du sie vorher nicht kanntest?«
Mariel zuckte mit den Schultern. »Da war was in ihren Augen, Momma. Irgendwie … so eine Weisheit.«
Ihre Mutter lachte schallend darüber. »Glaub mir, von einer Krankheit wird niemand klug.«
»Ich habe nicht von Klugheit gesprochen, sondern von Weisheit.«
Aber auch Weisheit war nicht das richtige Wort dafür. Im Gleichgewicht mit sich selbst kam der Sache schon näher. Zu Hause angekommen sein. Auch wenn man gar keins hatte.
»Du träumst«, sagte ihre Mutter. »Das ist okay, es sei dir gestattet.«
Auch wenn Mariel so praktisch sein musste, um an der Seite ihrer Mutter zu überleben, gegen einen gelegentlichen Anflug von Fantasie war sie nicht immun. Besonders, wenn sie daraus Hoffnung ziehen konnte. Zwar redete sie sich ein, sich an Hoffnungen zu klammern wäre immer noch besser als dieser ewige Zustand der Leugnung, doch eigentlich war ihr klar, dass Hoffnung und Leugnung Nachbarskinder waren, wenn auch verfeindete. Sie beäugten einander über den schlammigen Fluss der Umstände hinweg.
Auf der anderen Seite der einsamen Straße näherte sich ein Mann, dessen zielstrebiger Gang ein wenig wackelig wirkte, als hätte er Gelenke aus Gummi. Obwohl er fast vollständig im Schatten war, konnte Mariel erkennen, dass er zu ihnen herüberschaute.
War das ihre Verabredung? Oder war es einfach nur jemand, der ihnen Ärger machen wollte? Wie sich herausstellte, traf beides nicht zu. Er ging fröhlich weiter auf sein Ziel zu. Wohin auch immer es einen Gummimann um zwei Uhr morgens treiben mochte.
»Das stimmt nicht, weißt du«, sagte sie zu ihrer Mom, die das Gespräch schon fast vergessen hatte und eine Gedankenstütze brauchte. »Durch Krankheit kann man wachsen. Was ist mit Grandpa – er hat sich verändert. Nachdem er den Krebs besiegt hatte, fand er eine neue Lebensperspektive.«
Ihre Mutter lachte traurig. »So was möchte ich allerdings für eine neue Lebensperspektive nicht erst durchmachen müssen. Außerdem ist er ein Jahr später an einem Herzinfarkt gestorben, was hat ihm die neue Perspektive da genützt?«
Darauf wusste Mariel keine Antwort. Jetzt klang ihre Mutter wie die Realistin.
»Wir kriegen das schon alles hin«, sagte sie. »Wir finden einen Platz, wo wir sicher und legal parken können, und wenn wir den Grinch vom Abschlepphof zurückhaben, ziehen wir den Kopf ein und warten ab, bis alles vorbei ist.«
Der Grinch war ihr grüner Fiesta. Mom liebte es, leblosen Dingen einen Namen zu geben.
Der Typ, der ihnen helfen sollte, hätte längst da sein müssen. Ihre Mutter hatte gesagt »gegen zwei«, aber das stammte von dem Kerl, der ihrer Mutter den Kontakt vermittelt hatte. Ein namenloser Typ, den sie also nur um drei Ecken kannte und der bereits ihr Geld hatte.
Ihr Sinn für Realismus sagte Mariel, dass er nicht kommen würde. Die Hoffnung behauptete hingegen, dass vielleicht etwas Besseres kommen würde.
Mariel gab sich immer Mühe, ihr Bedürfnis nach Hoffnung mit ihrer praktischen Veranlagung in Einklang zu bringen. In diesem Fall rieten ihr beide, es sei womöglich am besten, diese Pandemie einfach so zu nehmen, wie sie kam. Da, jetzt hatte sie das P-Wort benutzt, denn darauf lief es eindeutig hinaus. Aber diesmal würde es anders werden. Sehr anders.
Die vorige war natürlich eine Katastrophe gewesen. Weltweit Millionen Tote. Wissenschaftler wurden feindlich angegangen, viele Menschen stürzten sich auf absurde Verschwörungstheorien, Hörensagen und aus dem Zusammenhang gerissene Posts in den sozialen Medien, und zwar noch, wenn sie schon im Sterben lagen. Während diejenigen, die sich der Wissenschaft anschlossen und die Regeln befolgten, Abweichlern den Tod wünschten. Diese Pandemie hatte auf allen Seiten das Übelste der Menschen ans Tageslicht gebracht.
Ihre Mom gehörte, versteht sich, zu den Leugnern und trieb sich noch in den schlimmsten Zeiten auf Partys herum. Die Krankheit erwischte sie bald und so heftig, dass es auch für Mariel mit reichte, die nämlich davon verschont blieb. Ihre Mom hingegen erwischte es so schlimm, dass sie im Krankenhaus landete.
Damals hatten sie noch eine Krankenversicherung, aber das nutzte letztlich auch nichts, denn es gab keine Beatmungsgeräte mehr. Ihre Mom kam durch, allerdings dauerte es ewig. Sie hatte das Long-Syndrom – technisch gesehen war sie zwar nicht mehr krank, tatsächlich ging es ihr jedoch auch nicht besser. Monatelang konnte sie nicht arbeiten, und als sie es wieder schaffte, gab es ihren Job nicht mehr. Das Restaurant, in dem sie angestellt gewesen war, hatte wie so viele andere in San Francisco dichtgemacht.
Danach ging die Fahrt mit dem Space Mountain, der Dunkelachterbahn, los.
So nannte Mariel die turbulente Abwärtsspirale ihrer Mutter, weil sie immer mit festgeschlossenen Augen durch die Dunkelheit rauschte. Und obwohl ihre Mom immer mal wieder hier und dort Arbeit fand, als die Welt sich wieder zu drehen begann, war der Schaden unübersehbar. Und zwar leider in zu vielen Bereichen.
Deshalb standen sie jetzt hier, auf einer verlassenen Straße, wo sich niemand bei Verstand aufhalten würde, schon gar nicht zu dieser Uhrzeit, und warteten auf einen Kerl, der vermutlich nicht auftauchen würde.
»Wäre es nicht schlauer gewesen, einfach den Strafzettel und die Gebühr fürs Abschleppen zu bezahlen, anstatt das Geld irgendeinem Typen zu geben, den du nicht mal kennst?«
Ihre Mutter schnaubte nur.
Das Geld, das man im Voraus verlangt hatte, war praktisch das Letzte, das sie noch hatten. Der Rest von dem, was ihnen Mariels Onkel mit den Worten gegeben hatte, es sei das letzte Mal. Das allerdings sagte er jedes Mal.
»Dieses Arschloch lässt sich nicht blicken«, stellte ihre Mom schließlich fest und seufzte. »Immer auf die Kleinen.« Das war ihr Lieblingsspruch. Zusammen mit: »Es ist, wie es ist.«
Aber Mariel wollte nicht hinnehmen, dass es war, wie es war, genauso wenig wie diese Immer-auf-die-Kleinen-Haltung. Selbstmitleid half niemandem, am wenigsten ihr selbst.
Dieses Interview, das sie kürzlich gesehen hatte … Wenn das stimmte, was sie annahm, könnte die Ansteckung ihnen tatsächlich helfen. Alles ändern. Vielleicht.
Vor ein paar Tagen hatten sie in einem Bar-Imbiss gesessen, der sich Gastropub nannte, damit man höhere Preise verlangen konnte, und hatten dort gegessen. Ihr Mutter ließ anschließend immerhin ein Drittel der Rechnung auf dem Tisch liegen, ehe sie sich davon machten.
Dafür respektierte sie ihre Mutter: Wenn sie die Zeche prellte, ließ sie trotzdem immer wenigstens eine gewisse Summe da.
»Ich will die Bedienung nicht übers Ohr hauen«, erklärte sie Mariel. »Die haben mehr verdient, als wir ihnen geben können.« Dabei hoffte sie, die Bedienung würde das Geld als Trinkgeld einstecken und das zechgeprellte Essen vom Restaurant abschreiben lassen.
In dem Gastropub liefen drei Fernseher, zwei Sportsendungen und einmal Nachrichten. Ein Mann, der mit »Crown Royale« – so nannten sie dieses neue Coronavirus – im Krankenhaus lag, wurde interviewt. Für jemanden, der dem Tod gerade von der Schippe gesprungen war, wirkte er ganz schön fröhlich – und nicht nur, weil er so erleichtert war, noch am Leben zu sein.
»Wie fühlen Sie sich jetzt?«, fragte die Reporterin. Die Frage war bescheuert, aber obligatorisch.
Der Mann lächelte aufrichtig und blickte die Reporterin an, als sähe er etwas Wunderbares in ihren Augen.
»So gut wie noch nie!«, sagte er. »Ehrlich, besser als je zuvor!« Dann lachte er. Wirklich, er lachte. Als wären mit dem Fieber alle Sorgen für alle Zeiten von ihm abgefallen.
Das könnte Mariel definitiv auch gebrauchen.
2
Hai auf der Dunklen Seite
»Hi, ich bin Rón, Rón mit einem Angeberakzent auf dem ›o‹. Ihr müsst die Hogans sein.«
Obwohl die Tür offen stand, hatten die vier Angehörigen der Familie Hogan scheinbar Hemmungen einzutreten. Wie alle, die hier einen Aufenthalt buchten, waren sie eingeschüchtert und überzeugt, es müsse sich um einen Irrtum oder gar um einen Jux handeln. Ob sie vielleicht in der Versteckten Kamera gelandet waren?
Rón hatte dafür heute keine Geduld. »Wir können auch noch mal mit dem Fahrstuhl fahren, wenn ihr möchtet. Es ist der schnellste Expressfahrstuhl der Stadt!«, erklärte Rón.
Das brachte sie immerhin dazu, aus der Kabine zu treten.
»Vergesst nicht, die Masken aufzusetzen«, erinnerte Rón sie. »Die sind Pflicht während der Einführung.«
Das verwirrte die Familie noch mehr. »Oh«, erwiderte die Frau. »Wir haben keine. Wir haben nicht gedacht …«
»Auf dem Tisch in der Schale«, sagte Rón und zeigte auf eine Waterford-Kristallschale direkt am Eingang.
Immer noch skeptisch nahmen sie sich einige, immer noch besorgt, dass sich hinter dieser raffinierten Location ein ebenso raffinierter Trick steckte.
»Mom«, sagte eins der Kids, ein etwa zehnjähriger Junge, »das sind diese digitalen! Darüber habe ich was gelesen.«
Die Masken bestanden aus einem Leuchtfaserdisplay, das ein ungefähres Abbild deines Gesichts anzeigte, wodurch es aussah, als würde man gar keine FFP2-Maske der zweiten Generation tragen. Allerdings konnten sie die Mimik nicht absolut exakt umsetzen, deshalb wirkten sie auch ein bisschen gruselig.
»Sind die nicht teuer?«, fragte Mrs. Hogan.
»Die sind in der Miete enthalten«, erklärte Rón ihr mit einem Lächeln, das nie von der Maske in seinem eigenen Gesicht verschwand, weil er diese so eingestellt hatte, dass sie immer ein bisschen fröhlicher erschien, als er sich eigentlich fühlte.
Schließlich sprach Mr. Hogan aus, was wohl alle insgeheim dachten. »Ich … ich fürchte, da muss ein Irrtum vorliegen. Ich glaube, wir sind hier falsch …«
»Vertrauen Sie mir, ganz und gar nicht. Kommen Sie, ich führe Sie herum.« Rón bat sie mit einem Schwung seines Arms, ihm in das weitläufige Penthouse zu folgen. »Wir sind im 61. Stock auf der Westseite. Vom Wohnzimmer aus können Sie die Golden Gate Bridge sehen. Links gibt es ein Schlafzimmer und ein Bad, doch da sie nur zu viert sind, werden Sie es nicht benötigen. Die Hauptschlafzimmer sind oben.«
»Es gibt ein Oben?«, staunte das Mädchen, das genauso alt zu sein schien wie der Junge. Vielleicht Zwillinge.
»Hier entlang. Folgen Sie mir.«
Oben gab es drei weitere Schlafzimmer, und das Elternschlafzimmer allein war so groß wie bei den meisten Menschen die ganze Wohnung. »Die Badezimmer haben Fußbodenheizung«, erläuterte Rón. »Die Jalousien können Sie mit Ihrem Telefon bedienen, wenn Sie sich mit Bluetooth verbinden. Und wegen eines Erdbebens brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen: Das Gebäude steht auf einer Art Stoßdämpfern wie die in Japan.«
Der Familie verschlug es den Atem. Die Sprache. Die beiden Kids kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, spielten mit ihren Handys an den Jalousien herum und stritten schon um die Zimmer.
Der Vater, der an sich gar nicht zaghaft wirkte, war definitiv eingeschüchtert. »Aber … aber wir haben nur hundert Dollar pro Nacht bezahlt.«
»Ja, ich weiß. Für vier Nächte.«
Trotzdem standen sie da und sahen sich um, als wären sie in eine andere Dimension gewechselt und könnten im nächsten Moment explodieren. Rón seufzte und erklärte es ihnen. »Mein Vater ist der Überzeugung, jeder sollte die Chance haben, solchen Luxus kennenzulernen. Deshalb vermietet er dieses Penthouse über Airbnb weit unter dem Marktpreis.«
»Wer ist Ihr Vater?«, erkundigte sich Mrs. Hogan.
Rón entschied sich, darauf nicht zu antworten. Das würden sie schon noch herausfinden. Und wenn nicht, spielte es wohl keine Rolle, oder? »Genießen Sie den Aufenthalt. Dies ist das westliche Penthouse, und ich bin direkt auf der anderen Seite des Flurs im östlichen Penthouse. Falls Sie irgendetwas brauchen, melden Sie sich einfach jederzeit gern bei mir.« Damit überließ er sie sich selbst und ihren technischen Spielzeugen – von denen es ja jede Menge gab.
Wenn dein Vater der drittreichste Mann der Welt ist, fällt es schwer, nicht über ihn definiert zu werden. Schwer, sich nicht selbst über ihn zu definieren. Egal, wie sehr du dich bemühst. Besonders, wenn er dich selbst nur als Anhängsel seiner eigenen Person betrachtet.
»Ich weiß, dass du von meiner Bekanntheit überwältigt bist. Da gibt es nur einen einzigen Ausweg: Bau dir dein eigenes Imperium auf.«
Sein Vater liebte es, Ratschläge zu erteilen, aber die kamen manchmal eher wie Anfeuern rüber, nicht wie irgendwas Nützliches. Dennoch musste Rón widerwillig zugeben, dass es ihm guttat, für seinen Vater in dessen Jackpot-Überraschungs-Airbnb den Gastgeber zu spielen. Sein berühmter Vater verlangte, dass Rón mehr unter Leute kam und regelmäßig Kontakt zu Fremden hatte. Die waren zwar sicherheitsüberprüft, aber trotzdem Fremde.
»In dieser Welt musst du lernen, wie du dich gegenüber allen möglichen Sorgen von Menschen aus allen möglichen Milieus verhältst, und zwar auch in den peinlichsten Situationen. Soziale Kompetenzen zu lernen ist wie Autofahren. Mit ausreichend Übung geht es in Fleisch und Blut über.«
Ja, klar, es sei denn, man baut einen Unfall und verbrennt – und für sozialen Totalschaden gibt es keine Versicherungen.
Um in einer internationalen Stadt wie San Francisco den Rang eines Spitzenvermieters einzunehmen, musste Rón die Airbnb-Show in sieben Sprachen beherrschen, was mühsamer war, als er erwartet hatte.
Leona, seine netteste und am wenigsten oberflächliche Schwester, ging da am pragmatischsten heran.
»Betrachte es als eine Art Teilzeitjob, sein Sohn zu sein. Ansonsten lebst du dein Leben. Nur ein paar Stunden die Woche musst du so sein, wie er dich haben möchte.«
»Warum übernimmst du die Sache nicht?«, hatte Rón sie gefragt.
Leona hatte das mit einem Schulterzucken abgetan, allerdings spürte Rón, dass es sie auf eine Weise verletzt haben musste, die er nie verstehen könnte. »Würde ich ja, aber mich hat er ja nicht ausgewählt.« Anschließend war sie nach Paris geflogen.
Er hätte sich nie vorgestellt, dass es das Highlight seines Tages sein könnte, diese naiven Fremden zu begrüßen. Dabei gefiel ihm am besten der Blick dieser Leute, wenn sie das Penthouse betraten. Es war schön, ihre Verblüffung mitzuerleben. Solche Verwunderung hatte er schon ewig nicht mehr empfunden, und es erinnerte ihn daran, dass das Leben eigentlich kein bisschen banal war, auch wenn es sich so anfühlte.
Außerdem verstieß die Vermietung über Airbnb gegen die Regeln der Eigentümergesellschaft des Gebäudes. Die anderen Wohnungsbesitzer waren deswegen sauer, was Rón genauso viel Spaß bereitete wie seinem Vater.
»Geh nicht weg«, rief Kavita, die gegenwärtige Freundin seines Vaters, ihm aus dem Wohnzimmer zu, als er eintrat. »Er will mit dir reden.«
Wo soll ich schon hingehen?, hätte Rón am liebsten geantwortet, stattdessen sagte er: »Ich bleibe zu Hause.«
Er ging hoch in sein Zimmer, nahm sich – wortwörtlich – das Lächeln aus dem Gesicht und warf sich auf sein Bett.
Róns Vater hatte die digitale FFP2-Maske erfunden. Róns Vater hatte vieles erfunden, oder besser gesagt, er hatte die Konzepte entwickelt und andere Leute bezahlt, damit sie die Dinge erfanden. Blas Escobedo war aus dem Alter herausgewachsen, in dem man Erfindungen machte – heute war er ein Mann der Ideen, und zwar, weil er es sich leisten konnte.
»Intelligenz bringt dich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wahres Genie bedeutet nicht nur Klugheit, sondern auch zu wissen, wie man seine eigene Intelligenz und die der anderen einsetzt.«
Sein Vater dozierte gern über die Themen, in denen er Experte war. Also praktisch alle Themen. Er schrieb sogar an einem inspirierenden Buch mit Aphorismen und erbaulichen Ratschlägen. Nun ja, jedenfalls bezahlte er jemanden, der ihm beim Reden zuhörte und das Buch schrieb. Noch vor der Veröffentlichung hatte es bereits eine Million Vorbestellungen. Weil jeder ein Stück von Blas Escobedo wollte. Entweder einen Bissen von seinem Fleisch, eine Scheibe von seinem Vermögen oder auch nur seine Aufmerksamkeit – und das gefiel Róns Vater besser als alles andere. Negative Aufmerksamkeit oder positive, das spielte keine Rolle, solange eine ansehnliche Anzahl von Scheinwerfern in der Welt auf ihn gerichtet war.
Und je heller das Licht auf seinen Vater schien, desto dunkler waren die Schatten, in denen sich Rón verstecken konnte. Oder genauer gesagt, in denen er verschwand, denn auch in den seltenen Momenten, in denen er sich nicht verstecken wollte, stand er trotzdem im Schatten seines Vaters, der so groß war wie die dunkle Seite des Mondes.
Manchmal hatte Rón versucht, dem zu entfliehen. Für immer. Ernsthaft allerdings nur einmal. Rón war nicht die Abkürzung für Ronald oder Ronaldo oder irgendetwas in der Art. Sein ganzer Name lautete Tiburón Tigre Escobedo – Tigerhai –, denn dieser Spitzenprädator der Ozeane war seinem Vater der liebste. Alle Geschwister von Rón waren nach einem Spitzenprädator benannt. Mit diesem kleinen Scherz seines Vaters mussten sie leben. (Natürlich gab es dabei eine ironische Wendung: Róns Brüder und Schwestern wandten sich wie Raubtiere zunehmend gegen ihren Vater.)
Seit seiner Kindheit hatte sein Vater ihn TéTé genannt, aber das war für einen Sechzehnjährigen, der ihn längst überragte, zu niedlich. Er selbst bevorzugte Rón. Das war schlicht und gradlinig, auch wenn er den Akzent behielt, der in einem Wort mit nur einer Silbe eigentlich überflüssig war, damit wollte er wenigstens eine Andeutung auf seinen tatsächlichen Namen behalten. Während es gleichzeitig auf ironische Weise angeberisch war.
Rón war das jüngste von sechs Geschwistern und Halbgeschwistern und wohnte als einziges Kind bei seinem Vater. Aus irgendeinem Grund hatte Blas Escobedo ausgerechnet in Rón sein Mini-Me gefunden und behielt ihn in seiner Nähe. Während die anderen Kinder ihre Zeit und ihr Geld bei Partys auf den Malediven oder Ibiza vergeudeten, blieb Rón daheim in San Francisco, kümmerte sich um den Laden und lernte, reich und berühmt in einer Welt zu leben, die ihn gar nicht haben wollte.
»Viele Menschen wollen nicht, dass jemand mit einem Namen wie Escobedo der drittreichste Mann der Welt ist. Und noch mehr glauben, jemand mit einem Namen wie Escobedo müsse seinen Reichtum durch illegale Machenschaften erlangt haben, und nicht aufgrund seiner Bildung, seiner Inspiration und harten Arbeit. Die sollen ruhig saure Trauben essen, während wir ihnen das Gegenteil beweisen.«
Das war ein anderes Zitat aus dem Buch seines Vaters. Mit »wir« meinte er sich und Tiburón. Oft schloss er Rón in die Aussagen über sich selbst ein, und er bemühte sich immer, Rón nicht außen vor zu lassen, was ihm jedoch trotzdem ständig passierte, denn die Welt interessierte sich nicht für den jungen Mann in Blas Escobedos Schatten. Nicht bei so extravaganten und fotogenen Geschwistern mit schlechten Angewohnheiten. Deshalb baute sein Vater ja ihn und nicht eine oder einen von den anderen als Nachfolger für seine Geschäfte auf. Er hatte eindeutig klargestellt, dass Rón irgendwann seine Welt der Hightech übernehmen sollte.
»Früher erbte immer der Älteste alles. Sitten und Gebräuche sind schön und gut, wenn sie Sinn ergeben. In diesem Fall trifft das jedoch nicht zu. Deine Brüder und Schwestern würden alles verschwenden, sich streiten und sich gegenseitig niedermachen. Am besten gibt man ihnen einfach genug, damit sie zufrieden sind, und lässt sie von dannen ziehen.«
Dieser spezielle Ausspruch würde nicht ins Buch kommen, auch wenn er ihn Rón gegenüber druckreif formuliert hatte. Der Augenblick, an dem er tatsächlich erben würde, war jedoch längst noch nicht am Horizont zu erkennen. Sein Vater war noch relativ jung und ließ außerdem einen beträchtlichen Teil des Silicon Valley an Möglichkeiten arbeiten, wie man ewig leben könnte.
»So wie ich es sehe, lässt sich viel Geld mit Lebensverlängerung verdienen. Denn die menschliche Gier nach Geld wird nur durch die menschliche Gier nach Zeit übertroffen. Irgendwer hat schon eine Pille erfunden, die einem mehrere zusätzliche Jahre schenkt. Ich glaube, das kriegen wir besser hin.«
Sein Vater war kein schlechter Mensch. Weit entfernt davon. Aber der Welt gefiel es, die schrecklichen Reichen in jeder Hinsicht als schrecklich zu zeichnen. Was das Geld anging, wusste Rón, wie wahr das war. Die Menschen verstanden nicht, dass Geld einen nicht veränderte. Es behinderte dich eher. Es begrenzte, wer du in den Augen der anderen sein durftest, in den Augen deiner Freunde und sogar in den Augen deiner Familie. Wenn jemand so viel Geld hatte wie die Escobedos, wurde es zu einem viktorianischen Korsett. Wenn man den Reichtum lange genug trug, schnürte er einem den Blutfluss ab, und man bekam kaum noch Luft.
Und manchmal wollte man sogar gar nicht mehr atmen.
Denn zwar konnte Blas Escobedo seinem jüngsten Sohn praktisch alles unter der Sonne kaufen, nur eins nicht: einen Grund fürs Dasein.
Die ersten zwei Versuche bezeichneten sie als Hilferufe von Rón. Vielleicht stimmte das. Und er bekam Hilfe. Alle Arten Hilfe. Seine Mutter kam für eine Weile zurück und wohnte bei ihnen, denn eine Scheidung war plötzlich nicht mehr so wichtig, wenn das Leben deines Kindes auf dem Spiel stand. Sein Vater legte sein gesamtes Tech-Imperium auf Eis, um für Rón da zu sein.
Medikamente, Therapie, Unterstützung. Und alles half eine Weile lang. Doch die schwarzen Löcher kehrten immer wieder zurück.
Beim dritten Versuch machte Rón ernst. Er verlor mehr Blut, als man eigentlich verlieren kann, ohne dabei draufzugehen. Doch wie sein Vater war er ein Kämpfer. Ein Überlebenskünstler, obwohl er Überleben gar nicht beabsichtigt hatte. Und weil er überlebte, kam er zu der Überzeugung, dass sein Körper vielleicht klüger war als er selbst. Dass ein Abgang nicht die Lösung war.
Sein Vater saß die ganze Zeit an seinem Bett, während er im Krankenhaus lag, und betete Rosenkränze, von denen Rón nicht einmal gewusst hatte, dass er sie besaß, und dann sogar auf Hebräisch, wovon Rón keine Ahnung hatte, dass Blas Escobedo es beherrschte. An den Gott des Alten oder des Neuen Testaments. An Jahwe, Jesus, Allah, Vishnu – das war gleichgültig, solange einer ihn erhörte.
Tiburón hatte seinen Vater noch nie so gedemütigt gesehen. So menschlich. Er erinnerte sich an vieles, was sein Vater gesagt hatte, während er selbst zu schwach für eine Antwort war. Er schwang keine Reden und dozierte nicht, sondern ließ das Flüstern seines Herzens vernehmen. Und manchmal tat er das immer noch.
»Du kannst das nicht wissen, sondern nur deine Großeltern. Aber als ich in deinem Alter war, TéTé, hatte ich ähnliche Gedanken, mein Leben zu beenden. Und wie du habe ich es versucht, aber glücklicherweise war das eins der vielen Dinge, bei denen ich keinen Erfolg hatte.«
»Hatte ich ja auch nicht«, hatte Rón gekrächzt, und das hatte seinen Vater zum Lächeln gebracht.
»Hatte«, wiederholte sein Vater. »Ich hoffe, das bedeutet, du siehst die Sache als Vergangenheit an.«
Daraufhin hatte sein Vater seine Hand ergriffen. Vorsichtig, um nicht den Verband zu beschädigen. »Ich habe meine Leidenschaft für Technik und Erfindungen entdeckt. Die hat mir die Frage nach dem Wofür meines Lebens beantwortet. Weißt du … Zerstörung und Schöpfung sind zwei Seiten derselben Münze. Und Selbstzerstörung? Kann ein Akt der Selbsterschaffung werden, wenn die Zeit und die Perspektive stimmen. Du wirst es erleben. Das verspreche ich dir.«
Im Krankenhaus bekamen alle ein stattliches Schweigegeld, damit Tiburón Tigre Escobedos versuchter Exit nicht ans Licht kam und in den Schlagzeilen landete und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog. Überraschenderweise hielten alle den Mund. Nicht eine einzige Boulevardzeitung enthüllte seine Tat. Zum ersten Mal war Rón wirklich dankbar dafür, unsichtbar zu sein.
Das war über ein Jahr her. Und obwohl das schwarze Loch immer noch da war, hatte er gelernt, diesen Ereignishorizont besser zu umschiffen. Was jedoch nicht hieß, dass es keine schlechten Tage gab.
»TéTé, bist du schon zu Hause? Komm nach unten und lass uns kurz reden.«
Rón hievte sich aus dem Bett und ging nach unten ins Arbeitszimmer seines Vaters. Es bildete die Ecke des Penthouses, wo sich die Glaswände trafen, und hatte etwas von einem Aquarium. Der Schreibtisch stand im 45-Grad-Winkel in der Ecke. Andere Möbel waren genauso angeordnet: verdammtes Feng-Shui. Róns Vater fuhr auf solche Winkel ab.
»Alles gut?«, fragte sein Vater. Das war eine Allerweltsfrage – wie die fünf Emoji-Knöpfe in Toiletten, mit denen man dem Management mitteilen kann, wie man die Hygiene einschätzt. Heute gab Rón ihm den zweiten grünen Knopf. Gut, aber nicht super. Was ganz respektabel war.
»Die neue Familie ist da. Sie wollen wissen, bei wem sie sich bedanken sollen.«
Sein Vater lachte. »Bei wem sie wollen, solange sie mich in Ruhe lassen.«
Sein Telefon klingelte, doch er wies den Anruf ab. Das musste man ihm zugutehalten: Sein Vater ließ sich nie von der Arbeit stören, wenn er sich mit Rón unterhielt.
Durch die Fenster, die wie ein Aquarium wirkten, konnte Rón über die offene Bucht hinüber zu den pittoresken Ortschaften Sausalito und Tiburon schauen. Als er sehr klein gewesen war und noch glaubte, die Welt würde sich um ihn drehen, hatte er ernsthaft gedacht, Tiburon sei nach ihm benannt. Dann wurde er älter und begriff, dass sich die Welt um seinen Vater drehte. Es bestand also keine Verbindung zwischen ihm und dem Ort auf der anderen Seite der Bucht.
»Es gibt eine traurige Neuigkeit, TéTé. Bennett, der Nachtportier.«
»Oh, nein …« Rón wusste, was kam, ehe sein Vater es aussprach.
»Er ist heute Morgen an Crown Royale gestorben.«
Rón hatte sich gelegentlich mit Bennett unterhalten, zuletzt vor vielleicht zwei Wochen, über die Giants und ihre Aussichten für die Saison. Jetzt würde er nie mehr ein Spiel sehen. »Können wir irgendetwas tun?«
»Ich habe seiner Familie Hilfe angeboten … aber wenn jemand auf diese Weise geht, ist nichts, was du tust, genug. Aber da gibt es etwas, was du tun könntest, TéTé. Um Bennett zu helfen, ist es zu spät, aber vielleicht kann es anderen noch nützen.«
Er räusperte sich und zögerte. Da wusste Rón, es ging um eine große Bitte, eine, die Rón aus seiner Komfortzone treiben würde.
»Ich möchte, dass du eine Rede hältst, die junge Leute wachrüttelt, damit sie gegen Crown Royale kämpfen.«
»Eine Rede …?«
Sein Vater winkte ab. »Reden sind einfach. Wenn du sie nicht selbst schreiben willst, lässt du sie für dich schreiben. Das Wichtigste ist, dass wir die Menschen frühzeitig mobilisieren. Prävention ist bei einer so ansteckenden Krankheit wichtig. Du könntest etwas bewirken und Leben retten.«
Vielleicht … Aber würde eine Rede von Blas Escobedos Schatten für irgendwen eine Rolle spielen? Und selbst wenn es den Leuten nicht egal war, dann wusste Rón nicht, wie er sich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit machen würde. Bei einigen seiner älteren Geschwister hatte er miterlebt, wie sie litten, wenn das Rampenlicht von ihrem Vater auf sie schwenkte. Pítons Drogenproblem, Jags Jähzorn, Panteras Nacktfotosession. Während sein Vater sowohl geliebt als auch gehasst wurde, bekamen Róns Geschwister vor allem den Schmäh der Presse ab, auch wenn sie nichts sonderlich Anstößiges verbrochen hatten. Die Welt hasste den Nachwuchs von Reichen und Berühmten. Deshalb hatte sich Róns Vater so sehr bemüht, ihn von dieser Welt abzuschirmen. Bis jetzt.
»Das sollte Leona übernehmen. Auf sie werden die Leute mehr hören als auf mich. Mir reicht es, im West-Penthouse den Vermieter zu spielen.«
»Damit ist es vorläufig vorbei«, erklärte sein Vater. »Crown Royale wird schlimmer. Wir sollten das Apartment nicht mehr vermieten. Die Seuchenschutzbehörde sagt, die Sterblichkeitsrate liegt bei vier Prozent – einer von fünfundzwanzig, die erkranken, wird sterben. Und es gibt Grund zu der Annahme, dass du zur Risikogruppe gehörst, Tiburón. Du solltest deine Kontakte beschränken. Vielleicht solltest du dich komplett isolieren.«
Rón verkniff sich ein Seufzen. Das mit der Risikogruppe war bislang nur ein Gerücht, doch wenn es um Rón ging, konnten die Vorsichtsmaßnahmen, die sein Vater traf, gar nicht umfassend genug sein.
»Ich mache mir keine Sorgen«, meinte Rón. »Deine Masken funktionieren.«
»Ja, aber sie wirken nicht zu hundert Prozent. Perfektion gibt es nicht. Außerdem verlassen wir die Stadt, denn du weißt ja, wie es in Städten bei solchen Sachen abläuft.«
»Aber die Schule …«
»Distanzunterricht, wenn das Schuljahr losgeht.«
»Und meine Freunde …?«
»Wenn es echte Freunde sind, bleibt ihr in Kontakt. Und wenn nicht, ist es besser, es gleich zu wissen, dann kannst du neue finden.«
Rón nahm sich einen Augenblick, um seinen Vater zu betrachten. Da war etwas in seinen Augen, das ihm nicht gefiel. Eine bestimmte seltene Sorte Angst. Wie die, die Rón bei ihm gesehen hatte, als er im vergangenen Jahr an seinem Bett im Krankenhaus saß.
Im Laufe seiner Karriere hatte Blas Escobedo mitangesehen, wie seine Raketen explodierten. Er hatte erlebt, wie seine Aktien im Sturzflug in den Keller gingen. Es hatte sogar einen Anschlag auf sein Leben gegeben. Raketen konnte man neu bauen. Aktienkurse erholten sich. Angreifer wehrte man ab. Dieser Blick war anders. Und Rón glaubte, den Grund zu kennen.
»Stimmt es, was die über Jarrick Javins erzählen?«, fragte Rón.
Sein Vater rutschte auf seinem Stuhl herum. Rón konnte fast spüren, wie sein Blutdruck stieg.
»Sie bringen es morgen in den Nachrichten. Sobald Javins von Crown Royale genesen war, hat er sein ganzes Geld gespendet, sich aus all seinen Firmen zurückgezogen und ist verschwunden.«
Wie kann die reichste Person der Welt verschwinden? Rón kam ins Grübeln.
»Seit Tagen hat ihn niemand gesehen. Gerüchten zufolge wandert er mit nichts als seiner Kleidung am Leib durch die Welt.«
Rón wusste darauf nichts zu antworten, nur: »Damit dürftest du dann der zweitreichste Mensch der Welt sein.«
Sein Vater machte spitze Lippen. »Auf diese Art wollte ich das nicht erreichen.« Wieder dieser Blick. Stiller Schrecken. »Diese Krankheit … wenn sie dich nicht gleich umbringt, raubt sie dir den Biss. Den Ehrgeiz. Sie verwandelt dich in einen Menschen, der du gar nicht bist, und zerstört dich.«
Rón versuchte es mit einem Schulterzucken abzutun. »Du hast auch immer viel gespendet.«
»Ich spende Geld für wohltätige Zwecke, weil ich es will – nicht, weil ich den Verstand verloren habe. Genau das passiert, TéTé – die Leute verlieren den Verstand.« Er tippte kurz mit den Fingern auf den Schreibtisch. »Hast du je von Howard Hughes gehört, TéTé?«
Ron nickte. »Der Typ mit den Flugzeugen. Der reichste Mann der Welt vor, was, fünfzig Jahren?«
»Der war ganz oben und ist dann verschwunden. Er hatte sie nicht mehr alle.« Sein Vater tippte sich an die Stirn. »So werde ich nicht enden.«
»Wenn du Crown Royale bekommst, wirst du eine Lösung finden«, sagte Rón. Es war weird, seinen Vater auf diese Weise beruhigen zu müssen. »Du findest immer eine Lösung.«
»Wenn es mir ergeht wie Javins, bleibt für dich nichts übrig. Das ist dir klar, oder?«
»Wer sagt, dass es mir etwas bedeutet?«
»Wenn es so weit ist, wird es dir etwas bedeuten. In der Vorstellung ist es vielleicht nicht schwer, ohne Geld glücklich zu sein, Tété, aber in der Realität sieht es anders aus. Sicher, Geld allein macht nicht glücklich – aber ohne ist man auch nicht unbedingt froh.«
Beide ließen diesen Gedanken eine Weile in der Luft hängen und erlaubten es ihren köchelnden Ängsten, vor sich hin zu brodeln. Dann fiel Rón etwas ein.
»Hat sich Howard Hughes nicht auch deshalb versteckt, weil er solche Angst vor Bakterien hatte?«
Sein Vater knurrte und versuchte abzuwinken, aber dieser Fakt ließ sich nicht so einfach verscheuchen.
Rückblickend würde sich Tiburón Tigre Escobedo an diesen Moment erinnern – den Moment, in dem ihm klar geworden war, dass er stärker war als sein Vater.
3
Morgan im Anzug
Es war ein waschechter Raumanzug. Keine Maske, kein Atemgerät und auch kein Schutzanzug, sondern so ein Ding, wie es Astronauten trugen.
»Echt? Muss ich das wirklich anziehen?«
»Ich fürchte ja, Miss. Das ist nicht verhandelbar. Dame Havilland verlangt es. Kommen Sie, wir sind zu viert und helfen Ihnen.«
Für dieses Vorstellungsgespräch hatte Morgan einen weiten Weg hinter sich gebracht, doch inzwischen befielen sie heftige Bedenken. Was hatte es mit diesem echt eigenartigen Praktikum auf sich? Dieser Ort, dieses Schlösschen in der grünen englischen Landschaft war einfach überwältigend. Aber irgendwie deutete sich schon an, dass es sich nicht um Aktenschleppen in einem Großraumbüro handeln würde. Das Praktikum würde sich auch finanziell lohnen, wenn sie es bekam – so viel wusste sie. Und dankenswerterweise war ihr das Glück heute sowohl gut als auch weniger gut gesonnen, und sie hatte es immerhin pünktlich zu dem Termin geschafft. Na, ja, eigentlich hatte das nicht so viel mit Glück zu tun gehabt. Denn das einzige Glück, an das Morgan Willmon-Wu glaubte, war dasjenige, das man selbst in die Hand nahm.
Im Augenblick betrachtete Morgan den Raumanzug mit ernster Sorge. »Wenn er jetzt nicht passt?« Sie wollte ihn einfach nicht anziehen. Hey, wollten die sie zum Mars schicken oder so?
»Oh, der passt schon«, sagte der Butler oder Diener oder wie man eine stocksteife Person in seiner Position auch immer nannte. »Er wurde genau nach ihren Maßen angefertigt.«
Da begannen in ihrem Kopf gleichzeitig so viele Warnleuchten zu blinken, dass Morgan sich regelrecht geblendet fühlte. Verdammt, wo war sie hier bloß gelandet?
Der Tag hatte für Morgan früh begonnen, und zwar mit einer Intensität, die an Panik grenzte, und die Kette der Ereignisse reichte von lächerlich bis grandios.
Mit der Fahrt zum Flughafen fing alles an. Da sie wusste, wie schwierig es war, frühmorgens ein Uber zu bekommen, hatte sie gleich zwei vorbestellt und war bereit, die Stornogebühr zu bezahlen, falls das zweite tatsächlich auftauchte. Allerdings sagten beide in letzter Minute ab, und natürlich konnte sie auch in ihren Mitfahr-Apps keine Alternative auftreiben. Am Ende musste sie einen Gefallen von einer ihrer Freundinnen aus dem Studentenwohnheim einfordern, die sie dann mit verquollenen Augen um fünf in der Frühe von der Universität zum Flughafen Zürich fuhr, damit Morgan ihren Flug erreichte.
Viel zu spät kam sie an der Schlange vor der Sicherheitskontrolle an, die sich als kafkaesker Albtraum entpuppte, und dank Crown Royale war die Anspannung bei den Leuten noch schlimmer als sonst. Wer eine Maske trug, starrte alle, die keine hatten, mit mörderischen Blicken an, aber da längst noch keine Maskenpflicht herrschte, ernteten sie nur genauso finsteres Zurückstarren. Morgan musste sich zwischen schlecht gelaunten Passagieren hindurchdrängeln, die sich extra breitmachten, bis sie die brillante Idee hatte, in ihre Richtung zu husten. Plötzlich bemühten sich alle, ob Maske oder nicht, aus ihrer Reichweite zu gelangen, und machten ihr den Weg frei. Jedes kleine Husten, Niesen oder Schniefen erinnerte die Menschen daran, dass Crown Royale jederzeit richtig loslegen konnte.
Ihre Strategie brachte sie halb durch die Schlange, bis sie auf einen Sicherheitsbeamten traf, der seine Aufgabe viel zu ernst nahm. »Nein«, verlangte er, »Sie müssen sich anstellen wie alle anderen auch.«
Ha! Anstellen wie alle anderen auch. Als hätte sie heute die Wahl.
Der Sicherheitsbeamte sprach, wie Morgan auffiel, Deutsch mit österreichischem Akzent, also antwortete sie mit ihrem eigenen, nachgeahmten, aber überzeugenden österreichischem Akzent, während sie auf die Tränendrüse drückte, als habe sie einen internen Wasserrohrbruch erlitten.
»Bitte, bitte, bitte!«, jammerte sie. »Ich darf den Flug nicht verpassen. Verstehen Sie nicht? Mein Vater! Sie haben keine Ahnung, was er mir antun wird!« Dann begann sie plötzlich wie spasmisch an ihrem Haar zu zerren, als würde sie mit sich selbst kämpfen. »Bitte, bitte, bitte.«
Die Kombination von allem – Tränen, Haareziehen und der Umstand, dass dieses Mädchen mit den unverkennbar europäischen und asiatischen Gesichtszügen wie jemand aus seinem Heimatort sprach – erfüllte den Zweck. Er ließ sie nicht nur durch, er begleitete sie sogar nach vorn.
Dann direkt hinter der Passkontrolle, wie zur Belohnung für ihren Auftritt bei dem Sicherheitsbeamten, fiel einem Mann, der ebenfalls zu seinem Gate rannte, ein Fünfzigeuroschein runter.
Morgan setzte den Fuß darauf, ehe irgendwer etwas bemerkt hatte. Sie hatte zwei Möglichkeiten. Entweder spielte sie die gute Samariterin, lief ihm hinterher und gab das Geld zurück … oder sie behielt es.
Das stürzte sie kaum in ein Dilemma.
Mit dem Schein in der Tasche eilte sie zu ihrem Gate, wo sich das Schicksal wieder gegen sie wandte.
»Tut mir leid, Fräulein«, sagte die Angestellte der Fluggesellschaft. »Sie haben zu spät eingecheckt, und wir haben Ihren Flug bereits jemandem mit einem Stand-by-Ticket überlassen. Heute Nachmittag gibt es den nächsten Flug.«
Das war wiederum keine Option. Sie überlegte, ob sie den Wasserrohrbruch wiederholen sollte, doch wie sie die Frau einschätzte, hatte die schon alles erlebt und würde sich nicht beeindrucken lassen. Nein, das Bild dieser Frau konnte sie sich bestens im Wörterbuch als Illustration neben dem Wort Schadenfreude vorstellen. Je verzweifelter Morgan aussähe, desto mehr Freude würde es der Gate-Agentin bereiten. Diese Situation verlangte einen anderen Ansatz.
Morgan blickte über den Tresen und sah die Bordkarte, die die Gate-Agentin gerade für die Person ausgedruckt hatte, die ihren Platz im Flieger einnehmen sollte. Morgan las den Namen.
»Wer ist Jern van Vleck?«, fragte sie.
Die Augen ihres Gegenübers zuckten zu einem älteren Gentleman, der etwas verloren und griesgrämig in der Nähe saß.
Morgan holte ihren Pass hervor. »Natürlich verstehe ich, dass Sie keine andere Wahl haben und mich auf den nächsten Flug umbuchen müssen«, sagte sie gleichgültig. »Doch ich wäre Ihnen ewig dankbar, wenn Sie darüber noch einmal nachdenken könnten.«
Sie legte die fünfzig Euro in den Pass und schob ihn der Frau über den Tresen zu.
Jern van Vleck flog an diesem Morgen nicht nach London.
Der Flug dauerte keine zwei Stunden und gab Morgan etwas Zeit, darüber nachzudenken, wie sie sich am besten präsentieren sollte. Sie hatte sich aus einer Laune heraus für dieses Praktikum beworben. Nie hätte sie gedacht, dass sie es mit ihrem Bullshit in die engere Auswahl schaffen würde. Schließlich dürfte sie deutlich jünger als die meisten anderen Bewerber sein. Sie war mit fünfzehn an die Uni gegangen, hatte jetzt bereits zwei Abschlüsse hinter sich und war trotzdem erst neunzehn.
Als einen Monat vor ihrer Abschlussfeier die Einladung für ein Vorstellungsgespräch in ihrem Wohnheim eintraf, war sie überrascht. Sie kam nicht per E-Mail, sondern per Post, und das Gespräch sollte auch nicht online stattfinden wie alle bisherigen, sondern man wollte sie persönlich sehen. In England. Für den Flug würden die aufkommen. Die. Das Havilland Konsortium.
Deren Website war minimalistisch und vage. Eine Reihe philanthropischer Zielsetzungen. Morgan konnte sich nicht vorstellen, was die mit ihren Abschlüssen in Linguistik und internationalem Marketing anfangen wollten, doch der Stil gefiel ihr. Die schicke goldgedruckte Einladung. Das geschenkte Flugticket. Und der Schokoriegel, der unverständlicherweise dabei lag. In der Poststube des Wohnheims war die Schokolade natürlich geschmolzen, aber ihre Neugier war geweckt.
Das Problem war, dass das Gespräch am gleichen Tag stattfinden sollte wie die Zeugnisvergabe. In Morgans Augen war eine solche Abschlussfeier etwas für Eltern und Egos. Im Gegensatz zu dem, was sie dem Sicherheitsbeamten über ihren gewalttätigen Vater erzählt hatte, war der in Wirklichkeit bereits tot, und ihre Mutter würde vermutlich sowieso nicht kommen. Abgesehen davon war ihr Ego auch ohne Absolventenhut und Talar gesund genug. Die Entscheidung war ihr leichtgefallen.
Es war nicht einfach, in einem Raumanzug zu gehen. Abgesehen davon, dass man aussah wie ein Idiot und sich auch so fühlte. Morgan fand es schwierig, das Gleichgewicht zu halten und die Füße vorwärts zu bewegen. Noch unangenehmer wurde es, weil der Salon, in den man sie geführt hatte, voller zerbrechlicher Gegenstände war. Knochenporzellan, Glasfiguren, Möbel mit dünnen Beinen, die so wirkten, als würden sie hinter die Kordelabsperrungen eines Museums gehören.
Und mittendrin eine Frau, die einen ebenso zerbrechlichen Eindruck machte wie ihre Einrichtung.
Sie saß in einem Rollstuhl, ein Plastikschlauch schlängelte sich von einem Sauerstofftank zu ihrer Nase, wo er mit zwei winzigen Stöpseln befestigt war.
»Nehmen Sie Platz, nehmen Sie doch Platz«, sagte Dame Glynis Havilland, nach der das Havilland Konsortium benannt war. »Ich hoffe, Ihre Anreise verlief ohne Zwischenfälle.« Die Lippen verzogen sich leicht zu einem verstörenden Grinsen. Sie sprach das Englisch der obersten Gesellschaftsschicht, allerdings schwang leise ein osteuropäischer Anklang darin mit. Morgan überlegte, ob sie sich ihr anpassen sollte, entschied sich dann für den Dialekt aus den »Home Counties«, und so klang sie wie eine typische Mittelklasse-Londonerin.
»Glauben Sie denn, dass die Möbel stabil genug sind? Mit diesem Anzug bin ich ziemlich schwer.«
»Das werden wir baldigst herausfinden, nicht wahr?« Die alte Frau hob den Stock und drückte ihn Morgan vor die Brust. Der Anzug war so superschwer, dass Morgan durch den Stoß die Balance verlor und rückwärts in einen antiken Stuhl plumpste.
Der Stuhl beschwerte sich mit kummervollem Ächzen, hielt am Ende jedoch stand.
»Ich bin hocherfreut, dass Sie es einrichten konnten!«, sagte Dame Havilland. »Ursprünglich sollten Sie den Anzug zu meinem Schutz tragen. Wie sich die Dinge entwickelt haben, dient er nun ihrer Sicherheit.« Die Frau ließ dies ein paar Augenblicke im Raum stehen, ehe sie es erklärte.
»Ungeachtet extremer Vorkehrungen wurde ich unlängst Crown Royale ausgesetzt, und zwar möglicherweise von einem boshaften Angehörigen meines Personals, der allerdings inzwischen entlassen wurde. Wie Sie vermutlich wissen, beträgt die Inkubationszeit drei bis sechs Tage, und ich habe erst vier hinter mir. Daher hat es für mich extrem hohe Priorität, diese Praktikumsstelle schnellstens zu besetzen – und es ist von großem Belang, die Bewerber nicht anzustecken.«
»Tut mir leid, das zu hören«, sagte Morgan. »Aber ich weiß immer noch nicht, worum es bei der Stelle eigentlich geht.«
»Und das wird so bleiben, bis ich es Ihnen erzählt habe.«
Dann hustete die Frau mehrmals. Sie hustete sehr trocken. Mochte vielleicht am muffigen Raum liegen. Oder es konnte mehr dahinterstecken. Morgan hatte gehört, der größte Teil von Hausstaub bestehe aus abgestorbenen Hautzellen, und in einem schlossartigen Anwesen wie diesem mussten im Laufe der Jahrhunderte viele Menschen wie Gespenster von Shakespeare durch die Hallen gespukt sein.
»Hat Ihnen übrigens die Schokolade geschmeckt?«, fragte Dame Havilland. »Das ist meiner Einschätzung nach die beste der Welt. Puccini Bomboni. Klingt italienisch, kommt aber aus den Niederlanden.«
Morgan erzählte ihr nicht, dass sie geschmolzen war. »Schon gewagt, einem Mädchen aus der Schweiz, dem Land der Schokolade, eine solche Süßigkeit zu schicken.«
»Das diente meinem eigenen Vergnügen«, sagte die Frau. »Eine Hommage an Roald Dahl, nach dessen hinterhältigstem Werk ich mein Praktikumsprogramm entworfen habe.«
»Dann darf ich erwarten, dass kleinwüchsige Menschen aus dem Dschungel springen und anfangen zu singen?«
Die alte Frau lachte. »Wenn mehr Zeit gewesen wäre, hätte ich das vielleicht arrangiert. Um die Wahrheit zu sagen, war Mr. Dahl ein schrecklicher Mensch, aber wenn wir Werke nach Sünden und Temperament der Schöpfer beurteilen würden, gäbe er praktisch keine Kunst, Literatur und Musik in der Welt.« Dann hob sie ein Kristallglas mit einem Schnaps. Morgan konnte in ihrem Raumanzug weder mittrinken noch überhaupt riechen, worum es sich handelte. »Auf die gequälten Seelen! Die spucken die interessantesten Rorschachmuster aus.«
Und als sich Morgan jetzt umschaute, entdeckte sie einige Skulpturen und Gemälde der gequältesten Seelen. Grüblerische, sinnträchtige Arbeiten. Die Sorte Kunst, mit der man nachts nicht allein sein möchte.
»Ich habe das Feld der Bewerber bis auf fünf Kandidaten reduziert«, sagte Dame Havilland und stellte das Glas ab. »Dann habe ich alle einem Test unterzogen, um festzustellen, wer den Mumm hat und meine hohen Ansprüche erfüllt. Die Tests waren ungefähr gleich. Die ersten Vier sind durchgefallen.«
»Ich bin also wegen einer Prüfung hier?«
»Die haben Sie schon hinter sich. Ihre Prüfung hat heute Morgen stattgefunden, meine Liebe.« Dame Havilland grinste wieder selbstgefällig. »Ich war es, die Ihre Taxibestellungen storniert hat und Sie so gezwungen hat, sich etwas anderes zu überlegen, damit Sie Ihren Flug erreichen.«
»Okay …«
»Am Flughafen hat sich mein Mitarbeiter – Sie dürfen ihn Slugworth nennen – angeschaut, wie Sie sich mit Ihrem Schauspiel an dem Sicherheitsbeamten vorbeigemogelt haben. Er war es auch, der den Fünfzigeuroschein fallen gelassen hat, den Sie weise behalten und nicht zurückgegeben haben. Hätten Sie ihn zurückgegeben, wären Sie nicht ins Flugzeug gekommen, denn die Gate-Agentin war angewiesen, Sie nur an Bord zu lassen, wenn Sie sie mit diesem markierten Schein bestechen.«
»Ich gehe davon aus, dass der traurige alte Mann ebenfalls zu Ihrer Truppe gehörte.«
»Nein, der war einfach nur ein trauriger alter Mann. Vermutlich wartet er immer noch am Flughafen, soweit ich das weiß.« Und dann begann Dame Havilland, lange und laut zu lachen.
»Sie sind eine sonderbare Frau«, erlaubte sich Morgan anzumerken.
Dame Havilland nahm ihr das nicht übel. »Ich genieße Spiele. Besonders die, die ich mir selbst ausdenke. Sie könnten sogar sagen, mein ganzes Leben ist ein langes Spiel, da ich einen Großteil davon in strategischen Manövern verbracht und mich stets neu erfunden habe, wenn die Notwendigkeit entstand.«
Morgan versuchte immer noch, die komplizierten Manipulationen am Flughafen zu verdauen. Hatte dieser Wahnsinn etwa Methode?
»Geboren wurde ich als Ungarin«, verriet Dame Havilland, »britische Aristokratin wurde ich durch meine Heirat. Obwohl ich von den anderen Angehörigen dieser dekadenten Klasse inbrünstig und ausgiebig gehasst wurde. Doch das habe ich überlebt.«
»Und Ihr Ehemann?«, erkundigte sich Morgan.
»Verblichen. Dabei hatte ich meine Finger nicht im Spiel, sondern ich wurde ehrlich durch einen Herzinfarkt zur Witwe. Ich habe ihn geliebt, er starb, und ich habe getrauert. Aber ich wusste, dass gebrochene Herzen heilen. Und nach einiger Zeit war ich in der Lage, mein bescheidenes Vermögen zu benutzen, um den Spieß umzudrehen gegen diese aufgeblasenen Wichtigtuer, die mich so verachtet hatten. Denn es genügt nicht, einfach nur Erfolg zu haben, man muss diejenigen, die dich verachtet haben, auch in den Staub werfen und ihnen beim Untergang zuschauen wie Dinosauriern, die sie sind.«
Morgan musste über das Gift in der Stimme der Frau lächeln. Und an einen ihrer Kurse denken. An das Mathe-Seminar eines altmodischen Professors, der Noten strikt nach einem Durchschnittsschlüssel vergab. Morgans größter Spaß in dem Seminar hatte darin bestanden, die Prüfung mit solcher Bravour zu bestehen, dass der Durchschnitt deutlich in die Höhe ging, weswegen einige der schwächeren Teilnehmenden durchgefallen waren. Es fühlte sich gut an, solche Macht zu besitzen.
»Aber jetzt haben wir genug über mich geredet«, sagte Dame Havilland und rollte vorwärts. »Sprechen wir über Sie. Morgan Willmon-Wu. Beherrscht fließend Kantonesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch. Geboren in Hongkong als Tochter einer englischen Mutter und eines chinesischen Vaters. Früh erkannte Hochbegabung.« Sie drohte mit dem Zeigefinger. »Allerdings weist Ihr Lebenslauf eine Falschinformation auf, meine Liebe. Ihr Vater war nicht Ihr richtiger Vater.«
»Entschuldigung?«
»Mein Rechercheteam ist gründlich, und Sie würden staunen, was man alles im Darkweb ausgraben kann. In diesem Fall fand es einen Abstammungstest, den Ihr Vater machen ließ, als Sie noch sehr jung waren. Offensichtlich hatte Ihre Mutter eine Affäre mit einem seiner Kollegen. Wir sind aber nicht sicher, mit welchem.«
Plötzlich erwachte in Morgan der Wunsch, die Frau durch die Bleiglasfenster hinauszuwerfen, doch sie beherrschte ihre Wut. Vielleicht gehörte das auch noch zum Test. Allerdings glaubte sie nicht, dass es sich um eine Lüge handelte.
»Warum erzählen Sie mir das?«
»Weil Sie es verdient haben, den Grund dafür zu erfahren, weshalb Ihr Vater vor seinem Tod plötzlich so distanziert war und warum Ihre Mutter mit Ihnen vor all den Jahren nach Zürich gezogen ist.«
»Ich habe genug gehört.« Morgan versuchte aufzustehen, doch sie hatte das Gefühl, der Stuhl würde unter ihr zusammenbrechen, wenn sie sich bewegte.
Dame Havilland lachte. »Meine Liebe, in einem Raumanzug können Sie es vergessen, einen eindrucksvollen Abgang zu machen. Ihr berechtigter Zorn büßt stark an Glaubwürdigkeit ein, solange Sie auf mein Personal angewiesen sind, um sich aus dem Ding zu befreien. Kommen wir lieber zum entscheidenden Punkt. Höchstwahrscheinlich werde ich in den nächsten Tagen an Crown Royale erkranken. In meinem Alter und angesichts meines schlechten Gesundheitszustands werde ich die Krankheit vermutlich nicht überleben. Falls aber doch, wäre das noch viel, viel schlimmer.«
Ehrlich gesagt freute sich Morgan beim Gedanken an den Tod der Alten, hielt aber den Mund und hörte weiter zu.
»Gewiss haben Sie Gerüchte über die Nachwirkungen der Krankheit im Anschluss an die Genesung gehört. Dem Anschein nach sind die Gerüchte wahr. Und das bedeutet: Sollte ich überleben, würde ich mein Anwesen und meinen gesamten Besitz wohl an mein Personal übereignen, an meine Scheinwohltätigkeitsstiftung oder, möge Gott davor sein, an meinen nichtsnutzigen Neffen. Wie durch ein Wunder werden sich meine Augen für die schlichten Dinge des Lebens öffnen, für die Freude am Schenken, Tiny Tim wird hereinmarschieren und Gott uns und alle anderen segnen.« Ihr finsterer Blick machte sehr deutlich, dass sie keineswegs zu dieser Art Scrooge gehörte. »Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich möchte nicht, dass mein Vermächtnis in Güte gegenüber meinen Mitmenschen besteht. In dieser Welt hat niemand meine Gunst verdient. Aber um ein solches Vermächtnis zu hinterlassen, wie ich es im Kopf habe, brauche ich jemanden, in dem mehr Leben steckt als gegenwärtig in mir …
Deshalb musste ich nach einem jungen Menschen suchen. Einem abgebrühten, eigennützigen, durchtriebenen und cleveren jungen Menschen. Dem ich alles anvertrauen kann, was mir lieb und teuer ist. Jemand, der hier das Heft in die Hand nimmt, nachdem ich entweder gestorben bin oder mich in eine Person verwandelt habe, die ich nicht sein möchte.«
Plötzlich erschien Morgan ihr Hass auf diese Frau klein und unbedeutend. »Wollen Sie damit sagen, was ich glaube, was Sie sagen wollen?«
Da stand Dame Glynis Havilland aus ihrem Rollstuhl auf, und ihre Beine waren gar nicht so schwach, wie es den Anschein gemacht hatte. »Morgan Willmon-Wu, ich möchte alles an Sie überschreiben, was ich besitze. Denn ich vertraue darauf, dass Sie wissen, was Sie damit tun werden. Und weil die Zeit zu knapp ist, einen besseren Anwärter zu suchen.«
Morgan schwirrte der Kopf, und sie fragte sich, ob sie in diesem Raumanzug ausreichend Sauerstoff bekam.
»Nehmen Sie mein Angebot an?«
»Wenn ich annehme«, erwiderte Morgan, »was wollen Sie dann im Gegenzug von mir?«
Dame Havilland humpelte zu ihr herüber und blickte Morgan durch das gewölbte Glas des Helms in die Augen. »Ich habe den Wunsch, ein Vermächtnis zu hinterlassen, und nur dieses eine«, erklärte Dame Havilland. »Ich möchte Crown Royale vom Antlitz der Erde tilgen.«
4
Heimurlaub ohne Opfer
»Es lag da auf der Bank. Was sollte ich tun? Es von jemandem stehlen lassen?«
Heute hatte Mariels Mutter nach der miesen Nacht, in der sie ihren Wagen nicht zurückbekommen hatten, beschlossen, dass die Welt ihnen etwas schuldig war, und sich die Brieftasche eines Geschäftsmannes angeeignet.
»Ich habe sie mir doch nur geliehen«, erklärte sie Mariel. »Ich habe sie zurückgegeben und keinen Penny genommen. Er hat nicht einmal bemerkt, dass sie weg war!«
Was Gena allerdings mitgenommen hatte, waren eine Kreditkartennummer, eine Prüfnummer und ein Gültigkeitsdatum.
»Mom, so was kannst du doch nicht machen! Du machst dir schon wegen des Obdachlosenheims in die Hose – solche Aktionen bringen dich ins Gefängnis!«
Ihre Mutter hatte es schon einmal getan – zumindest wusste Mariel von einem Mal. Damals hatte sie die Besitzerin gekannt, eine befreundete Nachbarin. Die Frau hatte eine Tochter in Mariels Alter, allerdings wussten die Mädchen wenig miteinander anzufangen. Sie hatten nichts gemeinsam, nur dass ihre Mütter befreundet waren. Dann fiel die Welt von Mariel und Gena in sich zusammen, und diese »Freundin« tischte ihnen zwar einen Topf voller Mitgefühl auf, hielt sich jedoch ansonsten zurück. Irgendwann später trafen sie sich mal zum Lunch, als Mariel mit ihrer Mutter schon in einem abgeranzten Motel wohnte. Man sah den beiden an, dass sie Angst hatten, die neue Armut könnte auf sie abfärben.
Natürlich bestand die Nachbarin darauf, das Essen zu bezahlen – und machte ein Riesentamtam darum. Dann ging Gena zur Toilette. Angeblich. In Wirklichkeit ging sie zum Kellner, gab ihm ihre Kreditkarte – die zu dem Zeitpunkt noch funktionierte – und bezahlte das gesamte Essen. »Weil wir von dieser Heiligen keine Barmherzigkeit brauchen.«
Wie sich herausstellte, hatte Gena, als sie die Karten wechseln ließ, sich auch die Kreditkartennummer der Nachbarin gemerkt, die Gena dann wochenlang für Essensbestellungen benutzte. Eine bezahlte Rechnung im Tausch für mehr als ein Dutzend.
Mariel hätte sie davon abhalten oder es zumindest versuchen sollen. Doch sie konnte diese Nachbarin und ihre unglaublich brave Tochter auch nicht leiden. Die Chicken Wings und Burger schmeckten umso besser mit dem Wissen, dass die dafür zahlten. Und schließlich war es doch ein Verbrechen ohne Opfer, oder? Denn wenn die Kartenabrechnung kam, würde sich die Nachbarin wegen dieser Buchungen beschweren, und die Bank würde dafür aufkommen.
Anstatt die Sache zu beenden, machte sich Mariel zur Komplizin und holte die Bestellungen persönlich ab, da der Lieferservice natürlich die Bank direkt vor ihre Motelzimmertür geführt hätte, falls es zu einer Ermittlung gekommen wäre. »Betrug ist ja kein Betrug, wenn es sich um schlichte Rache handelt«, hatte ihre Mutter behauptet.
Aber Rache an einer Schönwetter-Freundin war nicht das Gleiche, wie sich die American-Express-Nummer eines völlig Fremden anzueignen.
»Du musst die Nummer wegwerfen«, beharrte Mariel.
Ihre Mutter tippte sich an die Stirn. »Geht nicht. Habe sie schon hier oben.«
Ärgerlich. Ihre Mutter konnte sich Zahlen gut merken. Leider fand sie keine Möglichkeit, aus dieser Fähigkeit Profit zu schlagen. Jedenfalls keine legale Möglichkeit.
»Nur weil du sie dir gemerkt hast, musst du sie ja nicht benutzen!«
»Habe ich ja schon, als wir in der Bücherei waren. Aber ich schwöre hoch und heilig, ich benutze sie nur dieses eine Mal.«
Sie verbrachten viel Zeit in Büchereien – wo man sich den ganzen Tag aufhalten konnte, ohne vertrieben zu werden. Dort hatte sie ihre Mutter an einem der Computer gesehen. Mariel hatte angenommen, sie würde wie üblich in den sozialen Medien ihre Kommentare abgeben. Doch diesmal verfolgte sie einen Plan.
Sie legte Mariel die Hand auf die Wange. »Ich habe es getan, weil wir in diesem ganzen Schlamassel doch wenigstens eine schöne Sache verdient haben. Nicht wahr? Du hast eine schöne Sache verdient.«
Mariel seufzte. Passiert war passiert. »Was hast du gekauft?«
»Ich habe uns eine Nacht gekauft, in der wir uns keine Gedanken um den Grinch oder den Regen machen müssen. Vor allem nicht um irgendwelche Arschlöcher, die unser Geld nehmen, aber nicht auftauchen.« Dann lächelte sie. »Heute Nacht schlafen wir in einem Airbnb.«
Die Neuen waren früh angekommen, doch der Portier hatte Anweisung, eventuelle überpünktliche Gäste bis sechzehn Uhr in der Lobby warten zu lassen.
Tiburón stand bereit, als die Familie schließlich mit dem Expresslift nach oben geschickt wurde. Die Gäste waren eigentlich nicht einkalkuliert, doch sie hatten für eine Nacht gebucht, ehe Rón den Account sperren konnte, wie es sein Vater verlangt hatte. Alle zukünftigen Buchungen wurden gecancelt, doch diese war durchs Netz geschlüpft. Rón freute sich darüber. Da sein Leben auf unbestimmte Zeit zum Erliegen kommen würde, entschied er sich, die letzte persönliche Begegnung zu genießen, ehe es nur noch Gesichter auf Bildschirmen zu sehen gab.
Gleich bei ihrer Ankunft fiel Rón auf, dass diese Frau und ihre Tochter sich von den üblichen Touristen unterschieden, die das Apartment buchten. Sie müffelten. Eine voreingenommenere Person hätte es so ausgedrückt: Sie stanken. Dazu spürte man auch ihre Erschöpfung, als wären beide in den Strömungen eines gnadenlosen Ozeans gefangen.
Sowohl das Mädchen als auch ihre Mutter waren blond und schienen wenig Aufwand mit ihrem Äußeren zu treiben, vielleicht, weil sie keine Gelegenheit dazu hatten. Die Mutter wurde bereits grau, obwohl sie noch gar nicht so alt war.
Rón hatte sein Leben lang versucht, sich nicht über das Privileg des Reichtums definieren zu lassen, so wie viele durch das Privileg ihrer Geburt definiert wurden. Er wusste, was Reichtum bedeutet, er wusste aber auch, was es bedeutete, Braun zu sein, und – darauf wies sein Vater gern hin – es gab viele Menschen, die beides zusammen nicht akzeptieren konnten. Daher bemühte sich Rón stets, nicht auf andere herabzuschauen, doch bei diesen zwei fiel es ihm schwer, sich nicht sofort ein Urteil über sie zu bilden. Wie ihre Situation auch aussehen mochte, diese Nacht sollte sie wohl daran erinnern, dass sie Mitglieder der menschlichen Gemeinschaft waren, etwas, das die Welt ihnen Stück für Stück wegnahm. Trotzdem spürte er bei dem Mädchen ein gewisses Etwas, das er interessant fand. Er hatte sich noch nie ins Privatleben der Gäste gedrängt, doch diesmal war er definitiv neugierig.
Noch ehe er sie begrüßen und zu seiner Standardrede ansetzen konnte, blieb dem Mädchen hörbar die Luft weg. Nicht wegen des Penthouses, sondern seinetwegen.
»Das gibt’s nicht! Du bist Tiburón Escobedo!«, sagte sie.