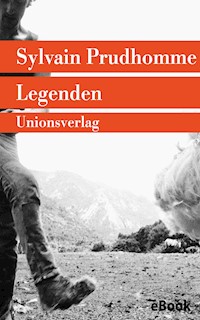12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sacha sehnt sich nach Einsamkeit. Müde vom lauten Paris, zieht er in eine Kleinstadt, irgendwo in der Provence. Fernab von allem, zwischen Platanen und menschenleeren Plätzen, möchte er sich dem Schreiben widmen. Doch dann trifft er auf einen alten Jugendfreund, den »Anhalter« - und der ist immer noch derselbe: Wie schon zu Jugendzeiten bricht er auf, ohne Vorwarnung, hängt sich ein Schild um den Hals – Nach Auxerre oder Nach Landes – und reist kreuz und quer durch Frankreich. Seine Frau Marie und sein Sohn Agustín bleiben allein zurück. Aus Wochen des Wartens werden Monate. Sacha kümmert sich rührend um Agustín und knüpft ein immer engeres Band zu Marie. Eine zarte Geschichte über Sehnsüchte und die große Frage, was ein erfülltes Leben ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Müde vom lauten Paris, zieht Sacha in die Provence. Dort trifft er auf einen Jugendfreund, der oft ohne Vorwarnung für Monate verschwindet, per Anhalter quer durch Frankreich reist. Sacha hingegen knüpft ein immer engeres Band zur Familie seines Freundes. Eine zarte Geschichte über Sehnsüchte und die Frage, was ein erfülltes Leben ausmacht.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Sylvain Prudhomme (*1979) wuchs in Afrika auf, wo er nach dem Studium der Literatur in Paris mehrere Jahre arbeitete. Er wurde u. a. mit dem Prix littéraire Georges Brassens, dem Prix littéraire de la Porte Dorée, dem Prix Révélation de la Société des Gens de Lettres und dem Prix Femina ausgezeichnet.
Zur Webseite von Sylvain Prudhomme.
Claudia Kalscheuer (*1964) übersetzt seit 1994 aus dem Französischen. 2002 wurde sie mit dem André-Gide-Preis, 2010 mit dem Internationalen Literaturpreis ausgezeichnet.
Zur Webseite von Claudia Kalscheuer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Sylvain Prudhomme
Allerorten
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2019 bei l’Arbalète, Éditions Gallimard, Paris.
Lektorat: Anne-Catherine Eigner
Die Übersetzung des Werks wurde unterstützt vom Centre National du Livre, Paris.Originaltitel: Par les Routes
© by Éditions Gallimard, 2019
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Claudia van Zyl (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31086-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 02:08h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ALLERORTEN
1 – Ich begegnete dem Anhalter vor sechs oder sieben …2 – Es hätten mehrere Monate vergehen können, ohne dass …3 – Gleich am nächsten Morgen rief ich ihn an …4 – Draußen lag der Platz verlassen da. Die Metallstühle …5 – Ich blieb den ganzen Nachmittag bei ihm …6 – Es vergingen mehrere Tage, ohne dass ich den …7 – Drei Tage später sah ich Marie wieder …8 – Ich machte mich wieder an die Arbeit …9 – An den folgenden Tagen sahen wir uns mehrmals …10 – Der Anhalter zog jetzt öfter los. Marie und …11 – Marie und Agustín warteten auf seine Anrufe …12 – Jedes Mal, wenn sein Vater zurückkam, fragte Agustín …13 – An den Abenden, an denen er zu mir …14 – Die Abwesenheiten des Anhalters dauerten eine Woche …15 – Eins kann ich versichern: Der Anhalter floh nicht …16 – Eines Tages war ich es, der ihm aushalf …17 – Es gibt zwei Kategorien von Menschen. Die …18 – Am Morgen wurde ich vom Tageslicht geweckt …19 – Als ich ankam, saßen sie schon im Auto20 – Nach diesem Tag stand ich mitten in der …21 – Ein paar Tage später fand Marie das Gitter …22 – Und dann zog er wieder los23 – Allmählich änderte der Anhalter seine Methode. Schluss mit …24 – Es kamen weiter Polaroids bei mir an …25 – Er war nach Norden unterwegs. Wir konnten seine …26 – Am nächsten Tag holte ich Agustín von der …27 – Marie kam nach zehn Tagen zurück. Gegen zwei …28 – An diesem Morgen redete Marie lange29 – Und dann habe ich ihn wiedergefunden. Am vierten …30 – Es war Mittag, als ich ging. Marie brachte …31 – Ich besuchte Marie und Agustín jetzt öfter …32 – Wir gewöhnten uns an unser neues Leben …33 – Wir begannen, ihm Aufträge zu erteilen. Gaben ihm …34 – Die Tage wurden wieder länger. Es war mild …35 – Mit der Zeit begann der Anhalter zu bedauern …36 – Nach und nach entfernte er sich. Die Häufigkeit …37 – Dann versiegten die Sendungen ganz38 – Drei Tage später war es so weit39 – Der letzte Fahrer setzte mich mitten auf einer …40 – Als wir vom Bach zurückkamen, zogen wir uns …41 – Als ich aufwachte, wollte ich nach der Uhrzeit …42 – Ich kehrte zu Marie zurück. Ich erzählte ihr …43 – Ich gab meine Wohnung auf. Transportierte die paar …44 – Mit Marie und Agustín habe ich wieder angefangen …45 – Dann bekam ich vor zwei Wochen von einer …NachweiseMehr über dieses Buch
Sylvain Prudhomme: »Jede Begegnung ist wie ein Fenster, das sich zum Möglichen hin öffnet – eine Gelegenheit.«
Über Sylvain Prudhomme
Über Claudia Kalscheuer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Sylvain Prudhomme
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Liebe
Die Zeit geht und kommt und wendet sich,nach Tagen, nach Monaten und nach Jahren,und ich, ach, weiß nichts davon zu sagen,denn immer einer bleibt mein Sinn.
BERNART DE VENTADORN
1
Ich begegnete dem Anhalter vor sechs oder sieben Jahren in einer kleinen Stadt im Südosten Frankreichs wieder, nachdem ich ihn fünfzehn Jahre lang zwar nicht ganz vergessen hatte (der Anhalter gehört nicht zu denen, die man vergisst), aber doch zumindest nicht mehr so oft an ihn dachte wie früher. Ich nenne ihn den Anhalter, denn so, unter diesem Beinamen, den er immer nur für mich hatte, wenn ich mich innerlich an ihn wandte, ist er mir stets erschienen in all den Jahren, in denen ich mit ihm Umgang pflegte, und auch noch in all denen, in denen wir einander fern waren und ich mich doch dann und wann an ihn erinnerte wie an eine Landmarke, Orientierungspunkt und Warnzeichen zugleich.
Ich war gerade nach V. gezogen, als ich erfuhr, dass er auch dort lebte.
Ich hatte Paris verlassen, um ein neues Leben zu beginnen. Ich sehnte mich mit aller Macht nach einer Luftveränderung. Zerstörung, Wiederaufbau: Das war mein Programm für die kommenden Tage, vielleicht auch Jahre.
Ich ging auf die vierzig zu. Seit Jahren schrieb ich Bücher. In Paris arbeitete ich zu Hause, ich ging hinaus und kam zum Arbeiten zurück. Ich ging auf die Dinge zu, die Dinge kamen mir entgegen. Ich lernte Menschen kennen. Manche wurden mir nah. Ich verliebte mich. Ich hörte auf, verliebt zu sein. Ich weiß nicht, ob der natürliche Hang des Lebens darin besteht, dass man zuerst allein ist, unabhängig, nomadisch, um sich dann allmählich mehr zu binden, sich niederzulassen, eine Familie zu gründen. Wenn dem so ist, entwickelte ich mich rückwärts. Ich ließ mich immer weniger ein. Meine Liebesgeschichten wurden immer kürzer. Immer seltener. Ich war schwerer zu ertragen als vorher. Oder vielleicht war ich es, der mit der Zeit weniger geduldig wurde, weniger fähig, mich um die anderen zu kümmern.
War ich nachlässig geworden. Oder interessierte mich die Liebe einfach weniger.
Das Alleinsein machte mir keine Angst. Ich habe in der Einsamkeit immer Momente tiefer Freude erlebt, natürlich im Wechsel mit Momenten tiefer Traurigkeit, aber dennoch: Alles in allem habe ich gute Anlagen zum Glücklichsein.
Ich liebe und fürchte zugleich die Vorstellung, dass es eine Schattenlinie gibt. Eine unsichtbare Grenze, die man gegen Mitte des Lebens überschreitet und jenseits derer man nicht mehr wird, sondern einfach nur noch ist. Schluss mit den Versprechen. Schluss mit den Spekulationen darüber, was man morgen wagen oder nicht wagen wird. Das Gebiet, zu dessen Erforschung man das nötige Potenzial in sich trug, die Spanne der Welt, die zu umarmen man fähig war, hat man nunmehr ermessen. Die Hälfte unserer Zeit ist vergangen. Die Hälfte unseres Lebens ist da, hinter uns, abgespult, und erzählt, wer wir sind, wer wir bisher gewesen sind, was wir zu riskieren in der Lage waren oder nicht, was uns bekümmert, was uns beglückt hat. Wir können uns noch schwören, dass die Mauser nicht abgeschlossen ist, dass wir morgen jemand anderes sein werden, dass der oder die, die wir wirklich sind, noch zum Vorschein kommen wird, aber es wird immer schwieriger, daran zu glauben, und selbst wenn es so wäre, die Lebenserwartung dieses neuen Menschen wird mit jedem Tag geringer, während zugleich das Leben des alten, desjenigen, der wir so oder so jahrelang gewesen sein werden, weiter wächst, was auch immer jetzt geschehen mag.
In V. hatte ich vor, ein beschauliches Leben zu führen. Gesammelt. Arbeitsam. Ich träumte von Ruhe. Von Licht. Von einem wahrhaftigeren Leben. Ich träumte von Schwung. Von Fluss. Von einem Buch, das mit einem Mal hervorquellen würde, in ein paar Wochen nur. Von etwas Blitzartigem, das plötzlich herausbräche, als Belohnung für Monate der Geduld. Ich war bereit, darauf zu warten. Ich mag die Vorstellung von harter Arbeit. Ich bewundere das: Beharrlichkeit, Eigensinn, Ausdauer.
Ich hatte mir V. ausgesucht, weil die Stadt klein ist. Weil es hieß, sie sei schön, das Leben dort sei angenehm. Weil ich dort nur zwei oder drei Bekannte hatte, die ich gerne ab und zu treffen würde, ohne dass es zu anstrengend wäre: einen Cousin, der Gymnasiallehrer war und den ich nicht gut kannte, aber gern mochte. Freunde von Freunden, die zu sehen mich nichts verpflichtete.
Ich erinnerte mich an zwei oder drei Sommerwochenenden, die ich in der Stadt verbracht hatte, aber ich wusste, dass sie in dieser Jahreszeit alles tat, um ihre Feriengäste zu erfreuen, und nur eines ihrer Gesichter zeigte, das attraktivste, zugänglichste. Ich hatte mir gewünscht, auch das andere zu sehen. Das der langen Winternächte. Der blauen, eisigen Januarhimmel. Ich hatte die überfüllten Caféterrassen, die Fassaden mit den weit offenen Fenstern betrachtet und mich gefragt: Und in drei Monaten. Wenn all die Leute wieder weg sind. Wenn die Temperaturen auf null sinken und das Licht auf die leeren Plätze und die geschlossenen Cafés fällt.
Ich hatte mich nach dieser Ruhe gesehnt. Ich hatte das Gefühl gehabt, in V. könnte ich die Konzentration, die Askese wiederfinden, die mir seit Jahren fehlten. Das rechte Maß an Isolation, das mir endlich erlauben würde, mich zu sammeln, zu fassen, vielleicht wiedergeboren zu werden.
2
Es hätten mehrere Monate vergehen können, ohne dass ich dem Anhalter begegnete – kein Gesetz zwingt zwei Bewohner derselben Stadt, wie klein auch immer, sich über den Weg zu laufen.
Es dauerte jedoch nur ein paar Stunden, bis es so weit war.
Ich kam gegen Mittag am Bahnhof von V. an, beladen mit zwei Taschen voller Bücher und Kleider, sonst nichts. Das Wetter war schön, es war Anfang September. Die Platanen begannen, ihre Blätter zu verlieren. Sie lösten sich eins nach dem anderen, fielen herab wie große Holzspäne, landeten mit einem schabenden Geräusch auf dem Boden. Raschelten dann mit jedem Windstoß über den Asphalt.
Ich ging zu Fuß bis ins Stadtzentrum, an den Mauern einer Schule entlang, hinter denen das Geschrei der Mittagspause aufstieg. Ich traf den Vermieter der möblierten Wohnung, die ich per Internet gefunden hatte. Wir erledigten die Übergabe, stellten ein paar Risse an der Decke fest, regelten die Überweisung der Miete, tranken auf der nächsten Caféterrasse ein Gläschen. Dann händigte der Mann mir die Schlüssel aus, und ich sah ihn um die Straßenecke verschwinden.
Ich ging zum Haus zurück, die Treppe hinauf. Ich öffnete die Wohnungstür, betrachtete meine neuen vier Wände. Zwei Zimmer mit Parkettboden, die mir auf den Fotos im Netz behaglich vorgekommen waren. Zwei Zimmer, die mir jetzt vor allem äußerst niedrige Decken zu haben schienen.
Ich betrachtete die mandelgrünen Wände – die habe ich selbst gestrichen, hatte der Mann gesagt, als er mich herumführte, voller Stolz, dass er, um genau dieses Grün und kein anderes zu erhalten, die Farbe bei einer Londoner Firma hatte bestellen müssen. Ich betrachtete die Lampe, die in Kopfhöhe über dem Tisch hing. Den angejahrten Stuck an der Decke. Die schweren Vorhänge. Das ausgesessene alte Sofa in einer Nische, weit weg vom einzigen Fenster.
Ich dachte: Jetzt bin ich also wieder Student.
Ich lächelte.
Ich stellte meine Sachen in eine Ecke, putzte kurz durch, erledigte viel schneller als früher die üblichen Telefonate für Strom, Gas, Internetverbindung.
Ich ging ein paar Sachen einkaufen, Kaffee, Nudeln, Olivenöl, Wein.
Ich kam zurück. Betrachtete erneut die reglosen Wände, die reglosen Vorhänge, die Lampe, den Tisch. Ich spürte die Stille als Block zwischen den Wänden. Ich hörte das Knarzen des Parketts unter meinen Schritten. Ich stellte meine Einkäufe neben die Spüle. Dieser Handgriff beglückte mich: meine Einkäufe auf die Arbeitsplatte einer neuen Küche zu stellen. Ich hörte, wie die Flasche Olivenöl auf dem Taschenboden leicht gegen die Anrichte stieß. Ich erkannte dieses vertraute Geräusch wieder, das Aufsetzen der Einkaufstasche auf dem Holz einer Küche. Meiner Küche.
Ich dachte: Ich werde mich hier wohlfühlen.
Ich kramte in der Schublade und nahm ein Messer heraus. Ich schälte mehrere Knoblauchzehen, hackte sie klein, gab sie in heißes Olivenöl. Es begann zu duften. Ich kochte die Nudeln, goss sie ab, schüttete sie in die Pfanne mit dem Öl und dem Knoblauch. Ich schaute zu, wie die langen Stränge sich wanden. Ich wartete, bis sie anbrieten, bis Öl und Knoblauch sie völlig durchdrangen, bis sie kross wurden wie Reisig.
Ich schob den Tisch ans Fenster. Ich setzte mich. Ich aß. Ich kratzte die Pfanne bis auf das letzte gebratene Knoblauchstückchen aus. Ich setzte Kaffee auf.
Dann begann ich ohne Verzug zu arbeiten.
Damit mein neues Leben nicht wartete.
Ich blieb bis zum Abend an meinem Computer sitzen, hellwach, angespannt, glücklich.
Ich dachte: Die Zeit wird hier ausgefüllt sein. Jede Woche wird hier wie ein Monat sein.
Gegen achtzehn Uhr bekam ich einen Anruf von Julien, meinem Cousin, dem ich gesagt hatte, dass ich an diesem Tag ankommen würde. Er bot mir an, zu einem Fest zu kommen, das bei ihm zu Hause stattfand.
Ich dachte: nein.
Nein, nicht jetzt schon.
Ich sagte Ja.
Und machte mich wieder an die Arbeit.
Gegen einundzwanzig Uhr duschte ich, schnappte mir in der Küche die Flasche Wein, die ich vorher gekauft hatte.
Draußen war die Septembernacht schon fast dunkel, die Straßen waren verlassen, nur wenige Restaurants noch offen. Der Wind hatte zugenommen, es war kalt. Ich betrachtete die Geschäfte mit den herabgelassenen Läden, die Häuser mit den hier und da erleuchteten Fenstern, das blaue und grüne Flackern eines Fernsehers an einer Decke im ersten Stock. Durch eine Scheibe im Erdgeschoss sah ich eine Familie beim Abendessen sitzen.
Ich kam vor einem hell erleuchteten Haus an. Durch die Fenster sah ich Gestalten in der Küche und im Wohnzimmer stehen, ich hörte die voll aufgedrehte Musik. Mein Cousin Julien öffnete mir die Tür.
Sacha.
Er umarmte mich.
Dann bist du also wirklich da.
Er nahm mich mit ins Wohnzimmer, stellte mir seine Freundin Anissa vor. Er machte die Musik leiser, um fröhlich meinen Namen in die Runde zu rufen.
Mein Cousin Sacha. Seht zu, dass er sich bei uns wohlfühlt.
Bevor ich irgendetwas entscheiden konnte, hatte ich schon ein Glas Rotwein in der Hand und unterhielt mich mit Anissa und Jeanne, einer Lehrerkollegin von Julien. Ich erzählte ihnen von meinem ersten Tag in der Stadt, von meiner Ankunft am Bahnhof mit meinen zwei Taschen voller Bücher und Kleider. Von meinen zwei Zimmern mit den grünen Wänden. Meinen gebratenen Knoblauchnudeln.
Sie lachten.
Wir laden dich ab und zu mal ein, damit du nicht immer nur Nudeln isst, meinte Anissa.
Ich sah, dass Jeanne näher rückte, dass die Geschichte dieser einsamen Ankunft sie amüsierte. Ich erriet, dass sie auch allein lebte. Anissa zog sich zurück. Jeanne erzählte mir, wie sie in der Stadt angekommen war, vor vier oder fünf Jahren, nach einer ersten Stelle in der Nähe von Brest. Ich erzählte ihr, was mich herführte. Von meinem Wunsch nach einem reinen Tisch. Nach Konzentration. Nach Ruhe.
Wir leerten unsere Gläser und füllten sie neu. Sie fragte mich, worum es in dem Buch gehe, das ich schreiben wollte.
Und was ging dann in ihrem Kopf vor. Was habe ich gesagt, dass ihr dieser Gedanke kam.
Oh da gibt es jemanden in V. den ich dir vorstellen muss. Jemand mit dem du dich ganz sicher verstehen wirst. Er ist amüsant ein bisschen verrückt du wirst sehen er ist auch ein Büchermensch. Er ist vor etwa vier Jahren nach V. gezogen.
Woran habe ich erraten, dass er es war. War es die Beschreibung als ein bisschen verrückt. Der Umstand, dass er vor ein paar Jahren erst hergezogen war.
Ich spürte das Blut in meinen Adern pochen.
Ihr müsst euch kennenlernen ihr seid füreinander geschaffen ganz sicher, fuhr Jeanne fort.
Und dann sagte sie seinen Namen.
Ich bemühte mich nach Kräften, mir nichts anmerken zu lassen. Sie sah nichts. Ahnte keine Sekunde lang, welchen Aufruhr sie in mir auslöste.
Du musst sie alle beide kennenlernen. Seine Lebensgefährtin und ihn. Alle drei. Sie haben einen kleinen Jungen. Sie sind toll.
Ich sagte nichts. Ich ließ die Neuigkeiten erst mal sacken. Der Anhalter, ganz in der Nähe. Der Anhalter in einer festen Beziehung. Vater eines Kindes.
In dem Moment tauchte Julien auf.
Alles in Ordnung Cousin bist du in guten Händen.
Er sah Jeanne neben mir. Er zog ein Päckchen Zigaretten hervor, fragte mich, ob mir schon jemand die Terrasse gezeigt habe. Wir stiegen alle drei eine steile kleine Treppe hoch, eine Etage, zwei Etagen, noch eine Treppe, um ganz oben in die Nacht hinauszutreten. Von der Terrasse aus blickten wir auf die Dächer der umliegenden Häuser, die Äste einer ganz nahen Platane, die Sterne über unseren Köpfen, das schwarze Wasser des Flusses.
Ihr scheint es hier gut zu haben, sagte ich nach einer Weile zu Julien.
Er nickte sanft.
Dir wird es in V. auch gefallen wirst schon sehen.
Auf dein Wohl Sacha, sagte Jeanne und hob ihr Glas. Willkommen in V.
Wir stießen alle drei an.
Ich betrachtete den Mond über den Dächern. Lauschte dem Lärm des Festes im Erdgeschoss.
Ich dachte an den Anhalter. An diese Fabel, die mir eines Tages wieder eingefallen war, kurz bevor ich ihm sagte, er solle aus meinem Leben verschwinden: Vom Eisentopf, der dem Tontopf nichts Böses will, der ihm sogar aufrichtig wohlgesinnt ist und ihn doch durch eine falsche Bewegung in tausend Stücke bricht. Vom Tontopf, der so lange mit dem Eisentopf verkehrt, bis er eines Tages zerspringt.
Dem Schicksal gegenüber gibt es zwei Möglichkeiten: bis zur Erschöpfung dagegen ankämpfen. Oder ihm nachgeben. Es annehmen, heiter, ernst, wie man von einer Klippe springt. Auf Gedeih und Verderb.
So sei es, heißt es in ziemlich allen Religionen, und in dieser Zustimmung liegt eine Kraft, die mich seit jeher fasziniert.
Amen.
Amin.
Da es denn sein muss.
Da es denn so kommen muss, so oder so.
3
Gleich am nächsten Morgen rief ich ihn an. Am Telefon blieb es erst einmal still.
Sacha.
Ich sagte, ich sei da. Ich sei gerade nach V. gezogen.
Er ließ einen Moment verstreichen.
Du hier das ist verrückt.
Wir schwiegen eine Weile, warteten beide. Wir hatten uns seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gesehen, nicht mehr gesprochen.
Komm, sagte er schlicht.
Was meinst du.
Komm gleich. Komm vorbei. Wozu warten.
Seine Stimme hatte sich nicht verändert. Trotz der Überraschung war er ruhig.
Komm Marie und Agustín sind da, es ist Sonntag, dann siehst du gleich alle.
Ich legte das Telefon auf einen Hocker. Betrachtete die grünen Wände um mich herum. Dachte, ich müsste Stühle kaufen. Die beiden, die da waren, würden nicht lange reichen, so einsam mein neues Leben auch sein mochte.
Ich betrachtete das Morgenlicht, das durch das Fenster hereinfiel und auf dem Parkett einen großen goldenen Fleck bildete. Ich betrachtete den Staub, den ich tags zuvor in meiner Eile, mich sofort an die Arbeit zu machen, übersehen hatte. Ich bückte mich, um mit dem Finger über die Fußleiste zu fahren. Meine Fingerspitze bedeckte sich mit einer schwarzen Schicht. In der kleinen Kammer unter der Treppe fand ich einen Staubsauger. Ich ging hinunter, um Chlorreiniger, Fensterputzmittel, neue Staubsaugerbeutel, Schwämme und einen Wischlappen zu kaufen. Ich saugte. Ich putzte. Ich schrubbte. Ich spülte. Die Wohnung begann, sauber zu riechen.
Ich warf einen Blick auf meinen Computer, der seit dem Vorabend aufgeklappt auf dem Tisch stand.
Ich dachte, arbeiten würde ich später.
Durch das nunmehr saubere Fenster beobachtete ich die Wohnung gegenüber, offene Fenster vor einer kleinen Schreibtischecke, weiße Wände, Regale voller Bücher.
Ich dachte, dass es sich in diesem Raum sicher gut arbeiten ließ. Dass die Nachbarn von gegenüber bestimmt sympathisch waren, wenn sie Bücher so liebten.
Ich kochte mir Kaffee. Der Geruch aus der Kaffeemaschine vermischte sich mit dem des Chlorreinigers. Ich fragte mich, ob das zu einer chemischen Reaktion führen würde. Ob der Chlorgeruch die Macht hatte, den Geschmack des Kaffees zu verderben. Ich goss den Kaffee in eine große Tasse, führte sie zu meinen Lippen. Der Geschmack kam mir merkwürdig vor. Ich trank einen zweiten Schluck, einen dritten. Dann schmeckte ich das Chlor nicht mehr.
Ich öffnete meine beiden Reisetaschen, holte meine Kleider heraus, alles in allem zwei Jeans, drei T-Shirts, ein Hemd, ein paar Unterhosen und Socken. Ich räumte sie in das einzige Regal der Wohnung, gut sichtbar, gebrauchsbereit, so wie ich es immer mache, wenn ich ein paar Tage an einem fremden Ort verbringe, bei Freunden oder in einem Hotelzimmer. Ich genoss diese Reduktion meiner Garderobe aufs Wesentliche. Ich sah darin ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg war. Auf dem Weg zu dem Leben, das ich wollte. Gesammelt. Genügsam. Verdichtet.
Ich tauchte wieder in meine Taschen ein und holte die etwa zwanzig Bücher hervor, die ich mitgebracht hatte. Korrektur von Thomas Bernhard. Dada aus dem Koffer. Die verkürzte Geschichte der tragbaren Literatur von Vila-Matas. Claude Simons Georgica, das vollste Buch, das je geschrieben wurde, wie ich immer gedacht habe, das dichteste, lebendigste, bis zum Rand vollgestopft mit stillstehenden Zügen im Winter, mit Granatenexplosionen und wogenden Weizenfeldern und nächtlichen Stunden des Wartens auf froststarren Pferden. Der Oberst hat niemand, der ihm schreibt von Garcia Márquez, in dem ein verarmter alter Mann wartet, immer weiter wartet auf eine Veteranenpension, die nicht kommt, und in der Zwischenzeit lieber verhungern will als auf den einzigen Stolz verzichten, der ihm bleibt: seinen Kampfhahn. Francis Ponges Pour un Malherbe, in dem ich an mutlosen Tagen nur zu blättern brauche, um mich aufgemuntert, entschlossen und zuversichtlich zu fühlen: »Wir sind ans Meer gefahren (dreizehn Kilometer von Caen): Wir haben dessen starke, bittere Verfassung festgestellt, und wie die Dünenpflanzen wütend dem Wind standhalten, selbst wenn sie sich nirgends anders als im Sand festklammern. Wir sind Meer und Dünen zugleich und wohl in der Lage, es ihnen gleichzutun. Wir werden unseren Zorn vom 1. und 2. Oktober nutzen, um den notwendigen Ton zu finden, das Wort zu ergreifen und zu behalten. Wir, in der Menge verloren. Wir, die wir dritter Klasse reisen. Wir, die wir nicht wissen, wie wir leben sollen, und keinen Geschmack an der Boheme finden.«
Ich stellte sie eins nach dem anderen ins Regal, in Blickhöhe, unübersehbar. Damit sie mich jedes Mal, wenn ich vorbeiging, mit all ihrer Macht zur Ordnung riefen, anstachelten, zu höchstem Anspruch und zur Arbeit aufforderten.
Ich packte meine Taschen vollends aus. Ich betrachtete meine gesamten Besitztümer, die vor mir im Licht ausgebreitet waren, geordnet, gebrauchsbereit, willentlich auf genau das Nötige beschränkt, gleich den Instrumenten eines Chirurgen vor der Operation. Ich dachte: Mit wenig sieht man besser. Lebt man besser. Bewegt man sich besser fort, denkt besser, entscheidet sich besser. Ich genoss den Gedanken, dass mein Leben jetzt da war. Der ganze Ballast meines vierzigjährigen Lebens reduziert auf diese paar Sachen in einem Regal.
Ich griff nach der Frankreichkarte, die ich immer dabeihabe, und pinnte sie an die Wand. Ich fuhr die Strecke nach, die ich tags zuvor mit dem Zug zurückgelegt hatte, Paris, wo alle Wege zusammenlaufen, das Rhonetal hinab, die grünen, gelben und orangeroten Zonen, die ich in den paar wenigen Stunden an Bord des TGVs durchquert habe bis zu dem entlegenen Punkt V.
Ich dachte: Jetzt bist du da. An diesem winzigen Punkt auf der Karte wohnst du. Irgendwo im Schwarz dieses Punktes namens V. befindet sich der noch unendlich viel kleinere Punkt deines eigenen Körpers.
Und dann fiel mir ein: Irgendwo in diesem Punkt befindet sich auch der Punkt des Körpers des Anhalters. Ich ließ meinen Blick über den Rest der Karte schweifen, über die großen leeren Gebiete, über die Tausende von anderen Punkten, wo er oder ich hätten beschließen können zu leben. Ich dachte, wie verrückt es doch war. Was es für einen unglaublichen Zufall gebraucht hatte, dass wir beide uns hier trafen. Oder vielleicht etwas anderes als einen Zufall. Ich versetzte mich an die Stelle des Anhalters. Ich dachte, was er wohl hatte denken müssen, als er hörte, dass ich da war. Wie undenkbar es war, dass er nicht gedacht hatte, ich sei gekommen, weil ich ihn suchte. Ich sei wegen ihm hergezogen.
Ich dachte an Lee Oswald, wie er im obersten Stockwerk des Gebäudes, von dem aus er auf Kennedy schießen wird, sein Gewehr auspackt. An alle Auftragskiller in den Stunden vor dem Mord, den sie begehen werden. An ihre Ruhe. An die Präzision ihrer Handgriffe. An die Sorgfalt, mit der sie ihre Stellung auswählen. Mit der sie ihre Sachen ordnen. Mit der sie alles vorbereiten, damit, wenn es so weit ist, alles gutgeht.
Lebe, sagte der Anhalter immer zu mir. Lebe erst mal, danach wirst du schreiben.
Lass diesen schönen sonnigen Tag nicht vorbeiziehen, jedes Mal, wenn er mich an meinem Computer sah. Oder wenn er so freundlich war, es nicht zu sagen, verstand ich, dass er es dachte. Und seine Taten sagten es mir auch. Wenn er baden ging und ich nicht. Wenn er einen Spaziergang machte und ich nicht. Wenn er in der Kneipe Unbekannte kennenlernte und ich nicht.
Ich trank meinen Kaffee aus. Mein Blick fiel auf einen Band im Regal, den ich im letzten Moment noch in meine Tasche gesteckt hatte. Ein kleines Buch, auf das ich kurz vor der Abreise gestoßen war, nachdem ich tagelang die Regale meines kleinen Pariser Zimmers leer geräumt hatte, und dessen Titel lautete: Per Anhalter! Praktischer und humoristischer Führer für den Tramper. Ich nahm es aus dem Regal. Ich blätterte die ersten Seiten durch. Text von Yves-Guy Bergès, Zeichnungen von Sempé. Ich konnte mich an den Bouquinisten erinnern, dem ich es zwanzig Jahre zuvor abgekauft hatte, unter dem Dach einer Markthalle im Süden von Paris.
Ich sah mich mit dieser Trophäe in der Hand vor mir, wie ich sie dem Anhalter zeigte. Ich erinnerte mich an seine Reaktion angesichts des Buchs. An das Lächeln auf seinem zwanzigjährigen Gesicht.
Ein Buch über das Trampen. Warum nicht gleich ein Buch über die richtige Art zu gehen. Ein Buch über die richtige Art, sich schlafen zu legen.
Ich blätterte darin herum. Ich bewunderte die erfrischende Widmung: Gewidmet der SNCF, zum Zeichen meiner Hochachtung und Sympathie. Ich ließ meinen Blick über die Seiten wandern, erhaschte hier und da eine Passage: »Ich kann für meinen Teil durchaus behaupten, dass ich Autofahrer liebe. Ich hatte in meinem Leben mit über dreitausend von ihnen Verkehr.« Ich entdeckte die Geschichte des Pariser Vereins Pouce, Daumen, der Ende der Fünfzigerjahre das löbliche Projekt entwickelt hatte, Anhalter und Autofahrer durch ein System von Kleinanzeigen zusammenzubringen – ein Vorläufer der heutigen Mitfahrportale, nicht mehr und nicht weniger.
Ich spürte, wie meine Scham sich verschob, ihren Gegenstand wechselte. Meine frühere Scham wich einer gegenwärtigen Scham: derjenigen, dass mir dieses doch gute Buch damals peinlich gewesen war. Dass ich das Urteil des Anhalters derart gefürchtet hatte. Ich fragte mich, ob er heute nicht der Erste wäre, dem es gefiele.
Ich nahm das Buch unter den Arm. Und verließ das Haus.
4
Draußen lag der Platz verlassen da. Die Metallstühle der Bar de la Fontaine glänzten. Platanenblätter bedeckten den Asphalt, vom Regen in der Nacht aufgeweicht, platt wie nasser Karton, dumpf unter der Schuhsohle. Es war frisch, das tat gut. Auf den Armlehnen der Alustühle glänzten Tropfen. Der Stoff der zugeklappten Sonnenschirme hing schlaff herab. Die Wolken waren weiß. Das Licht prallte von den Fassaden ab, strahlte von überall her. Die Gullydeckel schimmerten. Die Stämme der Platanen waren dunkel, die Poller sauber gespült von der großen Herbstwäsche.
Ich ging die Straße hinunter. Ich kam an geschlossenen Läden vorbei. Ich sah schon von Weitem das morgendliche Treiben vor der Bäckerei, das Kommen und Gehen durch die automatische Schiebetür, das Ballett der mit Baguettes und Croissants beladenen Kunden. Ich trat in die warme, duftende Luft ein. Ich kaufte eine Fougasse mit Oliven. Ich trug den großen, leichten Gebäckschläger vor mir her. Ich roch den fetten, aufdringlichen Geruch. Betrachtete die Tausende von eingebackenen Thymianblättchen, die schwarzen Flecken der zerdrückten, beinahe karamellisierten Oliven. Das braune, schon mit Öl vollgesogene Papier.
Ich kam vor dem Haus des Anhalters an. Ich sah die mehr als bescheidene kleine Straße. Die Vorschule gegenüber. Die Eingangstür des Hauses, gesichert mit einem wenig einladenden Gitter. Ich klingelte. Die Tür öffnete sich. Dahinter tauchte der Kopf eines Kindes auf. Vielleicht acht Jahre alt. Oder neun, das Alter von Kindern zu erraten, war nie meine Stärke. Schwarze Haare. Schwarze Augen, wie sein Vater. Ich wollte das noch geschlossene Gitter aufziehen. Der Junge und ich starrten einander durch die Metallstäbe an.
Hallo du.
Hallo.
Wie heißt du denn.
Agustín. Und du.
Sacha.
Der Kleine drehte sich um, rief nach seinem Vater.
Ich sah die Gestalt des Anhalters durch den Flur näher kommen. Sein lächelndes Gesicht.
Er deutete auf die Gittertür.
Wir waren heute Morgen noch nicht draußen, tut mir leid.
Er drehte den Schlüssel zweimal im Schloss. Das ließ mir Zeit, ihn anzuschauen. Ihn genau zu betrachten. Sein nur ein bisschen älter gewordenes Gesicht. Seine kaum merklich schärfer gewordenen Züge. Männlicher. Wangenknochen und Nasenrücken prägnanter. Stirn etwas breiter. Weniger jungenhaft. Lässig gekleidet, wie schon immer, einfache Jeans, Pullover mit geknöpftem Kragen, schlichte Eleganz.
Hallo Sacha. Komm rein.
Der Junge kletterte an der Gittertür hoch, stieß sie zum Spaß auf und zu, von der Tür zur Wand und wieder zurück.
Na komm Agustín.
Das Kind tat, als würde es nicht hören.
Los Agustín komm jetzt.
Diesmal kam er, und der Anhalter fuhr ihm mit der Hand durch die Haare und schaute zu, wie er sich zwischen uns hindurchschlängelte und zu seinen Spielen im Wohnzimmer zurückkehrte.
Es ist viel Wasser den Bach heruntergeflossen, wie.
Ich ließ meinen Blick aufs Geratewohl über die Zeichnungen wandern, die an die Wand gepinnt waren. Manche waren Kinderzeichnungen, Drachen, Vulkane, unterirdische Welten voller Gänge, Strickleitern, Höhlen. Andere von Erwachsenen. Ich blieb an einer Spinne hängen, die mit Tusche auf die Seiten eines dicht bedruckten Buches gemalt war.
Und du, keine Kinder.
Ich zuckte lächelnd mit den Schultern.
Keine Kinder, keine wirkliche Liebe seit einer Weile. Kein Schwein gehabt.
Er lachte.
Komm ich stell dir Marie vor.
Er führte mich in die Küche. Von dort aus sah ich durchs Fenster in den Garten. Die alten Steinmauern. Die beiden Zypressen. Das dunkle Blattwerk eines großen Lorbeerbaums. Der Busch zweier großer weißer Rosenstöcke neben dem Fenster, vom Regen zerwühlt, die Blüten voller Wassertropfen, die Blätter glänzend.
Schön, sagte ich.
Es war schon so, als wir eingezogen sind. Die vorige Mieterin war eine Pflanzennärrin.
Ich verstand, dass er das sagte, damit ich dieses Wort hörte: Mieter. Damit ich mir nur keine falschen Vorstellungen machte.
Er trat ein paar Schritte in den Garten und schaute zum Fenster über uns hoch. Ich folgte seinem Blick und sah Marie, die im ersten Stock an einem kleinen Schreibtisch vor dem Fenster saß.
Marie das ist Sacha.
Marie klappte den Bildschirm ihres Computers herunter, um sich aus dem Fenster zu lehnen. Sie lächelte mir zu.
Hallo Sacha. Macht euch einen Kaffee, ich komme gleich, bin fast fertig. Höchstens noch eine Viertelstunde.
Kaffee oder Spaziergang, fragte der Anhalter mit einem Blick in den Himmel. Sieht aus, als würde es aufziehen. Wir könnten ein bisschen rausgehen. Agustín, wollen wir Sacha den Kanal zeigen, was meinst du.
Der Kleine zog seine Schuhe an, und wir verließen zu dritt das Haus.
Wir gingen durch die kleinen Straßen bis zum Boulevard, dann unter der Bahnlinie hindurch, auf der anderen Seite an einem kleinen Kanal entlang durch ein Viertel mit älteren Einfamilienhäusern, die meisten umgeben von Gärten mit schon hohen Bäumen.
Nach und nach wurden die Abstände zwischen den Häusern größer. Wir kamen an einem Fußballplatz vorbei und verließen die Stadt. Der Kanal wurde breiter. Der Weg war nicht mehr geteert. Unter unseren Füßen wich der Schotter wilden Gräsern, Erde, ein paar matschigen Pfützen. Ringsherum öffnete sich die Landschaft. Gärten. Obstwiesen, Brachen, die sich die Stadt vielleicht eines Tages einverleiben würde.
Am Wegrand entdeckte Agustín einen Ameisenhaufen, der unter dem nächtlichen Regen gelitten hatte. Er beugte sich darüber, begann, mit Grashalmen im Eingang herumzustochern.
Gefällt es dir hier, fragte ich den Anhalter, als wir etwa zehn Meter Vorsprung hatten.
Er schaute geradeaus und nickte.
Im Großen und Ganzen ja.
Ihr scheint ein schönes Leben zu haben.
Er sagte Ja.
Was nicht heißt, dass es keine Momente gibt, in denen man keine Luft mehr kriegt, in denen man etwas ändern möchte, abhauen, wie alle Welt. Aber im Großen und Ganzen haben wir es gut.
Schilf bedeckte jetzt den Kanal, der etwas unterhalb des Weges verlief. Große Libellen schwirrten dicht über der Wasseroberfläche hin und her, setzten sich einen Augenblick auf einen dicken Stängel, hoben wieder ab, das Brummen ihrer blauen Flügel in der Stille. Hier und da schwamm eine Plastikflasche zwischen den Pflanzen.
Wir schauten zurück, sahen Agustín, der eine Schuhspitze auf einen Punkt im hohen Gras richtete.
Was macht er da.
Ich sah den Jungen den Fuß ausstrecken, einer Pflanze nähern, beim Geräusch einer Explosion zusammenzucken.
Was ist das.
Samenbomben, sagte der Anhalter. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber schau mal, wie lustig das ist.
Er suchte eine schön dicke Frucht aus, tippte sie leicht mit dem Schuh an. Mit einem Knall wie ein Chinakracher explodierte die Kapsel und schleuderte ihre Samen über unsere Köpfe hinweg.
Er lachte.
Hast du gesehen, ist doch irre. Obwohl es geregnet hat. Sonst kracht es noch lauter.
Ich schaute ihn an, diesen vierzigjährigen großen Jungen, der sich nach all den Jahren weiter über alles und nichts amüsierte. Ich dachte, dass er sich im Grunde nicht verändert hatte. Mieter eines Hauses und nicht mehr einer Wohnung. Vater geworden. Aber seine fröhliche impulsive Art war wie eh und je, liebenswert und unberechenbar zugleich.
Wir nahmen unseren Spaziergang alle drei wieder auf. Die Stadt hatte sich entfernt. Der Geruch nach Erde, nach nassen Pflanzen wurde stärker. Als ich mich umdrehte, sah ich die Türme aufragen. Den der Bischofskirche. Den des früheren Gymnasiums. Den der Stiftung, noch im Bau, funkelnd, gigantisch, nunmehr für alle Zeit in der Landschaft.
Ich spürte, dass er zögerte.
Ich habe dein letztes Buch gelesen.
Dies in einem leichten, aufrichtig freundschaftlichen Ton.
Mein Blut begann zu pochen, als müsste gleich ein Fallbeil niedergehen.
Es ist schön. Es ist sehr schön. Ich fand es toll.
Ich atmete auf. Ich dankte ihm. Ich wartete etwas ab, ob er noch etwas hinzufügen wollte. Einen Dämpfer nachschieben, der das Wohlwollen dieses ersten Urteils flugs wieder aufheben würde.
Es kam kein Dämpfer.
Marie hat es auch gelesen. Ich glaube, wir haben alle deine Romane. Wir warten immer auf das Erscheinen des nächsten Buchs. Ich frage mich jedes Mal, wie du das machst. Ich schaffe das nicht mit dem Schreiben. Mich an einen Tisch setzen, stundenlang auf einem Computer tippen, all das aus mir herausholen. Ich weiß noch, wie ich dir schon damals zugeschaut habe, wenn du stundenlang gearbeitet hast, ohne einmal aufzustehen, und mir sagte: Wahnsinn. Ich spürte, dass das für mich unerreichbar war, dass mein ganzer Körper es verweigerte. Ich beneidete dich.
Ich schüttelte den Kopf, um zu protestieren. In der Ferne hörte man den Motor eines Traktors angehen. Wir schauten ihm zu, wie er am Horizont die Ebene durchmaß, ab und zu durch eine Rinne holperte, mit Schwung weiterfuhr, ein torkelnder Maikäfer.
Und du, fragte der Anhalter.
Was ich.
Wie geht es dir. Bist du glücklich.
Ich fühlte mich ohnmächtig. Unfähig zu antworten.
Ich sagte Ja. Eher glücklich, glaube ich, ja.
Ich sah ihn nicken. Sich aufrichtig für mich freuen. Als genüge ihm meine Antwort. Als zweifle er nicht daran, dass es die Wahrheit war.
Ich finde es schwierig, das mit Sicherheit zu sagen, sagte ich und lächelte.