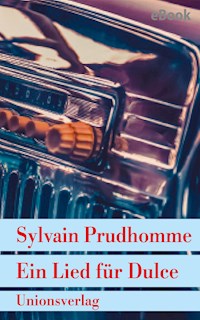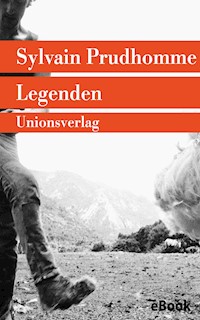18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer ist dieser M., über den die Familie nicht reden will? Auf der Beerdigung seines Großvaters erfährt Simon von dessen verleugnetem Sohn. Am Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gezeugt und zurückgelassen, ist M. nicht mehr als eine Leerstelle, eine vage Erinnerung. Simon, selbst mit dem Ende seiner Beziehung konfrontiert, lässt der Gedanke an diesen deutschen Jungen nicht los. Was für ein Leben hat er gelebt, war er einsam, verlassen, frei? Ist er es noch? Die Suche treibt Simon von Südfrankreich an den Bodensee, wo sich vergessene Spuren mit den seinen kreuzen und ein neues Bild ergeben. Hunderttausende Kinder von Besatzungssoldaten haben ihre Väter nie kennengelernt. In einem ebenso persönlichen wie poetischen Roman spürt Sylvain Prudhomme den Echos der Vergangenheit nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Simon glaubt, seine Familie zu kennen, bis er vom verleugneten Sohn seines Großvaters erfährt – wie so viele andere Kinder während der Besatzungszeit in Deutschland gezeugt und nach Abzug der Soldaten vom Vater zurückgelassen. Simon folgt den Spuren der Vergangenheit von Südfrankreich bis an den Bodensee, um das Schweigen seiner Familie zu brechen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Sylvain Prudhomme (*1979) wuchs in Afrika auf, wo er nach dem Studium der Literatur in Paris mehrere Jahre arbeitete. Er wurde u. a. mit dem Prix littéraire Georges Brassens, dem Prix littéraire de la Porte Dorée, dem Prix Révélation de la Société des Gens de Lettres und dem Prix Femina ausgezeichnet.
Zur Webseite von Sylvain Prudhomme.
Claudia Kalscheuer (*1964) übersetzt seit 1994 aus dem Französischen, u. a. Werke von Marie NDiaye, Nastassja Martin, Laurent Mauvignier und Alexander von Humboldt. 2002 wurde sie mit dem André-Gide-Preis ausgezeichnet, 2010 erhielt sie mit Marie NDiaye den Internationalen Literaturpreis des HKW.
Zur Webseite von Claudia Kalscheuer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Sylvain Prudhomme
Der Junge im Taxi
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Kalscheuer
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2023 bei Les Éditions de Minuit, Paris.
Lektorat: Anne-Catherine Eigner
Das Motto wurde von Julia Schoch ins Deutsche übertragen, aus: Georges Hyvernaud, Haut und Knochen, Berlin: Suhrkamp, 2010.
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Originaltitel: L’Enfant dans le Taxi
© by Les Éditions de Minuit 2023
© by Unionsverlag, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Menno Huizinga (Huizinga collectie uitgelaten jongens, 1945; Wikimedia Commons)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31191-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 12.05.2025, 12:12h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER JUNGE IM TAXI
1 – Aber erst einmal zurück zum Anfang. Erst einmal …2 – An diesem Abend kam ich spät nach Hause …3 – Du willst wissen, wo er wohnt, fragte die …4 – Ich verbiete dir ihn zu besuchen hörst du5 – Der Sommer ging zu Ende. Die Sonne knallte …6 – Das Haus stand am Waldrand, eine Autostunde entfernt …7 – Dann kam der Herbst, und mit dem Herbst …8 – Dann kamen die Feiertage und wir verlebten unser …9 – Und als ich nach Hause zurückkam, fand ich …10 – Ich stieg gegen elf Uhr morgens aus dem …11 – An diesem Nachmittag hatten Jacqueline und Louis einen …12 – Am nächsten Tag traf ich mich vor dem …13 – Am Straßenrand wies ein braunes Schild auf den …14 – Zurück im Auto, fand ich auf WhatsApp 15 …15 – Imma kam kurz vor Mittag mit Catherine an …16 – Vom Schwimmbad drangen immer lautere Schreie herüber …17 – Der Renault Clio flitzte im Licht des zu …18 – Ich möchte in einer Welt leben, in der …Mehr über dieses Buch
Über Sylvain Prudhomme
Über Claudia Kalscheuer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Sylvain Prudhomme
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Liebe
Aber die wirklichen Erinnerungen leben darunter. Die sind hartnäckig.
GEORGES HYVERNAUD, Haut und Knochen, 1949
An dem Morgen hilft sie ihrem Vater im Hof beim Holzspalten. Es hat die ganze Nacht geschneit, der Boden ist weiß, ihre Schritte hinterlassen matschige Flecken. Seit einer Stunde reicht sie ihm ein Holzstück nach dem anderen, hebt jedes Mal den Keil aus dem Schnee auf, um ihn aufs nächste Stück zu platzieren, Oberkörper vorgebeugt, Arm in Erwartung des Hammerschlags angespannt. Schließlich gibt das letzte Scheit nach, das Holz kracht, die beiden Hälften trennen sich, fallen auseinandergerissen in den Schnee, das Mark erstrahlt im Licht. Der Vater stellt den Spalthammer an die Wand und geht, der Stallknecht wartet bei den Kühen auf ihn, seit zwei Tagen findet er an ihren Fersen Klauenfäule.
Sie bleibt allein zurück, schichtet die letzten Scheite auf in der Stille, die nur von dem hellen Laut der Holzstücke durchbrochen wird, wenn sie sie auf den Stapel legt. Ringsum schweigen die Mauern, der Schornstein raucht, der ganze Hof liegt im Schnee wie ein warmes Tier.
Sie fragt sich, wo der Franzose ist, den ihre Familie seit zwei Wochen beherbergt. Sie fragt sich, ob er bemerkt hat, dass sie allein ist, ob er weiß, dass die Mutter seit dem Morgen in der Stadt, der Vater für mindestens zwei Stunden unten im Stall ist. Dass bis zum Mittagessen bestimmt niemand kommen wird.
Sie beobachtet das Haus, versucht zu erraten, wo er ist. Lauert auf ein Zeichen an den Fenstern, auf die Bewegung eines Fensterladens, eines Vorhangs, eines Schattens. Sie fragt sich, ob er vorhat, an diesem Morgen in die Garnison hinunterzugehen oder, wie er es manchmal tut, bis zum Abend auf dem Hof zu bleiben, in seine Bücher vertieft, die er nur für einen kurzen Spaziergang beiseitelegt, immer den gleichen, immer um die gleiche Zeit am frühen Nachmittag, den Pfad hinab, der zum See führt, während sie ihm dann jedes Mal bedauernd nachblickt und die Arbeit, die ihre Hände gerade verrichten, als sinnlos empfindet, das Wäscheaufhängen, das Kaninchenfüttern – sie möchte ebenfalls zum See hinuntergehen, wie er vor der Aussicht stehen bleiben, mit ihm diesen See betrachten, auf den sie seit ihrer Geburt hinausschaut, weit wie ein Meer, am anderen Ufer begrenzt von den Schweizer und österreichischen Bergen.
Und plötzlich sieht sie ihn, er ist da, ganz in der Nähe, und sieht sie an. Vielleicht steht er schon seit einer Weile dort am Küchenfenster. Sie zuckt zusammen. Sie lächelt. Sie macht ihm ein Zeichen. Eine Handbewegung, die bedeutet: Komm. Ein unmissverständliches Zeichen, noch ehe sie es wollte, das nichts anderes bedeuten kann. Dann dreht sie sich um und geht quer über den Hof zur Scheune, erreicht das schwere Holztor, öffnet es nur einen Spalt weit, gleitet in die Dunkelheit hinein. Lehnt sich an die dicke Mauer. Wartet. Wartet im kräftigen Geruch von gelagertem Stroh, Wollschweiß, Dünger, Werkzeug, Maschinen, die durch die Jauche gefahren sind. Fühlt ihren Puls schlagen. Ihr Blut in den Schläfen pochen.
Sie hört die knirschenden Schritte im Schnee, die Schritte des Franzosen, der sich nähert, der in zehn Sekunden da sein wird, sie sieht ihn vor sich, wie er über den verschneiten Hof geht, die Hände in diesem Mantel, den sie für ihn gesäubert hat, ohne ihn wieder geschmeidig zu bekommen, als hätten Frost und Schlamm ihn unwiderruflich verhärtet, diesen Mantel, von dem er sich nie trennt, mit dem er im Krieg war.
Sie hört die Angeln quietschen, sieht das Tor kaum merklich wieder aufgehen, die Gestalt des Mannes im schmalen Lichtstrahl hereinschlüpfen, erst einmal eine Weile in der Dunkelheit stehen bleiben, ohne etwas zu sehen, hört ihn mit zögernder Stimme ihren Vornamen rufen.
Sie löst sich von der Wand, stellt sich im Schatten sehr aufrecht vor ihn. Sie lächelt. Sie ist stolz, sich getraut zu haben. Sie hört den Franzosen ihren Namen flüstern, er spricht ihn ungeschickt aus. Sie lacht darüber, dass er so schlecht Deutsch spricht, dass er, der seit zwei Wochen bei ihrer Familie lebt, nie etwas versteht. Sie schaut ihn an, wie er friert, mit seiner feuchten Nase, seinen blassen Wangen, seinen eisigen Händen. Seinem Körper, der nicht dafür geschaffen ist, nicht für den Krieg und nicht für diese Kälte. Ganz anders als die Körper der Soldaten, die in den letzten Monaten immer wieder unter betrunkenem Gejohle in den Hof einfielen, drei oder vier Hühner schlachteten, diese halb roh verschlangen und sie dabei von Weitem anstierten, schmutzige Worte im Mund und lüsternes Feixen in den Augen. Um dann so schnell wie möglich wieder abzuziehen, mit dem Schrecken von Männern auf der Flucht, mit der Brutalität von Lebenden, deren Ende nahe ist und die das wissen. Die in ihrer Verzweiflung darüber, verloren zu sein, alles um sich herum beneiden, was leben wird, und am liebsten jedes Wesen, dessen Herz weiterschlagen wird, umbringen, verletzen, beschädigen würden, um es für seine unverschämte Gesundheit bezahlen zu lassen.
In sechs Jahren Krieg hat sie eine Menge Soldaten vorüberziehen sehen. Deutsche. Franzosen. Sieger. Besiegte. Gefangene. Zwangsarbeiter, die zum Pflügen oder Ernten eingesetzt wurden. Verräter an ihrem Land, die ungeniert unter den Mördern ihres Volkes herumparadierten, Ehrenzeichen gut sichtbar auf der Brust, ohne jeden Stolz, ohne jede Scham. Sie hat die Sieger von gestern nach der Niederlage zurückkommen sehen, flüchtend, verstört, kaum wiederzuerkennen, in viel geringerer Zahl, voller Grimm.
Aber dieser Franzose hier gehört einer unbekannten Art an. Er hat einen langen, schmalen Körper, ein zartes Gesicht, eine fast mädchenhafte Art. Er lebt seit zwei Wochen bei ihr und ihren Eltern, ohne je eine Spur von Grobheit an den Tag zu legen, er isst mit der Familie, behandelt sie freundlich, hat neulich unter den Bäumen am See sogar mit ihr getanzt, zu der vom Kiosk aufsteigenden Musik des Festes, das die Franzosen veranstalteten, um das Ende des Krieges zu feiern, die Wiederkehr des Lebens, wenn man das Leben nennen konnte. Die Franzosen hatten an nichts gespart, an allen Ästen der Linden und Weiden über dem Wasser hingen Lampions, das ganze Ufer leuchtete in der Nacht – in all diesem Glanz und Prunk im Herzen der ausgebluteten Stadt lag eine unerträgliche Arroganz, und doch tat die Musik gut, tat der Alkohol gut, alle hatten sich allmählich gehen lassen. Der Franzose war gekommen und hatte sie zum Tanzen aufgefordert, und man hatte ringsum die Stirn gerunzelt, als man sah, dass sie annahm, dass sie aufstand und einfach in seinen Armen herumzuwirbeln begann, dass beide glücklich waren zu tanzen, dass sie gut aussahen, sie hatte schon so lange nicht mehr getanzt, in den Armen eines Mannes, der ihr gefiel, auf die Musik einer Kapelle, die für sie spielte, in den Gliedern und im ganzen Körper die Wärme von mehreren heruntergestürzten Gläsern Schaumwein.
Das war drei Tage her, und am nächsten Morgen hatten mehrere Freundinnen es sich nicht nehmen lassen, ihr ins Gesicht zu sagen, was sie dachten, sag mal, du wirst doch wohl nicht mit einem Franzosen herumschlafen, du wirst doch nicht zur Hure werden, uns Schande machen, während eine andere Freundin ihr im Gegenteil gesagt hatte, liebe, worauf wartest du, liebe, sie hatte sie sich vorgenommen und wie einen Apfelbaum geschüttelt, wach auf Herzchen hast du gesehen wie die Welt ringsum aussieht, hast du gesehen in welchem Zustand die Stadt ist, in welchem Elend wir alle stecken, so eine Gelegenheit wirst du dir doch hoffentlich nicht entgehen lassen. Immer wieder hatte sie ihr vorgesagt, liebe und pfeif darauf, was du zu hören bekommen wirst, was die Eifersüchtigen denken werden, diese Megären diese Neiderinnen, die nur davon träumen, an deiner Stelle zu sein, dieser Mann gefällt dir also liebe ihn.
Und jetzt küsst sie den Franzosen, presst sich an ihn. Sie küsst ihn weiter, kostet seine inbrünstigen, glühenden, köstlichen, vor lauter Inbrunst fast komischen Küsse, die Küsse eines Liebhabers, dem das alles gefällt, die Lust, die Liebe, Liebe machen, das spürt man instinktiv. Sie fühlt seine Arme, die sie umfassen, seine Hände, die unter das Umschlagtuch wandern, das sie sich über die Schultern geworfen hat, die sie drücken, sie ungeduldig an sich pressen, die schon nach ihren Hüften, ihrem Hintern greifen, unter ihre Kleider gleiten. Sie löst sich einen Moment von ihm, schnappt sich aus einem Regal eine alte Decke, entfaltet sie, breitet sie über das Stroh. Komm, sagt sie ihm. Komm, und wenigstens dieses deutsche Wort versteht der Franzose, und sie legen sich beide hin, küssen sich, streicheln sich, streicheln sich gierig, sind nackt, schmiegen sich aneinander, um sich zu wärmen, so gut es geht. Sie sind jung, doch das hindert sie nicht daran, genau zu wissen, was zu tun ist, wie ihre Körper sich bewegen müssen, um einander Lust zu schenken und selbst Lust zu empfinden. In ihrer Erinnerung geht alles von allein, alles ist einfach, sie erinnert sich, dass ihr das aufgefallen ist: Wie leicht alles ist, und warm, und schön. Das und die Geschmeidigkeit ihrer ineinander verschlungenen Glieder. Die Zartheit ihrer Haut. Die Feuchtigkeit ihrer Geschlechter. Die Energie ihrer Muskeln. Die Fülle all dieses Lebens, das in ihren Adern pocht und so stark durch ihren Körper strömt, das frohlockt, das seit Monaten nichts anderes ersehnte, als zu frohlocken.
*
Ich weiß nicht, ob diese Szene stattgefunden hat. Das heißt: Ich weiß nicht, ob sie auf diese Weise stattgefunden hat, unter diesen Umständen. Ich weiß nicht, ob es diesen Bauernhof je gegeben hat. Ob es in einer Scheune passiert ist, in einem Hotelzimmer, in der Garderobe eines Offizierskasinos. Ich weiß nicht, wie das Gesicht der Unbekannten vom Bodensee aussah. Ich weiß nicht, ob sie blond oder brünett war, ich weiß nichts, ich habe nicht einmal das: ein Indiz zu ihrer Haarfarbe, ein Detail über ihre Figur, ihre Körperhaltung, eine vertraute Geste, eine laute oder eine leise Art zu lachen, der Klang ihrer Stimme, ein heiteres Gemüt oder im Gegenteil ein besonderer Ernst. Ich habe kein Foto, kenne keine Erzählung, weder aus erster noch aus zweiter Hand.
Ich merke nur, dass diese Szene mich verfolgt. Dass ich sie schon vor Jahren in ein Buch aufgenommen habe, ohne ihre Tragweite recht zu ermessen. Ich merke, dass meine Fantasie mich immer wieder zu ihr zurückführt, sie sich ausmalt, sich erträumt. Mit ihrer Unschuld. Ihrem Ernst. Ihren schwindelerregenden Konsequenzen. Diese Szene eines Verlangens, stärker als alle Verbote, mit ihrer Unvernunft, ihrem Skandal, ihren Auswirkungen über Jahrzehnte. Diese gewöhnliche Szene eines gewöhnlichen Verlangens, mit ihrer gewöhnlichen Schockwelle. Diese Urszene, die für immer fehlen wird, da weder Malusci noch diese Frau noch da sind, um sie zu erzählen. Strahlende und zugleich dunkle Matrix, um die ich kreisen, zu der ich zurückkehren will, bevor der Tag kommt, an dem alle, die von nah oder fern damit zu tun hatten, ihrerseits begraben sein werden, und an dem dort oben nichts mehr übrig sein wird als die Sonne über dem See, die verschneiten Berge ringsum und das für alle Zeit glitzernde Wasser, auf das andere Liebespaare hinausblicken, wenn sie am Ufer spazieren gehen, immer wieder neue, wie schon Malusci und diese Frau ergriffen davon, nebeneinander herzugehen, einander zu begehren – erneut das Verlangen, das unbezwingliche Bedürfnis, einander zu umarmen, miteinander zu verschmelzen, immer wieder die gleichen elektrisierenden Regungen, bis in alle Ewigkeit.
Ich weiß nicht, warum diese beiden Liebenden mich derart berühren. Ich weiß nur, dass dies stattgefunden hat. Dass diese beiden Münder sich eines Frühlingstages geküsst haben. Dass diese beiden Körper einander genommen haben. Ich weiß, dass Malusci und diese Frau sich liebten, wenn ich auch nicht weiß, welcher Wert diesem Wort hier beizumessen ist, das aber auf jeden Fall passt, denn lieben kann tausend verschiedene Dinge bedeuten, auch einfach in einer Scheune miteinander zu schlafen, ohne weitere Gefühle oder mehr Zärtlichkeit als das Auflodern eines flüchtigen Verlangens, als der Blitz einer jähen Lust, an die, darauf deutet alles hin, Malusci und diese Frau sich noch lange erinnerten. Ich weiß, dass aus dieser Lust ein Kind hervorging, das noch immer lebt, dort oben am See. Und dass dieses Buch gewissermaßen ein Buch in seine Richtung ist.
1
Aber erst einmal zurück zum Anfang. Erst einmal muss von dem Moment erzählt werden, als die ganze Geschichte wieder an die Oberfläche gekommen ist, als sie sich einen Weg gebahnt hat durch die Schichten des Schweigens, unter denen alle sie seit Jahrzehnten zu begraben gewohnt waren, gewohnt oder mehr oder weniger bewusst entschlossen – falls man denn je mit Gewissheit unterscheiden kann, was bewusst gewollt wurde und was letztlich nur auf das unglückliche Zusammentreffen einer Reihe von Nachlässigkeiten zurückgeht. Eher eine unglückliche Ansammlung von Nicht-Entscheidungen als von tatsächlichen Entschlüssen, letztlich aus einer Art Faulheit heraus, ein ewig wiederholtes Aufschieben des Versprechens an sich selbst, sich der Schwierigkeit eines Morgens endlich zu stellen, weniger eine Handlung im eigentlichen Sinne als vielmehr ein fortgesetztes Nicht-Handeln, eine fehlende Bereitschaft, gegen den Willen der Familie zu verstoßen und einen Skandal zu verursachen, ein Befolgen des ewigen Gebots, bloß keine Wellen zu schlagen. Eine Art höherer Befehl in Gestalt eines Lacküberzugs, eine vor lauter Gewohnheit unsichtbar gewordene Decke des Schweigens, umso machtvoller, als sie friedlich, glatt, ungreifbar ist, denn alle Geheimnisse bestehen aus dieser unschuldigen Masse und sind mit den besten Absichten verkleidet, mit der Sorge um den Nächsten verhüllt: Wenn ich dir nichts gesagt habe, dann nur zu deinem Wohl. Denn in der Ordnung der Familien besteht das Verbrechen seit jeher darin zu reden, niemals zu schweigen.
Etwas also wie eine notorische Faulheit, die sich im Lauf der Jahrzehnte breitgemacht hatte und die die ganze Geschichte aus dem Kreis der Themen, mit denen die Familie sich beschäftigte, ausschloss, um sie in den Bereich der Dinge zu verbannen, die höchstens mit gesenkter Stimme am Ende eines feuchtfröhlichen Weihnachtsessens angesprochen wurden, wenn zum Kaffee nur noch die übrig waren, die Bescheid wussten, und wozu dann an diese Dinge erinnern, an die niemand mehr denken wollte, wozu eine Erinnerung wecken, die diejenigen, die sie lange geplagt hatte, endlich in Ruhe zu lassen begann.
Bis zu jenem Julinachmittag, an dem das Geheimnis wieder an die Oberfläche gekommen war, in diesem Raum, in dem sich die gesamte Familie nach der Rückkehr vom Friedhof entspannte und dank der Petits Fours und eines guten Muskatweins zu einer Art guter Laune, einer Art Schwung zurückfand, die Ältesten auf den Sofas vor sich hin dösten, der für seine Komik von allen geliebte Cousin wieder begann, hier und da einen Witz zu wagen, jeder sich wieder erlaubte zu lachen, von etwas anderem zu reden als von dem Großvater, der nun friedlich unter der Erde lag, oder andere Erinnerungen an ihn zur Sprache zu bringen als die, die der Ernst der Trauerfeier erlaubte, denn das Leben ging weiter, es nahm mit seinem vertrauten Rauschen, seinem beruhigenden Stimmengewirr seinen Lauf.
Und so hatte ich mich plötzlich mit einem losen Faden zwischen den Fingern wiedergefunden, dem Ende eines Knäuels, an dem ich, wie ich sofort gespürt hatte, nur zu ziehen bräuchte, um den Rest der Geschichte zu mir heranzuholen. Es war genau da passiert, und anders, als man denken könnte, war es keineswegs dem Zufall geschuldet, ebenso wenig wie der versehentlichen Indiskretion eines der anwesenden Gäste und erst recht nicht der Lektüre eines Dokuments oder eines Briefs, zu der ich mich ungehörigerweise hätte hinreißen lassen. Nein: Es war die Wahl eines Mannes, nennen wir ihn Franz, seine ruhige, seit Tagen reiflich überlegte oder vielleicht auch erst auf dem Rückweg vom Friedhof gefällte Entscheidung, nachdem er seine Frustration darüber, wieder einmal Stillschweigen bewahrt zu haben, hin und her gewälzt hatte und es auf einmal nicht mehr ertrug, sich dem allgemeinen Gesetz des Schweigens zu unterwerfen.
Ich sah die Szene wieder vor mir, mit all ihren unerwarteten, verblüffenden Aspekten: Letztlich war es weniger das Ende eines Knäuels als die Zündschnur einer Bombe, die dieser Mann – besagter Franz – mir unversehens in die Hände gelegt hatte, ohne Vorwarnung, ohne dass ich oder sonst jemand irgendetwas hätte kommen sehen. Ein paar still und leise hingeraunte Worte, mit der größten Diskretion gegenüber den Dutzenden anderer Gäste, die nichts geahnt, nichts mitbekommen hatten von unserer zwei- oder dreiminütigen Unterhaltung – das ganze Haus war mit den nach einer Trauerfeier gängigen Emotionen beschäftigt, Imma noch etwas verstört in der Sofaecke, wo ihre Kinder sie hingesetzt hatten, mit tausend Aufmerksamkeiten, Nettigkeiten, tröstenden Worten umgeben, die sie nicht zu hören schien, vom Lärm ringsum überfordert, wie ausgebrannt, erschöpft von der Aufregung der letzten Tage, die endlich nachließ.
Und inmitten des Trubels dieser Mann, der mich plötzlich beiseitegenommen hatte, dieser Mann (wie soll ich ihn nennen: meinen Onkel? Er war zweifellos mein Onkel, wenn man dieses Wort der langjährigen Vertrautheit entledigt, die es in sich birgt, da Franz und meine Tante Julie sich erst ein paar Jahre zuvor kennengelernt und einander in zweiter Ehe geheiratet hatten; ein Onkel, den ich nicht viel öfter als zehn Mal in meinem Leben gesehen haben mochte, von dem ich letztlich nicht viel wusste, mit dem ich kaum mehr als Banalitäten ausgetauscht hatte, durchaus aufrichtige Zuneigungsbekundungen, die aber an der Oberfläche unserer Leben blieben, ohne dass uns irgendetwas tiefer verbunden hätte), ein der Familie beinahe fremder Mann, jedenfalls blutsfremd, da es in der ganzen folgenden Geschichte ja vor allem auf das Blut ankommt. Ein Mann, der, das muss man sagen, in unser aller Augen in erster Linie dadurch gekennzeichnet war, Deutscher zu sein, ein echter Deutscher aus Deutschland, mit allem, was das an Exotischem hatte in unserer Familie, die seit jeher südländisch war, an den Ufern des Mittelmeers verwurzelt, unter der heißen Sonne, mit ihren Weinbergen voll zuckerschwerer Trauben, ihren Aprikosen- und Pflaumenplantagen, ihren sonnenverbrannten Hügeln. Generationen von Kindern und Kindeskindern ohne je etwas anderes am Horizont als südländisches Blut, von der Hitze gebräunte Gesichter, vom Mistral und der Tramontane gegerbte Haut, schwielige Hände vom Hacken der steinigen Erde, an den Rotwein voller Sulfite aus dem Languedoc und aus Algerien gewohnte Kehlen. Und da plötzlich dieser glatt rasierte Biertrinker, aus den germanischen Wäldern gekommen wie ein personifiziertes Stück Deutschland, echter als echt, nicht nur Deutscher aus Deutschland, sondern Deutscher aus Bayern, nicht nur Münchner, sondern Angestellter der berühmtesten Autofirma jenseits des Rheins, seit Jahren mit dem Bau von Autos befasst, die in der Vorstellungswelt der Maluscis die Quintessenz Deutschlands darstellten, den absoluten Inbegriff der germanischen Tugenden. Der Deutsche der Familie, mit allem, was sein untadeliges, nur mit einem leichten Akzent gefärbtes Französisch ihm an Gutmütigkeit verlieh, an Leutseligkeit, an sympathischer Tölpelhaftigkeit, stets hilfsbereit, stets aufgeräumt, auch gegenüber Malusci, wenngleich dieser in seiner Rolle als Schwiegervater kaum eine Gelegenheit ausließ, ihn zu piesacken.
Und nun war er es, der alles auslöste, der den Moment nutzte, als ich unser beider Gläser nachfüllte, um den bisherigen Konversationston plötzlich fallen zu lassen und mir dieses Geheimnis anzuvertrauen, das ich mir ungläubig anhörte, siehst du Simon, eines tut mir leid – erinnerst du dich, als der Typ vom Bestattungsinstitut gefragt hat, ob jemand noch etwas hinzufügen wollte
und ich sah die Situation sofort wieder vor mir, die langen Sekunden der Betretenheit, die uns alle auf dem Friedhof ergriffen hatte, der Sarg kurz davor, ins Grab hinabgelassen zu werden, Rosenblütenblätter schon auf dem Holzdeckel verstreut, Imma seit mehreren Minuten darauf vorbereitet zu sehen, wie der Mann, mit dem sie fünfundsiebzig Jahre ihres Lebens verbracht hatte, an Stricken in die Betongruft versenkt wurde, womit die Zeremonie, die am Morgen in der Kirche begonnen hatte, endlich ihren Höhepunkt erreichen würde – und da war es dem Typ vom Bestattungsinstitut plötzlich eingefallen, noch mal nachzulegen
möchte vielleicht jemand noch etwas sagen
als hätte es nicht in der Kirche schon mehrere Reden gegeben, als hätten nicht zwei von Maluscis Enkeln schon alle zu Tränen gerührt, indem sie ein Duo für Geige und Klavier spielten, das der Verstorbene geliebt hatte, wodurch sie bezeugten, was immer eines der beständigsten Bande zwischen Imma und ihm dargestellt hatte, ihren größten Stolz, nämlich eine musikalische Familie gegründet zu haben, mit lauter Pianisten, Violinisten und Sängern, von denen Malusci selbst der begabteste gewesen war, eine herrlich melodische Bassstimme, sagten diejenigen gern, die ihn früher hatten singen hören, und bedauerten, dass er es nicht zu seinem Beruf gemacht hatte, sie träumten von der Karriere, die er hätte haben können, wenn er durchgehalten hätte, wenn er nicht beim ersten Widerstand, beim ersten Hindernis eingeknickt wäre, wie sie mit einer Spur von Missbilligung beklagten
möchte ein Angehöriger oder eine nahestehende Person einen letzten Gruß an den Verstorbenen richten, hatte dieser verdammte Typ im Anzug noch einmal nachgehakt, in einem Augenblick werden wir den Sarg ins Grab lassen und damit wird die Feier enden