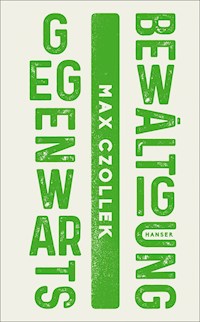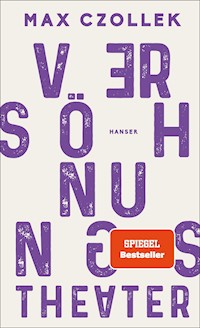18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Deutschland versteht sich als Erinnerungs- und Aufarbeitungsweltmeister. Aber wie kommt es dann, dass Rechtspopulisten Wahlen gewinnen, rechtsextremistische Straftaten unzureichend aufgeklärt werden und »Nie wieder ist jetzt« zu einer Phrase verkommt? Max Czollek und Hadija Haruna-Oelker meinen, dass das auch an einer gescheiterten deutschen Erinnerungskultur liegt. Gemeinsam denken sie über eine neue Praxis nach, die die Gegenwart so einrichtet, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Eine scharfsinnige und streitbare Analyse zum gesellschaftlichen Rechtsruck von zwei wichtigen intellektuellen Stimmen unserer Gegenwart. Ein Buch voller Witz, Trauer, Widerstand und mit der Energie, alles auf Anfang zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Max Czollek | Hadija Haruna-Oelker
Alles auf Anfang
Auf der Suche nach einer neuen Erinnerungskultur
Über dieses Buch
Deutschland versteht sich als Erinnerungs- und Aufarbeitungsweltmeister. Aber wie kommt es dann, dass Rechtspopulisten Wahlen gewinnen, rechtsextremistische Straftaten unzureichend aufgeklärt werden und »Nie wieder ist jetzt« zu einer Phrase verkommt? Max Czollek und Hadija Haruna-Oelker meinen, dass das auch an einer gescheiterten deutschen Erinnerungskultur liegt. Gemeinsam denken sie über eine neue Praxis nach, die die Gegenwart so einrichtet, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Eine scharfsinnige und streitbare Analyse zum gesellschaftlichen Rechtsruck von zwei wichtigen intellektuellen Stimmen unserer Gegenwart. Ein Buch voller Witz, Trauer, Widerstand und mit der Energie, alles auf Anfang zu setzen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Max Czollek, geboren 1987 in Berlin, lebt ebenda. Studium Politikwissenschaften, FU Berlin sowie Promotion am Zentrum für Antisemitismusforschung, TU Berlin. Mitglied des Lyrikkollektivs G13 und Mitherausgeber des Magazins »Jalta – Positionen zur jüdischen Gegenwart«. Gemeinsam mit Sasha Marianna Salzmann Initiator von »Desintegration. Ein Kongress zeitgenössischer jüdischer Positionen« (2016), der »Radikalen Jüdischen Kulturtage« (2017) am Maxim Gorki Theater Berlin, Studio Я sowie der internationalen »Tage der Jüdisch-Muslimischen Leitkultur« 2020. Außerdem ist er zusammen mit Hadija Haruna-Oelker Host des Erinnerungspodcasts »Trauer & Turnschuh«. Das Essay »Desintegriert Euch!« erschien 2018, »Gegenwartsbewältigung« 2020, »Versöhnungstheater« 2023. Die Gedichtbände »Druckkammern« (2012) und »Jubeljahre« (2015), »Grenzwerte« (2019) sowie »Gute Enden« (2024) erscheinen im Verlagshaus Berlin.
Die Politikwissenschaftlerin Hadija Haruna-Oelker lebt und arbeitet als Autorin, Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Sie moderiert die Römerberggespräche in Frankfurt, das Debattenformat »StreitBar« in der Bildungsstätte Anne Frank und die feministische Presserunde der Heinrich-Böll-Stiftung. In der Frankfurter Rundschau schreibt sie eine monatliche Kolumne. Außerdem ist sie zusammen mit Max Czollek Host des Erinnerungspodcasts »Trauer & Turnschuh«. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Jugend und Soziales, Rassismus- und Diversitätsforschung. Anfang 2022 erschien ihr persönliches Sachbuch »Die Schönheit der Differenz – Miteinander anders denken«, das für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. 2024 erschien »Zusammensein. Plädoyer für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit«. Sie ist Preisträgerin verschiedener Medienpreise wie dem ARD-Hörfunkpreis Kurt Magnus 2015 oder dem Medienspiegel-Sonderpreis für transparenten Journalismus 2021. Darüber hinaus ist sie Teil des Journalist*innenverbandes Neue Deutsche Medienmacher*innen (NDM) und der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD).
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Simone Andjelkovic
ISBN 978-3-10-492184-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog Es gibt keine deutsche Gesellschaft ohne uns!
Einführung Reise durch die Gegenwart
Kapitel 1 Das Ende des postmigrantischen Jahrzehnts
Kapitel 2 Ignoranz als Aufklärung. Die Debatten der Anti-Woken
Kapitel 3 Hoffnung und Verlieren. Zivilgesellschaft und die Rettung der Demokratie
Kapitel 4 »We were never meant to survive«. Eine Generationenbetrachtung
Kapitel 5 Wie weiter? Alles auf Anfang.
Epilog Dass wir da noch lachen können …
Unser Dank
PrologEs gibt keine deutsche Gesellschaft ohne uns!
Es war einmal, da trat eine Generation Autor*innen, Schauspieler*innen und Theatermacher*innen an, um Deutschland neu zu erzählen. Im Frühjahr 2018 erreichte mich, Max, eine Einladung für das Festival »Textland – Literatur made in Germany«. Man wolle der Frage nachgehen, was deutschsprachige Literatur gerade auch unter dem Eindruck einer neu entdeckten radikalen gesellschaftlichen Vielfalt sei, und dafür gern von betroffenen Autor*innen lernen. Das waren Zeiten, als die Öffentlichkeit neugierig danach fragte, wie eine Kunst aussehen könnte, die die deutschen Realitäten abbildet. Das Maxim Gorki Theater in Berlin lief da schon seit fünf Jahren auf einem postmigrantischen Antrieb und belebte mit seinem Programm den Rest der Szene wie ein Monster Energy Drink. Man konnte also den Eindruck gewinnen, dass es voran ging in diesen Jahren, die die Soziologin Naika Foroutan rückblickend als »postmigrantisches Jahrzehnt« bezeichnen würde.[1] Einen Moment lang sah es tatsächlich so aus, als wendete sich die deutsche Gesellschaft endlich ihren eigenen Realitäten zu. Von dieser Aufbruchstimmung hatten sich die Kolleg*innen in Frankfurt am Main offenbar anstecken lassen und widmeten dem Thema ein Festival, welches seitdem jedes Jahr unter einem anderen Motto stattfindet. Eine Aufgabe lautete, dass die eingeladenen Autor*innen jeweils sechs Thesen zur deutschen Gegenwartsliteratur formulieren sollten. Und weil ich damals viel im Maxim Gorki Theater abhing und an die Kraft des gemeinsamen Schreibens glaube (Hallo, Hadija!), beschloss ich, die Thesen gemeinsam mit der Gorki-Edelfeder Necati Öziri zu verfassen, der sofort zusagte.
Necati, der sich Jahre später für einen großen Österreichischen Literaturpreis als Autor zwischen Adorno und Kreuzberg vorstellen sollte, verfasste die ersten fünf Thesen. Er begann mit einer diskursiven Schelle: »Die Frage danach, was ›deutsch‹ oder was die ›deutsche Identität‹ ist, die ja auch in der Frage ›Was ist deutsche Literatur‹ steckt, ist bereits eine sehr deutsche Frage. Mit nichts beschäftigen sich die Deutschen so gerne und so intensiv wie mit sich selbst.« Necati unterstrich also, dass man bei der Bestimmung einer neuen deutschen Literatur darauf achten müsse, nicht einfach ein dominanzkulturelles Bedürfnis nach Selbstbespiegelung – und Selbstbestätigung zu erfüllen. Autor*in Sasha Marianna Salzmann und ich waren diesem Thema schon einmal nachgegangen, als wir unter dem Titel »Desintegration« nach der Instrumentalisierung von Juden*Jüdinnen für eine Wiedergutwerdung Deutschlands gefragt hatten. Dann schrieb ich darüber ein Buch, das so ähnlich hieß. Es war einer der Gründe, warum ich zum Festival eingeladen wurde.
Als sieben Jahre später, Anfang Mai 2025, die Shoah-Überlebende Margot Friedländer mit 103 Jahren verstarb, war die Selbstbezüglichkeit, über die Sasha, Necati und ich damals sprachen, wieder in voller Aktion zu beobachten. Kein*e Politiker*in ließ es aus, auch die vermeintliche Versöhnlichkeit der Verstorbenen zu würdigen. Die ehemalige Staatssekretärin für Kultur und Medien, Monika Grütter, erklärte gar im Spiegel, Friedländer sei der »lebende Beweis, dass es Versöhnung geben kann«[2]. Eine kuriose Behauptung, denn soweit ich mich erinnerte, hatte Friedländer zwar unermüdlich gemahnt, dass wir heute Verantwortung übernehmen müssten, aber Versöhnung für die Shoah hatte sie nicht angeboten. Wäre ja auch irgendwie vermessen, oder? Mir zumindest scheint es wenig verwunderlich, dass das jüdische Gegenüber das Bedürfnis nach Versöhnung für gewöhnlich eher nicht teilt und daher auch nicht von Versöhnung spricht. Weil die deutsche Seite dennoch nicht darauf verzichten möchte, bedankt sie sich einfach für das, was sie hören will. Tote können schließlich keinen Einspruch mehr erheben.
Die Kritik, die ich gemeinsam mit Sasha Marianna Salzmann, Necati Öziri und so vielen anderen in den zehner Jahren entwickelte, zielte auch auf eine künstlerische Zurückweisung genau dieser Übergriffigkeit. Unsere Antwort lässt sich seitdem in fünf einfachen Worten zusammenfassen: Wir. Sind. Auch. Noch. Da. Und wir haben eben eine andere Perspektive auf Deutschland, den Umgang mit seiner Geschichte und die Frage, was es braucht, damit sich die Gewalt nicht wiederholt. Damit komme ich auch zu meinen Frankfurter Thesen. Die erste lautete: »Die deutsche Nachkriegsgesellschaft hat eine Antwort auf die Frage, was ›deutsch‹ ist, schon lange gefunden.« Im Zentrum dieses neuen deutschen Selbstbildes stehe die Erzählung von der erfolgreichen Überwindung des Nationalsozialismus und seiner Gewaltpraxen, was fortwährend an Juden*Jüdinnen und anderen marginalisierten Gruppen bewiesen werden müsse. Und darum sei eine Kritik an dieser Funktionalisierung die notwendige Voraussetzung für eine Antwort auf die Frage, was eine neue deutsche Literatur ausmachte.
Wir beendeten unser kleines Manifest mit ein paar von einer Rap-Attitude inspirierten Versen. Sie lauteten: »Wir sind keine Avantgarde, darum machen wir das nicht alleine./Das heißt, wir umzingeln euch jeder einzeln./ Schrieben wir ein Manifest, lautete seine Präambel:/Kompromisse sind der Tod der Kunst. Es gibt keine deutsche Literatur. Ohne uns.« Damals fanden wir das nicht nur witzig, sondern auch gewitzt, weil wir damit am Ende noch einmal die Kernidee unterstrichen, dass wir eben auch noch da sind. Nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit: Es gibt keine deutsche Literatur. Ohne uns. So weit unser Beitrag. Als Nächstes betrat ein Autor die Bühne, der im Vorfeld den Auftrag erhalten hatte, eine Antwort auf unsere Thesen zu formulieren. Mit rotem Kopf und mühsam zurückgehaltener Wut rumpelte er etwas von »Auschwitzkeule« ins Schwanenhalsmikrophon und dass er sich seinen Stolz auf Deutschland nicht verbieten lassen wolle. Er sagte auch noch andere Dinge, die ich nicht mehr genau weiß. Ich erinnere mich aber daran, dass er dann abging, noch immer rauchend vor Wut, und Necati und ich überrascht und etwas verwirrt zurückblieben. Es musste dringend etwas passieren, wollte man diesen Festivalauftakt noch retten. Und weil das hier der Prolog für ein gemeinsames Buch ist, war es nun Zeit für den Auftritt von: Hadija!
Ja, und ich saß unweit von euch als zweite Kommentatorin in der ersten Reihe und dachte, was soll das denn jetzt? Plötzlich war ich sehr aufgeregt, und das nicht nur, weil ich auf euch reagieren sollte, zwei Menschen, die ich damals nicht kannte, sondern auch wegen meines Vorredners. Ich spürte die schlechte Stimmung im Saal, und von den ganzen Verbindungen, dem »Wer kennt hier wen« in der Literaturszene hatte ich keine Ahnung. Ich hatte damals noch kein Buch geschrieben. Essays fürs Radio, Reportagen, Hintergrundartikel waren meine Textformen, also eine ganz andere Schreibschule als eure. Aber ich wusste, dass ich die Anspannung mit meinem Text jetzt auffangen müsste. Ausgerechnet ich – die einzige Journalistin an diesem Tag.
Das Anliegen meiner Antwort auf eure Thesen war im Gegensatz zu meinem Vorredner die Beantwortung der Frage: Was ist deutsch? Eine Frage, die ich in meinem Leben auf unterschiedliche Weise wieder und wieder durchgekaut habe. Ich erinnere mich noch, dass damals kurz vor dem Festival eine Kollegin – auch mit Migrationsgeschichte – in Vorbereitung auf eine Radiosendung zu mir gesagt hatte, dass wir endlich damit aufhören sollten, uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Dass sie darauf keinen Bock mehr habe, weil wir längst weiter sein müssten. Was zwar theoretisch richtig war, aber praktisch nicht stimmte, damals wie heute nicht. Leider. Darum passt meine Intervention von 2018 heute immer noch. Irgendwie zeitlos erscheint mir mein Text, in dem ich euch und dem Publikum vom nicht überwundenen nationalsozialistischen Erbe berichtete und erzählte, dass ich manchmal provokativ sage, dass auch in mir deutsches Blut fließt. Schwarz und deutsch? Ja, gerade deshalb, weil Deutschland eben nicht nur weiß ist – nie gewesen ist.
Irgendwie ist es traurig, dass dieser Text von damals als ein gerade erst geschriebener erscheinen könnte. Nennen wir es ein Täglich-grüßt-das-Murmeltier-Gefühl, das sich in der Frage »Woher kommst du?« versinnbildlicht. Wurzelkunde. Herkunftsdialog. Was ist deine Heimat? Erst kürzlich habe ich dazu wieder eine Hintergrundsendung fürs Radio gemacht. Auch diese in meiner Stammredaktion des Hessischen Rundfunks »Der Tag – ein Thema, viele Perspektiven«.[3] Es war eine besondere Runde, weil ich ausnahmsweise drei Gäst*innen gleichzeitig im Studio hatte, die Hessin und die Hessen Hannelore, Michael und Amine. 80, 42 und 20Jahre alt. Wir sprachen über ihre unterschiedlichen Vorstellungen von Heimat, und einmal mehr wurde mir durch ihre unterschiedlichen Erklärungen klar, welche widersprüchlichen Bedeutungen dieser Begriff hat und wie eng er mit den Erfahrungen der Menschen verbunden ist. Weil sich manche eine Heimat wünschen und andere sie suchen. Heimat ist alles, von Zuhause bis Albtraum. Was mich zum Sammelband »Eure Heimat ist unser Albtraum«[4] von 2019 führt und der Kritik an einer langen Geschichte politischer Instrumentalisierung ebendieses Heimatbegriffs, mit dem schon seit dem Ersten Weltkrieg Propaganda betrieben wird und im Zweiten Weltkrieg ein homogenes völkisches Verständnis untermalt wurde.[5] Heute nennt sich diese Idee Ethnopluralismus, mit der sich die rechte Identitäre Bewegung ein Europa der weißen Völker ausmalt. In dieser Vorstellung werden nichtweiße Ausländer in ihre Heimat zurückgeführt, also »remigriert«, wie es heute in rechten Kreisen heißt. Schlussendlich wird dabei an eine weitverbreitete Denkweise angeknüpft, die unter anderem dazu führt, dass Leute sich fragen, ob ich wirklich Deutsche sein kann. Hier schließt sich der Kreis.
Hölle, denke ich. Denn wer hat sich dieses Deutschsein nur ausgedacht? Diese Art des Deutschseins überhaupt erfunden? Das habe ich mich auch 2018 auf der Bühne gefragt. Konkret fragte ich, ob nicht jede deutsche Familiengeschichte so begann, wie Carl Zuckmayer sie in »Des Teufels General« erzählt: mit einem römischen Legionär, der einem blonden Mädchen Latein beibrachte. Dann kam ein Kelte dazu, ein Graubündener Landsknecht, ein Schiffer aus Holland, ein französischer Hauslehrer, ein böhmischer Musiker. Und ganz am Schluss stand eine vermeintliche Mehrheit da und sagte: Wir sind Deutsche. Eingeborene in einem Landstrich, durch den seit Menschengedenken die Völker zogen und Nachkommen hinterließen.
2018 fehlte es an allen Ecken und Enden an einem Bewusstsein und Wissen über Schwarze Menschen. Die große Auseinandersetzung über Antischwarzen Rassismus lag noch vor uns und hinter uns die intensive Debatte über die Rolle von Migration und geflüchteten Menschen um das Jahr 2015. Darum wollte ich behutsam vorgehen, das Publikum bloß nicht überfordern. Näherte mich über die Zusammensetzung des Begriffs »deutsch«, beschrieb ihn als eine Art Illusion, eine Konstruktion, die erst im 18. Jahrhundert geschaffen wurde. Mein Text war nicht als Angriff gedacht, aber er klang plötzlich so und musste auch so klingen, nachdem der besagte Autor in seiner Vorrede mit der »Nazikeule« um die Ecke gekommen war. Ungeplant war das. Ich schwöre! Aber ich erinnere mich auch daran, wie bestärkend es war, meinen Text auf der Bühne zu sprechen und damit das letzte Wort zu haben. Diese ganze Situation war einfach so bezeichnend für den deutschen Diskurs.
Wer bestimmt, was deutsch ist? Wer dazugehört oder nicht, vielleicht ein bisschen oder erst später? Und wie viele andere sind in einem Deutschen? Was also ist deutsche Literatur? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, bedarf es Kontext. Und so war meine Antwort auf dich und Necati nicht nur eine Reaktion auf eure Thesen, sondern fand auch vor dem Hintergrund der Debatte um die gewaltvollen Ausschreitungen in Chemnitz 2018 statt. Ein rassistischer Mob war dort nach einer tödlichen Auseinandersetzung am Rande eines Stadtfestes durch die Straßen gezogen und hatte Menschen angegriffen, die nicht in ihr völkisches, weißes Bild von Zugehörigkeit passten. Die Ereignisse hatten eine wochenlange mediale Debatte ausgelöst, die auch zur Versetzung des damaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, in den einstweiligen Ruhestand führte. Ein Mann, der als Geheimdienstchef die Demokratie schützen sollte, später mit der Werteunion die Politik aufmischen wollte und zum offiziell eingestuften Extremisten wurde, der sich heute mit international aktiven Rechtsradikalen trifft und Verschwörungsgedanken teilt.[6]
Exklusive Vorstellungen von Deutschsein waren also schon in der damaligen Gegenwart extrem gefährlich. Das wollte ich unterstreichen. Und würde ich meinen Text von damals heute ergänzen, müsste ich weitere Debatten und Anschläge hinzufügen: Halle 2019 und Hanau 2020 und die Zahl rechter Übergriffe und Gewalt, die laut Bundesinnenministerium 2024 um 40 Prozent angestiegen ist und jede andere Form politisch motivierter Kriminalität weit übersteigt.[7] Ich würde meinen Text also um viele gewaltvolle Erfahrungen erweitern und doch nichts Wesentliches an meiner Rede ändern müssen – außer dass die AfD inzwischen stärkste Oppositionspartei Deutschlands geworden ist.
Es stimmt, Max, damals waren wir hoffnungsvoller, aber naiv waren wir nicht. Und das, was wir heute erleben, ist darum wenig überraschend. Bereits 2018 wurde über das Versagen des Rechtsstaates diskutiert, das Netzwerk der rechten Szene im Sammelbecken AfD, die Legitimation rassistischer Taten durch Politiker und den Verfassungsschutz. Und was den Fall von Chemnitz und die Frage nach dem Deutschsein anging, war dieser in einem weiteren Punkt symbolisch, weil es im öffentlichen und medialen Diskurs hieß: »Deutscher von Ausländern« erstochen. Nur in wenigen Medien fand sich etwas zur Wurzelkunde des Opfers, einer Person »of colour«, Schwarz – und deutsch dazu. Nur wenige benannten, dass er ein Mann war, der von genau dem rassistischen Mob gejagt worden wäre, der sich in Reaktion auf seine Ermordung formiert hatte. Finde den Fehler. Deutsch sein, wenn es in die Story passt.
Ich erinnere mich, wie auch deshalb meine Stimme zum Ende meiner Rede drängender wurde. Wie ich noch einmal unterstrich, wie gefährlich ein Argument ist, das die Zugehörigkeit eines Menschen von seiner Herkunft und dem Nutzen für eine Gesellschaft abhängig macht, da das die ausschließende, die exklusive Idee von Deutschsein stützt. Weil dann beispielsweise Menschen mit einer Bindestrich-Identität eben nicht so sehr zu Deutschland zählen wie diejenigen, die durch Chemnitz gezogen waren oder salbungsvolle Artikel über die Vorteile der »gut integrierten« Migranten schreiben, »die ungeahnte Fähigkeiten haben, viele Sprachen sprechen, anders kochen, musizieren, die Welt bereichern – einfach bunter machen«, wie ich den damals wie heute überholten Integrationsdiskurs illustrierte. Am Ende plädierte ich für eine neue, innovative und mutige Idee von »Deutschsein«, die sich von den exklusiven Vorstellungen der Vergangenheit löst.
Max, unser gemeinsamer Tag und unser Kennenlernen markieren für mich einen Moment, in dem sich wirklich »Alles auf Anfang« stellte – auf unseren Anfang nämlich und damit gewissermaßen auch den Anfang der Arbeit an diesem Buch. Ich erinnere mich, wie ich damals noch in übenden Worten das formulierte, was ich später als intersektionalen Blick in zwei Sachbüchern ausgearbeitet habe. Und auch mein Standpunkt von 2018 war nicht ohne Vorlauf entstanden. Bei mir überschnitten sich biographische Erfahrungen mit vielem, das ich in der Schwarzen Community über die Zeit davor gelernt hatte. Ich war zudem seit zwei Jahren Mutter und verstand immer besser, was ein plurales Selbstverständnis unserer Gesellschaft bedeuten müsste. Die Schönheit der Differenz nannte ich 2022 mein erstes Buch, womit ich eine Anerkennung der Vielfalt im Menschsein meine. Und dieses, unser Buch hier möchte ich darum mit den Worten beginnen, die ich 2018 zum Abschluss an euch richtete: »Wir schreiten voran, weil wir mitgestalten wollen und können. Wir legen ein klares Bekenntnis zur Gleichheit im Unterschiedlichsein ab. Es wäre schön, wenn die Kunst uns dabei helfen würde. Ich zitiere Czollek und Öziri und ergänze sie: Schrieben wir ein Manifest, lautete seine Präambel: Kompromisse sind der Tod der Kunst. Es gibt keine deutsche Literatur, keine deutsche Gesellschaft ohne uns.«
Fußnoten
[1]
Wem gehört Deutschland, Folge 1 »Das postmigrantische Jahrzehnt«,
https://www.podcast.de/episode/681595053/episode-1-das-postmigrantische-jahrzehnt-mit-max-czollek-und-naika-foroutan
[2]
Monika Grütters, Sie war der lebende Beweis, dass es Versöhnung geben kann, Spiegel Online, 10.5.25, https://www.spiegel.de/kultur/margot-friedlaender-ist-tot-sie-war-der-lebende-beweis-dass-es-versoehnung-geben-kann-a-9f947223-577e-405b-ac79-54a39b8c32cd
[3]
https://www.ardaudiothek.de/episode/der-tag-ein-thema-viele-perspektiven/was-ist-schon-heimat-der-tag-im-dialog/hr/14001791/
[4]
Fatma Aydemir, Hengameh Yaghoobifarah (Hrsg.), Eure Heimat ist unser Albtraum, Berlin 2019
[5]
https://www.belltower.news/die-exklusive-heimat-voelkische-ideologie-und-ausgrenzung-93749/
[6]
https://www.phoenix.de/sendungen/dokumentationen/der-fall-maassen---zwisch-a-3243852.html und https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/politik/maassen-verfassungsschutz-rechtsextremismus-werteunion-e433987/?reduced=true
[7]
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2025/05/pmk2024.html
EinführungReise durch die Gegenwart
manche stehen schon in flammen andere riechen nicht einmal den rauch[1]
Deutschland im Winter. Es ist Bundestagswahlkampf. Wir beide, Hadija und Max, schreiben uns zusammen durch die Jahreswende 2024/2025. Endlose Abgründe. Wir sitzen in Zügen, bei Lesungen und Redaktionssitzungen, fahren durch Deutschland. Die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg haben im September stattgefunden. Die AfD hat wie erwartet in jedem der Bundesländer um die 30 Prozent geholt. Bei der Bundestagswahl ein halbes Jahr darauf wird sie stärkste Kraft in Ostdeutschland. In ganz Ostdeutschland? Nein, in Berlin erringt die Linke überraschend eine Mehrheit der Stimmen.
Immer wieder telefonieren wir in dieser Zeit miteinander und erzählen uns, wie wir die aktuelle Situation erleben. So wird es bis zum Ende des Schreibens an diesem Buch sein. Hadija hilft es, die Ereignisse durch ihre journalistische Brille zu reflektieren. Ihre Arbeit ist ihr Schutzschild. Sie recherchiert die Hintergründe der gesellschaftlichen Veränderungen, befragt Menschen in ihren Sendungen und Gesprächsrunden, formuliert ihre Gedanken in ihrer Kolumne und plädiert für journalistische Transparenz, also offen und ehrlich über die eigene Arbeit und die Quellen zu informieren und verantwortungsvoll zu berichten. Max trifft auf Panels, bei Festivals und Lesungen die unterschiedlichsten Menschen: Sinti*zze und Rom*nja, Muslim*innen, Theaterleute und Aktivist*innen, die alle auf ihre Weise von einer zunehmenden Unsicherheit berichten. Und dann ist da ja auch noch das Publikum, das eigene Themen mitbringt – in Dresden andere als in Karlsruhe, München, Hanau oder Lüneburg.
Ein Telefonat Ende 2024 verläuft dann beispielsweise so: Rituelle Begrüßung von Hadija, Hey du, wie geht es dir gerade, rituell ausweichende Antwort von Max, dem es eigentlich ganz gut geht, aber die Welt macht ihm Sorgen. Hadija möchte wissen, ob Max gerade Zeit für sich habe, Max antwortet, dass er keinesfalls Zeit für sich haben möchte, sondern froh sei, wenn ihn Leute ablenkten. Hadija fragt, ablenken – wovon gerade konkret? Max sagt, von der Panik, die tagsüber in ihm aufsteige. Dass die Bühne ihm dabei helfe, nicht allein damit zu sein. Hadija denkt kurz nach, schüttelt hörbar den Kopf und wirft ein, dass ihr gerade schnell alles zu viel werde und dass sie eher Zeit für sich suche, um zur Ruhe zu kommen, die sie meistens nicht hat. Max sagt, dass er das verstehen könne, Menschen seien schließlich schrecklich anstrengend, jetzt fast noch mehr als sonst. Hadija lacht, seufzt, sagt, ach man. Pause. Max, ja, man. Pause. Hadija fragt, was wir heute eigentlich besprechen müssen?
Wenn wir miteinander reden, dann geht es zwischen Themen und Gefühlen oft hin und her. Zwischen Privatem und Politischem sind die Übergänge fließend. Alles hängt mit allem zusammen. Da fällt es manchmal schwer, Inseln zu finden, Orte, an denen wir nicht daran denken, was um uns herum gerade Schlimmes passiert. Wir sind involviert, oft auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. In Räumen, die sich nicht unbedingt überschneiden, obwohl wir uns mit ähnlichen Themen beschäftigen: aktuelle politische Debatten und Skandale, mediale Framings oder Kampfbegriffe. Wenn wir einander zuhören, bringen wir uns auf den aktuellen Stand, und dabei entsteht dann eine vielstimmige Beschreibung der Realität da draußen. Denn die Leben eines Lyrikers und einer Journalistin unterscheiden sich doch erheblich. Und es sind genau diese unterschiedlichen Erfahrungen, die uns bei unserem Nachdenken über die Gegenwart helfen.
Als Autorin und Autor dieses Buches stehen wir also an verschiedenen Punkten: Frankfurt am Main trifft auf Berlin, West- auf Ostdeutschland, ghanaisch-afrodeutsch-deutsche auf jüdisch-deutsche Familiengeschichte, Journalismus auf Kunst. Gemeinsam denken wir über eine Gegenwart nach, die zugleich sehr gut und sehr schlecht ist. Eine Gegenwart, die so bewältigt werden muss, dass sie den aktuellen Bedrohungen gerecht wird. Mit einer Geschichte, die unsere ist – und zugleich nicht unsere. Vom Anfang unserer gemeinsamen Story 2018 haben wir im Prolog erzählt. Fünf Jahre später ging sie in eine weitere, vertiefende Runde, als wir den Podcast »Trauer und Turnschuh« starteten.[2] Wir widmeten ihn der Frage, wie die deutsche Gewaltgeschichte in die Gegenwart hineinwirkt, nannten das die »emotionale Afterhour der Vergangenheit« und meinten einen Austausch über die Dinge, die liegengeblieben sind in der Aufarbeitung der gewaltvollen deutschen Geschichte. Seither kommen wir jede Folge mit anderen Erfahrungsexpert*innen ins Gespräch, unterhalten uns über Geschichte und Ideologien wie die des Kolonialismus und des Nationalsozialismus. Wir denken über Rassismus, Antisemitismus, Ableismus und andere Diskriminierungsformen nach und werfen dabei immer wieder die Frage auf, wie diese Gewalttraditionen in unsere Gegenwart reichen. Auch weil rechter Terror tiefe Wunden hinterlässt – bei den Überlebenden, den Angehörigen und in den Communities, also den Gemeinschaften in Deutschland, die durch bestimmte Gemeinsamkeiten wie Biographie oder Diskriminierungserfahrung verbunden sind. Viele von ihnen kämpfen bis heute nicht nur mit Verlust, sondern auch für bislang fehlende Anerkennung. Und sie müssen sich gegen die Kontinuitäten der Gewalt in der Gegenwart wehren. Darum war unser Plan eigentlich, einen bestärkenden, informativen und irgendwie kämpferischen Podcast darüber zu machen, dass Erinnerungskultur auch Gerechtigkeit und Widerständigkeit heißen sollte. Ein Gegenentwurf also gegen eine etablierte Vorstellung von Erinnerungskultur, die den Bezug auf eine gewaltvolle Vergangenheit vor allem als etwas versteht, das überwunden worden und damit abgeschlossen ist. Nach zwölf Folgen wollten wir in der Gegenwart ankommen und mit zurückhaltender Hoffnung in die Zukunft blicken. Aber dann machte uns diese Gegenwart einen Strich durch die Dramaturgie.
Spätestens, als die AfD im Juni 2023 in den Wahlprognosen bei 20 Prozent lag, wurde uns klar, dass wir eine andere Richtung einschlagen mussten. Und so begannen wir, über Formen politischer Trauer zu sprechen und die Frage, was uns angesichts der sich zuspitzenden Situation im Land weiterhelfen könnte. Als dann wenige Monate darauf am 7. Oktober 2023 das Massaker der Hamas an der israelischen Zivilbevölkerung stattfand und Israel mit der verheerenden Bombardierung des Gazastreifens und zwischenzeitlich auch des Libanons antwortete, wurde es noch einmal ungemütlicher. Die Frage nach dem Scheitern der Hoffnungen von Aufarbeitung und einer Überwindung nicht nur deutscher Gewalttraditionen stellt sich seither mit noch größerer Dringlichkeit. Weil der Krieg in Gaza die Leben so vieler Menschen in Palästina fordert, die noch verbliebenen israelischen Geiseln noch immer nicht frei sind, viele die Regierung Israels mit Juden*Jüdinnen gleichsetzen und uns das Ausmaß der gewaltvollen Politik von den USA bis nach Deutschland vor neue Herausforderungen stellt. Das richtige Maß scheint dabei in den Reaktionen immer wieder zu verrutschen.
Seit dem 7. Oktober kollidieren der Schmerz und die Trauer vieler Menschen miteinander. Wir haben darüber privat gesprochen, aber auch in unserem Podcast sind wir darauf zurückgekommen, dass die Aufmerksamkeit und Empathie häufig entlang der Linien verteilt wird, die Rassismus und Antisemitismus ziehen. Wie das zu einem verstörten Sprechen oder sogar Verstummen geführt hat und einer Einsamkeit, die viele von uns seither in der noch immer allgegenwärtigen Polarisierung auf jeweils eigene Weise umgibt. Eine ehrliche Auseinandersetzung über den Tag des Anschlags und die Wochen, Monate, Jahre des Krieges jedenfalls ist in Deutschland bis heute ausgeblieben. Stattdessen ging es viel um Sprache, so, als sei mit den Worten Selbstverteidigung oder Genozid und Geiselbefreiung, Antisemitismus oder Rassismus alles geklärt. Als würde die Diskussion nicht damit erst beginnen. In dieser Zeit ging es uns deshalb nicht nur um Fragen von Meinungsfreiheit und die Grenzen, die der Staat ihr setzt, sondern auch um das Scheitern der Vision einer postmigrantischen, solidarischen Gemeinschaft, die wir in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten selbst mitgestaltet hatten. Wir fragten uns: Waren unsere Hoffnungen zu naiv? Und wir beantworteten das unterschiedlich. Das Fragen hat nicht aufgehört, manchmal sind wir irritiert voneinander, und dann suchen wir nach Erklärungen. Wir denken gemeinsam nach und manchmal allein, fühlen uns hinein in den Anderen und suchen nach Verbindung. Dabei ist uns beiden immer wieder klargeworden, wie viel die aktuelle politische Zuspitzung und das damit verbundene gesellschaftliche Auseinanderdriften auch von der gewaltvollen Geschichte Deutschlands bestimmt ist.
So gilt der Slogan »Nie wieder ist jetzt« seit den Enthüllungen der Correctiv-Recherchen Anfang 2024 als eine Art Mantra, mit dem sich dieses Land seine eigene erfolgreiche Aufarbeitung beweisen möchte. Zugleich ist diese Selbsterzählung in den vergangenen Jahren immer weiter unter Druck geraten – durch die steigenden Umfragewerte der AfD, den anwachsenden Rassismus seit 2015 und den Antisemitismus seit 2017, aber eben auch durch den Anschlag vom 7. Oktober 2023, der als weiterer Beschleuniger einer Polarisierung und gesellschaftlichen Erkaltung wirkt. Trotz allem oder gerade deshalb gleicht der Slogan heute einer Beschwörung, welche die deutsche Dominanzkultur gegen eine Anerkennung dieser Realitäten und manchmal auch gegen die Anerkennung der eigenen Verantwortung für diese Realität wiederholt. Noch lange klingt uns Olaf Scholz in den Ohren, der Ende Oktober 2023 angesichts der teilweise antisemitischen Proteste gegen den Gazakrieg sein Wort an Juden*Jüdinnen richtete und als Lösung für den steigenden Antisemitismus in Deutschland ankündigte, jetzt im großen Stil Menschen abschieben zu wollen.[3]
Die Intensivierung dieser verqueren erinnerungskulturellen Signale in Bezug auf die Asylpolitik verschärfte für uns beide noch einmal die Frage, warum die gleichzeitig rasant wachsende rechte Gefahr in Deutschland nicht viel ernster genommen wurde und wird. Uns schien, und inzwischen sind wir davon überzeugt, dass die Migrationsdebatte und die wütenden Angriffe gegen die sogenannte »Wokeness« auch der Ablenkung dienen. Die weitaus größere Gefahr für die plurale Demokratie und ihre Strukturen ging nämlich schon damals nicht von Straßenprotesten oder Unibesetzungen, Kulturveranstaltungen oder Klimaaktionen aus, sondern von einer völkischen Partei. Sie schickte sich gerade an, zur stärksten Kraft Ostdeutschlands zu werden, und bei der Bundestagswahl 2025 wurde sie schließlich sogar bundesweit zur zweitstärksten Partei gewählt. Zumal sie im April desselben Jahres in manchen Umfragen die CDU/CSU sogar überholte.[4] Da liegt der Schluss nahe, dass die selbsterklärte Christliche Union mit ihrem Kurs, rechte Themen einfach zu übernehmen, bislang nicht die richtige politische Antwort auf die AfD gefunden hat, wie es die Spiegel-Journalistin Ann-Katrin Müller in ihrem Text im Sammelband »Rechtsextrem, das neue Normal?« darlegt.[5] Die extrem rechten Kräfte setzen nämlich gerade nicht auf die Zusammenarbeit mit der Union, sondern auf ihre »Implosion« – unterstützt durch rechtspopulistische Strömungen wie die Werteunion und sogenannte Alternativmedien, die in den 2010er Jahren ihre Gründungswelle im Internet erlebten und ihren Aufstieg mit gesellschaftlichen Wendepunkten wie der sogenannten »Migrationskrise« 2015/16 oder der Coronapandemie. Die Medienwissenschaftlerin Lisa Schwaiger unterscheidet hier zwischen vier Typen von »Alternativmedien«, darunter beschreibt sie die »Aufdecker der Mainstreamlügen«, wozu beispielsweise Tichys Einblick und Nius zählen. Kritiker*innen zufolge orientiert sich Nius am US-Sender Fox News, der Donald Trumps Republikanischer Partei nahesteht. Beide gelten aufgrund ihrer Optik und Reichweite als Leuchttürme rechter Medienarbeit. Sie eint, dass sie von (ehemals) etablierten Journalisten geführt werden und dass ihre Finanziers oft ein gewisses Näheverhältnis zu konservativen Parteien oder Institutionen pflegen. So wird Nius beispielsweise vom Millionärs-Unternehmer Frank Gotthardt finanziert, der unter anderem Ehrenvorsitzender des CDU-Wirtschaftsrats in Rheinland-Pfalz ist. Er bezeichnet sich selbst als »Kümmerer«.[6]
Wenn aktuell in deutschen Talkshows, Artikeln oder auf Bühnen über die Gegenwart nachgedacht wird, schwankt die Debatte oft zwischen zwei altbekannten Extremen. Auf der einen Seite diejenigen, die die deutsche Geschichte als Drohkulisse verstehen. Eine Warnung davor, wie schlimm es noch kommen kann. Und auf der anderen Seite jene, die diese Drohung herunterspielen. Der Autor und Auschwitz-Überlebende Primo Levi brachte die erste Position schon 1986 auf den Punkt, als er sagte: »Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.«[7] Das beschreibt die Gefühle der Unruhe, Angst und gelegentlich aufsteigender Panik, die wir beide aus eigener Erfahrung kennen. Die gegenteilige Sichtweise argumentiert, dass Deutschland dasselbe Recht auf Nationalismus und Heimatgefühle haben sollte wie andere Länder auch. Nimmt man diesen Standpunkt ein, dann wird die Sorge vor einer Wiederholung der deutschen Gewaltgeschichte heruntergespielt oder sogar verärgert zurückgewiesen. So wie von Autor Martin Walser, als er 1998 den im Prolog bereits erwähnten Begriff »Auschwitzkeule« einführte, um den moralischen Druck zurückzuweisen, den er als aufrecht fühlender Deutscher von der Gegenseite verspürte.
Der Warnung vor einer Wiederholung der Geschichte steht also der Vorwurf gegenüber, dass nicht die Wiederholung der Geschichte das Problem ist – sondern die Angst davor. Und so ist das bis heute, erweitert um das gesellschaftliche Selbstbild von der erfolgreichen Aufarbeitung und Überwindung der gewaltvollen Vergangenheit. Es ist vermutlich kein Zufall, dass ein Bewusstsein um die Mängel und Leerstellen der deutschen Aufarbeitung insbesondere bei jenen Menschen existiert, die am stärksten von rechter Gewalt betroffen waren und es weiterhin sind: Juden*Jüdinnen und Muslim*innen, Sinti*zze und Rom*nja, Schwarze, queere und behinderte Personen.
Das Wissen, das aus diesem Bewusstsein entstanden ist, wird an unterschiedlichen Orten bewahrt: in der Arbeiter*innenbewegung, in migrantischen Communities, bei Juden*Jüdinnen, in der Hip-Hop-Kultur, es ist niedergelegt in Literatur, Filmen, Theaterstücken und öffentlichen Aktionen. Nicht wenige dieser Errungenschaften sind über die Jahrzehnte in politische Forderungen und neue Denkweisen eingegangen, manchmal auch ohne das Bewusstsein, von wem dieses Wissen eigentlich geschaffen und bewahrt wurde. Aus diesem über Generationen gesammelten Wissen schöpft die jeweils folgende Generation, und gelegentlich fehlt ihr dabei das Quellenbewusstsein ihres eigenen Empowerments und nicht selten ein intergenerationaler Austausch. Dieser Mangel an gemeinsamen Erzählungen hat auch zur Distanz zwischen den sich mal parallel, mal ganz anders entwickelnden Communities beigetragen, und die Konsequenzen dieses Mangels haben wir heute vor Augen. Deshalb fragen wir in diesem Buch auch danach, wie sich aus geteilten Leid- und Widerstandserfahrungen wieder eine gemeinsame politische Praxis entwickeln lässt.