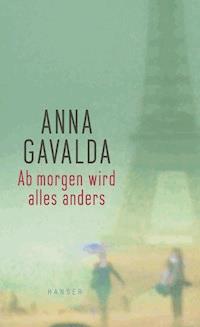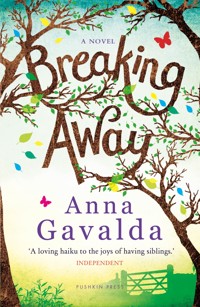Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charles Balanda, 47, ist ein erfolgreicher Architekt und glücklich mit seinem Leben. Bis er einen Brief bekommt, in dem nur drei Worte stehen: "Anouk ist tot." Von da an ist nichts mehr, wie es war. Denn Anouk ist nicht nur seine große Liebe gewesen, sie war eine wunderbare Frau, und ihr Sohn, der hochbegabte Alexis, war sein Freund, bis ... Was damals geschah, lässt Charles nicht mehr los. Er begibt sich auf Spurensuche und merkt, dass er sich eigentlich nach einem ganz anderen Leben sehnt. Wieder einmal beglückt uns Anna Gavalda mit einer wunderbaren Geschichte von atemberaubendem Realismus - ein Feuerwerk an witzigen Dialogen und unvergesslichen Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Gavalda
Alles Glück kommt nie
Roman
Aus dem Französischen von
Ina Kronenberger
Carl Hanser Verlag
Die französische Originalausgabe erschien 2008
unter dem Titel La Consolante bei Le Dilettante in Paris.
Krieg und Frieden von Leo Tolstoi auf Seite 98/99
wird zitiert in der Übersetzung von Marianne Kegel,
Winkler Verlag 1956. © Patmos Verlag GmbH & Co KG/
Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf.
Singende Steine von Fernand Pouillon auf Seite 167/168
wird zitiert in der Übersetzung von Gudrun Trieb,
© edition tertium Ostfildern 1996.
Das Leben der Bienen von Maurice Maeterlinck
auf Seite 540/541 wird zitiert in der Übersetzung von
Friedrich von Oppeln-Bronikowski.
eBook ISBN 978-3-446-23347-8
© Le Dilettante 2008
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2008
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
www.hanser.de
www.anna-gavalda.de
So egoistisch
und abwegig es wirken mag,
dieses Buch, Charles,
ist für Sie.
Er hielt sich stets etwas abseits. Dort drüben, ein gutes Stück vom Gitterzaun entfernt, außerhalb unserer Reichweite. Mit fiebrigem Blick, die Arme verschränkt. Mehr als verschränkt, verschlossen, verhakt. Als hätte er Bauchschmerzen oder würde frieren. Als klammerte er sich an sich selbst, um nicht zu fallen.
Er trotzte uns allen, sah jedoch niemanden an. Hielt Ausschau nach einem bestimmten Jungen und presste eine Papiertüte fest an sein Herz.
Darin war ein Schokocroissant, das wusste ich genau und fragte mich jedes Mal, ob es nicht völlig platt gedrückt war, wo er es ...
Ja, daran hielt er sich fest, an der Schulglocke, an der Verachtung der anderen, am Abstecher in die Bäckerei und an den vielen kleinen Fettflecken an seinem Revers, die ebenso vielen unverhofften Medaillen glichen.
Ja, unverhofften ...
Aber – wie hätte ich das damals wissen können?
Damals flößte er mir Angst ein. Seine Schuhe waren zu spitz, seine Fingernägel zu lang, sein Zeigefinger zu gelb. Seine Lippen zu rot. Sein Mantel zu kurz und viel zu eng.
Seine Augenränder zu dunkel. Und seine Stimme zu seltsam.
Wenn er uns schließlich bemerkte, lächelte er und nahm die Arme auseinander. Bückte sich schweigend, berührte seine Haare, seine Schultern, sein Gesicht. Und während mich meine Mutter fest an sich drückte, zählte ich noch einmal voller Faszination die vielen Ringe an der Wange meines Freundes.
Er hatte einen an jedem Finger. Echte Ringe, schöne, wertvolle, wie meine Großmütter sie hatten. Und immer wandte meine Mutter sich in diesem Moment entsetzt ab, und ich ließ ihre Hand los.
Alexis hingegen nicht. Er entzog sich nie. Hielt ihm mit der einen Hand den Schulranzen hin und schob mit der anderen, der freien, das Schokocroissant in den Mund, während er in Richtung Marktplatz davonging.
Alexis mit seinem Außerirdischen auf hohen Absätzen, seinem Gruselmonster, dem Clown aller Grundschüler, fühlte sich sicherer als ich und wurde mehr geliebt.
Glaubte ich.
Trotzdem hatte ich ihn eines Tages gefragt: »Hm, ist das denn – ist das jetzt ein Mann oder eine Frau?«
»Wer?«
»Der – die – dich abends abholt?«
Er hatte mit den Schultern gezuckt.
Ein Mann natürlich. Den er aber seine Nounou nannte.
Und sie, seine Nounou, hatte zum Beispiel versprochen, ihm Goldknöchelchen zum Spielen mitzubringen, die er gegen eine meiner Kugeln eintauschen würde, wenn ich wollte, oder, Mensch, heute kommt sie zu spät, meine Nounou. Hoffentlich hat sie ihren Schlüssel nicht verloren. Sie verliert nämlich immer alles, weißt du. Sie sagt oft, dass sie irgendwann ihren Kopf bei der Friseuse oder in der Umkleidekabine vom Prisunic vergessen wird, und dann lacht sie und sagt, zum Glück hat sie ihre Beine!
Es ist ein Mann, das siehst du doch.
Was für eine Frage ...
Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Dabei war er sehr ausgefallen.
Ein Name, der nach Music-Hall, abgewetztem Samt und kaltem Rauch klang. Ein Name wie Gigi Lamor oder Gino Cherubini oder Rubis Dolorosa oder ...
Ich weiß es nicht mehr, und das macht mich wütend. Ich sitze in einem Flugzeug ans Ende der Welt, ich sollte schlafen, ich muss schlafen. Ich habe sogar Medikamente genommen. Ich habe keine Wahl, sonst werde ich verrecken. Ich habe schon so lange kein Auge mehr zugetan, und ich ...
Ich werde verrecken.
Aber nichts hilft. Weder die Chemie noch der Kummer noch die Erschöpfung. In mehr als dreißigtausend Fuß, in der Leere hier oben, kämpfe ich immer noch wie ein Idiot, stochere in nicht ganz erloschenen Erinnerungen herum. Und je stärker ich in die Glut blase, umso stärker brennen mir die Augen, und je weniger ich sehe, umso mehr gehe ich in die Knie.
Meine Sitznachbarin hat mich schon zweimal gebeten, meine Leselampe auszumachen. Tut mir leid, das geht nicht. Es ist vierzig Jahre her, Madame. Vierzig Jahre, verstehen Sie? Ich brauche Licht, um den Namen dieser alten Transe zu finden. Den genialen Namen, den ich vermutlich vergessen habe, weil ich ihn auch Nounou genannt habe. Und den ich auch vergöttert habe. Weil es bei ihnen so war: Man vergötterte.
Nounou, die eines Abends im Krankenhaus in ihrem zerrütteten Leben aufgetaucht war.
Nounou, die uns verwöhnt, verzogen, verköstigt, vollgestopft, getröstet, entlaust und richtig hypnotisiert hatte, tausendmal verzaubert und wieder vom Zauber befreit. Die uns aus der Hand gelesen, Karten gelegt, ein Leben als Sultan, als König, als Nabob vorhergesagt hatte, ein Leben mit Bernsteinen und Saphiren, mit lässigen Posen und erlesenen Liebschaften, und Nounou, die eines Morgens auf dramatische Weise aus unserem Leben verschwunden war.
So dramatisch, wie es sich gehört. Wie es sich für ihn gehörte. Wie es sich für sie alle gehörte.
Ich aber ... Später. Das erzähle ich später. Ich habe jetzt nicht die Kraft dazu. Und außerdem habe ich keine Lust. Ich will sie jetzt nicht alle wieder verlieren. Noch ein wenig auf dem Rücken meines Resopalelefanten sitzen bleiben, mit dem Küchenmesser im Schurz, mit ihren Fesseln, ihrem Lidschatten und all den Turbanen aus dem berühmten Alhambra.
Ich brauche meinen Schlaf, und ich brauche meine Funzel. Ich brauche alles, was ich unterwegs verloren habe. Alles, was mir gegeben und wieder genommen worden war.
Und was mir verdorben wurde ...
Weil, ja, so war es in ihrer Welt. Das war ihr Gesetz, ihr Credo, ihr Leben als Ungläubige. Man vergötterte, prügelte sich, heulte, tanzte die ganze Nacht hindurch – und alles ging in Flammen auf.
Alles.
Nichts durfte bleiben. Nichts. Niemals. Nada. Von den verbitterten, verkniffenen, verzerrten Mündern, den Betten, der Asche, den verlebten Gesichtern, den Stunden zum Heulen, der jahrelangen Einsamkeit, keine Erinnerungen. Auf keinen Fall. Erinnerungen waren etwas für die anderen.
Die Zaghaften. Die Buchhalter.
»Ihr werdet sehen, Herzchen, die schönsten Feste sind am Morgen vergessen«, sagte er, »die schönsten Feste gibt es während des Fests. Den Morgen gibt es nicht. Der Morgen ist dann, wenn man die erste Metro nimmt und von neuem attakkiert wird.«
Und sie. Sie. Sie sprach unentwegt vom Tod. Unentwegt. Um ihm zu trotzen, das Miststück fertigzumachen. Weil sie wusste, dass wir alle dran glauben müssen ... Ihr Leben bestand darin, dies zu wissen, und darum musste man sich berühren, sich lieben, trinken, beißen, genießen und alles vergessen.
»Setzt es in Brand, Kinder. Setzt mir alles in Brand.« Das ist ihre Stimme und ich – ich höre sie noch heute. Barbaren.
*
Er kann das Licht nicht löschen. Auch die Augen nicht schließen. Er wird bald, nein, er ist schon dabei, verrückt zu werden. Er weiß es. Überrascht sich in dem dunklen Fenster und ...
»Alles in Ordnung, Monsieur?«
Eine Stewardess berührt ihn an der Schulter.
Warum habt ihr mich verlassen?
»Alles in Ordnung?«
Er würde ihr gern mit Ja antworten, alles in Ordnung, danke, aber er kann nicht: Er weint.
Endlich.
Teil 1
1
Anfang Winter. An einem Samstagmorgen. Flughafen Paris Charles-de-Gaulle, Terminal 2E.
Milchigweiße Sonne, Kerosingeruch, unendliche Müdigkeit.
»Haben Sie keinen Koffer?«, fragt mich der Taxifahrer und tippt auf seinen Kofferraum.
»Doch.«
»Dann haben Sie ihn aber gut versteckt!«
Er grinst sich eins, ich drehe mich um: »O nein, ich, das Laufband. Ich habe vergessen, ihn ...«
»Holen Sie ihn! Ich warte hier!«
»Nein. Egal. Ich habe nicht die Kraft dazu, ich, egal ...«
Er grinst nicht mehr. »He! Sie wollen ihn doch nicht hierlassen?«
»Ich hole ihn ein andermal ab. Ich komme schon übermorgen wieder. Es ist fast so, als würde ich hier wohnen, ich ... Nein, fahren wir. Ich pfeif drauf. Ich gehe jetzt nicht wieder zurück.«
»He du, klatsch, klatsch, mein Gott, ja du, ich komm zu dir – auf einem Pferd!
Oh,yeah, auf einem Pferd!
He du, klatsch, klatsch, mein Gott, ja du, ich komm zu dir – auf einem Rad!
Oh,yeah, auf einem Rad!«
Es swingt nicht schlecht, im Peugeot 407 des Claudy A’Bguahana Nr. 3786. (Seine Lizenz ist mit Tesafilm an der Rückenlehne befestigt.)
»He du, klatsch, klatsch, mein Gott, ja du, ich komm zu dir – im Heißluftballon!
Oh,yeah, im Heißluftballon!«
Er spricht mich im Rückspiegel an: »Die stören Sie hoffentlich nicht, die Gospels, oder?«
Ich lächle.
»He du, klatsch, klatsch, mein Gott, ja du, ich komm zu dir – in einer Rakete!«
Mit solchen Lobgesängen hätten wir alle den Glauben nicht so früh verloren, oder?
Oh,yeah!
O ja ...
Nein, nein, ist schon okay. Danke. Alles bestens.«
»Woher kommen Sie?«
»Aus Russland.«
»O je! Dort ist es ganz schön kalt, oder?«
»Sehr.«
Unter Schäfchen meiner Herde wäre ich liebend gern brüderlicher, aber ... Und hier schlage ich mich an die Brust, ja, das kann ich, ich schlage mich an die Brust als Erwiderung, ich kann nicht.
Und es ist ganz und gar meine Schuld.
Ich bin zu weit weg, zu erschöpft, zu schmutzig und zu ausgetrocknet, um mich auf ihn einzulassen.
Eine Autobahnauffahrt weiter: »Ist Gott denn in Ihrem Leben?«
Jesses. Und das muss ausgerechnet mir passieren ... »Nein.«
»Soll ich Ihnen was sagen? Das hab ich gleich gewusst. Ein Mann, der seinen Koffer einfach so zurücklässt, da habe ich mir gleich gedacht: Gott ist nicht da.«
Er wiederholt es noch einmal und schlägt aufs Lenkrad. »Gott-ist-nicht-da.«
»Genau ...«, gebe ich zu.
»Das stimmt nicht! Er ist da! ER ist überall! Er zeigt uns den We–«
»Nein, nein«, ich unterbreche ihn, »da, wo ich herkomme, von wo ich zurückkomme. Da ist er nicht. Glauben Sie mir.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Das Elend –«
»Aber Gott ist im Elend! Gott bewirkt Wunder, verstehen Sie?«
Blick auf den Tacho, 90, ich kann unmöglich die Tür aufmachen.
»Ich, zum Beispiel. Früher war ich – ein Taugenichts!« Er ereifert sich: »Ich habe getrunken! Gespielt! Habe mit vielen Frauen geschlafen! Ich war kein Mensch, verstehen Sie? Ich war ein Taugenichts! Doch der Herr hat sich meiner angenommen. Der Herr hat mich wie eine Blume gepflückt und zu mir gesagt: Claudy, du ...«
Ich werde nie erfahren, was ihm der Alte vorgeschwindelt hat, ich war eingenickt.
Wir standen vor der Eingangstür zu meinem Wohnblock, als er mein Knie anstieß.
Auf der Rückseite der Rechnung hatte er die Anschrift des Paradieses vermerkt: Kirche von Auberviiiers, 46–48, Rue Saint-Denis, 10–13 h.
»Sie müssen nächsten Sonntag kommen, ja? Sie müssen sich sagen: Wenn ich in dieses Auto gestiegen bin, dann war das kein Zufall, es gibt nämlich ... (große Augen) keinen Zufall.«
Das Fenster auf der Beifahrerseite war runtergekurbelt, ich beugte mich vor, um mich von meinem Hirten zu verabschieden: »Und Sie, äh, – schlafen Sie jetzt überhaupt nicht mehr – äh – mit Frauen?«
Breites Lächeln. »Nur mit denen, die der Herr mir schickt.«
»Und woran erkennen Sie die?«
Sehr breites Lächeln. »Es sind die Schönsten ...«
Man hat uns alles ganz falsch beigebracht, überlegte ich, als ich das Tor aufstieß, ich selbst war, soweit ich mich erinnere, nur ein einziges Mal ehrlich, nämlich als ich die Worte nachsprach: »Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach.«
Ja, genau. Daran glaube ich wirklich.
Und du, klatsch, klatsch, beim Hochsteigen, ja du, meiner vier Etagen, stellte ich entsetzt fest, dass ich diese verfluchte Leier im Kopf hatte, in einem Taxi,ja, in einem Taxi.
Oh, yeah.
Die Tür war mit dem Sicherheitsbügel verriegelt, und die zehn Zentimeter, um die mir meine Wohnung widerstand, machten mich rasend. Ich kam von zu weit her, hatte zu viel gesehen, der Flieger hatte zu viel Verspätung gehabt, und Gott war zu anspruchsvoll. Bei mir knallte eine Sicherung durch. »Ich bin’s! Macht auf!«
Ich brüllte und hämmerte an die Tür: »Jetzt macht endlich auf, Mann!«
Snoopys Schnauze tauchte im Türspalt auf.
»He, ist ja gut. Reg dich ab. Reg dich ab ...«
Mathilde löste den Bügel, trat zur Seite und hatte mir schon den Rücken zugekehrt, als ich über die Schwelle trat.
»Guten Abend!«, sagte ich.
Sie hob nur kurz den Arm und bewegte lässig ein paar Finger.
Enjoy prangte hinten auf ihrem T-Shirt. Warum nicht? Einen Augenblick lang hatte ich nicht übel Lust, sie an den Haaren zu packen und ihr den Hals zu brechen, damit sie sich umdrehte und mir in die Augen schaute, woraufhin ich diese vier kurzen und altmodischen Silben wiederholen würde: Guten Abend. Doch dann, ach ... ließ ich es bleiben. Die Tür zu ihrem Zimmer war sowieso schon zugefallen.
Ich war eine Woche nicht hier gewesen, würde übermorgen wieder wegfahren – und was soll das Ganze?
He? Was spielt es schon für eine Rolle? Ich war sowieso nur auf der Durchreise.
Ich ging in Laurence’ Schlafzimmer, das auch mein Schlafzimmer war, glaube ich. Das Bett war perfekt gemacht, die Decke glattgezogen, die Kopfkissen waren aufgeplustert, bauchig, hochmütig. Traurig. Ich drückte mich an der Wand entlang und setzte mich vorsichtig auf den Rand des Lattenrosts, um keine Falten zu hinterlassen.
Ich betrachtete meine Schuhe. Ziemlich lange. Sah aus dem Fenster. Auf die Dächer und das Militärhospital Val-de-Grâce in der Ferne. Und dann auf ihre Kleider über der Rückenlehne des Sessels.
Ihre Bücher, ihre Wasserflasche, ihr Notizbuch, ihre Brille, ihre Ohrringe. Das alles musste etwas zu bedeuten haben, aber ich verstand einfach nicht, was. Ich – ich verstand gar nichts.
Ich spielte mit einem Fläschchen voller Kügelchen herum, das auf dem Nachttisch stand.
Nux Vomica 9CH, Schlafstörungen.
Ja, das musste es sein, hier ist jemand echt gestört, knurrte ich und stand auf.
Nux Vomica.
Es war jedes Mal das Gleiche und wurde von Mal zu Mal schlimmer. Ich kam nicht mehr mit. Die Jahre entfernten sich, ich ...
Komm, hör auf, schalt ich mich. Du bist müde und drehst dich im Kreis. Hör auf.
Das Wasser war kochend heiß. Mit offenem Mund, die Augen geschlossen, wartete ich darauf, dass es mich von all den üblen Ablagerungen befreite. Der Kälte, dem Schnee, dem fehlenden Licht, den Stunden im Stau, den unendlichen Diskussionen mit diesem Idioten von Páwlowitsch, den im Voraus verlorenen Schlachten und all den Blicken, die mich noch verfolgten.
Von dem Typ, der mir gestern seinen Helm ins Gesicht gefeuert hatte. Von all den Worten, die ich nicht verstand, die ich aber mühelos erraten konnte. Von der Baustelle, die mich überforderte. In jeder Hinsicht.
Warum hatte ich mich bloß darauf eingelassen? Warum? Und jetzt! Jetzt fand ich inmitten all dieser Schönheitsprodukte nicht einmal mehr meinen Rasierer! Orangenhaut, schmerzhafte Regel, strahlender Teint, straffer Bauch, fettige Haut, brüchige Haare.
Wozu soll dieser Plunder bloß gut sein! Wozu?
Und für welche Streicheleinheiten?
Ich unterbrach mich und feuerte den ganzen Kram in die Tonne.
»Weißt du, was? Ich glaube, ich koch dir einen Kaffee.«
Mathilde lehnte am Türpfosten der Badezimmertür, die Arme verschränkt, die Hüfte kokett zur Seite gestreckt.
»Gute Idee.«
Sie betrachtete den Boden.
»Ja, äh, mir sind gerade zwei, drei Teile runtergefallen. Ich werde ... Mach dir keine Sorgen ...«
»Nein, nein. Ich mach mir keine Sorgen. Das Spielchen bringst du doch jedes Mal.«
»Ach?«
Sie schüttelte den Kopf. »Schöne Woche gehabt?«, fing sie wieder an.
»...«
»Komm! Einen Kaffee.«
Mathilde. Das kleine Mädchen, dessen Zutrauen so schwer zu gewinnen war. Unendlich schwer. Wie groß sie geworden ist, mein Gott.
Zum Glück hatten wir noch Snoopy ...
»Geht’s dir jetzt besser?«
»Ja«, sagte ich und blies über meine Tasse, »danke. Ich habe das Gefühl, endlich zu landen ... Musst du nicht zur Schule?«
»Ä-ä.«
»Arbeitet Laurence den ganzen Tag?«
»Ja. Sie kommt direkt zu Omi. Neeee. Sag jetzt nicht, du hast es vergessen. Du weißt doch, dass sie heute Abend ihren Geburtstag feiert.«
Ich hatte es vergessen. Nein, nicht dass Laurence morgen Geburtstag hat, sondern dass wir so einen netten Abend vor uns haben. Eine richtige Familienfeier, wie ich sie liebe. Genau das, was mir jetzt fehlt. »Ich habe noch kein Geschenk.«
»Ich weiß. Darum habe ich auch nicht bei Léa übernachtet. Ich wusste, du würdest mich brauchen.«
Die Jugend. Dieses ätzende Auf und Ab.
»Weißt du, Mathilde, dein Schwanken zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt überrascht mich immer wieder.«
Ich war aufgestanden, um mir nachzuschenken.
»Wenigstens überrasche ich überhaupt noch einen ...«
»Na na«, antwortete ich und strich ihr über den Rücken, »enjoy.«
Sie sträubte sich. Ganz leicht.
Wie ihre Mutter.
Wir wollten zu Fuß gehen. Nach ein paar schweigsamen Straßen, jede meiner Fragen schien sie mehr zu nerven als die vorige, fingerte sie an ihrem iPod herum und steckte sich die Stöpsel in die Ohren.
Okay, okay ... Ich sollte mir vielleicht lieber einen Hund halten, oder? Jemanden, der mich liebt und Freudensprünge macht, wenn ich von einer Reise zurückkomme ... Er muss ja nicht echt sein. Mit großen zärtlichen Augen und einem kleinen Mechanismus, der den Schwanz wedeln lässt, wenn ich seinen Kopf berühre.
Ach, ich bin schon ganz vernarrt in ihn.
»Bist du sauer?«
Wegen dieser Dinger im Ohr hatte meine Begleiterin lauter gesprochen als üblich und sich umgedreht.
Sie seufzte, schloss die Augen, seufzte noch einmal, nahm den linken Stöpsel heraus und steckte ihn mir ins rechte Ohr: »Hier, ich such dir was aus, was zu deinem Alter passt, das wird deine Stimmung heben ...«
Und inmitten von Straßenlärm und Autoschlangen kamen aus dem Ende einer äußerst kurzen Leitung ein paar Gitarrenakkorde, die mich in meine weit zurückliegende Kindheit versetzten.
Ein paar Noten und die perfekte rauhe und etwas gedehnte Stimme von Leonard Cohen.
Suzanne takes you down to her place near the river
You can hear the boats go by
You can spend the night beside her
And you know that she’s half crazy ...
»Schon besser?«
But that’s why you want to be there.
Ich nickte, wie ein trotziger kleiner Junge.
»Super.«
Sie war zufrieden.
Der Frühling war noch weit weg, aber die Sonne machte schon erste Versuche, indem sie sich träge über der Panthéon-Kuppel reckte. Meine-Tochter-die-nicht-meine-Tochter-war-aber-auch-nicht-weniger-als-das hakte mich unter, um den Ton nicht zu verlieren, und wir waren in Paris, der schönsten Stadt der Welt, wie ich zugeben musste, seit ich sie regelmäßig verließ.
So schlenderten wir durch das Viertel, das ich innig liebte, drehten den Großen Toten den Rücken zu, zwei kleine Sterbliche, über die sich in der friedlichen Menge der Wochenendspaziergänger niemand wunderte. Besänftigt, die Fäuste gesenkt, und im selben Rhythmus, for he’s touched our perfect bodies with his mind.
»Verrückt«, sagte ich kopfschüttelnd, »und der Song kommt immer noch an?«
»Na klar.«
»Ich habe ihn bestimmt vor über dreißig Jahren in genau dieser Straße geträllert. Siehst du den Laden da?«
Mit dem Kinn wies ich auf die Auslagen von Chez Dubois, einem Geschäft für Künstlerbedarf in der Rue Soufflot.
»Wenn du wüsstest, wie viele Stunden ich sehnsüchtig vor diesem Schaufenster verbracht habe. Die Sachen brachten mich zum Träumen. Alle. Das Papier, die Federn, die Rembrandt-Farben. Einmal habe ich sogar gesehen, wie Prouvé hier rauskam. Jean Prouvé, kannst du dir das vorstellen! Tja, an dem Tag bin ich stundenlang durch die Straßen geschlendert und hab Jesus was a saior und so weiter gesummt, wirklich. Prouvé. Wenn ich daran denke ...«
»Wer ist das?«
»Ein Genie. Oder auch nicht. Ein Erfinder. Ein Handwerker. Ein unglaublicher Typ. Ich kann dir Bücher über ihn zeigen. Aber hm – um auf unseren Freund hier zurückzukommen. Mein Lieblingssong war Famous Blue Raincoat, hast du den vielleicht auch?«
»Nein.«
»Ach! Was lernt ihr heute eigentlich noch in der Schule? Ich war verrückt auf dieses Lied! Verrückt! Irgendwann war meine Kassette kaputt, weil ich sie immer wieder zurückspulen musste ...«
»Warum?«
»Tja, ich weiß nicht. Ich müsste den Song noch mal hören, aber ich glaub, es geht um einen Typ, der einem Freund schreibt, einem Kerl, der ihm die Frau weggeschnappt hat, und er will ihm sagen, dass er ihm verziehen hat. Irgendwie kam eine Haarsträhne vor, kann ich mich erinnern, und – tja – ich, ich kriegte ja kein einziges Mädchen rum, ungeschickt, wie ich war, linkisch und finster, es war absolut herzerweichend, ich fand die Geschichte hyper –, hypersexy. Tja, wie für mich geschrieben.«
Ich lachte. »Noch was. Ich hatte meinem Vater in den Ohren gelegen, dass er mir seinen alten Burberry-Mantel gibt, hatte ihn blau gefärbt, was komplett in die Hose ging. Das Ding war gelbgrün geworden. Grässlich! Du kannst es dir nicht vorstellen.«
Sie lachte.
»Glaubst du, das hätte mich gebremst? Nix da. Ich habe mich in das Teil gezwängt, den Kragen aufgestellt, den Gürtel offen, Fäuste in Taschen löcherig wie Siebe, und los ging’s ...«
Ich mimte für sie den altmodischen Typ, der ich damals war. Peter Sellers in seinen besten Tagen. »... mit großen Schritten habe ich mir einen Weg durch die Menge gebahnt, geheimnisvoll, kaum greifbar, und habe mich bemüht, all die Blicke zu ignorieren, die mich gar nicht meinten. Ach! Er hat sich bestimmt köstlich amüsiert, der gute alte Cohen, von der Anhöhe seiner großen Zen-Meister herab, das sag ich dir!«
»Und was ist aus ihm geworden?«
»Tja, er ist noch nicht gestorben, glaube ich ...«
»Nein, aus dem Regenmantel –«
»Ach der! Hat sich verflüchtigt, wie der ganze Rest. Aber frag mal Claire heute Abend, ob sie sich erinnert.«
»Ja, und ich lad dir den Song runter.«
Ich verzog das Gesicht.
»Ist ja gut! Wir werden uns deswegen doch nicht wieder in die Wolle kriegen. Der hat genug Knete verdient, der Typ.«
»Es geht doch nicht ums Geld, das weißt du genau. Die Sache ist viel ernster. Es –« »Stopp. Ich weiß. Das hast du mir schon hundertmal gesagt. Wenn es irgendwann keine Künstler mehr gibt, sind wir alle tot, bla bla bla.«
»Genau. Wir leben dann zwar noch, sind aber alle tot. Das trifft sich ja gut ...«
Wir waren bei Gibert angelangt.
»Gehen wir rein. Ich schenk ihn dir, meinen gelbgrünen Paletot.«
An der Kasse zog ich die Augenbrauen hoch. Drei weitere CDs hatten sich wie durch ein Wunder auf die Theke geschmuggelt.
»He!«, sagte sie unschuldig, »die wollte ich mir auch noch runterladen.«
Ich zahlte, und sie drückte flüchtig ihre Wange an meine. Schnell erledigt.
Wieder im Strom auf dem Boulevard Saint-Michel, nahm ich all meinen Mut zusammen: »Mathilde?«
»Yes.«
»Darf ich dir eine indiskrete Frage stellen?«
»Nein.«
Und ein paar Meter weiter, während sie ihr Gesicht verbarg: »Ich höre.«
»Warum ist es zwischen uns so weit gekommen? So ...« Stille.
»So was?«, fragte ihre Kapuze.
»Ich weiß nicht – berechenbar – käuflich. Ich hole meine Visakarte raus und erhalte zum Dank eine zärtliche Geste. Wobei, zärtlich. Nicht mehr als eine Geste. Was – wie viel ist ein Küsschen von dir inzwischen wert?«
Ich öffnete meine Brieftasche und nahm die Quittung heraus. »Fünfundfünfzig Euro und sechzig Cent. Okay ...«
Stille.
Warf sie in den Rinnstein.
»Es geht ja nicht ums Geld, ich kauf dir gern die CDs, aber – es wäre mir viel lieber gewesen, du hättest mich vorhin begrüßt, als ich nach Hause kam, ich – so –«
»Ich hab dich begrüßt.«
Ich zog sie am Ärmel, damit sie mich ansah, hob dann die Hand und ahmte ihre lässige Geste nach. Lässig-gehässig. Abrupt zog sie den Arm weg.
»Das ist nicht nur bei mir so«, fuhr ich fort, »ich weiß, dass es bei deiner Mutter genauso ist. Wenn ich sie anrufe, wenn ich weit weg bin und so dringend ..., redet sie von nichts anderem. Wie du dich verhältst. Eure Auseinandersetzungen. Immer diese Erpressungen. Ein bisschen Zärtlichkeit gegen ein bisschen Cash. Ständig. Ständig. Und ...«
Ich blieb stehen und hielt sie noch einmal fest. »Antworte mir. Warum ist es zwischen uns so gekommen? Was haben wir nur getan? Was haben wir dir getan, dass du uns so behandelst? Ich weiß, die Leute werden sagen, das ist die Jugend, das schwierige Alter, die undankbare Zeit, diesen ganzen Blödsinn, aber du, Mathilde. Ich dachte, du wärst intelligenter als die anderen. Ich dachte, das würde bei dir nicht ziehen. Du wärst zu schlau, um dich in ihre Statistiken einzureihen.«
»Da hast du dich wohl geirrt.«
»Das sehe ich ...«
»Dessen Zutrauen so schwer zu gewinnen war ...« Warum diese alberne Vergangenheitsform vorhin über meiner Kaffeetasse? Weil sie sich die Mühe gemacht hatte, eine Kapsel in die Maschine zu stecken und auf den kleinen grünen Knopf zu drücken?
»He, ich bin ganz schön begriffsstutzig.«
Auf keinen Fall.
Wie alt war sie? Sieben oder acht, als sie im Finale eines Reitturniers verlor. Ich sehe sie vor mir, wie sie ihre Reitkappe in den Graben warf, den Kopf senkte und ihn mir ohne Vorwarnung in den Bauch rammte. Rums. Wie ein Widder. Ich musste mich an einem Pfosten festhalten, um nicht zu fallen.
Gerührt, angeschlagen, außer Atem, die Hände in den Manteltaschen verfangen, habe ich schließlich meinen Mantel um sie gelegt, während sie mir das Hemd mit Tränen, Rotz und Pferdeäpfeln verschmierte und mir fast die Luft abschnürte.
Kann man diese Geste »jemanden umarmen« nennen? Ja, beschloss ich, ja. Es war das erste Mal.
Das erste Mal, und wenn ich acht Jahre sage, liege ich wahrscheinlich falsch. Ich bin ganz schlecht beim Alter. Vielleicht war es auch später. Mein Gott, es hatte Jahre gedauert.
Aber sie war da, sie war da. Sie passte ganz und gar unter meinen Mantel, und das nutzte ich lange aus, mit eiskalten Füßen, schmerzenden Beinen, die in diesem verdammten normannischen Steinbruch festzuwachsen drohten, um sie vor der Welt zu verstecken und dümmlich zu grinsen.
Später im Auto, als sie sich hinten wie eine Kugel eingerollt hatte:
»Wie hieß dein Pony noch? Pistazie?«
Keine Antwort.
»Kleeblatt?«
Daneben.
»Ja, jetzt fällt’s mir wieder ein! Zuckerschnute!«
»...«
»He? Was konntest du von einem hässlichen dummen Pony erwarten, das auch noch Zuckerschnute heißt. Mal ehrlich? Es war bestimmt das erste und letzte Mal, dass es ins Finale gekommen ist, unser dickes Zuckerschnütchen, das sag ich dir!«
Ich war gemein. Trat großspurig auf und wusste nicht einmal mehr den Namen. Wenn ich daran zurückdenke, glaube ich, es war Mondfee ...
Okay, sie sah mich sowieso nicht an.
Ich stellte den Rückspiegel wieder höher und biss die Zähne zusammen.
Wir waren in aller Frühe aufgestanden. Ich war erschöpft, mir war kalt, ich hinkte meinem Zeitplan hinterher und musste am Abend noch mal ins Büro, um eine weitere Nacht durchzuakkern. Und außerdem hatte ich mich immer vor Pferden gefürchtet. Auch vor den kleinen. Vor allem vor den kleinen. Au au au, das alles wog schwer in einem Stau. Sehr schwer. Und während meine Gedanken um all diese Probleme kreisten, ich genervt, angespannt, kurz vorm Explodieren, plötzlich diese Worte:
»Manchmal wünsche ich mir, du wärst mein Vater ...«
Ich hatte nicht geantwortet, aus Angst, alles kaputtzumachen. Ich bin nicht dein Vater oder ich bin wie dein Vater oder ich bin ein besserer Vater als dein echter oder, nein, ich meine, ich bin – pff. Mein Schweigen, so schien es mir, konnte dies alles sehr viel besser ausdrücken.
Aber heute. Heute, wo das Leben so – ja, wie nun? So mühselig geworden ist, so leicht entflammbar auf unseren hundertzehn Quadratmetern. Heute, wo wir fast nicht mehr miteinander schlafen, Laurence und ich, heute, wo ich jeden Tag eine Illusion verliere und pro Tag ein Lebensjahr auf der Baustelle, wo ich mich mit Snoopy unterhalte und meinen Kreditkartencode eintippen muss, um geliebt zu werden, heute hasse ich all die Warnblinklichter...
Ich hätte sie natürlich einschalten sollen.
Ich hätte den Wagen sofort auf den Standstreifen ziehen sollen, für einen Nothalt, wie es so schön heißt, in die Nacht hinausgehen, ihre Tür aufmachen, sie an den Füßen herausziehen und meinerseits erdrücken.
Was hätte mich das gekostet? Nichts.
Nichts, ich hätte nichts weiter sagen müssen. Na ja. So stelle ich sie mir jedenfalls vor, die verpasste Szene: wirkungsvoll und stumm. Weil die Worte, verflixt noch mal, die Worte ... Damit konnte ich noch nie besonders gut umgehen. Hatte einfach nicht das Rüstzeug dazu.
Noch nie.
Und jetzt, wo ich mich zu ihr umdrehe, hier, vor dem Gitterzaun der Medizinischen Hochschule, und ihr hartes, böses, fast hässliches Gesicht sehe, wegen einer winzigen Frage von mir, der ich sonst niemals welche stelle, überlege ich, dass ich besser auch diesmal die Klappe gehalten hätte.
Sie ging vor mir her, mit großen Schritten, den Kopf gesenkt. »Untirglaubstuirwädbessa?«, hörte ich sie stammeln.
»Pardon?«
Kehrtwende. »Und ihr? Glaubst du, ihr wärt besser?« Sie war stinkwütend.
»Glaubst du, ihr wärt besser? He? Glaubst du, ihr wärt besser? Ihr wärt nicht berechenbar? Ihr?«
»Wer ihr?«
»Wer ihr, wer ihr ... Ihr halt! Ihr! Mama und du! Ich frage mich, in welcher Statistik ihr angekommen seid. In der über total kaputte Ehen, die ...«
Stille.
»Die was?«, wagte ich mich leichtsinnig vor.
»Das weißt du genau.«
Ja, ich wusste es genau. Und das ist der Grund, warum wir am Ende schwiegen.
In dem Moment beneidete ich sie um ihre Ohrstöpsel, während ich nur meinen eigenen Lärm hatte, der mich erfüllte.
Die Rückkopplung und mein von Motten zerfressener Raincoat.
In der Rue de Sèvres, vor dem Kaufhaus mit dem irreführenden Namen, das mich schon jetzt mittellos machte, bog ich kurzerhand in eine Kneipe.
»Ist es dir recht? Ich brauche noch einen Kaffee vor der Schlacht ...«
Sie verzog das Gesicht und folgte mir.
Ich verbrannte mir die Lippen, während sie weiter an ihrem Teil herumfummelte. »Charles?«
»Ja.«
»Kannst du mir sagen, was der hier singt? Ich verstehe zwar einiges, aber nicht alles.«
»Kein Problem.«
Und wir teilten uns wieder den Sound. Sie Dolby, ich Stereo. Jeder mit einem Ohr.
Aber die ersten Klavierakkorde wurden gleich vom Kaffeeautomaten übertönt.
»Moment.«
Sie zerrte mich ans andere Ende der Theke.
»Jetzt?«
Ich nickte.
Wieder eine Männerstimme. Heißer.
Und ich begann mit meiner Simultanübersetzung:
»Wärst du die Straße, ich würde gehen ... Moment. Es kann der Weg oder die Straße sein, je nach Zusammenhang. Willst du es poetisch oder wörtlich?«
»Mensch«, stöhnte sie und stellte den Ton ab, »du machst alles kaputt. Ich will keine Englischstunde, ich will nur wissen, was der Typ singt!«
»Okay«, sagte ich ungeduldig, »lass mich den Song erst mal allein hören, dann sag ich’s dir.«
Ich nahm ihr die Dinger weg und hielt mir mit beiden Händen die Ohren zu, während sie mich von der Seite hektisch beobachtete.
Ich war groggy. Mehr, als ich gedacht hätte. Mehr, als mir lieb war. Ich – ich war groggy.
Verdammte Liebeslieder. Hinterhältig. Brechen uns in nicht mal vier Minuten das Rückgrat. Verdammte Banderilleros in unseren der Statistik gehorchenden Herzen.
Ich gab ihr seufzend ihren Ohrstöpsel zurück. »Der ist gut, was?«
»Wer ist es?«
»Neil Hannon. Ein irischer Sänger. Okay, los geht’s?«
»Los geht’s.«
»Und du hörst nicht zwischendrin auf, ja?«
»Don’t worry sweetie, it’s gonna be all right«, kaute ich wie ein Cowboy.
Sie lächelte endlich. Gut gespielt, Charly, gut gespielt.
Und ich kehrte auf den Weg zurück, den ich verlassen hatte, es ging hier nämlich sehr wohl um einen Weg, kein Zweifel.
»Wärst du der Weg, ich würd ihn bis zum Ende gehen. Wärst du die Nacht, ich würd am Tage schlafen. Wärst du der Tag, ich würde in der Nacht weinen.« Sie hing an meinen Lippen, um nur ja kein Wort zu verpassen. »Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Licht.
Wärst du ein Baum, ich könnte meine Arme um dich schlingen – und du – könntest dich nicht beklagen. Wärst du ein Baum, ich könnte meinen Namen in deinen Stamm ritzen, und du könntest nicht jammern, denn Bäume jammern nicht« (hier habe ich mir ein paar Freiheiten genommen, »’Cos trees don’t cry«, okay, Neil, nichts für ungut, was? Ein nervöser Teenager hört mit). »Wärst du ein Mann, ich – ich würd dich trotzdem lieben. Wärst du ein Drink, ich würd dich ganz austrinken. Würdest du angegriffen, ich würd für dich töten. Wär dein Name Jack, ich würd meinen in Jill ändern,für dich. Wärst du ein Pferd, ich würd deinen Stall ausmisten, ohne mich je zu beschweren. Wärst du ein Pferd, ich könnt auf dir über die Felder reiten – im Morgengrauen und – den ganzen Tag lang, bis der Tag vorbei ist« (Mmh – keine Zeit für den letzten Schliff). »Ich könnte dich in meinen Liedern besingen« (auch nicht gerade genial). (Ihr war es völlig gleich, ich roch ihre Haare an meiner Wange.) (Auch ihr Parfum. Das Antipickelwässerchen eines Teenagers, das sich vordrängelte.) »Wärst du mein Töchterchen, es würde mir schwerfallen, dich gehen zu lassen. Wärst du meine Schwester, ich würde«, hmm – »find it doubly« – okay, das müssen wir raten, »mich doppelt spüren. Wärst du mein Hund, ich würde dir die Reste direkt vom Tisch geben« (sorry), »auch wenn meine Frau meckert. Wärst du mein Hund« (und jetzt ging es ins Crescendo), »ich bin sicher, das wär dir lieber, und so wärst du mein redlicher vierbeiniger Freund und du« (er brüllte fast) »müsstest nie mehr denken und ...« (jetzt brüllte er wirklich, aber ganz traurig) »und wir wären zusammen bis zum Ende.« (Bis zum Eeeeee-eeennnnnde eigentlich, aber man spürte, dass er noch nicht gewonnen hatte, noch gar nicht ...)
Ich gab ihr das Ding wortlos zurück und bestellte noch einen Kaffee, auf den ich überhaupt keine Lust hatte, um ihr Zeit für den Abspann zu lassen. Damit sie sich wieder an das Licht gewöhnen und sich ein wenig schütteln konnte.
»Ich liebe diesen Song«, seufzte sie.
»Warum?«
»Weiß nicht. Weil – weil die Bäume nicht jammern.«
»Bist du verliebt?«, wagte ich einen Vorstoß, sprach die Worte wie auf Eiern.
Schmollmund.
»Nein«, ließ sie sich herab, »nein. Wenn man verliebt ist, braucht man so was nicht zu hören.«
Nach ein paar Minuten, in denen ich gewissenhaft den Kaffeesatz aus meiner Tasse löffelte: »Um noch mal auf die Sache da zurückzukommen ...«
Sie hob den Blick und sah hinüber zu der Frage von vorhin. Ich rührte mich nicht.
»Die schwierige Zeit und so. Na ja, äh – ich glaube, wir sollten es dabei belassen. Den anderen nicht zu sehr vereinnahmen, verstehst du?«
»Hm, nicht ganz.«
»Na ja. Du kannst dich darauf verlassen, dass ich dir helfe, ein Geschenk für Mama zu finden, und ich kann mich darauf verlassen, dass du mir die Lieder übersetzt, die ich gern höre – und das war’s.«
»Ist das alles?«, protestierte ich vorsichtig, »ist das alles, was du mir zu bieten hast?«
Sie hatte die Kapuze wieder aufgesetzt. »Ja. Im Moment schon. Aber das ist schon ziemlich viel. Das ist – ja – das ist ganz schön viel.«
Ich starrte sie an.
»Warum grinst du so blöd?«
»Weil«, antwortete ich und hielt ihr die Tür auf, »weil, wärst du mein Hund, könnt ich dir die Essensreste zustecken, und du wärst immer noch mein redlicher friend.«
»Ha! Sehr witzig.«
Und während wir auf dem Bordstein standen und auf eine Lücke zwischen den vielen Autos warteten, hob sie das Bein und tat, als würde sie mir an die Hose pinkeln.
Sie war ehrlich zu mir gewesen, und auf der Rolltreppe beschloss ich, mich dafür zu revanchieren: »Weißt du, Mathilde –«
»Was?« (im Ton von: Was denn jetzt schon wieder?)
»Wir sind alle käuflich.«
»Ich weiß«, gab sie wie aus der Pistole geschossen zurück.
Die Entschiedenheit, mit der sie mir eine Abreibung verpasste, stimmte mich nachdenklich. Ich hatte den Eindruck, dass wir zu Zeiten von Suzanne großzügiger waren.
Oder vielleicht weniger gerissen?
Sie ging eine Stufe weiter. »He, es reicht jetzt mit dem super-schwermütigen Gelaber, okay?«
»Okay.«
»Und was holen wir jetzt für Mama?«
»Was du willst«, antwortete ich.
Ein Schatten flog vorbei.
»Ich habe mein Geschenk schon«, sagte sie bockig, »es geht hier um deins.«
»Klar doch, klar doch«, ich bemühte mich krampfhaft, den Satz ins Lächerliche zu ziehen, »aber gib mir etwas Zeit für die Suche ...«
War es so, heute vierzehn zu sein? Ein helles Köpfchen zu haben und klar zu erkennen, dass auf dieser Welt alles verhandelbar war, zugleich aber naiv und zärtlich genug zu sein, um zwei Erwachsenen die Hand zu geben und zwischen ihnen zu bleiben, genau zwischen ihnen, nicht mehr hopsend, sie aber nicht loszulassen, um sie trotz allem zusammenzuhalten.
Das war schon viel, oder?
Auch mit schönen Liedern dürfte das schwer wiegen.
Wie bin ich in ihrem Alter gewesen? Vollkommen unreif, denke ich mal.
Ich stolperte, als ich die obere Etage erreichte. Pah, ist nicht so wichtig. Nicht von Bedeutung. Überhaupt nicht.
Ich erinnere mich sowieso an nichts mehr.
Komm, Mäuschen, mir reicht’s jetzt schon, stellte ich fest, als ich mich am Geländer festhielt. Wir suchen, finden, lassen einpacken und hauen wieder ab.
Eine Handtasche. Noch eine, die fünfzehnte, vermute ich. »Wenn der Artikel nicht gefällt, kann die Frau Gemahlin ihn jederzeit umtauschen«, säuselte die Verkäuferin.
Ich weiß, ich weiß. Danke. Die Frau Gemahlin tauscht fast alles um. Und das ist auch der Grund, warum ich mir nicht mehr so viel Mühe gebe, verstehen Sie?
Ich schwieg jedoch und bezahlte stattdessen. Bezahlte.
Kaum waren wir aus dem Kaufhaus raus, löste sich Mathilde in Luft auf, und ich blieb wie bescheuert vor einem Zeitungskiosk stehen und las die fetten Schlagzeilen, ohne sie wahrzunehmen.
Hatte ich Hunger? Nein. Hatte ich Lust auf einen Spaziergang? Nein. Sollte ich mich nicht lieber ins Bett legen? Doch. Auf keinen Fall. Ich würde nie mehr aufstehen.
Sollte ich... Ein Typ rempelte mich an,um eine Zeitschrift aus dem Ständer zu fischen, und ich war es, der sich entschuldigte.
Allein und ohne Phantasie, angeschlagen mitten im Ameisenhaufen, hob ich den Arm, winkte einem Taxifahrer und nannte ihm meine Büroadresse.
Ich ging zur Arbeit, weil es das Einzige war, was ich noch konnte. Mir den Mist ansehen, den sie hier fabriziert hatten, während ich weg war, um den Mist zu kontrollieren, den sie dort fabriziert hatten. So in etwa sah mein Job seit ein paar Jahren aus. Große Risse, ein lächerliches Messer und viel Putz.
Der vielversprechende Architekt war, als er befördert wurde, zu einem kleinen Maurer geworden. Er stopfte auf Englisch Löcher, machte keine Entwürfe mehr, sammelte massenhaft miles und ließ sich von den leisen Kriegsgeräuschen auf CNN in Hotelbetten, die viel zu groß für ihn waren, in den Schlaf wiegen.
Der Himmel hatte sich zugezogen, ich drückte meine Stirn an die kühle Scheibe und verglich die Farbe der Seine mit der der Moskwa, auf meinen Knien ein sinnloses Geschenk.
War Gott da?
Schwer zu sagen.
2
Sie sind gekommen, alle sind da.
Wir werden sie in der Reihenfolge ihres Erscheinens vorstellen, das ist am einfachsten.
Der uns die Tür öffnet und zu Mathilde sagt: Mensch, bist du groß geworden, eine richtige Dame, das ist der Mann meiner älteren Schwester. Ich habe noch einen Schwager, aber den hier mag ich am liebsten. He, sag mal, hast du schon wieder ein paar Haare verloren, fügt er hinzu, während er mir die Haare zerzaust, hast du wenigstens diesmal an den Wodka gedacht? Was treibst du eigentlich bei den Ruskis? Tanzt du Kasatschok oder was?
Was habe ich gesagt? Der ist doch klasse, oder? Er ist perfekt. Okay, wir schieben ihn mal ein Stück beiseite, denn der sehr aufrechte Herr hinter ihm, der uns die Mäntel abnimmt, ist mein Papa, Henri Balanda. Er redet nicht so viel. Er hat es aufgegeben. Heute sagt er nur, dass ich Post bekommen habe, und zeigt auf die Konsole zu meiner Linken. Ich umarme ihn flüchtig. Die Post, die mich bei meinen Eltern erwartet, ist nur das Klappern ehemaliger Leidensgenossen. Klassentreffen, Werbung für abgelaufene Zeitungsabonnements, die ich seit zwanzig Jahren nicht mehr erneuert habe, Einladungen zu Versammlungen, zu denen ich nie gehe.
Alles klar, antworte ich und suche insgeheim schon den Papierkorb, der keiner ist, wie mir meine Mutter später zum wiederholten Mal predigen wird, die Augenbrauen hochziehend, es ist nämlich ein Schirmständer, wenn ich dich daran erinnern darf. Ein über die Jahre einstudiertes Szenario, läuft wie geschmiert.
Meine Mutter, von der man im Moment nur den Rücken sieht. Sie steht in ihrer Küche am Ende des Flurs, in eine Schürze gewickelt, und spickt den Braten.
Jetzt dreht sie sich um und begrüßt Mathilde, sagt, was bist du groß geworden, du bist ja eine richtige junge Frau jetzt! Ich warte, bis ich an der Reihe bin, und begrüße schon mal meine andere Schwester, nicht die Frau von Fridolin Kiesewetter, sondern von dem großen hageren Kerl, der dort drüben sitzt. Ein völlig anderer Typ. Leiter eines Champion-Marktes in der Provinz, der die Sorgen und die Wirtschaftspolitik eines Bernard Arnault aber bestens nachvollziehen kann. Ja, des Bernard Arnault von der Gruppe Louis Vuitton Moët Hennessy. Eine Art Kollege, wenn man so will. Wir machen so in etwa den gleichen Job, verstehen Sie, und ... Ich hör ja schon auf. Wir werden das nachher noch ausgiebig genießen können.
Sie selbst heißt Edith, und von ihr werden wir auch noch hören. Sie wird über das Gewicht von Schulranzen und über Elternabende sprechen, also wirklich, wird sie sagen und dabei ein zweites Stück Kuchen ablehnen, es ist unglaublich, wie wenig sich die Leute heutzutage engagieren. Zum Beispiel beim Schulfest, was meint ihr, wer mich mal am Angelstand abgelöst hat? Kein Mensch! Und wenn sich schon die Eltern drücken, was kann man dann von den Kindern erwarten, frage ich euch? Okay, man sollte ihr keine Vorwürfe machen, ihr Mann ist Leiter eines kleinen Champion-Marktes, dabei hätte er das Zeug zu einem Riesensupermarkt, das hat er bewiesen, und in der Sägemehllache am Gymnasium Saint-Joseph hört die Welt für sie auf, wir wollen ihr also keine Vorwürfe machen, nein, nein. Sie ist nur ein bisschen anstrengend und sollte ab und zu mal eine neue Platte auflegen. Und sich eine neue Frisur zulegen, wo wir schon dabei sind ... Folgen wir ihr ins Wohnzimmer, wo uns die andere Seite erwartet: meine Schwester Françoise. Die Nummer eins. Frau Kasatschok für diejenigen, die nicht mitgekommen sind oder noch in der Küche rumhängen. Sie wechselt dafür ganz häufig die Frisur, ist aber noch leichter zu durchschauen als ihre jüngere Schwester. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen, es reicht, wenn man ihren ersten Satz wiedergibt: »Mensch, Charles, du siehst ja schrecklich aus. Und außerdem hast du – hast du zugenommen, stimmt’s?« Okay, den zweiten auch noch, sonst könnte man mir vorwerfen, parteiisch zu sein: »Doch, doch! Du bist richtig auseinandergegangen seit dem letzten Mal, wenn ich’s dir sage! Außerdem bist du immer unmöglich angezogen ...«
Nein, Sie brauchen mich nicht zu bedauern, in drei Stunden sind alle wieder aus meinem Leben verschwunden. Mit etwas Glück bis Weihnachten. Sie können heute nicht mehr einfach in mein Zimmer platzen, ohne anzuklopfen, und wenn sie mich verpetzen, bin ich längst über alle Berge.
Außerdem habe ich mir das Beste für den Schluss aufgehoben. Diejenige, die man nicht sieht, aber oben mit den Teenies der Familie lachen hört. Spüren wir ihm nach, dem bezaubernden Lachen, und pfeifen auf die Cashewnüsse …
*
»Nee, ich glaub’s nicht!«, schleudert sie mir entgegen und massiert dabei die Kopfhaut eines meiner Neffen, »weißt du, worüber sie sich unterhalten, diese Rabauken?«
Flüchtige Umarmung.
»Sieh sie dir an, Charles. Siehst du, wie jung und hübsch sie sind, wie ... Siehst du diese schönen Zähne hier!« (Zieht die Oberlippe des armen Hugo hoch.) »Schau dir diese hübschen Burschen an! Diese Milliarden Kilo an Hormonen, die in alle Richtungen überlaufen! Und – und weißt du, worüber sie sich unterhalten?«
»Nein«, sage ich und entspanne mich endlich.
»Über Gigabytes, ich glaub, ich spinne. Sie traktieren ihre Musikdinger und vergleichen die Zahl ihrer Gigabytes. Nicht zu fassen, was? Wenn ich mir vorstelle, dass so was später unsere Renten zahlen soll, dann gute Nacht. Und anschließend vergleicht ihr die Flatrates eurer Handys, oder was?«
»Längst passiert«, kichert Mathilde.
»He, im Ernst, ihr tut mir leid, Herzchen. In eurem Alter muss man doch vor Liebe sterben! Gedichte schreiben! Die Revolution vorbereiten! Die Reichen beklauen! Die Rucksäcke rausholen. Auswandern! Die Welt verändern! Eure Gigabytes, ich weiß nicht. Eure Gigabytes – pff. Warum nicht gleich noch eure Bausparverträge, wo wir schon dabei sind?«
»Und du?«, fragt Marion treuherzig, »worüber hast du dich mit Charles unterhalten, als du in unserem Alter warst?« Meine kleine Schwester dreht sich zu mir um.
»Tja, wir – wir waren um diese Uhrzeit schon im Bett«, brummle ich, »oder machten unsere Hausaufgaben, stimmt’s?«
»Genau. Oder du hast mir bei meinem Aufsatz über Voltaire geholfen.«
»Kann gut sein. Oder wir haben für die nächste Woche vorgelernt. Und weißt du noch, wir haben uns einen Spaß draus gemacht, geometrische Formeln auswendig aufzusagen –«
»Na klar!«, ruft die heißgeliebte Tante, »oder Gleichu–«
Das Kopfkissen, das sie ins Gesicht bekommt, hindert sie daran, den Satz zu beenden.
Sie antwortet mit lautem Gebrüll. Ein weiteres Kissen fliegt durchs Zimmer, dann ein Converse-Schuh, weiteres Kriegsgeheul, eine zur Kugel geknüllte Socke, ein ...
Claire zieht mich am Ärmel. »Los, komm mit. Jetzt, wo wir die Kleinen hier etwas in Schwung gebracht haben, werden wir unten mal den Laden aufmischen.«
»Das wird schwerer.«
»Ach was. Ich brauche mich bloß an unseren Unterbelichteten zu hängen und die Produkte der Konkurrenz anzupreisen, schon ist die Sache geritzt.«
Sie dreht sich auf der Treppe um und fügt mit ernster Miene hinzu: »Weil du bei Casino die Tüte immer noch gratis dazubekommst! Bei Champion hingegen kannst du das knicken ...«
Sie prustet los.
So ist sie. So ist Claire. Und das tröstet uns über die beiden anderen hinweg, stimmt’s? Mich jedenfalls hat es immer getröstet.
»Was habt ihr nur da oben angestellt«, fragt meine Mutter beunruhigt und knüllt ihre Schürze zusammen, »bei dem Geschrei?«
Meine Schwester rechtfertigt sich und zieht unschuldig die Schultern hoch: »He, ich kann nix dafür, Schuld ist Pythagoras.«
In der Zwischenzeit war Laurence eingetroffen. Hockte am Rand des Canapés und musste bereits die umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen der Gewürzabteilung über sich ergehen lassen.
Gut, okay, es ist ihr Abend, ihr Geburtstag, und sie hat den ganzen Tag gearbeitet, trotzdem ... Wir haben uns fast eine Woche lang nicht gesehen. Hätte sie mich nicht suchen können? Aufstehen? Mir zulächeln? Oder mich wenigstens wahrnehmen?
Ich schlich mich von hinten an sie ran.
»Nein, nein, die Idee ist gut, Ketchup zu den Tomatensoßen zu stellen, du hast vollkommen recht.«
Dazu hat meine Hand auf ihrer Schulter sie inspiriert.
Enjoy.
Während wir uns ins Esszimmer schoben, registrierte sie mich, wie man im Stockwerk über uns sagen würde.
»Gute Reise gehabt?«
»Hervorragend. Danke.«
»Und hast du mir zum Zwanzigsten ein Geschenk mitgebracht?«, sagte sie kokett und klammerte sich an meinen Arm, »ein Juwel von Fabergé vielleicht?«
Es liegt wirklich in der Familie.
»Russische Puppen«, brummte ich, »du weißt schon, eine hübsche Frau, und je mehr du dich für sie interessierst, umso kleiner wird sie.«
»Willst du mir damit was sagen?«, scherzte sie und ließ mich stehen.
Nein. Mir.
Scherzte sie.
Scherzte sie und ließ mich stehen.
Aufgrund solcher Einwürfe hatte ich mich in sie verliebt, vor Jahren, als ihr Fuß an meinem Bein hochkletterte, während ihr Mann mir erklärte, was er sich von meinen Diensten erhoffte, wobei er mit der Bauchbinde seiner Zigarre spielte, dieses unschuldige Stück Papier zu einer Auf-und-ab-Bewegung brachte, die ich für – äußerst leichtsinnig hielt.
Ja, denn eine andere wäre berechenbarer gewesen, aggressiver. Willst du mir damit was sagen?, hätte sie gespottet oder geschrien, sich amüsiert oder mich angegriffen, die Worte gekaut oder Blicke abgefeuert, egal was gemacht, was weniger grausam war, sie nicht. Nein, sie nicht. Nicht die schöne Laurence Vernes.
Es war Winter, und ich hatte mich mit ihnen in einem Nobelrestaurant im 8. Arrondissement getroffen. »Auf einen Kaffee«, hatte er klargemacht. Na gut, auf einen Kaffee. Ich war Dienstleister, kein Kunde.
Bestenfalls eine Praline.
Schließlich tauchte ich auf.
Atemlos, salopp gekleidet, dick eingepackt. Den Helm in der Hand, die Rollen unterm Arm. Gefolgt von einem ebenso entsetzten wie dienstbeflissenen Kellner, der aufgeregt meine Spur aufgenommen hatte und erst Ruhe gab, als ich mich meiner Klamotten entledigt hatte. Er hatte mir meine fürchterliche Jacke aus den Händen gerissen und war davongeeilt, nicht ohne dabei den hellen Teppichboden zu inspizieren. Auf der Suche nach Spuren von Schmieröl, Lehm oder anderen denkbaren Exkrementen, stellte ich mir vor.
Die Szene hatte nur wenige Sekunden gedauert, mich aber begeistert.
Da stand ich also, verschmitzt, spöttisch, wickelte mich aus meinem langen Schal und schlotterte ein letztes Mal, als mein Blick zufällig ihren kreuzte.
Sie glaubte oder wusste oder wollte, dass dieses Lächeln ihr galt, wobei es der Absurdität einer Situation, der Dummheit einer Welt, ihrer Welt, gewidmet war, die mich wider Willen ernährte. (Ich hatte damals das Gefühl, einem Typ, der sein Glück mit Lederwaren gemacht hatte und nun seine neue Maisonettewohnung renovieren wollte, »ohne an den Marmor zu rühren«, einen Kostenvoranschlag zu präsentieren, das sei von meiner Seite ein Verstoß gegen den guten Geschmack. Aber die Lohnnebenkosten, mein Gott, die Lohnnebenkosten! Le Corbusier wurde hier geopfert. (Seither habe ich meine Meinung geändert. Ich habe bei Geschäftsessen den Gürtel Loch für Loch enger schnallen müssen und mehrere Beschwerden bei der Einzugsstelle für Sozialversicherungsbeiträge eingelegt. Ich kann sie mir sonstwohin stecken, meine schlauen Einsichten, sonstwohin. Zusammen mit dem Marmor.) Wider Willen, sagte ich, und nahm, ohne dazu aufgefordert worden zu sein, an einem fleckigen Tischtuch Platz, während ein Hilfskellner die letzten Krümel vom Tisch entfernte.
Meine Boshaftigkeit gegen ein Lächeln. Eine Verwechslung also.
Die erste.
Aber hübsch ...
Hübsch und schon ein bisschen abgeklärt, denn ihre Selbstsicherheit, ihr Augenzwinkern, ihre schmeichelhafte Verwegenheit, verdankten wir leider, wie ich ziemlich schnell durchschaute, eher den Tugenden eines Monsieur Taittinger als meinem kaum vorhandenen Charme. Aber egal. Es war sehr wohl ihr großer Zeh, den ich in meiner Kniekehle spürte, während ich versuchte, mich auf seine Wünsche zu konzentrieren.
Er verlangte von mir genauere Angaben zu ihrem Schlafzimmer. »Etwas Geräumiges und zugleich Intimes«, wiederholte er mehrmals und beugte sich über meine Zeichnungen.
»Nicht wahr, Liebes? Wir sind uns einig?«
»Pardon?«
»Das Schlafzimmer!«, stieß er in einer exzessiven Rauchwolke aus. »Jetzt hör mal ein bisschen zu.«
Sie waren sich einig. Nur ihr hübscher Fuß hatte sich verirrt.
Ich habe mich in Kenntnis der Sachlage verliebt und sehe nicht, worüber ich mich heute beklagen könnte, wenn sie mich scherzend stehenlässt.
Sie beaufsichtigte die Bauarbeiten. Unsere Treffen mehrten sich, und je weiter die Arbeiten voranschritten, umso unklarer wurden meine Perspektiven, umso weniger energisch ihre Fäuste, umso weniger wichtig die tragenden Wände, umso lästiger die Bauarbeiter.
Und so waren wir die Ersten, die es einweihten, dieses herrliche Schlafzimmer. Auf einer Malerplane, geräumig und intim, inmitten von Zigarettenstummeln und Gläsern mit Terpentinersatz.
Doch nachdem sie sich schweigend wieder angezogen, ein paar Schritte gemacht, eine Tür geöffnet und sogleich wieder geschlossen hatte, kam sie auf mich zu, strich ihren Rock glatt und verkündete schlicht und einfach: »Hier werde ich nicht wohnen.«
Sie sprach diesmal ohne Arroganz, ohne Bitterkeit und ohne Aggressivität. Hier würde sie nicht wohnen ...
Wir löschten die Lichter und gingen im Halbdunkel die Treppen hinunter.
»Ich habe ein Töchterchen«, vertraute sie mir zwischen zwei Stockwerken an, und während ich bei der Concierge an die Scheibe klopfte, um ihr die Schlüssel zurückzugeben, fügte sie ganz leise, nur für sich, hinzu: »Ein Töchterchen, das etwas Besseres verdient hat, glaube ich.«
Ah! Die Sitzordnung! Das ist in der Regel der beste Moment des Abends.
»Also, Laurence – zu meiner Rechten«, erklärt mein alter Herr, dann Sie, Guy (die Arme, jetzt gibt’s kein Halten mehr: Frischwarenabteilung,Taschendiebstahl, Personalquerelen...), »du, Mado, dann Claire, dann –«
»Nein, nein!«, ereiferte sich meine Mutter und riss ihm den Zettel aus der Hand. »Wir hatten gesagt, Charles hier, Françoise dort. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Uns fehlt ein Mann.«
Was wären wir ohne Sitzordnung?
Claire sah mich an. Sie wusste, dass ein Mann fehlte. Ich lächelte ihr zu, und sie zuckte trotzig mit den Schultern, um mein Mitgefühl zu vertreiben, das ihr nicht gefiel.
Unsere Blicke waren trotzdem mehr wert als er ...
Ohne abzuwarten, schnappte sie sich den Stuhl, der vor ihr stand, faltete die Serviette auseinander und rief unseren Lieblingslebensmittelhändler zu sich: »Los, komm her, Guitou! Setz dich zu mir und erklär mir noch mal, was ich für meine drei Treuepunkte bekomme.«
Meine Mutter seufzte und streckte die Waffen: »Ach, setzt euch doch, wie ihr wollt ...«
Was für eine Begabung, dachte ich.
Was für eine Begabung ...
Doch die Intelligenz dieser fantastischen Frau, die fähig war, innerhalb von zwei Sekunden eine Tischordnung zu sabotieren, ein Familientreffen erträglich zu gestalten, ein paar blasierte Kinder auf Trab zu bringen, ohne sie zu demütigen, die Zuneigung einer Frau wie Laurence zu gewinnen (überflüssig hinzuzufügen, dass es mit den beiden anderen nie gefunkt hatte, was mich übrigens immer gefreut hat) und von ihren Kollegen respektiert zu werden, man nannte sie in exklusiven Kanzleien hinter vorgehaltener Hand Marschallin Vauban (»Gnade dem Gegner, wenn sie ihr Augenmerk auf ein Stadtviertel geworfen hat«, stand in einer seriösen Zeitschrift über Stadtplanung), das alles, ihre Raffinesse, ihr gesunder Menschenverstand, hörte jedoch in der unmittelbaren Umgebung ihres Herzens abrupt auf.
Der Mann, der uns heute Abend und schon seit Jahren fehlte, existierte sehr wohl. Er musste allerdings bei seiner Familie Präsenz zeigen. Bei seiner Frau (»bei Mama«, wie sie mit einem etwas zu säuerlichen Lächeln sagte, als dass es ehrlich hätte sein können, und mit Blick auf ihren Serviettenring.)
Heroisch.
Und hielt sich in ihren Hausschuhen kerzengerade.
Dabei hätte er uns beinahe entzweit, der fette Arsch ... »Nein, Charles, das kannst du nicht sagen. Fett ist er nicht.« Das war die Art Antwort, mit der sie damals parierte, wenn ich wieder mal einen auf Don Quijote machte und versuchte, gegen verbale Windmühlen zu kämpfen. Inzwischen habe ich es aufgegeben, ich habe es aufgegeben. Ein Mann, auch ein schlanker, der es fertigbringt, zu einer Frau wie ihr allen Ernstes und ohne zu grinsen zu sagen: »Hab Geduld, ich gehe, wenn meine Töchter groß sind«, ist nicht das Heu wert für die gute alte Rosinante.
Soll er krepieren.
»Warum bleibst du nur bei ihm?«, habe ich sie in allen Tonarten bearbeitet.
»Ich weiß es nicht. Weil er mich nicht will, nehme ich an ...« Und das ist alles, was ihr als Plädoyer einfällt. Ja, ihr – unserer hübschen Boje, und dem Schrecken des Justizpalastes ... Zum Verzweifeln.
Aber ich habe es aufgegeben. Aus Erschöpfung und Ehrlichkeit, ich, der ich unfähig bin, vor meiner eigenen Tür zu kehren.
Mein Arm ist zu kurz, als dass ich einen guten Staatsanwalt abgeben würde.
Und außerdem lauern darunter Kapitulationen, Grauzonen und viel zu rutschiges Gelände, auch für die verwandte Seele eines Bruders wie mir. Darum sprechen wir nicht mehr darüber. Und sie macht ihr Handy aus. Und zieht die Schultern hoch. Und c’est la vie. Und sie lacht. Und sie zieht sich den Champion rein, um auf andere Gedanken zu kommen.
Die Fortsetzung lässt sich nicht erzählen. Sie ist uns nur allzu vertraut.
Das Festmahl. Das samstägliche Abendessen bei wohlerzogenen Leuten, von denen jeder tapfer seine Partitur spielt. Die Hochzeitsagentur, die grässlichen Messerbänkchen in Dackelform, das umgekippte Rotweinglas, das Kilo Salz, das auf die Tischdecke geschüttet wird, die Debatten über die Fernsehdebatten, die 35-Stunden-Woche, Frankreich, das den Bach runtergeht, die Steuern, die man zahlt, und die Radarkontrolle, die man nicht bemerkt hat, der Böse, der behauptet, die Araber bekämen zu viele Kinder, und die Nette, die erwidert, dass man nicht verallgemeinern dürfe, die Dame des Hauses, die behauptet, das Fleisch sei zu lange im Ofen gewesen, und die nur will, dass man ihr widerspricht, und der Patriarch, der sich fragt, ob der Wein richtig temperiert ist.
Okay, das erspare ich Ihnen. Das kennen Sie in- und auswendig, diesen herzlichen und immer etwas deprimierenden Mikrokosmos, den man Familie nennt und der einen von Zeit zu Zeit daran erinnert, wie kurz er eigentlich ist, der zurückgelegte Weg...
Das Einzige, was es zu retten gilt, ist das Lachen der Kinder im Obergeschoss, und am lautesten lacht ausgerechnet Mathilde. Ihr glucksendes Lachen führt uns zurück zur Hausmeisterwohnung am Boulevard Beauséjour, zu den Geständnissen der wunderbaren Frau meines Bauherrn, die mein Herz und meine Sinne soeben in eine versiffte Malerplane gewickelt hatte.
Ich werde nie erfahren, was dem kleinen Mädchen erspart geblieben ist oder was es eigentlich verdient hätte, aber ich weiß, wie sehr es mir die Arbeit erleichtert hat. Nach dieser letzten »Baustellenbegehung« habe ich nichts mehr von ihr gehört. Sie kam nicht mehr vorbei, war unerreichbar, schlimmer noch, es schien sie nicht mehr zu geben, und ich schickte meine letzten Vorschläge ins Leere.
Aber sie ließ mir keine Ruhe. Sie ließ mir keine Ruhe. Und da sie zu hübsch für mich war, verfiel ich auf eine List.
Auch mein trojanisches Pferd war aus Holz. Und ich arbeitete wochenlang daran.
Es war meine Abschlussarbeit, die ich nie zu Ende gebracht hatte. Mein Gesellenstück, mein Klebstoff-Traum, mein Kieselstein, den ich in den Brunnen warf.
Je geringer meine Hoffnung auf ein Wiedersehen wurde, desto mehr feilte ich an meiner Arbeit. Machte den besten Handwerkern der Rue du Faubourg Saint-Antoine Konkurrenz, klapperte alle Modellbauläden ab, nutzte sogar einen Londonaufenthalt, um mich zwischen den Katzen einer wunderlichen Omi, Mrs Lily Lilliput, zu verlieren, die fähig war, den Buckingham Palace in einen Fingerhut zu stecken, und bei der ich ein kleines Vermögen ließ. Sie hat mir sogar, ich habe es nicht vergessen, eine ganze Batterie Kuchenformen aus Kupfer angedreht, nicht größer als Marienkäfer. An essential in the kitchen, indeed, versicherte sie, während sie mir die Rechnung – etwas oversized – ausstellte. Eines Tages musste ich dann den Tatsachen ins Auge sehen: Es gab nichts mehr zu verbessern, ich konnte sie nur noch aufsuchen.
Ich wusste, dass sie bei Chanel arbeitete, nahm meinen ganzen Mut zusammen, verband das C von Charmeur mit dem C von Casanova, nix da, du Angeber, eher das C von Chancenlos mit dem C von Cupido und stieß die Tür in der Rue Cambon auf. Ein wenig zu glatt rasiert, mit Schnittwunden am Kinn, aber sauberem Kragen und neuen Schnürsenkeln.
Sie wurde gerufen, tat völlig überrascht, spielte mit den Perlen ihrer Halskette, war charmant, ungezwungen und ... Ach, wie grausam das war. Aber ich ließ mich nicht aus der Fassung bringen und lud sie ein, am nächsten Samstag in mein Büro zu kommen.
Und als ihr Mäuschen mein Geschenk erblickte, vielmehr ihres, und ich ihr zeigte, wie man im schönsten Puppenhaus der Welt das Licht anknipste, wusste ich, dass sich die Sache gut anließ.
Nach den üblichen Begeisterungsrufen blieb sie jedoch ein wenig zu lange auf den Knien ...
Entzückt zunächst, dann verwirrt und still, sich bereits fragend, was wohl der Preis für all diese Stunden minutiösester Hoffnung war. Es wurde Zeit für mein letztes Geschoss: »Schauen Sie«, sagte ich und beugte mich über ihren Nacken, »es gibt sogar Marmor hier ...«
Daraufhin lächelte sie, und ich durfte sie lieben.
»Daraufhin lächelte sie und liebte mich« hätte noch besser geklungen, oder? Wäre stärker, romantischer gewesen. Aber ich traute mich nicht. Weil ich es nicht konnte, glaube ich. Und wenn ich sie heute so ansehe, wie sie mir gegenüber am Tisch sitzt, fröhlich, liebenswürdig, so nachsichtig, so großherzig mit den Meinen und immer noch so verführerisch, so ... Nein, ich konnte es nie ... Nach dem Teppichboden im Restaurant und der Wirkung des Alkohols war Mathilde vielleicht die dritte Verwechslung in unserer Geschichte ...
Diese Art Schwindelanfälle sind neu. Die Selbstbeobachtung, die überflüssigen Fragen zu uns beiden, das ist sonst nicht meine Art. Zu viele Reisen vielleicht? Zu viel Zeitverschiebung, zu viele Hotelzimmerdecken und Nächte ohne Erholung? Oder zu viele Lügen. Oder zu viele Seufzer. Zu viel Handy, das zugeklappt wird, wenn ich leise hereinkomme, Posen und plötzliche Stimmungsschwankungen oder ... In Wahrheit zu viel Nichts.