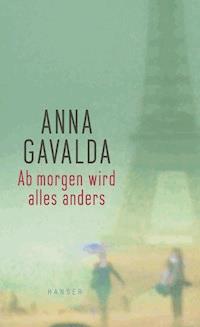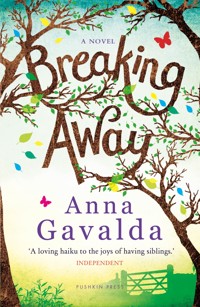Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Philibert, von verarmtem Adel, ist zwar ein historisches Genie, doch wenn er mit Menschen spricht, gerät er ins Stottern. Camille, magersüchtig und künstlerisch begabt, verdient sich ihren Lebensunterhalt in einer Putzkolonne, und Franck schuftet als Koch in einem Feinschmeckerlokal. Er liebt Frauen, Motorräder und seine Großmutter Paulette, die keine Lust aufs Altersheim hat. Vier grundverschiedene Menschen in einer verrückten Wohngemeinschaft in Paris, die sich lieben, streiten, bis die Fetzen fliegen, und versuchen, irgendwie zurecht zu kommen. Anna Gavalda erzählt vom wirklichen Leben: witzig, charmant und liebevoll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Hanser E-Book
Anna Gavalda
Zusammen ist man
weniger allein
Roman
Aus dem Französischen
von Ina Kronenberger
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Titel Ensemble, c’est tout bei Le Dilettante in Paris.
ISBN 978-3-446-24256-2
© Le Dilettante 2004
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München Wien 2005/2012
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für Muguette
(1919–2003)
Angehörige nicht ermittelt
TEIL 1
1
Paulette Lestafier war nicht so verrückt, wie die Leute behaupteten. Natürlich wußte sie, wann welcher Tag war, sie hatte ja sonst nichts zu tun, als die Tage zu zählen, auf sie zu warten und wieder zu vergessen. Sie wußte sehr wohl, daß heute Mittwoch war. Außerdem war sie fertig! Hatte ihren Mantel übergezogen, ihren Korb gegriffen und ihre Rabattmärkchen zusammengesucht. Sie hatte sogar schon von weitem das Auto der Yvonne gehört. Aber dann stand die Katze vor der Tür, hatte Hunger, und als sie sich bückte, um ihr den Napf wieder hinzustellen, war sie gestürzt und mit dem Kopf auf der untersten Treppenstufe aufgeschlagen.
Paulette Lestafier fiel öfter hin, aber das war ihr Geheimnis. Das durfte sie nicht erzählen, niemandem.
»Niemandem, hörst du?« schärfte sie sich ein. »Weder Yvonne noch dem Arzt und schon gar nicht deinem Jungen…«
Sie mußte langsam wieder aufstehen, warten, bis die Gegenstände alle wieder normal aussahen, Jod auftragen und ihre verfluchten blauen Flecken abdecken.
Die blauen Flecken der Paulette waren nie blau. Sie waren gelb, grün oder hellviolett und lange sichtbar. Viel zu lange. Mehrere Monate bisweilen. Es war schwer, sie zu verstecken. Die Leute fragten sie, warum sie immer wie im tiefsten Winter herumlief, warum sie Strümpfe trug und nie die Strickjacke auszog.
Vor allem der Kleine ging ihr damit auf die Nerven:
»He, Omi? Was soll das? Zieh den Plunder aus, du gehst ja ein vor Hitze!«
Nein, Paulette Lestafier war überhaupt nicht verrückt. Sie wußte, daß ihr die riesigen blauen Flecken, die nicht mehr weggingen, einmal viel Ärger bereiten würden.
Sie wußte, wie alte, unnütze Frauen wie sie endeten. Die die Quecke im Gemüsegarten wuchern ließen und sich an den Möbeln festhielten, um nicht zu fallen. Die Alten, die den Faden nicht mehr durch das Nadelöhr bekamen und nicht mehr wußten, wie man den Fernseher lauter stellt. Die alle Knöpfe der Fernbedienung ausprobierten und am Ende heulend vor Wut den Stecker zogen.
Winzige, bittere Tränen.
Mit dem Kopf in den Händen vor einem stummen Fernseher.
Und dann? Nichts mehr? Keine Geräusche mehr in diesem Haus? Keine Stimmen? Nie mehr? Weil man angeblich die Farbe der Knöpfe vergessen hat? Dabei hat er dir farbige Etiketten aufgeklebt, der Kleine, er hat dir Etiketten aufgeklebt! Eins für die Programme, eins für die Lautstärke und eins für den Ausknopf! Komm schon, Paulette! Hör auf, so zu heulen, und sieh dir die Etiketten an!
Schimpft nicht mit mir, ihr. Sie sind schon lange nicht mehr da, die Etiketten. Sie haben sich fast sofort wieder gelöst. Seit Monaten suche ich den Knopf, weil ich nichts mehr höre, weil ich nur noch die Bilder sehe, die leise murmeln.
Jetzt schreit doch nicht so, ihr macht mich ja ganz taub.
2
»Paulette? Paulette, bist du da?«
Yvonne fluchte. Sie fror, drückte ihren Schal fester an die Brust und fluchte nochmals. Sie mochte es nicht, wenn sie zu spät zum Supermarkt kamen.
Ganz und gar nicht.
Seufzend kehrte sie zu ihrem Auto zurück, stellte den Motor ab und nahm ihre Mütze.
Die Paulette war bestimmt hinten im Garten. Die Paulette war immer hinten im Garten. Saß auf der Bank neben den leeren Kaninchenställen. Stundenlang saß sie dort, von morgens bis abends womöglich, aufrecht, reglos, geduldig, die Hände auf den Knien, mit abwesendem Blick.
Die Paulette redete mit sich selbst, sprach mit den Toten und betete für die Lebenden.
Sprach mit den Blumen, den Salatpflänzchen, den Meisen und ihrem Schatten. Die Paulette wurde senil und wußte nicht mehr, wann welcher Tag war. Heute war Mittwoch, und Mittwoch hieß Einkaufen. Yvonne, die sie seit mehr als zehn Jahren jede Woche abholte, hob das Schnappschloß des Seitentürchens an und stöhnte: »Was für ein Jammer…«
Was für ein Jammer zu altern, was für ein Jammer, so allein zu sein, und was für ein Jammer, zu spät zum Supermarkt zu kommen und keine Einkaufswagen mehr neben der Kasse zu finden.
Doch nein. Der Garten war leer.
Die Alte fing an, sich Sorgen zu machen. Sie ging ums Haus herum und hielt die Hände wie Scheuklappen an die Scheibe, um zu sehen, was es mit der Stille auf sich hatte.
»Allmächtiger!« stieß sie aus, als sie sah, daß ihre Freundin in der Küche auf dem Fliesenboden lag.
Vor lauter Schreck bekreuzigte sich die gute Frau irgendwie, verwechselte den Sohn mit dem Heiligen Geist, fluchte noch ein bißchen und suchte im Geräteschuppen nach Werkzeug. Mit einer Hacke schlug sie die Scheibe ein, dann schwang sie sich unter enormer Anstrengung auf das Fensterbrett.
Mit Mühe gelangte sie durch den Raum, kniete nieder und hob den Kopf der alten Frau an, der in einer rosa Pfütze badete, in der sich Milch und Blut schon vermischt hatten.
»He! Paulette! Bist du tot? Bist du jetzt tot?«
Die Katze schleckte schnurrend den Boden ab und scherte sich kein bißchen um das Drama, den Anstand und die ringsum verstreuten Glasscherben.
3
Yvonne legte keinen großen Wert darauf, aber die Feuerwehrleute hatten sie gebeten, zu ihnen in den Krankenwagen zu steigen, um die Formalitäten zu regeln und die Aufnahmemodalitäten des Rettungsdienstes zu klären:
»Kennen Sie die Frau?«
Sie war empört:
»Ich glaube schon, daß ich sie kenne! Wir waren zusammen auf der Volksschule!«
»Dann steigen Sie ein.«
»Und mein Auto?«
»Das wird sich schon nicht in Luft auflösen! Wir bringen Sie später hierher zurück.«
»Gut«, sagte sie ergeben, »dann muß ich wohl heute nachmittag einkaufen gehen…«
Im Wagen war es ziemlich unbequem. Man hatte ihr neben der Trage ein winziges Höckerchen zugewiesen, auf dem sie sich mehr schlecht als recht hielt. Sie drückte ihre Handtasche fest an sich und kippte in jeder Kurve beinahe um.
Ein junger Mann war bei ihr. Er schimpfte, weil er am Arm der Kranken keine Vene finden konnte. Yvonne mißfiel sein Verhalten.
»Schreien Sie nicht so«, murmelte sie, »schreien Sie nicht so. Was wollen Sie denn von ihr?«
»Sie soll an den Tropf.«
»An was?«
Der Blick des jungen Mannes verriet ihr, daß es besser war, den Mund zu halten, und sie murmelte weiter vor sich hin:
»Da seh sich einer an, wie er ihr den Arm demoliert, nein, da seh sich einer das mal an. Wie furchtbar. Ich schau lieber nicht hin. Jesus Maria. He! Sie tun ihr doch weh!«
Er stand neben ihr und justierte ein kleines Rädchen an einem Schlauch. Yvonne zählte die Bläschen und betete verzweifelt. Das Heulen der Sirene beeinträchtigte ihre Konzentration.
Sie hatte die Hand ihrer Freundin genommen, sie sich in den Schoß gelegt und strich mechanisch darüber, als wollte sie einen Rocksaum glätten. Der Kummer und der Schrecken ließen nicht mehr Zärtlichkeit zu.
Yvonne Carminot seufzte, betrachtete die Falten, die Schwielen, die dunklen Flecken hier und da, die noch feinen, aber harten, dreckigen und rissigen Fingernägel. Sie hatte ihre Hand danebengelegt und verglich sie miteinander. Sie selbst war etwas jünger und auch rundlicher, aber vor allem hatte sie auf Erden weniger Leid erfahren. Sie hatte weniger hart gearbeitet und mehr Liebkosungen empfangen. Es war schon ziemlich lange her, daß sie sich im Garten abgerackert hatte. Ihr Mann machte weiter die Kartoffeln, aber der Rest war im Supermarkt viel besser. Das Gemüse war sauber, und sie brauchte beim Salatkopf nicht länger das Herz auseinanderzunehmen wegen der Schnecken. Und außerdem hatte sie ihre Lieben um sich: ihren Gilbert, ihre Nathalie und die Kleinen. Die Paulette hingegen, was war ihr geblieben? Nichts. Nichts Gutes. Der Mann tot, eine Nutte von Tochter und ein Junge, der sie nie besuchen kam. Nichts als Sorgen, nichts als Erinnerungen, ein Rosenkranz kleiner Nöte.
Yvonne Carminot kam ins Grübeln: War es das, das Leben? Wog es so leicht? War es so undankbar? Und doch, die Paulette. Was war sie für eine schöne Frau gewesen! Und wie gut sie war! Wie sie früher gestrahlt hatte! Und jetzt? Wo war das nur alles hin?
In dem Augenblick bewegten sich die Lippen der alten Frau. Auf der Stelle verscheuchte Yvonne das ganze tiefsinnige Zeug, das sie bedrückte:
»Paulette, ich bin’s, Yvonne. Es ist alles in Ordnung, Paulette. Ich bin zum Einkaufen gekommen und…«
»Bin ich tot? War’s das, bin ich tot?« flüsterte sie.
»Natürlich nicht, Paulette! Natürlich nicht! Du bist nicht tot, also wirklich!«
»Ach«, stöhnte Paulette und schloß die Augen, »ach«.
Dieses »Ach« war entsetzlich. Eine Silbe der Enttäuschung, der Entmutigung, gar der Resignation.
Ach, ich bin nicht tot. Na ja. Was soll’s? Ach, Verzeihung.
Yvonne war keineswegs einverstanden:
»Komm schon! Wir wollen doch leben, Paulette! Wir wollen doch leben!«
Die alte Frau drehte den Kopf von rechts nach links. Fast unmerklich und ganz schwach. Winziges Bedauern, traurig und trotzig. Winzige Revolte.
Die erste vielleicht.
Dann war es still. Yvonne wußte nicht, was sie sagen sollte. Sie schneuzte sich und nahm erneut die Hand ihrer Freundin, vorsichtiger jetzt.
»Sie werden mich in ein Heim stecken, stimmt’s?«
Yvonne fuhr zusammen:
»Nicht doch, sie werden dich nicht in ein Heim stecken! Nicht doch! Warum sagst du so was? Sie werden dich pflegen und damit ist’s gut! In ein paar Tagen bist du wieder zu Hause!«
»Nein. Ich weiß genau, daß es nicht so ist.«
»Ach! Tatsächlich, na, das ist ja ganz was Neues! Und warum nicht, meine Liebe?«
Der Sanitäter bedeutete ihr mit einer Geste, leiser zu sprechen.
»Und meine Katze?«
»Ich kümmere mich um sie. Keine Sorge.«
»Und mein Franck?«
»Wir werden ihn anrufen, deinen Jungen, wir werden ihn gleich anrufen. Dafür werde ich sorgen.«
»Ich finde seine Nummer nicht mehr. Ich habe sie verloren.«
»Ich werde sie schon finden!«
»Aber wir sollten ihn nicht stören, ja? Er muß hart arbeiten, weißt du?«
»Ja, Paulette, ich weiß. Ich werde ihm eine Nachricht hinterlassen. Du weißt ja, wie das heute ist. Die jungen Leute haben alle ein Handy. Man stört sie nicht mehr.«
»Sag ihm, daß… daß ich… daß…«
Der alten Frau versagte die Stimme.
Während der Wagen die Auffahrt zum Krankenhaus nahm, weinte Paulette Lestafier leise: »Mein Garten… Mein Haus… Bringt mich wieder nach Hause, bitte…«
Yvonne und der junge Sanitäter waren bereits aufgestanden.
4
»Wann hatten Sie zuletzt Ihre Regel?«
Sie stand schon hinter dem Vorhang und kämpfte mit den Hosenbeinen ihrer Jeans. Sie seufzte. Sie hatte gewußt, daß er sie das fragen würde. Sie hatte es gewußt. Sie hatte es vorhergesehen. Sie hatte sich die Haare mit einer ziemlich schweren, silbernen Haarspange zusammengebunden, war mit geballten Fäusten auf die verfluchte Waage gestiegen und hatte versucht, sich so schwer wie möglich zu machen. Sie war sogar ein wenig gehüpft, um die Nadel etwas anzustoßen. Aber nein, es hatte nicht gereicht, und jetzt durfte sie seine Moralpredigt über sich ergehen lassen.
Sie hatte es vorhin schon seiner Augenbraue angesehen, als er ihr den Bauch abgetastet hat. Ihre Rippen, ihre vorstehenden Hüftknochen, ihre lächerlichen Brüste und ihre hohlen Oberschenkel, das alles mißfiel ihm.
Langsam zog sie die Schnalle ihres Ledergürtels zu. Dieses Mal hatte sie nichts zu befürchten. Das hier war der Amtsarzt, nicht der Schularzt. Ein paar schöne Worte, und sie war draußen.
»Na?«
Sie saß ihm jetzt gegenüber und lächelte ihn an.
Es war ihre Kriegslist, ihre Geheimwaffe, ihr letzter Trumpf. Ein Lächeln für den lästigen Gesprächspartner, etwas Besseres gab es nicht, um das Thema zu wechseln. Nur leider hatte der Typ dieselbe Schule durchlaufen. Er hatte die Ellbogen aufgestützt, die Hände verschränkt und seinerseits ein entwaffnendes Lächeln aufgesetzt. Jetzt war sie dran mit der Antwort. Sie hätte es sich im übrigen denken können, er war süß, und sie hatte nur noch die Augen schließen können, als er ihr die Hände auf den Bauch legte.
»Na? Und nicht lügen! Sonst antworten Sie lieber gar nicht.«
»Lange her.«
»Natürlich«, sagte er und verzog das Gesicht, »natürlich… Achtundvierzig Kilo bei eins dreiundsiebzig, wenn Sie so weitermachen, passen Sie bald zwischen Papier und Kleber.«
»Was für ein Papier?« fragte sie naiv.
»Hm… ein Plakat.«
»Ach so! Ein Plakat? Tut mir leid, den Ausdruck kannte ich nicht.«
Er wollte etwas erwidern, ließ es jedoch bleiben. Mit einem Seufzer bückte er sich und griff nach dem Rezeptblock, bevor er ihr erneut in die Augen sah:
»Sie essen nicht?«
»Und ob ich esse!«
Plötzlich überkam sie eine große Müdigkeit. Sie hatte diese Diskussionen über ihr Gewicht satt, sie hatte die Schnauze voll. Seit fast siebenundzwanzig Jahren gingen sie ihr damit schon auf den Keks. Konnten sie nicht über etwas anderes reden? Sie war doch da, verdammt! Sie war lebendig. Sehr lebendig. Ebenso aktiv wie die anderen. Ebenso fröhlich, ebenso traurig, ebenso mutig, ebenso sensibel und ebenso frustriert wie alle anderen Mädchen. Da drinnen gab es jemanden! Da war jemand.
Erbarmen, konnte man mit ihr heute nicht über was anderes reden?
»Sie geben mir recht, oder? Achtundvierzig Kilo ist nicht so rasend viel.«
»Ja«, sie gab sich geschlagen, »ja… Ich gebe Ihnen recht. Es ist schon lange nicht mehr so weit runtergegangen. Ich…«
»Sie?«
»Nein. Nichts.«
»Raus damit.«
»Ich… ich war schon mal glücklicher, glaube ich.«
Er reagierte nicht.
»Füllen Sie mir das aus, die Bescheinigung?«
»Ja, ja, die fülle ich Ihnen aus«, antwortete er und schüttelte sich, »hm… was ist das noch mal für ein Unternehmen?«
»Welches?«
»Das hier, bei dem wir gerade sind, also Ihrs.«
»Proclean.«
»Pardon?«
»Proclean.«
»Großes P, dann r-o-k-l-i-n«, buchstabierte er.
»Nein, c-l-e-a-n«, verbesserte sie ihn. »Ich weiß, es ist eigentlich nicht logisch, besser wäre ›Prorein‹ gewesen, aber ich glaube, ihnen hat dieser Yankee-Touch gefallen, verstehen Sie? Das klingt sauberer. Mehr… wanderfull driem tiem.«
Er verstand nicht.
»Was ist das genau?«
»Pardon?«
»Das Unternehmen?«
Sie lehnte sich zurück, streckte die Arme, um sich zu dehnen, und deklamierte, so ernst sie konnte, mit Hostessen-Stimme, worin ihre neue Aufgabe bestand:
»Proclean, meine Damen und Herren, erfüllt all Ihre Wünsche in puncto Sauberkeit. Ob Villa, Dienstwohnung, Büroraum, Arztpraxis, Sprechzimmer, Agentur, Krankenhaus, Siedlung, Mietshaus oder Werkstatt, Proclean ist Ihnen stets zu Diensten. Proclean räumt auf, Proclean putzt, Proclean fegt, Proclean saugt, Proclean wachst, Proclean bohnert, Proclean desinfiziert, Proclean sorgt für Glanz, Proclean verschönert, Proclean saniert und Proclean schafft Duft in der Luft. Wann immer Sie wünschen. Flexibilität. Diskretion. Sorgfalt, knapp kalkulierte Preise. Proclean, die Profis für Sie im Einsatz!«
Sie hatte diesen beachtlichen Sermon in einem Atemzug hergebetet, ohne zwischendurch Luft zu holen. Ihr kleiner French-Doktor war völlig verdattert:
»Ist das ein Gag?«
»Keineswegs. Und außerdem werden Sie das Dream Team gleich kennenlernen, es wartet vor der Tür.«
»Was genau machen Sie?«
»Das habe ich Ihnen doch gerade gesagt.«
»Nein, ich meine Sie… Sie!«
»Ich? Na ja, ich räume auf, ich putze, ich fege, ich sauge, ich wachse, das ganze Programm.«
»Sind Sie Putzfr…?«
»Rrr…raumpflegerin, bitte.«
Er wußte nicht, was er glauben sollte.
»Warum machen Sie das?«
Sie riß die Augen auf.
»Nein, ich meine, warum ›das‹? Warum nicht etwas anderes?«
»Warum nicht?«
»Würden Sie nicht lieber einer Beschäftigung nachgehen, die… hm…«
»Erfüllender ist?«
»Ja.«
»Nein.«
Er verharrte einen Augenblick, den Stift in der Luft, den Mund halb offen, sah dann auf seine Uhr, um das Datum abzulesen, und fragte sie, ohne aufzusehen:
»Name?«
»Fauque.«
»Vorname?«
»Camille.«
»Geburtsdatum?«
»17. Februar 1977.«
»Bitte schön, Mademoiselle Fauque, ich erkläre Sie für arbeitstauglich.«
»Wunderbar. Was schulde ich Ihnen?«
»Nichts, es wird… Proclean zahlt für Sie.«
»Aaah Proclean!« wiederholte sie, stand auf und fügte theatralisch hinzu, »ich bin kloputztauglich, herrlich ist das!«
Er begleitete sie zur Tür.
Er lächelte nicht mehr und hatte wieder die Maske des Gewissensgurus aufgesetzt.
Während er die Klinke drückte, hielt er ihr die Hand hin:
»Ein paar Kilos wenigstens? Für mich.«
Sie schüttelte den Kopf. Das zog nicht mehr bei ihr. Emotionale Erpressungen, davon hatte sie ihre Dosis gehabt.
»Mal sehen, was sich machen läßt«, antwortete sie. »Mal sehen.«
Nach ihr trat Samia ein.
Sie stieg die Stufen des Wagens hinunter und tastete ihre Jacke nach einer Zigarette ab. Die dicke Mamadou und Carine saßen auf einer Bank, lästerten über die Passanten und schimpften, weil sie nach Hause wollten.
»Na?« Mamadou lachte, »was hast du denn da drin getrrieben? Ich muß meine Bahn krriegen! Hat er dich verhext oder was?«
Camille hatte sich auf den Boden gesetzt und sie angelächelt. Nicht das Lächeln von eben. Ein reines Lächeln diesmal. Ihre Mamadou, der konnte sie nichts vormachen, dafür war sie viel zu schlau.
»Is er nett?« fragte Carine und spuckte einen Fetzen von ihrem Fingernagel aus.
»Ganz toll.«
»Ah, ich hab’s genau gewußt!« frohlockte Mamadou, »hab ich’s mir doch gedacht! Hab ich’s dir und der Sylvie nicht gesagt, daß sie da drrin ganz nackt war!«
»Er stellt dich auf die Waage.«
»Wen? Mich?« schrie Mamadou. »Mich? Wenn der glaubt, daß ich auf seine Waage steige!«
Mamadou dürfte um die hundert Kilo wiegen, vorsichtig geschätzt. Sie schlug sich auf die Oberschenkel:
»Niemals! Wenn ich da drraufsteige, zermalme ich sie und ihn gleich mit! Und was noch?«
»Er verpaßt dir ein paar Spritzen«, warf Carine ein.
»Was für Sprritzen denn?«
»Nein, nein«, Camille beruhigte sie, »nein, nein, er hört nur dein Herz und deine Lunge ab.«
»Das ist okay.«
»Er faßt auch deinen Bauch an.«
»Das wollen wir mal sehen«, sie zog ein Gesicht, »das wollen wir doch mal sehen, viel Spaß wünsch ich ihm. Wenn der meinen Bauch anfaßt, frreß ich ihn roh. Mm, lecker, so ein kleines weißes Medizinmännchen.«
Sie machte einen auf Afrikanerin und rieb sich über ihr Gewand.
»Oh ja, das ist gutes Ham-ham. Das weiß ich von meinen Ahnen. Mit Maniok und Hahnenkämmen. Mmm…«
»Und die Bredart, was er mit der wohl macht?«
Die Bredart, Josy mit Vornamen, war ihr Drachen, ihre Furie, ihre Anscheißerin vom Dienst und ihrer aller Lieblingsfeindin. Nebenbei war sie auch noch ihre Vorgesetzte. Die »Vorarbeiterin der Kolonne«, wie ihr Anstecker unmißverständlich verkündete. Die Bredart machte ihnen das Leben schwer, im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel zwar nur, aber immerhin, ermüdend war es schon.
»Mit der, nichts. Wenn er die riecht, bittet er sie auf der Stelle, sich wieder anzuziehen.«
Carine hatte nicht unrecht. Zu den bereits erwähnten Qualitäten der Josy Bredart kam hinzu, daß sie ziemlich stark schwitzte.
Dann war Carine an der Reihe, und Mamadou holte aus ihrem Bastkorb ein Bündel Papiere, das sie Camille auf die Knie legte. Diese hatte ihr versprochen, einen Blick darauf zu werfen, und versuchte nun, das ganze Durcheinander zu entziffern.
»Was ist das?«
»Fürs Kindergeld!«
»Nein, ich meine hier die ganzen Namen?«
»Wie, das ist meine Familie!«
»Welche Familie?«
»Welche Familie, welche Familie? Na, meine! Strreng mal deinen Kopf ein bißchen an, Camille!«
»All die Namen, das ist deine Familie?«
»Alle«, sagte sie mit stolzem Kopfnicken.
»Wie viele Kinder hast du denn?«
»Ich selbst habe fünf und mein Bruder vier.«
»Und warum stehen die alle da?«
»Wo da?«
»Na… Auf dem Papier.«
»Das ist am einfachsten so, mein Bruder und meine Schwägerin wohnen bei uns, und wo wir außerdem denselben Briefkasten haben…«
»Das geht aber nicht. Sie sagen, das geht nicht. Du kannst nicht neun Kinder haben.«
»Und warum nicht?« fragte sie entrüstet, »meine Mutter hatte zwölf!«
»Moment, reg dich nicht auf, Mamadou, ich sag dir ja nur, was da steht. Sie fordern dich auf, die Situation zu klären und dein Familienstammbuch vorbeizubringen.«
»Und warum das?«
»Tja, ich nehme an, euer Arrangement ist nicht legal. Ich glaube nicht, daß du deine Kinder und die von deinem Bruder zusammen in einen Antrag packen kannst.«
»Ja, aber mein Bruder hat doch nix!«
»Arbeitet er?«
»Natürlich arbeitet er! Auf der Autobahn!«
»Und deine Schwägerin?«
Mamadou rümpfte die Nase:
»Die, die macht nix! Gar nix, sag ich dir. Die rührt keinen Finger, diese Jammerliese, bewegt ihren fetten Arsch nicht von der Stelle!«
Camille schmunzelte in sich hinein, schwer vorzustellen, was in Mamadous Augen ein »fetter Arsch« sein konnte.
»Haben sie Papiere, die beiden?«
»Na klar!«
»Dann können sie doch einen eigenen Antrag abgeben.«
»Aber meine Schwägerin will da nicht hingehen, zum Amt, und mein Bruder arbeitet nachts, am Tag schläft er also, verstehst du?«
»Ich verstehe. Aber für wie viele Kinder kriegst du denn zur Zeit Kindergeld?«
»Für vier.«
»Vier?«
»Ja, das will ich dir doch die ganze Zeit schon erklären, aber du, du bist wie alle Weißen, immer recht haben wollen und nie zuhören!«
Camille schnaubte genervt.
»Was ich dir erzählen will: Das Prroblem ist, daß sie die Sissi vergessen haben.«
»Die wievielte ist das, Disissi? Nummer…?«
»Das ist keine Nummer, du dumme Nuß!« Die Dicke kochte vor Wut, »das ist meine Jüngste! Die kleine Sissi.«
»Ach so! Sissi!«
»Ja.«
»Und warum ist sie nicht dabei?«
»Sag mal, Camille, machst du das extrra? Das ist genau das, was ich die ganze Zeit wissen will!«
Sie wußte nicht mehr, was sie sagen sollte.
»Am besten, ihr geht zur Kindergeldstelle, du, dein Bruder und deine Schwägerin mit allen Papieren und erklärt der Frau…«
»Was heißt ›der Frau‹? Welcher denn?«
»Egal welcher!« ereiferte sich Camille.
»Ach so, okay, reg dich ab. Ich dachte ja nur, du kennst da eine.«
»Mamadou, ich kenne niemanden bei der Kindergeldstelle. Ich bin da noch nie im Leben gewesen, verstehst du?«
Sie gab ihr den ganzen Packen zurück, darunter Reklamezettel, Fotos von Autos und Telefonrechnungen.
Sie hörte sie brummen: »Sagt ›die Frau‹, und ich frage sie, welche Frau, ist doch normal, sind ja auch Männer da, woher will sie das wissen, wenn sie noch nie da war, woher will sie wissen, daß da nur Frauen sind? Es gibt auch Männer da. Ist unsere Frau Hellseherin oder was?«
»He? Bist du beleidigt?«
»Nein, ich bin nicht beleidigt. Du sagst nur, daß du mir helfen willst, und dann hilfst du mir nicht. Das ist alles! Mehr nicht!«
»Ich komme mit.«
»Zur Kindergeldstelle?«
»Ja.«
»Und sprichst du mit der Frau?«
»Ja.«
»Und wenn sie nicht da ist?«
Camille drohte gerade ihre Gelassenheit zu verlieren, als Samia zurückkam:
»Du bist dran, Mamadou. Hier«, sagte sie und drehte sich um, »die Nummer vom Onkel Doktor.«
»Wozu das?«
»Wozu das? Wozu das? Was weiß ich! Für Doktorspielchen vielleicht! Er sagt, die soll ich dir geben.«
Er hatte auf einem Rezeptformular seine Handynummer notiert: Ich verschreibe Ihnen ein gutes Abendessen, rufen Sie mich an.
Camille Fauque formte ein Kügelchen daraus und warf es in den Rinnstein.
»Weißt du was«, fügte Mamadou hinzu, erhob sich schwerfällig und zeigte mit dem Finger auf sie, »wenn du die Sache mit der Sissi in Ordnung bringst, sag ich meinem Bruder, daß er dir einen Mann schicken soll.«
»Ich dachte, dein Bruder arbeitet auf der Autobahn?«
»Auf der Autobahn, aber auch mit Behexungen und Gegenzauber.«
Camille rollte mit den Augen.
»Und ich?« fiel Samia ein, »kann er mir auch einen besorgen, einen Kerl für mich?«
Mamadou ging an ihr vorbei und zeigte ihr die Klauen:
»Du gibst mir erst meinen Eimer zurück, du Miststück, dann sprechen wir uns wieder!«
»Scheiße, du gehst mir auf den Zeiger! Ich hab deinen Eimer nicht, das hier ist meiner! Dein Eimer war rot!«
»Miststück, du«, zischte Mamadou und entfernte sich, »verfluchtes Miststück.«
Sie war noch nicht oben auf dem Treppchen angekommen, als der Wagen schon gefährlich ins Schwanken geriet. Alles Gute da drinnen, lächelte Camille und schnappte sich ihre Tasche. Alles Gute.
»Gehen wir?«
»Ich komm mit.«
»Was machst du? Nimmst du auch die Metro?«
»Nein. Ich geh zu Fuß.«
»Stimmt ja, du wohnst ja in der besseren Gegend.«
»Von wegen.«
»Also, bis morgen.«
»Tschüß, Mädels.«
Camille war bei Pierre und Mathilde zum Abendessen eingeladen. Sie rief an, um abzusagen, und war erleichtert, als der Anrufbeantworter ansprang.
Die ach so leichte Camille Fauque machte sich auf. Das einzige, was sie auf dem Asphalt hielt, waren das Gewicht ihres Rucksacks und, nicht ganz so leicht zu benennen, die Schotter- und Kieselsteine, die sich in ihr angesammelt hatten. Das hätte sie dem Amtsarzt vorhin erzählen sollen. Wenn sie Lust dazu gehabt hätte… Oder die Kraft? Oder auch die Zeit? Die Zeit vor allem, beruhigte sie sich, ohne so recht daran glauben zu können. Die Zeit war etwas, das sie nicht länger zu fassen vermochte. Zu viele Wochen und Monate waren vergangen, ohne daß sie, in welcher Form auch immer, daran teilgehabt hätte, und ihre Tirade von vorhin, ihr absurder Monolog, mit dem sie sich einzureden versucht hatte, daß sie ebenso fleißig war wie alle anderen, war die reinste Lüge.
Welches Wort hatte sie noch mal verwendet? »Lebendig«, oder? Lächerlich, Camille Fauque war nicht lebendig.
Camille Fauque war ein Gespenst, das nachts arbeitete und tagsüber Steine hamsterte. Das sich langsam fortbewegte, wenig sprach und sich elegant verdrückte.
Camille Fauque war eine junge Frau, die man nur von hinten sah, zerbrechlich, nicht greifbar.
Man durfte dem Auftritt von vorhin nicht trauen, der den Anschein großer Leichtigkeit hatte. So einfach. So unbefangen. Camille Fauque log. Sie begnügte sich damit, andere hinters Licht zu führen, sie zwang sich, nötigte sich und antwortete mit »hier«, um nicht aufzufallen.
Trotzdem dachte sie noch einmal an den Arzt. Seine Handynummer war ihr völlig schnuppe, aber sie überlegte, ob sie vielleicht eine Chance hatte vorbeiziehen lassen. Er wirkte geduldig, dieser Mensch, und aufmerksamer als die anderen. Vielleicht hätte sie… Sie hätte auch beinahe… Sie war müde, sie hätte ebenfalls die Ellbogen auf den Schreibtisch stützen und ihm die Wahrheit erzählen sollen. Ihm sagen, daß sie nichts mehr aß oder so wenig, weil die Steine den ganzen Platz in ihrem Bauch einnahmen. Daß sie jeden Tag mit dem Gefühl aufwachte, auf Kies zu kauen, daß sie noch nicht die Augen geöffnet hatte und schon erstickte. Daß die Welt um sie herum schon keine Rolle mehr spielte und daß jeder Tag ein großes Gewicht war, das sie nicht hochzuheben vermochte. Also weinte sie. Nicht, weil sie traurig war, sondern um alles hinter sich zu bringen. Die Tränen, die Flüssigkeit halfen ihr schließlich, die Steine zu verdauen und wieder durchzuatmen.
Hätte er ihr zugehört? Hätte er sie verstanden? Natürlich. Und genau deshalb hatte sie geschwiegen.
Sie wollte nicht wie ihre Mutter enden. Sie weigerte sich, ins selbe Boot zu steigen. Wenn sie anfing, wußte sie nicht, wohin es sie führen könnte. Zu weit, viel zu weit, zu tief und ins Dunkel. Diesmal hatte sie nicht die Kraft, sich umzudrehen.
Andere hinters Licht zu führen, ja, aber nicht sich umzudrehen.
Sie betrat den Supermarkt bei sich im Haus und zwang sich, ein paar Lebensmittel zu kaufen. Sie tat es dem wohlwollenden jungen Arzt zuliebe und Mamadous Lachen. Das laute Lachen dieser Frau, die bescheuerte Arbeit bei Proclean, die Bredart, die abstrusen Geschichten von Carine, die Anschisse, die geschnorrten Zigaretten, die körperliche Erschöpfung, die albernen Lachkrämpfe und die bisweilen feindselige Stimmung, das alles half ihr zu leben. Half ihr zu leben, ja.
Sie strich mehrfach um die Regale, bevor sie sich für Bananen, vier Joghurts und zwei Flaschen Wasser entschied.
Da sah sie den komischen Kauz aus ihrem Haus. Den seltsamen großen Jungen, dessen Brille mit Pflaster geflickt war, der Hochwasserhosen trug und die Umgangsformen eines Marsmenschen an den Tag legte. Kaum hatte er einen Artikel in die Hand genommen, stellte er ihn wieder hin, ging ein paar Schritte weiter, besann sich eines Besseren, nahm ihn wieder in die Hand, schüttelte den Kopf und verließ überstürzt die Schlange an der Kasse, wenn er schon an der Reihe war, um ihn wieder zurückzustellen. Einmal hatte sie ihn sogar aus dem Laden kommen und wieder hineingehen sehen, um das Glas Mayonnaise zu kaufen, das er sich kurz zuvor versagt hatte. Ein trauriger Clown, der zur allgemeinen Belustigung beitrug, vor den Verkäuferinnen stotterte und ihr das Herz zerriß.
Sie begegnete ihm mitunter auf der Straße oder vor der Toreinfahrt, und alles war nur mehr Komplikation, innerer Aufruhr und Beklemmung. Auch diesmal stand er stöhnend vor dem Zahlencode an der Tür.
»Gibt’s Probleme?« fragte sie.
»Ah! Oh! Eh! Pardon!« Er verrenkte sich die Hände. »Guten Abend, Mademoiselle, entschuldigen Sie bitte, daß ich… ah… Sie belästige, ich… Ich belästige Sie, nicht wahr?«
Schrecklich war das. Sie wußte nie, ob sie lachen oder Mitleid haben sollte. Diese krankhafte Scheu, seine hochgeschraubte Art zu reden, die Wörter, die er wählte, und seine Bewegungen, die von einer anderen Welt zu kommen schienen, machten sie entsetzlich beklommen.
»Nein, nein, kein Problem! Haben Sie den Code vergessen?«
»Teufel, nein. Vielmehr, nicht daß ich wüßte… vielmehr, ich… ich habe die Dinge noch nicht aus dieser Warte betrachtet. Mein Gott, ich…«
»Sie haben ihn vielleicht geändert?«
»Ist das Ihr Ernst?« fragte er, als würde sie ihm das Ende der Welt verkünden.
»Das sehen wir gleich… 342B7…«
Das Klicken der Tür war zu hören.
»Oh, ich bin beschämt… ich bin beschämt… Ich… Genau das habe ich auch gedrückt. Das verstehe ich nicht.«
»Kein Problem«, sagte sie und stemmte sich gegen die Tür.
Er machte eine abrupte Bewegung, um an ihrer Stelle die Tür aufzustoßen, verfehlte jedoch, als er mit dem Arm über sie greifen wollte, sein Ziel und verpaßte ihr einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf.
»Oh Schande! Ich habe Ihnen doch nicht weh getan? Was bin ich aber auch ungeschickt, wahrhaftig, ich bitte Sie um Verzeihung… Ich…«
»Kein Problem«, wiederholte sie zum dritten Mal.
Er rührte sich nicht von der Stelle.
»Hm«, bat sie ihn schließlich, »könnten Sie Ihren Fuß anheben, Sie zerquetschen mir gerade den Knöchel, und das tut furchtbar weh.«
Sie lachte. Ein nervöses Lachen.
Als sie drinnen waren, eilte er zur Glastür voraus, damit sie ungehindert durchgehen konnte:
»Tut mir leid, aber ich muß dort lang«, sagte sie bedauernd und zeigte auf den Hinterhof.
»Wohnen Sie im Hof?«
»Eh… nicht direkt… eher unterm Dach.«
»Ah! Hervorragend.« Er zerrte am Henkel seiner Tasche, der sich am Messinggriff verfangen hatte. »Das… das ist gewiß sehr angenehm.«
»Eh… ja«, sagte sie mit einer Grimasse und ging rasch weiter, »so kann man es auch sehen.«
»Einen schönen Abend noch, Mademoiselle«, rief er ihr hinterher, »und… grüßen Sie Ihre Eltern von mir!«
Ihre Eltern. Der Typ war wohl debil. Sie erinnerte sich, wie sie ihn einmal nachts, denn sie kam für gewöhnlich mitten in der Nacht nach Hause, im Eingangsbereich überrascht hatte, im Schlafanzug, mit Jagdstiefeln und einer Dose Trockenfutter in der Hand. Er war ganz aufgewühlt und fragte sie, ob sie nicht eine Katze gesehen hätte. Sie verneinte und ging auf der Suche nach besagtem Kater ein paar Schritte mit ihm durch den Hof. »Wie sieht er denn aus?« erkundigte sie sich, »Bedaure, das weiß ich nicht«, »Sie wissen nicht, wie Ihre Katze aussieht?« Er stand wie angewurzelt da: »Wie soll ich das wissen? Ich habe noch nie eine Katze gehabt!« Sie war völlig verdutzt gewesen und hatte ihn kopfschüttelnd stehenlassen. Der Kerl war entschieden zu durchgeknallt.
»Die bessere Gegend.« Sie dachte noch einmal an Carines Kommentar, als sie die erste von hundertzweiundsiebzig Stufen erklomm, die sie von ihrem Verschlag trennten. Die bessere Gegend, stimmt schon. Sie wohnte im siebten Stock der Hintertreppe eines stattlichen Wohnhauses, das zum Champ-de-Mars ging, und so gesehen konnte man tatsächlich sagen, daß sie nobel wohnte, denn wenn sie auf einen Schemel kletterte und sich gefährlich weit nach rechts aus dem Fenster lehnte, konnte sie tatsächlich die Spitze des Eiffelturms sehen. Was jedoch den Rest anging, meine Liebe, was den Rest anging, war dem nicht wirklich so.
Sie hielt sich am Geländer fest, keuchte schwer und zog die Wasserflaschen hinter sich her. Sie versuchte, nicht stehenzubleiben. Niemals. Auf keinem Stockwerk. Einmal nachts war es ihr passiert, und sie konnte nicht wieder aufstehen. Sie hatte sich im vierten Stock hingesetzt und war mit dem Kopf auf den Knien eingeschlafen. Ein qualvolles Aufwachen war das gewesen. Sie war völlig durchgefroren und hatte eine Weile gebraucht, bis sie wußte, wo sie war.
Aus Furcht vor einem Gewitter hatte sie das Oberlicht geschlossen, bevor sie ging, jetzt seufzte sie beim Gedanken an die Backofenhitze dort oben. Wenn es regnete, wurde sie naß, wenn es schön war wie heute, erstickte sie, und im Winter schlotterte sie. Camille kannte die klimatischen Gegebenheiten in- und auswendig, da sie schon seit über einem Jahr hier wohnte. Sie beklagte sich nicht, dieses schäbige Nest war ihr unverhofft zugefallen, und sie erinnerte sich noch an Pierre Kesslers betretenes Gesicht, als er die Tür zu der Rumpelkammer vor ihr aufstieß und ihr den Schlüssel hinhielt.
Es war winzig, dreckig, zugestellt und eine glückliche Fügung.
Als er sie eine Woche zuvor auf der Schwelle seiner Wohnungstür empfangen hatte, ausgehungert, verstört und still, hatte Camille Fauque ein paar Nächte auf der Straße hinter sich.
Er hatte es zunächst mit der Angst bekommen, als er den Schatten auf dem Treppenabsatz sah:
»Pierre?«
»Wer sind Sie?«
»Pierre«, stöhnte die Stimme.
»Wer sind Sie?«
Er drückte auf den Lichtschalter, und seine Angst wurde noch größer:
»Camille? Bist du’s?«
»Pierre«, schluchzte sie und schob einen kleinen Koffer vor sich her, »ihr müßt das hier für mich aufbewahren. Das sind meine Utensilien, versteht ihr, mir werden sie bestimmt geklaut. Alles wird mir geklaut. Alles, alles… Ich will nicht, daß sie mir meine Utensilien wegnehmen, sonst krepier ich…Versteht ihr? Ich krepiere.«
Er glaubte, sie phantasiere:
»Camille! Wovon sprichst du denn? Und wo kommst du her? Komm rein!«
Mathilde war hinter ihm aufgetaucht, und die junge Frau brach auf dem Fußabtreter zusammen.
Sie zogen sie aus und legten sie in das hintere Zimmer. Pierre Kessler hatte einen Stuhl zu ihr ans Bett gezogen und betrachtete sie beklommen.
»Schläft sie?«
»Scheint so.«
»Was ist passiert?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sieh nur, in was für einem Zustand sie ist!«
»Pssst.«
Sie wachte einen Tag später mitten in der Nacht auf und ließ ganz langsam Badewasser einlaufen, um sie nicht zu wecken. Pierre und Mathilde, die nicht schliefen, hielten es für ratsamer, sie in Ruhe zu lassen. Sie ließen sie einige Tage bei sich wohnen, gaben ihr einen Zweitschlüssel und stellten ihr keine Fragen. Dieser Mann und diese Frau waren ein Segen.
Als er ihr vorschlug, sie in einem Dienstmädchenzimmer unterzubringen, das er nach dem Tod seiner Eltern in deren Haus behalten hatte, holte er unter dem Bett den kleinen Koffer im Schottenmuster hervor, der sie zu ihnen geführt hatte:
»Hier«, sagte er zu ihr.
Camille schüttelte den Kopf:
»Ich würde ihn lieber hier lass…«
»Kommt nicht in Frage«, unterbrach er sie sofort, »den nimmst du mit. Der hat bei uns nichts zu suchen!«
Mathilde begleitete sie zu einem Verbrauchermarkt, half ihr, eine Lampe, eine Matratze, Bettwäsche, ein paar Töpfe, eine Elektroplatte und einen winzigen Kühlschrank auszusuchen.
»Hast du Geld?« fragte sie, bevor sie sie gehen ließ.
»Ja.«
»Meinst du, es wird gehen, Herzchen?«
»Ja«, wiederholte Camille und hielt die Tränen zurück.
»Möchtest du unseren Schlüssel behalten?«
»Nein, nein, es geht schon. Ich… was soll ich sagen… was…«
Sie heulte.
»Sag nichts.«
»Danke?«
»Ja«, sagte Mathilde und zog sie an sich, »danke, es geht schon, alles in Ordnung.«
Sie schauten ein paar Tage später bei ihr vorbei.
Das Treppensteigen hatte sie erschöpft, und sie ließen sich auf die Matratze sinken.
Pierre lachte, behauptete, dies erinnere ihn an seine Jugend, und stimmte »La Bohäää-me« an. Sie tranken aus Plastikbechern Champagner, und Mathilde zauberte aus einer großen Tasche einen Haufen herrlicher Leckereien hervor. Mit Unterstützung des Champagners und ihrer guten Laune trauten sie sich, ein paar Fragen zu stellen. Einige beantwortete sie, die beiden insistierten nicht.
Als sie sich anschickten zu gehen und Mathilde schon ein paar Stufen hinuntergegangen war, drehte sich Pierre Kessler um und packte sie an den Handgelenken:
»Du mußt arbeiten, Camille… Du mußt jetzt arbeiten.«
Sie schlug die Augen nieder:
»Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit viel gemacht zu haben. Viel, viel…«
Er drückte noch fester zu, tat ihr beinahe weh.
»Das war keine Arbeit, und das weißt du genau!«
Sie sah auf und hielt seinem Blick stand:
»Habt ihr mir deshalb geholfen? Um mir das zu sagen?«
»Nein.«
Camille zitterte.
»Nein«, wiederholte er und ließ sie los, »nein. Red nicht solchen Unsinn. Du weißt genau, daß wir dich immer wie eine Tochter behandelt haben.«
»Verloren oder auserkoren?«
Er lächelte und fügte hinzu:
»Arbeite. Du hast sowieso keine Wahl.«
Sie schloß die Tür hinter sich, räumte ihr Puppengeschirr weg und fand unten in der Tasche einen dicken Katalog von Sennelier Künstlerbedarf. Dein Konto ist immer verfügbar… stand auf einem Post-it. Sie hatte nicht die Kraft, darin zu blättern, und trank die Flasche aus.
Sie hatte ihm gehorcht. Sie arbeitete.
Heute wischte sie die Scheiße der anderen weg, was ihr sehr zusagte.
Man kam vor lauter Hitze tatsächlich um. Super Josy hatte sie am Abend zuvor gewarnt: »Beschwert euch nicht, Mädels, wir erleben gerade unsere letzten schönen Tage, bald kommt der Winter, und wir werden uns den Hintern abfrieren! Also beschwert euch ja nicht!«
Sie hatte ausnahmsweise einmal recht. Es war Ende September, und die Tage wurden zusehends kürzer. Camille überlegte, daß sie sich dieses Jahr anders organisieren mußte, früher zu Bett gehen und am Nachmittag aufstehen, um die Sonne zu sehen. Sie war selbst von solch einem Gedanken überrascht und hörte mit einer gewissen Unbekümmertheit den Anrufbeantworter ab:
»Hier ist deine Mama. Das heißt…« kicherte die Stimme, »ich weiß nicht, ob du dir darüber im klaren bist, von wem die Rede ist. Deine Mama, weißt du? Das ist das Wort, das liebe Kinder aussprechen, wenn sie sich an ihre Erzeugerin wenden, glaube ich. Denn du hast eine Mutter, Camille, erinnerst du dich? Entschuldige, daß ich schlechte Erinnerungen in dir wachrufe, aber da es nun schon die dritte Nachricht ist, die ich dir seit Dienstag hinterlasse. Ich wollte nur wissen, ob wir immer noch zusammen ess…«
Camille würgte sie ab und stellte den Joghurt, den sie gerade angebrochen hatte, in den Kühlschrank zurück. Sie setzte sich im Schneidersitz hin, griff nach ihrem Tabak und versuchte, eine Zigarette zu drehen. Ihre Hände verrieten sie. Sie mußte mehrmals ansetzen, um das Papier nicht zu zerreißen. Konzentrierte sich auf ihre Bewegungen, als gäbe es auf der Welt nichts Wichtigeres, und biß sich die Lippen blutig. Es war zu ungerecht. Zu ungerecht, daß sie so litt, wegen eines Fetzen Papiers, wo sie fast einen normalen Tag hinter sich gebracht hatte. Sie hatte gesprochen, zugehört, gelacht, sich sogar gesellig gezeigt. Sie hatte vor dem Arzt kokettiert und Mamadou ein Versprechen gegeben. Das sah nach nicht viel aus, und doch… Es war lange her, daß sie zuletzt etwas versprochen hatte. Sehr lange. Und jetzt stießen ein paar Sätze aus einer Maschine sie vor den Kopf, zogen sie herunter und zwangen sie, sich hinzulegen, erdrückt, wie sie war, vom Gewicht irrsinniger Mengen Bauschutts.
5
»Monsieur Lestafier!«
»Ja, Chef!«
»Telefon…«
»Nein, Chef!«
»Was, nein?«
»Bin beschäftigt, Chef! Soll später noch mal anrufen.«
Der gute Mann schüttelte den Kopf und kehrte in das Kabäuschen zurück, das ihm hinter der Durchreiche als Büro diente.
»Lestafier!«
»Ja, Chef!«
»Es ist Ihre Großmutter.«
Kichern in der Versammlung.
»Sagen Sie ihr, daß ich zurückrufe«, wiederholte der junge Mann, der ein Stück Fleisch entbeinte.
»Nerven Sie nicht, Lestafier! Gehen Sie jetzt ans Telefon, verflucht noch mal! Ich bin hier doch nicht das Fräulein von der Post!«
Der junge Mann wischte sich die Hände an dem Geschirrtuch ab, das an seiner Schürze hing, fuhr sich mit dem Ärmel über die Stirn und sagte zu dem Jungen am Schneidebrett neben ihm, wobei er tat, als wollte er ihn abstechen:
»Du rührst hier nichts an, sonst… krrrr…«
»Schon gut«, meinte der andere, »geh deine Weihnachtsgeschenke bestellen, Omi wartet schon.«
»Blödmann.«
Er ging ins Büro und nahm seufzend den Hörer auf:
»Omi?«
»Franck, guten Tag. Es ist nicht deine Großmutter, Madame Carminot am Apparat.«
»Madame Carminot?«
»Jesses! War das schwer, dich aufzutreiben. Ich habe zuerst im Grands Comptoirs angerufen und erfahren, daß du dort nicht mehr arbeitest, dann habe ich…«
»Was ist los?« schnitt er ihr das Wort ab.
»Mein Gott, Paulette…«
»Moment mal. Bleiben Sie dran.«
Er stand auf, schloß die Tür, nahm den Hörer wieder auf, setzte sich, nickte, ganz blaß, suchte auf dem Schreibtisch nach etwas zum Schreiben, sagte noch ein paar Worte und legte auf. Er nahm seine Kochmütze ab, legte den Kopf in die Hände, schloß die Augen und verharrte einige Minuten in dieser Stellung. Der Chef betrachtete ihn durch die Glastür. Schließlich steckte er den Zettel in die Hosentasche und verließ das Büro.
»Alles in Ordnung, Junge?«
»Alles in Ordnung, Chef.«
»Nichts Schlimmes?«
»Der Oberschenkelhalsknochen…«
»Ach, das ist bei den alten Leutchen nicht selten. Meine Mutter hatte das vor zehn Jahren, und wenn Sie sie heute sehen würden… Wie eine Gemse!«
»Sagen Sie, Chef…«
»Hört sich an, als wollten Sie den Tag frei haben, was?«
»Nein, ich mache die Mittagsschicht und erledige die Vorbereitungen für heute abend in der Pause, aber dann würde ich gerne gehen.«
»Und wer kümmert sich heute abend ums warme Essen?«
»Guillaume. Der Junge schafft das.«
»Tatsächlich?«
»Ja, Chef.«
»Wer garantiert mir, daß er das kann?«
»Ich, Chef.«
Der Chef verzog das Gesicht, herrschte einen Jungen an, der gerade vorbeikam, und befahl ihm, das Hemd zu wechseln. Dann drehte er sich wieder zu seinem Chef de partie um und fügte hinzu:
»Ist gut, hauen Sie ab, aber ich warne Sie, Lestafier, wenn heute abend eine Sache schiefläuft, wenn ich eine Bemerkung machen muß, eine einzige nur, hören Sie? Dann fällt es auf Sie zurück, ist das klar?«
»Ja, hab verstanden, Chef.«
Er kehrte an seinen Platz zurück und nahm das Messer wieder in die Hand.
»Lestafier! Waschen Sie sich zuerst die Hände! Wir sind hier nicht auf dem Land!«
»Leck mich«, murmelte er und schloß die Augen. »Ihr könnt mich alle mal.«
Schweigend machte er sich wieder an die Arbeit. Nach einer Weile wagte sein Gehilfe einen Vorstoß:
»Alles in Ordnung?«
»Nein.«
»Ich hab gehört, was du dem Dicken erzählt hast… Der Oberschenkelhals, stimmt’s?«
»Ja.«
»Ist es schlimm?«
»Nee, glaub nicht, aber das Problem ist, daß ich ganz allein bin.«
»Ganz allein womit?«
»Mit allem.«
Guillaume verstand nicht, zog es aber vor, ihn mit seinen Sorgen in Ruhe zu lassen.
»Wenn du gehört hast, wie ich mit dem Alten gesprochen hab, dann hast du auch das mit heute abend kapiert?«
»Yes.«
»Kannst du’s mir garantieren?«
»Das muß sich auszahlen…«
Sie arbeiteten schweigend weiter, der eine über seine Kaninchen gebeugt, der andere über seine Lammrippen.
»Meine Maschine…«
»Ja?«
»Die leih ich dir am Sonntag.«
»Die neue?«
»Ja.«
»He«, pfiff der andere, »er mag seine Omi. Okay. Bin dabei.«
Franck hatte einen bitteren Zug um den Mund.
»Danke.«
»He?«
»Was ist?«
»Wo ist denn die Alte?«
»In Tours.«
»Dann brauchst du dein Bike doch am Sonntag, wenn du zu ihr willst?«
»Ich kann mich anders behelfen.«
Die Stimme des Chefs fuhr dazwischen:
»Ruhe, die Herren! Ruhe, bitte!«
Guillaume schärfte sein Messer und nutzte das Geräusch, um zu murmeln:
»Okay… Du kannst sie mir leihen, wenn die Alte wieder gesund ist.«
»Danke.«
»Sag das nicht. Ich werde dir dafür die Stelle stibitzen.«
Franck Lestafier schüttelte lächelnd den Kopf.
Er sprach kein Wort mehr. Die Schicht kam ihm länger vor als sonst. Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren, er brüllte, wenn der Chef die Bons hereinschickte, und achtete darauf, daß er sich nicht verbrannte. Um ein Haar hätte er ein Rippenstück versaut und schimpfte ununterbrochen leise vor sich hin. Er dachte daran, wie beschissen sein Leben ein paar Wochen lang sein würde. Es war schon nicht ohne, an sie zu denken und sie zu besuchen, wenn sie gesund war, aber jetzt. Was für ein Schlamassel, verflucht. Das hatte gerade noch gefehlt. Er hatte sich eben erst ein sündhaft teures Motorrad gegönnt, mit einem endlos langen Kredit, und sich für zahlreiche Extraschichten verpflichtet, um die Raten zahlen zu können. Wo sollte er sie in alledem noch unterbringen? Na ja… Er wollte es sich nicht eingestehen, aber er freute sich auch über den glücklichen Zufall. Der dicke Titi hatte seine Maschine frisiert, und er würde sie auf der Autobahn ausprobieren können.
Wenn alles gutging, würde er seinen Spaß haben und wäre in gut einer Stunde da. Er blieb während der Pause also allein mit den Tellerwäschern in der Küche. Rührte seinen Fond, machte eine Bestandsaufnahme seiner Waren, numerierte die Fleischstücke durch und hinterließ Guillaume eine lange Nachricht. Er hatte nicht die Zeit, noch einmal zu Hause vorbeizuschauen, er duschte in der Umkleide, suchte nach etwas, um sein Visier zu reinigen, und zog konfus davon.
Glücklich und sorgenvoll zugleich.
6
Es war noch keine sechs Uhr, als er sein Motorrad auf dem Krankenhausparkplatz abstellte.
Die Dame am Empfang teilte ihm mit, daß die Besuchszeit vorbei sei und er am nächsten Tag ab zehn Uhr wiederkommen könne. Er insistierte, sie wurde bockig.
Er legte seinen Helm und seine Handschuhe auf die Theke:
»Warten Sie, warten Sie… Sie haben nicht ganz verstanden…« versuchte er es, ohne sich aufzuregen, »ich komme aus Paris und muß nachher wieder zurück, wenn Sie mich also…«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!