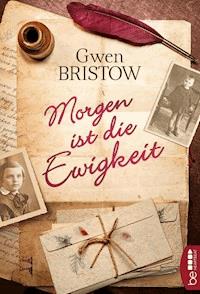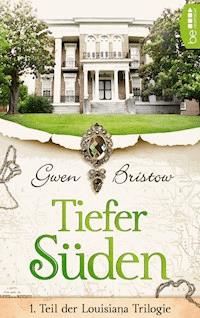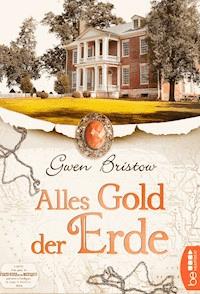
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1847 wurde Kalifornien über Nacht ein Mekka für Glücksuchende, Abenteurer und Tunichtgute. Als die junge Kendra Logan in San Francisco eintrifft wird auch sie von der Stimmung angesteckt.
Auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück lernt Sie Liebe, Hass und Leidenschaft kennen. Wird sie es schaffen, sich trotz aller Verlockungen selbst treu zu bleiben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
1847 wurde Kalifornien über Nacht ein Mekka für Glücksuchende, Abenteurer und Tunichtgute. Als die junge Kendra Logan in San Francisco eintrifft wird auch sie von der Stimmung angesteckt.
Auf der Suche nach ihrem persönlichen Glück lernt Sie Liebe, Hass und Leidenschaft kennen. Wird sie es schaffen, sich trotz aller Verlockungen selbst treu zu bleiben?
Über die Autorin
Gwen Bristow wurde am 16. September 1903 als Tochter eines Pastors in Marion, South Carolina/USA geboren. Sie besuchte die Pulitzer School für Journalismus und arbeitete als Reporterin. 1929 veröffentlichte sie ihren ersten Roman und wurde durch ihre Südstaaten-Romane weltbekannt. Sie starb 1980.
Gwen Bristow
Alles Gold der Erde
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Claus Velmeden
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Mohrbooks AG Literary Agency, Zürich
Titel der Originalausgabe »Calico Place«
Copyright © 1970 by Gwen Bristow
Copyright der deutschen Erstausgabe © 1979 by Franz-Schneekluth-Verlag, Darmstadt
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: KennStilger47 | allegro | Marzolino | Davor Ratkovic | sniegirova mariia | Molodec
E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2775-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Namen,Charaktere und Handlungenin diesem Romansind frei erfunden –ausgenommen historischePersönlichkeiten
1
Die Cynthia fuhr nach Kalifornien. Sie war ein schönes Schiff. In den Großsegeln sang der Wind, und die Galionsfigur – eine weiße Göttin – war mit einem Halbmond verziert. Das Schiff hatte New York im Oktober 1847 verlassen. Seit zwei Monaten segelte es auf Südkurs und näherte sich nun Kap Hoorn.
Kendra Logan stand auf dem Achterdeck und betrachtete das graue Meer ringsum. Kendra war neunzehn. Sie hatte eine schlanke und feste Figur. Ihr Gesicht war nicht gerade strahlend schön, doch war es immerhin ein Gesicht, das sich die Leute zweimal ansahen. Ihre Nase war wohlgeformt, ihr Kinn eigenwillig und ihr Mund heiter. Ihre tiefblauen Augen wurden von schwarzen Wimpern umschattet. Ihr dunkler Haaransatz wuchs spitz wie ein Pfeil aus ihrer Stirn. Wenn es ihnen gelang, hauchten die Männer gern einen schnellen Kuss auf diese Strähne – ein Küsschen in Ehren natürlich, so wie man seine ehemalige Lehrerin küsst oder seine Tante. Das behaupteten sie wenigstens.
Kleid, Mantel, Schal – alles war so blau wie ihre Augen, und alles flatterte im Wind. Als eine besonders heftige Bö sie traf, wandte sich Kendra von der Reling ab und blickte zu den Männern hinauf, die sich an den Segeln zu schaffen machten. Ihre Gestalten zeichneten sich hoch am Himmel ab.
Diese Männer hatten noch nie mit ihr geplaudert, und sie würden dies auch künftig nicht tun. In den Kabinen und auf dem Achterdeck hatten die Seeleute nichts zu suchen. Die Passagiere wiederum hatten woanders nichts zu suchen. Die Arbeit der Matrosen war so hart, dass sie kaum noch die Energie zu sehnsüchtigen Träumen aufbrachten. Als Kendra jedoch zu ihnen aufschaute, wobei der feuchte Nebel sich wie Perlchen in ihren Wimpern einnistete, hielt ein Seemann droben in der Takelage inne und starrte verlangend auf sie herab. Es war ein großer Bursche mit einem rostfarbenen Bart. Er fing ihren Blick auf und grinste sie an. Seine unverfrorene Haltung schien zu sagen: Mädel, du kannst mir schließlich keinen Vorwurf daraus machen, dass ich dich anglotze.
Kendra wusste, dass sie dieses Lächeln nicht zu beantworten brauchte; sie tat es aber doch. Als das Grinsen des Mannes immer unverschämter wurde, schlug sie allerdings ihre Augen nieder und kehrte sich wieder der See zu. Während der acht Wochen, die sie jetzt an Bord waren, hatte ihre Mutter sie oft genug gewarnt: Sie solle so tun, als wären die Matrosen gar nicht da. Kendra vermutete, dass diese Warnung berechtigt sei; dennoch wünschte sie, es wäre anders. Es müsste eigentlich ganz spaßig sein, den Mann da oben kennenzulernen. Sie fragte sich, wie ihm wohl auf diesem kalten grauen Meer zumute sein mochte, auf dieser Fahrt nach einem trostlosen Land am Ende der Welt.
Aber er war ja aus freien Stücken auf diesem Schiff, was sich von ihr nicht behaupten ließ. Die Vereinigten Staaten führten Krieg mit Mexiko, und ihr Stiefvater, der Oberst Alexander Taine, war in eine Stadt namens San Francisco versetzt worden. Er hatte die Fahrt auf einem Truppentransporter gemacht, wo es keinen Platz für Frauen gab. Deshalb folgten ihm nun Kendra und ihre Mutter auf der Cynthia, die – obgleich ein Handelsschiff – einige Passagiere mitnahm. Kendras leiblicher Vater war jung gestorben, und sie war in Internatsschulen aufgewachsen. Jetzt aber war die Schulzeit zu Ende, und zum ersten Mal würde sie mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zusammenwohnen, und zwar auf vorgeschobenem Posten bei der Armee.
Diese Aussicht gefiel ihr ganz und gar nicht. Trotz aller schönen Worte, mit denen man ihr die Reise schmackhaft gemacht hatte, wusste sie sehr gut, dass sie nicht allzu gern gesehen wurde. Die beiden hatten viele Jahre ohne sie gelebt, und sie nahmen sich ihrer jetzt nur deshalb an, weil sie nicht länger in der Schule versteckt werden konnte und weil es sonst niemanden gab, der sie hätte haben wollen. Kendra war jung und unerfahren, aber sie war durchaus nicht dumm. Schon seit Langem war sie entschlossen, sich keine Sorgen um sich selber zu machen. Sie kam jedoch nicht gegen den Wunsch an, einen Menschen zu kennen, der sich darum kümmerte, was aus ihr wurde.
Während sie nun hier im Sturm stand, der sie nach Kalifornien hinaufjagen würde, fragte sich Kendra, wie das Leben dort wohl sein werde. Sie konnte sich keinerlei Vorstellungen machen. Mit ihrer Mutter war sie niemals lange beisammen gewesen, und den Obersten Taine kannte sie so gut wie überhaupt nicht. Und was nun dieses Kalifornien anlangte, so wusste niemand etwas darüber. Die Hälfte der Kongressmitglieder hatte bereits erklärt, es lohne sich nicht, dieses Land zu erwerben, und die Entsendung einer Armee bedeute nur, dass das Geld der Steuerzahler zum Fenster hinausgeworfen werde.
Kendra lauschte dem Klatschen des Wassers und dem Knirschen der Taue, und sie dachte an die Galionsfigur des Schiffes, an die Göttin mit dem Halbmond. Von hier aus vermochte Kendra sie nicht zu sehen; sicher war ihr gleißendes Weiß jetzt so grau wie die Wolken. Nahe Kap Hoorn war es stürmisch und düster. Des Nachts schwankten geisterhafte Lichter durch die Finsternis. Loren Shields, der fröhliche junge Frachtaufseher der Cynthia, hatte ihr erzählt, die Seeleute glaubten, diese Lichter seien wandernde Seelen. Nein, Loren selber wusste nicht, woher sie kamen; er glaube nicht, dass jemand ihren Ursprung kannte, aber er war überzeugt, dass es sich nicht um Gespenster handelte.
Eine Luke wurde zugeschlagen, und Kendra sah Loren Shields auf Deck erscheinen. Er war in seinen dicken Mantel eingemummelt, seine Wangen waren gerötet, und sein helles Haar wehte im Wind. Er winkte Kendra und kam auf sie zu. Wenngleich er immerhin bereits sechsundzwanzig Jahre zählte, war er doch der Typ, den Kendra als »netten Jungen« bezeichnete. Er war kein aufregender junger Mann, aber sie konnte ihn gut leiden. Es war freilich fast unmöglich, ihn nicht gern zu haben, weil er einfach so nett war, so höflich, so freundlich, so gefällig. Er lieh ihr Bücher und weihte sie in die Meereskunde ein; auch hatte er oft Zeit für ein Spielchen. Es hatte Kendra überrascht, dass er dazu Muße fand, aber Loren hatte ihr erklärt, »Frachtaufseher« bedeute genau, was das Wort sage: Er hatte sich um die Fracht zu kümmern, deshalb habe er in den Häfen viel, auf See dagegen häufig nichts zu tun.
Als er die Reling erreichte, schlingerte das Schiff, und beide wurden von einem Brecher übergossen. Loren hielt sich mit einer Hand an der Reling, während er mit der anderen Kendras Arm umfasste. Sobald sie wieder fest auf den Beinen stand, lockerte er seinen Griff und deutete aufs Meer. In der Ferne, halb vom Nebel verhüllt, war ein riesiger gezackter Felsen zu erkennen, der sich aus dem Wasser hob.
Loren brachte seinen Mund nahe an das blaue Halstuch, das sich Kendra um den Kopf gewickelt hatte, und schrie im Toben des Sturms:
»Das ist Kap Hoorn!«
Kendra war kein furchtsames Mädchen, doch jetzt erschauerte sie. Kap Hoorn ragte etwa vierhundertfünfzig Meter hoch aus dem Meer. Sie wusste, dieser südlichste Zipfel von Südamerika trennte den Atlantischen vom Pazifischen Ozean. Unentwegt wüteten hier die Stürme. Fast immer fegten sie von West nach Ost den Schiffen entgegen, die sich die Passage erzwingen mussten. Und dies stand nun der Cynthia bevor. Als jedoch Loren das Zittern Kendras bemerkte, lächelte er sie beruhigend an.
»Kein Grund zur Angst!«
Kendra erinnerte sich, dass Loren Kap Hoorn schon einmal umfahren hatte.
Jetzt sprach er weiter:
»Es ist kalt hier oben. Gehen wir hinunter ins Warme.«
Einmal, als die Cynthia schlingerte und Kendra beinahe hingestürzt wäre, packte Loren sie beim Ellbogen, ließ sie jedoch – wie schon auf Deck – gleich wieder los. Loren behandelte eine Frau mit Respekt; er hatte nichts Dreistes an sich wie dieser Seemann, der sie aus der Takelage angefeixt hatte. Aber sie meinte immer noch, es müsse ganz lustig sein, mit dem Mann zu plaudern.
Als sie den Sturm hinter sich hatten und wieder ruhig sprechen konnten, sagte Loren, um sie zu ermutigen:
»Wir werden nicht in Schwierigkeiten geraten, Kendra. Ein besseres Schiff als die Cynthia gibt es gar nicht, und Captain Pollock ist der beste Nautiker, der je gelebt hat.«
Was für ein netter Junge, dachte Kendra zum hundertsten Mal. Loren fuhr fort:
»Außerdem ist da noch ein anderer Grund … ich meine … na ja, es wird schon klappen.«
Großer Gott, er wurde ja rot, stellte Kendra fest, oder kam diese Verfärbung von dem Sturm? Doch statt auszusprechen, was er hatte sagen wollen, drängte er sie in die Kabine. Dort fanden sie Kendras Mutter, Eva Taine, und die beiden anderen Passagiere, Bess und Bunker Anderson. Die Andersons waren in mittleren Jahren und lebten in Honolulu, wo er die Filiale einer New Yorker Handelsgesellschaft leitete. Die drei hatten Karten gespielt, doch damit aufgehört, als die See immer rauer geworden war. Eva nähte; sie begrüßte Kendra mit einem hellen Lächeln. Das tat sie übrigens immer. Kendra lächelte zurück. Das tat sie übrigens immer. Kendra und ihre Mutter waren nie ungezwungen miteinander ausgekommen, aber sie taten wenigstens so.
Eva war fünfunddreißig. Sie hatte keine Ähnlichkeit mit ihrer Tochter; Kendra sah wie ihr Vater aus, an den sie sich nicht erinnern konnte. Eva war in der Tat eine schöne Frau. Mit ihren großen dunklen Augen und ihrem stets glatten und glänzenden braunen Haar strahlte sie eine anmutige Gelassenheit aus. Es überraschte niemanden, dass sie die Frau eines Obersten war. Als Loren berichtete, Kap Hoorn sei in Sichtweite, legte Eva ihre Arbeit zur Seite und erklärte, sie wolle sich diesen berühmten Felsen einmal ansehen. Bess und Bunker Anderson erboten sich, sie zu begleiten. Loren sagte, er habe einige Berichte zu prüfen und ging in sein Quartier. Kendra legte Mantel und Schal ab und setzte sich.
Die gemütliche Kabine der Cynthia war mit Hartholz getäfelt; durch das Oberlicht fiel tagsüber Licht ein; abends steckten sie eine Lampe mit Walfischtran an. Der Steward servierte die Mahlzeiten unter diesem Oberlicht, wo Captain Pollock am Kopfende der Tafel saß und die Offiziere und Passagiere die Längsseiten einnahmen. Ihre Stühle waren festgeschraubt, damit sie bei stürmischem Wetter nicht den Halt verloren. In Erzählungen über das Meer hatte Kendra gelesen, dass man auf langen Reisen bloß Salzfleisch und Schiffszwieback bekomme, und sie war erstaunt gewesen, dass die Speisen an Bord so gut waren. Natürlich erhielten sie Salzfleisch, aber zur Abwechslung auch Frischfleisch, denn sie hatten lebende Schweine und Geflügel in Verschlägen auf dem Vorschiff. Außerdem gab es Käse, Wurst, geräucherten Fisch, Kartoffeln, Zwiebeln, Erbsensuppe, Kohl und Trockenfrüchte. Bei besonderen Anlässen brachte Captain Pollock sogar eine Karaffe Wein, obwohl er selbst nie einen Tropfen trank.
Kendra interessierte sich für das Essen. Sie kochte nämlich gern. Oft probierte sie neue Rezepte aus und erfand auch welche. Aus Resten, die keiner mehr haben mochte, bereitete sie schmackhafte Gerichte. Wenn sie die Ferien im Haus ihrer Großmutter verbracht hatte, war sie immer in die Küche gegangen, sobald es ihr zu langweilig geworden war.
Doch hier auf der Cynthia konnte sie natürlich nicht kochen. Und nähen wollte sie nicht. Kendra hasste es geradezu, mit Nadeln zu hantieren, und sie war eine resolute junge Person. Entweder machte sie etwas richtig, oder sie machte es gar nicht. Für Halbheiten war sie nicht zu haben.
Ihre Mutter konnte ebenso gut nähen wie stricken und sticken, und sie hatte schon viele Handarbeiten gemacht, seit sie in New York ausgelaufen waren. Auf dem Tisch lag ihr derzeitiges Stück: eine Handtasche aus braunem Leinen, die sie mit ihren Initialen bestickt hatte, und zwar in einem Muster von Herbstblumen. Eva vergeudete nie ihre Zeit. Sie hat immer recht, dachte Kendra rebellisch. In ihrem ganzen Leben hatte sie nur ein Mal Unsinn gemacht, und dieser Unsinn war ihre Heirat mit Kendras Vater gewesen.
Es war ihr mit fünfzehn Jahren passiert. Eva lebte in Baltimore. Sie war das jüngste Kind der Familie und das einzige Mädchen, hübsch, verhätschelt und gewöhnt, seinen Willen durchzusetzen. Eines Morgens ritt sie mit einem achtzehnjährigen Jungen namens Baird Logan durch die Gegend. Eva und Baird bildeten sich ein, sie liebten einander, und beschlossen im Handumdrehen, durchzubrennen und zu heiraten – was für ein verteufelt romantisches Abenteuer musste das doch sein! Also begaben sie sich schnurstracks zu dem Friedensrichter einer benachbarten Kleinstadt, machten sich ein paar Jahre älter, und der Richter, ein närrischer alter Mann mit schwachen Augen, nahm ihre Flunkereien für bare Münze und traute sie. Eva jagte nach Hause, packte ein paar Kleider, kritzelte eine Notiz und stahl sich ungesehen davon. Und auf ging’s zu einer Spritztour. Das waren ihre Flitterwochen.
Nach acht Tagen hatten ihre entsetzten Eltern sie jedoch schon aufgestöbert und wieder heimgeholt. Die beiden Väter wandten sich an einen Advokaten, der dafür sorgen sollte, dass die Ehe annulliert wurde. Baird und Eva erhoben keine Einwände; sie waren bereits enttäuscht von ihrer Eskapade und wollten nichts mehr voneinander wissen. Doch ehe das Annullierungsverfahren begann, entdeckte Eva, dass sie ein Kind bekommen würde.
Sie weinte und tobte. Die beiden Väter rannten im Flur auf und ab und fragten sich, wie um alles in der Welt sie diesen Skandal ertragen sollten. Die beiden Mütter stöhnten und jammerten über ihre Sprösslinge. »Nach allem, was ich für dich getan habe, ist das nun der Dank …«
Aber die Tatsachen waren nicht zu ändern. Baird und Eva mussten wohl oder übel beisammenbleiben. Die Eltern brachten sie in einem hübschen kleinen Haus unter. Bairds Vater erklärte, sein Sohn könne in das Importgeschäft der Familie eintreten. Doch trotz alledem blieb das hübsche kleine Haus eine Art Gefängnis. Eva war knapp sechzehn, als Kendra geboren wurde. Zu dieser Zeit hasste sie Baird, und Baird hasste seine junge Ehefrau nicht minder. Ständig lagen sie sich in den Haaren. Baird fing zu trinken an, und eines Nachts – Kendra war gerade ein Jahr alt – ritt er in einem Wintersturm von einem feuchtfröhlichen Fest nach Hause und zog sich eine Lungenentzündung zu. Ein paar Tage später war er tot.
Bairds Mutter, eine Frau mit Verstand, behauptete, es sei ihre Pflicht, Kendra zu sich zu nehmen, weil Eva eine Närrin sei, und Evas Mutter wiederum müsse ebenfalls eine Närrin sein, sonst hätte sie nicht eine solche Närrin von Tochter großgezogen. Eva war froh, ihr ungewünschtes Kind loszuwerden, aber die Großmutter wollte Kendra nicht haben. Schließlich tat sie gerade das Notwendigste, und sobald Kendra alt genug war, wurde sie in eine New Yorker Schule gesteckt.
Kein Mensch hatte Kendra all dies jemals erzählt. Jedermann war nett zu ihr. Ihre Großeltern, ihre Tanten und Onkel, die Freunde der Familie – alle erwachsenen Leute waren nett. Aber erwachsene Leute reden. Sie lassen Bemerkungen fallen, wenn man mit seiner Puppe auf dem Fußboden sitzt. Sie sehen sich vielsagend in die Augen. Sie schütteln traurig die Köpfe. Man ist ja bloß ein Kind. Sie meinen, man verstehe sie nicht. Aber man versteht doch. Solange sie sich entsinnen konnte, hatte Kendra gewusst, dass sie ein Kind war, das keiner haben wollte. Als Kendra vier Jahre wurde, heiratete Eva, die Mutter, diesen Alexander Taine, und die beiden reisten zu einem Stützpunkt westlich des Mississippi, wo die Armee die Grenzen gegen Indianer sicherte. Das sei kein Ort für ein kleines Mädchen, sagte Eva. Alex stimmte ihr zu. Er interessierte sich nicht für Kendra. Er hatte sie noch nie gesehen, und er hoffte auf eigenen Nachwuchs. Und darin wurde er nicht getäuscht, denn Eva gebar ihm zwei hübsche Buben. In diesem Jahr hatten sie die beiden in New York zurückgelassen, in Kalifornien gab es keine Schulen, und Alex wünschte, dass Eva mit ihm komme.
Kendra hatte ihren Stiefvater Alex in all den Jahren nur drei- oder viermal getroffen, wenn er mit seiner Frau Freunde im Osten der Vereinigten Staaten besuchte. Sie hatte jedoch festgestellt, dass er keineswegs Baird Logan glich. Alex war Absolvent der Kadettenanstalt West Point gewesen. Er war weder leichtsinnig noch impulsiv; er teilte sich die Zeit genau ein und zahlte seine Rechnungen pünktlich und tat, was von ihm erwartet wurde. Und so verhielt es sich auch mit Eva. Denn Eva hatte etwas gelernt; nie wieder würde sie sich hereinlegen lassen. Sie hatte mit Alex in verschiedenen Grenzorten gelebt, und das gefiel ihr. Es war ein Abenteuer, aber ein sicheres Abenteuer; in einer Grenzgarnison hatte sie die gesamte Armee der Vereinigten Staaten hinter sich.
Wenn Eva zuweilen nach New York gekommen war, hatte sie Kendra zu einer Ausfahrt abgeholt. Manchmal hielten sie irgendwo an und kauften Eis und Makronen. Nie wussten sie, was sie sich eigentlich sagen sollten, und beide fühlten sich erleichtert, wenn die Sache hinter ihnen lag. In den Ferien ging Kendra zu ihrer Großmutter.
Und dann, im letzten Sommer, war Kendras Schulzeit abgelaufen. Sie war wieder zur Oma nach Baltimore zurückgekehrt, und just zu dieser Zeit wurde Alex nach San Francisco abkommandiert. Nachdem er sich mit den Truppen eingeschifft hatte, hatte Eva eine Einzelkabine auf der Cynthia gebucht. Doch während sie noch in New York auf die Abfahrt des Schiffes wartete, wurde Kendras Großmutter vom Schlag getroffen und starb.
So also kam es, dass Kendra nun unterwegs nach San Francisco war. Ihre anderen Großeltern, die Eltern ihrer Mutter, waren schon vor einigen Jahren gestorben, und es gab niemanden, dem Eva ihre Tochter hätte anvertrauen können. Kendras Tanten und Onkel waren so nett wie immer. Sie meinten, da dieser Todesfall nun einmal eingetreten sei, müsse man es geradezu als eine Gnade ansehen, dass Kendras Mutter zufällig da war und sich um das liebe Mädchen kümmern konnte. Mit andern Worten: Nichts lag ihnen ferner, als sich mit Evas Range zu befassen.
Eva kam nach Baltimore, anmutig und schön gekleidet wie immer. »Ich werde Alex sofort schreiben«, erklärte sie, »und den Brief werde ich einem der Kuriere mitgeben, die Armeedepeschen befördern. Ich bin entzückt, dass ich meine charmante Tochter jetzt bei mir habe.«
Wie die Tanten und Onkel, meinte sie nicht, was sie sagte. Eva fand ihre Tochter mitnichten charmant. Andere Leute mochten ihretwegen Kendras blaue Augen und dunkles Haar bewundern; Eva dachte nichts dergleichen. Kendra sah genauso aus wie Baird Logan, und jeder Blick auf Kendra gemahnte Eva an den Kummer, den sie sich selber zugefügt, als sie mit ihm davongelaufen war.
Kendra saß in der Kabine der Cynthia. Es fiel ihr wieder ein, was Eva in der ihr eigenen taktvollen Weise vorgeschlagen hatte: Sie möge doch ihren Familiennamen Logan ablegen und sich stattdessen Taine nennen. »Solange du mit deiner Großmutter zusammengelebt hast, die Logan hieß, war es selbstverständlich, dass auch du dich Logan nanntest. Aber ich bin Mrs. Taine. Wenn du deinen Namen als Logan angibst – nun, das wird die Leute verwirren. Du verstehst mich doch?«
Allerdings, Kendra verstand. Sie wusste, ihre Mutter betrachtete ihre erste Ehe als eine kindische Narretei, von der sie möglichst nichts mehr hören wollte. Kendra nahm ihr das übel. Und Kendra fehlte nicht nur das Äußere ihrer Mutter, auch im Wesen hatte sie wenig gemein mit ihr. Eva besaß Takt und Würde, Kendra hingegen war so geradeheraus wie ein Sturmwind. Sie sagte immer unverblümt, was sie dachte. Also hatte sie bockig geantwortet:
»Ich werde niemandem sagen, dass ich Taine heiße. Vielleicht schämst du dich wegen Baird Logan. Ich schäme mich nicht. Er war mein Vater, und mein Name ist Logan, und so werde ich mich auch nennen, bis ich einmal heirate.«
Eva wusste stets, wenn sie die Unterlegene war. Mit einem freundlichen Lächeln entgegnete sie:
»Gut, Kendra.«
Und damit war die Angelegenheit erledigt. Dieses freundliche Lächeln Evas gehörte zu der Heuchelei, die es ihnen erlaubte, miteinander auszukommen. Kendra hasste jedoch das Heucheln.
»Nun«, fragte Loren plötzlich neben ihr, »warum so düster?« Kendra fuhr zusammen. Loren blickte lächelnd auf sie herab. Er sah so liebenswürdig aus, fast wie ein Bruder, dass sie den Wunsch verspürte, mit ihm zu plaudern. Aber es fiel ihr natürlich nicht im Ernst ein, ihm von diesen Dingen zu erzählen. Sie verabscheute Menschen, die jammerten, und Loren würde sie sowieso nicht verstanden haben. Er war in einer Kleinstadt New Englands aufgewachsen. In seinem Elternhaus war es unbekümmert zugegangen; vor großen Kaminen und auf bequemen alten Möbeln hatte eine Menge Kinder gespielt, die von ihren Eltern innig geliebt wurden. Er würde die Einsamkeit ihres Lebens gar nicht begreifen können. »Loren, ich habe gerade überlegt: Wie weit ist es von New York bis San Francisco?«
In solchen Fragen kannte Loren sich aus. Er antwortete:
»Auf dem Weg um Kap Hoorn siebzehntausend Meilen.«
Kendra legte den Kopf auf die Seite. »Ein weiter Weg. Er ist so weit, dass ich fast Angst kriege. Ich habe das Gefühl, als wäre ich ein reines Nichts – so völlig unwichtig.«
»Aber Sie sind wichtig!«, entgegnete Loren impulsiv. »Hier auf der Cynthia sind Sie wichtiger, als Sie überhaupt wissen.« Er verstummte und sprach erst nach einer Weile weiter. »Aber es wird jetzt spät. Ich sollte mich besser erkundigen, ob der Captain Befehle für mich hat.«
Er ging hinaus. Kendra starrte ihm mit gerunzelter Stirn nach. Jetzt hatte er schon zum zweiten Mal etwas sagen wollen und es doch nicht getan. Sie wunderte sich. Was meinte er damit: Sie sei auf der Cynthia wichtiger, als sie überhaupt wisse …
2
Jetzt begann der Kampf um Kap Hoorn. Tag um Tag ächzte und taumelte die Cynthia gegen den Sturm an, um die Einfahrt in den Pazifik zu finden.
Die Matrosen zerrten an den dicken Tauen. Das Meer warf eisige Wogen über die Planken, es blendete und erstickte die Männer beinahe, das Salzwasser schnitt in ihre aufgerissenen Hände. Unter Deck krallten sich die vier Passagiere an ihre Stühle, sonst wären sie wie Murmelsteine durch den Raum gerollt. Es war nicht geheizt, und nachts brannte kein Licht, denn es wäre zu gefährlich gewesen, bei diesem rasenden Seegang die Öllampen anzuzünden. Tagsüber saßen sie unter dem trüben Oberlicht; nachts war es so dunkel, dass Kendra meinte, die Finsternis fast mit Händen greifen zu können. Sie legten sich wie gewöhnlich in ihre Kojen, aber sie fanden nicht viel Schlaf: Das stürmische Gewoge hielt sie meist wach.
Jetzt freilich bestand ihr Essen tatsächlich aus Zwieback und kaltem, sehr kaltem gesalzenem Rindfleisch. Sonst gab es nichts, denn es war dem Koch nahezu unmöglich, einen Topf auf dem Herd stillzuhalten. Hin und wieder brachte er es fertig, Kaffee zu kochen, doch auf Weisung des Captains wurde er zu den mühsam kämpfenden Männern gebracht.
Am Morgen des vierten Tages war es mit Kendras Nerven nicht mehr gut bestellt. Die Nacht war so schlimm gewesen, dass sie überall am Körper Schmerzen verspürte, und sie war ebenso froh wie ihre Mutter, als es Zeit zum Aufstehen war und sie in die Kabine gehen konnte. Der Steward servierte ihnen wieder einmal gesalzenes Rindfleisch, Zwieback und Wasser, das nach Rost schmeckte, denn es lagerte nun schon lange im Tank. Dann kam der Erste Offizier herein, aß hastig und verschwand wieder. Captain Pollock war noch auf Deck.
Kendra umklammerte ihre Stuhllehne.
Wie verloren waren sie doch in dieser schrecklichen Wasserwüste. Wie viele Schiffe mochten schon in diesen Strudeln zerschellt sein, durch die sich nun die Cynthia ihren Weg bahnen musste. Selbst die Namen all jener Menschen, denen die Felsen des Kap Hoorn die Knochen zerschmettert hatten, waren verschollen.
Ihr gegenüber saßen ihre Mutter und die Andersons; mit grimmigen Mienen ertrugen sie das stetige Auf und Ab. Loren tauchte auf und setzte sich neben Kendra.
»Die Männer oben haben keine Angst«, berichtete er. »Die Hälfte von ihnen ist schon einmal unter dem Kommando von Captain Pollock gefahren. Wenn sie zu ihrem alten Captain zurückkehren, dann ist dies das höchste Lob, das sie ihm zollen können.«
Kendra lächelte. Es gelang ihm, sie ein wenig aufzuheitern. Loren, der gleichfalls schon unter Pollock gesegelt war, fuhr fort:
»Er ist ein strenger Mann, aber ich war froh, dass er mich wieder haben wollte. Ein junger Bursche kann bei einem Captain wie ihm eine Menge lernen.«
Jetzt betrat auch Pollock die Kabine und bat Loren, er möge ihm durch den Steward sein Frühstück bringen lassen. Den Passagieren hatte er bloß zugenickt. Der Steward servierte ihm Fleisch mit Zwieback. Er kaute stumm. Er aß nur, weil er essen musste. Seine Gedanken waren bei seinem Schiff.
Pollock war sechsunddreißig Jahre alt, ein kräftig gebauter Mann mit wetterhartem Seemannsgesicht und scharfen Augen. Sein Haar und sein Bart waren kastanienbraun, seine Hände groß und stark, seine Schultern breit. Seine blaue Marineuniform, seine weißen Hemden und seine schwarzen Stiefel wurden vom Steward in Ordnung gehalten. Jetzt aber war seine Uniform klatschnass, Haar, Bart und Brauen waren von gefrorenem Salzwasser verkrustet. Er hatte weder Zeit zum Ausruhen noch zum Reden.
Sobald Pollock seine Mahlzeit beendet hatte, verließ er die Kabine und stieg an Deck.
Er schien geistesabwesend zu sein, war aber offensichtlich unbesorgt. Er sah aus wie ein Mann, der seine Pflichten hat. Kendra dachte, sein bloßer Anblick flöße einem schon Zuversicht ein. Sie sagte dies Loren, der sich wieder auf den Stuhl neben ihr gesetzt hatte.
Loren nickte. Pollock fahre seit seinem sechzehnten Jahr zur See, berichtete er. »Er ist Kapitän seit dem fünfundzwanzigsten Jahr. Er hat die Welt viermal umsegelt, und nicht ein einziges Mal ist die Versicherung genötigt gewesen, auch nur einen Dollar zu zahlen. Schließlich ist diese prächtige Cynthia eigens für ihn gebaut worden. Jetzt macht sie die Jungfernfahrt.«
»Und wie er dieses Schiff liebt!«, rief Loren aus.
Während er weitersprach, blickte er über den Tisch zu Bunker Anderson, der seiner Frau und Eva gerade einen Witz über seinen Chinahandel zum Besten gab. Loren senkte die Stimme:
»Kendra, neulich hatte ich Ihnen fast etwas gesagt. Im letzten Moment aber habe ich geglaubt, es sei besser, den Mund zu halten. Doch jetzt denke ich anders darüber. Sie werden sich dann weniger Gedanken machen. Also: Captain Pollock ist froh, dass er Sie an Bord der Cynthia hat.«
Sie krauste die Stirn. »Sie meinen, er sieht mich lieber als die anderen?«
Loren nickte. Nachdem er ein zweites Mal über den Tisch geschaut hatte, um sicher zu sein, dass die andern ihn nicht hören konnten, fügte er hinzu:
»Sie bringen ihm Glück.«
Kendra machte vor Erstaunen große Augen. »Ich? Wieso denn das?«
Er antwortete schlicht:
»Weil Sie ein unschuldiges junges Mädchen sind.«
Kendra brach in Lachen aus. Sie war ein unschuldiges junges Mädchen, das stimmte; wie hätte sie in ihrem wohl behüteten Dasein auch Gelegenheit finden sollen, ihre Unschuld zu verlieren? Sie besaß indessen praktischen Verstand. Dass der Captain glaubte, ihre Anwesenheit bringe der Cynthia Glück, fand sie absurd.
»Ach, Loren«, sagte sie, »Sie werden doch nicht solches Zeug glauben?«
Loren entgegnete in nüchternem Ton:
»Kendra, ich spreche von dem, was Captain Pollock glaubt. Ich weiß, dass er einmal einen Passagier von Bord gewiesen hat, weil er der Meinung war, dieser Mensch sei einer von jenen Gesellen, die für sein Schiff nicht gut genug sind. Und jetzt, da er die Cynthia kommandiert, ist er strenger denn je.«
Da sie noch immer verblüfft war, versuchte Loren, ihr die Situation auseinanderzusetzen. »Für Pollock«, sagte er, »ist ein Schiff ein lebendiges Wesen. Natürlich haben nicht alle Schiffe denselben Wert, ebenso wenig wie das bei den Menschen der Fall ist. Viele dreckige Walfangschiffe verdienen nichts Besseres als Schmieröl und Seeleute aus Hafenkneipen. Wenn jedoch ein Kapitän mit einem schönen Schiff wie mit Ausschussware umgeht, ist dies ungefähr so, wie wenn eine schöne Frau missbraucht wird. Die Frau kann eine solche Beleidigung niemals vergessen. Ein stolzes Schiff auch nicht. Pollock respektiert seine Schiffe nach Gebühr, und sie danken es ihm. Daran glaubt er fest, und er macht daraus gar kein Geheimnis. Wenn andere Kapitäne ihn deswegen auslachen, verweist er nur auf sein Logbuch.
Und das Merkwürdige ist, dass er sich an Land ganz anders gibt. In den Hafenstädten trinkt er gern, verspielt ein paar Dollar, trifft sich mit Mädchen und lässt Gott einen guten Mann sein. In Honolulu gibt es einen Spielsalon, den er oft besucht. Die Leute behaupten, er himmele die Empfangsdame an.«
Kendra war amüsiert und erstaunt. An Bord war Captain Pollock so unnahbar und enthaltsam; sie wünschte, einmal beobachten zu können, wie er mit dieser Empfangsdame umsprang.
Doch Loren war noch nicht fertig:
»Er möchte sie aber um alles in der Welt nicht auf der Cynthia haben. Er glaubt, ein Mädchen wie sie würde das Schiff beleidigen, und das Schiff würde dann ihn dafür bestrafen.«
Loren grübelte eine Weile vor sich hin.
»Wie gesagt, an Land ist ihm die Gesellschaft von Frauen nicht unlieb. Verheiratet war er übrigens nie. Es ist auch nicht bekannt geworden, dass er jemals in eine ernste Liebesaffäre verstrickt war. Sein ganzes Leben lang hat er nur Schiffe geliebt. Sein ganzes Leben lang hat er von dem vollkommenen Schiff geträumt. Jetzt hat er es offenbar bekommen.«
Kendra nickte.
»Sie nehmen die Sache immer noch nicht ernst? Nun, vielleicht haben Sie recht. Aber ich habe Ihnen diese Geschichte erzählt, weil ich nicht möchte, dass Sie sich hier am Kap Hoorn Sorgen machen. Captain Pollock versteht sein Handwerk; und da er Sie an Bord hat, ist seine Sicherheit noch größer. So etwas kann eine wirkliche Hilfe sein, Kendra.«
Kendra blickte ihn an. »Ich bin nicht mehr ängstlich, Loren.«
Und so war es auch. Ob es nun auf Lorens Erzählung zurückzuführen war oder auf die Selbstsicherheit Pollocks, sie verspürte tatsächlich keine Angst mehr. Den Rest des Tages über lauschte sie dem Knirschen der Taue, dem Knattern der Segel und den Schreien der Matrosen im Sturm. Diese Männer waren stark und geschickt, und Captain Pollock – mochte er auch ein paar sonderbare Eigenheiten haben – war der rechte Mann am rechten Platz. Deswegen würde sich die Cynthia auch erkenntlich zeigen – und nicht etwa deshalb, weil sich eine Jungfrau unter den Passagieren befand. An diesem Abend, kurz vor Mitternacht, vernahm Kendra einen Schlag, als sei eine Luke laut zugeknallt worden. Captain Pollock betrat die Kabine und brachte den Geruch von Luft und Meer herein. Seine Nase war so rot wie eine Erdbeere, sein Mantel triefte, und seine Stiefel quietschten beim Gehen. Aber seine blauen Augen glänzten befriedigt, und er glühte förmlich vor Erregung. Er blieb stehen und schüttelte sich wie ein nasser Hund. Bunker Anderson rief ihm zu:
»Na, Captain, sind wir also glücklich im Pazifik?«
Pollock nickte. Halb verborgen unter seinem verkrusteten Bart war ein triumphierendes Lächeln wahrzunehmen. Er hatte dies schon früher geschafft, und sein Lächeln verriet, dass er es wieder schaffen würde, doch jedes Mal war der Kampf hart, und der Sieg tat wohl. Schweigend schaute er sie alle an, als wolle er ihnen versichern, er freue sich, sie an Bord zu wissen. Als sein Blick auf Kendra fiel, zögerte er. Dieses Zögern war nur kurz, aber ihr schien, dieser Blick durchdringe sie. Dann drehte sich Pollock um und ging in seine Kajüte. Die Arbeit war getan. Der Captain konnte sich nun ausruhen.
Wieder fiel Kendra die Galionsfigur ein, die Göttin mit dem Halbmond. Zum ersten Mal wurde ihr bewusst, dass der Name des Schiffes, Cynthia, ja eine alte griechische Bezeichnung für die Mondgöttin war, die ewig jung und ewig jungfräulich blieb.
Komisch, dachte Kendra.
Aber irgendwie stimmte das alles sie unbehaglich.
Das Schiff segelte an der Westküste Südamerikas hinauf. Mit jedem Tag, den sie Valparaiso näher kamen, wurde die Sonne wärmer. Zwei Wochen nach der Umsegelung von Kap Hoorn erreichten sie die Hafenstadt, wo sie anlegten, um Nahrungsmittel und Wasser an Bord zu nehmen.
Zunächst sah man von Valparaiso einen Berg, der so steil war, dass die Straße, die zu seinem Gipfel führte, die Form eines Z hatte. An dieser Straße waren zwei Häuser sichtbar, eines auf dem unteren Balken des Z, das andere auf dem oberen. Diese weißen Häuser mit roten Ziegeldächern fingen das Sonnenlicht auf und glänzten hell.
In beiden Behausungen warteten Mädchen auf Matrosen, die Landurlaub bekamen, und keine anständige Frau hatte jemals Notiz von ihnen genommen. Bess Anderson warnte Eva, und Eva – taktvoll wie immer – warnte ihrerseits Kendra. Kendra erwiderte pflichtschuldig: »Ja, Mutter.« Am liebsten hätte sie allerdings »Quatsch!« gesagt. In der Schule hatten manche Mädchen von derartigen Lasterhöhlen gefaselt, aber sie hätte nie damit gerechnet, einmal solche Häuser zu sehen. Da jedoch gleich zwei dieser Etablissements direkt vor ihrer Nase standen, fand sie es albern, so zu tun, als sähe man sie nicht. Sie kam sich wie eine Närrin vor.
Am Hafen drängte sich die eingeborene Bevölkerung in bunten Kleidern und behängt mit Armreifen. Am Kai wartete eine Gruppe nordamerikanischer Kaufleute mit ihren Frauen, von denen viele mit den Andersons gut bekannt waren. Diese Kaufleute lebten ständig hier und eilten jedes Mal herbei, wenn irgendein Schiff anlegte, das die amerikanische Flagge trug. Ein Ehepaar bat die Andersons, sich als ihre Gäste zu betrachten, während ein anderes Eva und Kendra einlud. Eva dankte mit gewohner Anmut.
Der kurze Aufenthalt war hübsch. Sie pflückten Pfirsiche und Weintrauben, fuhren in Kutschen durch die fremdartigen Straßen und trafen andere Amerikaner. Doch nicht ein einziges Mal erwähnte jemand die beiden weißen Häuser auf dem Berg.
Sie blieben vier Tage im Hafen. Als das Schiff wieder auslief, stand Kendra an der Reling und musterte zum letzten Mal die geheimnisvollen beiden Häuser. Sie fragte sich, was für eine Sorte Mädchen dort wohl leben mochte. Waren sie von ihren Müttern angelernt worden, die demselben Gewerbe nachgingen? Oder waren sie – wenigstens einige von ihnen – auf ordentliche Weise erzogen worden?
Schöne Mädchen gerieten manchmal in Schwierigkeiten. Mehr als einmal hatten Kendras Schulfreundinnen skandalöse Geschichten aus ihren Ferien erzählt: »... und sie stammt aus einer so guten Familie, meine Liebe!«
Kendra hatte Romane über solche »Unglückliche« gelesen. Darin pflegte das Mädchen meist zu sterben: Sie verschmachtete vor Gram, wie es hieß; zuweilen freilich sprang auch eine dieser Bedauernswerten von einer Brücke in die Tiefe. Kendra jedoch glaubte nicht, dass sie im wirklichen Leben so einfach im passenden Moment von der Bildfläche verschwanden. Sie hätte gern gewusst, was tatsächlich aus ihnen wurde.
Jetzt nahm die Cynthia direkten Kurs auf San Francisco. Da die Stürme sie häufig abtrieben, fuhren Schiffe, die nach San Francisco bestimmt waren, zunächst nach Honolulu, was die Cynthia indessen nicht tat, da sie den Truppen in Kalifornien Proviant zu bringen hatte. Sie würde erst später Honolulu anlaufen und danach in chinesischen Häfen Handel treiben.
Der Neujahrstag 1848 war schön. Seit geraumer Zeit segelten sie in tropischen Gewässern, und jetzt glitten sie unter einer Sonne dahin, die so heftig stach, dass die Planken nicht selten zu heiß waren, als dass man sie hätte berühren können. Anfang Februar verkündete Loren: »Wir werden nun bald die Bucht von San Francisco erreichen. Der Ort ist nichts anderes als ein armseliges Dorf. Die Kalifornier hatten die Siedlung Yerba Buena – Heilkraut – genannt, und zwar wegen einer Pflanze, die dort wuchs und aus der sie eine Medizin bereiteten. Die meisten Bewohner waren jedoch Yankees, und sie konnten diesen Namen nur schwer aussprechen, deshalb gaben sie der Stadt den Namen der Bucht: San Francisco. Mit dem Nest ist es nicht weit her, aber die Bucht ist großartig. Sehen Sie mal.«
Loren legte seine Hände flach auf den Tisch, die Finger deckten sich, die Daumen waren gegeneinander gerichtet.
»Stellen Sie sich vor, meine Hände wären die kalifornische Küste und meine Daumen die beiden Halbinseln. Der kleine Raum zwischen meinen Daumenspitzen ist dann der Eingang zur Bucht. Und auf der Innenseite meines rechten Daumens – mit dem Blick über die Bucht aufs Festland – liegt San Francisco.«
Es verwunderte Kendra, dass San Francisco nach Osten gelegen war. Als pazifischer Hafen sollte die Stadt eigentlich auch ihr Gesicht dem Pazifischen Ozean zuwenden. Loren lachte und meinte, die meisten Leute nähmen das an, aber sie irrten nun einmal.
Zwei Wochen später segelte die Cynthia in die Bucht und ging vor Anker. Die Fahrt von New York hatte hundertzweiunddreißig Tage gedauert. Das war bemerkenswert schnell, denn die durchschnittliche Reisedauer betrug hundertsechzig Tage. Doch keines von Captain Pollocks Schiffen hatte zum Durchschnitt gehört, und seine schöne Cynthia hatte sie allesamt weit übertroffen. Es hätte Kendra interessiert, ob er noch immer glaubte, dies komme daher, weil die Cynthia ein unschuldiges junges Mädchen mit sich geführt habe.
Auf jeden Fall war die Reise nun zu Ende. An einem trüben Februartag des Jahres 1848 sah Kendra zum ersten Mal San Francisco.
3
Loren hatte behauptet, die Bucht sei großartig. Kendra fragte sich, wie er zu dieser Ansicht gekommen sei: Sie nahm nichts anderes wahr als unruhige graue Wellen und Nebelstreifen, die gleich einer Geisterarmee vorüberzogen.
Es war gegen zehn am Morgen. Kendra wartete an Deck, um an Land zu gehen – ein weiter Weg übrigens, denn das Wasser vor San Francisco war so seicht, dass Hochseeschiffe eine Meile außerhalb ankern mussten. Die Luft war feucht, der Wind wehte heftig.
Sie war allein. Alex hatte sich in einem Boot eingefunden und den Quartiermeister mitgebracht, der jetzt mit Captain Pollock wegen des Proviants verhandelte. Auf Deck hatte der Stiefvater ihr die Hand geschüttelt und Eva mit einem Kuss begrüßt, als wäre sie bloß übers Wochenende fort gewesen. Er liebte seine Frau zärtlich, aber er wäre lieber gestorben, als dies angesichts fremder Leute zu zeigen. Alex war fünfundvierzig Jahre alt und auf eine dunkle romantische Weise schön; er zählte zu jenen Männern, die in Uniform immer gut aussehen. Kendra nahm sich zehn Minuten Zeit, dann stufte sie ihn als einen hochherzigen Langweiler ein.
Bei Flutwechsel begab er sich mit seiner Frau in einem Armeeboot an Land; Kendra sollte mit den Andersons später folgen. Loren war mit Captain Pollock hinuntergegangen, aber er hatte ihr seinen Fernstecher gegeben, sodass sie sich ein bisschen in der Gegend umsehen konnte.
Jetzt nahm sie das Glas vor die Augen. Sie erblickte zwei andere Schiffe, eine Brigg namens Eagle, die aus China kam, wie ihr Loren gesagt hatte, sowie eine kleinere Brigg, die Euphemia, die gerade aus Monterey eingetroffen war, wie sie kurz darauf erfuhr. Nahe am Strand entdeckte sie einige kleine Schiffe, die regelmäßig zwischen der Stadt und den an Flüssen gelegenen Viehzüchterfarmen verkehrten. Der Nebel klarte auf, und eine blasse Sonne wagte sich hervor. Kendra betrachtete sich nun das Land.
Dies also war der Streifen, den Loren mit seinem rechten Daumen markiert hatte. Das Ganze sah wie ein Wirrwarr von Bergen, Unkraut und ein paar Bäumen aus, die von den erbarmungslosen Stürmen gekrümmt worden waren. An der Küste bemerkte sie eine Stelle, wo das Wasser eine halbmondförmige Bucht ausgehöhlt hatte. Rund um diesen Halbmond standen drei Berge und umschlossen ihn wie eine zerbrochene Tasse. Jenseits dieser drei Berge erstreckte sich San Francisco.
Kendra hatte noch nie eine so steil aufragende Stadt gesehen. Vom Ufer bis zur höchsten Erhebung waren Häuser wahllos verstreut. Die größten Gebäude – Warenhäuser und Handelsniederlassungen – standen am Meer. Sie konnte ungefähr ein Dutzend großer Geschäftshäuser erkennen. Die Leute in San Francisco beschäftigten sich nämlich in erster Linie mit dem Verkauf von Waren für den Pazifikhandel. Ebenfalls in der Nähe des Strandes machte sie sechs schäbige Hütten aus, auf deren Vorderfront das Wort »Saloon« gemalt war. Dort traten Männer ein, während andere davongingen und wieder andere auf Fässern und Kisten herumlungerten.
Weiter entfernt sah sie ein langes plumpes Gebäude aus braunen Backsteinen, an dessen Dach ein Schild mit der Aufschrift »City Hotel« hing. Daneben gab es zwei weiße Fachwerkhäuser – keine sehr weißen –, an denen geschrieben stand: »Betten«. (Sofort musste Kendra an Bettwanzen denken.) Einige Reiter trabten vorbei.
Dann fielen ihr ein paar kleine Holzhäuser auf, die den Eindruck machten, als ließen sie wohl keinen Regen ein. Doch außer ihnen waren alle andern »Gebäude« Baracken und Hütten aus rohen Brettern, breitgeschlagenen Konservenbüchsen, Kisten und allen möglichen sonstigen Gegenständen, die sich aneinandernageln ließen. Nebelfetzen flogen wie nasse Lappen durch die Luft.
Schließlich fuhr Kendra mit den Andersons an Land. Die Matrosen ruderten sie zur Nordseite der halbmondförmigen Bucht, wo ein Mann, dem ein Warenhaus gehörte, Steine ins Wasser geworfen hatte, um eine Art Landesteg zu schaffen. Auch hier wurden die Andersons wie in Valparaiso von freundlichen Kaufleuten begrüßt, und Bunker machte die am nächsten Stehenden mit Kendra bekannt: Es waren ein Mr. Chase und ein Mr. Fenway. Kendra erkundigte sich höflich: »Wie geht’s?« Während die Andersons mit ihren Bekannten schwätzten, gab sie sich alle Mühe, ihr Entsetzen zu verbergen.
Vor den Läden und Lagerhäusern erblickte sie eine schlammige Spur, wo Pferde ihre Hufeindrücke und ihre »Äpfel« hinterlassen hatten. Es handelte sich demnach um so etwas wie eine Straße. Diese »Straße« war mit Abfall übersät. Kendra sah Büchsen und Lumpen, Papierschnipsel, ein Geschirrteil und einen alten Schuh. Sie hörte die Fliegen über den Stapeln leerer Flaschen vor den Saloons summen. Sie rümpfte die Nase über den Gestank der Abtritte und toten Fische.
Und hier waren auch die Strolche, die sie von fern erspäht hatte: ungewaschene, ungekämmte, nach Schnaps riechende Kerle. Sie hatten die Fässer und Kisten, auf denen sie gehockt hatten, verlassen und kamen so nahe, wie sie es wagten. Mit gierigen Augen starrten sie Kendra an.
Plötzlich spürte sie eine Berührung am Ellbogen und zuckte zusammen. Zu ihrer Erleichterung erkannte sie jedoch einen der Geschäftsleute, und zwar Mr. Chase. Es war ein kleiner dicker Mann mit angenehmem Lächeln.
Mr. Chase nahm sie auf die Seite. »Ich kann mir denken, wie es jetzt in Ihnen aussehen muss, Miss«, meinte er mitfühlend. »Meine Frau war fürchterlich aufgeregt, als sie hier eintraf. Aber ganz so schlimm, wie Sie glauben, ist es wiederum doch nicht.« Mit einem verlegenen Blick auf die Tagediebe räusperte er sich. »Nun, diese Kerle da … lassen Sie es mich Ihnen erklären. Erst kürzlich hat eine Zählung ergeben, dass etwa neunhundert Menschen in San Francisco leben. Auf drei Männer kommt eine Frau. Und man hat nur jene Leute gezählt, die ihren Wohnsitz hier haben, nicht aber die Soldaten der Garnison, auch nicht die Rancher, die in Geschäften zur Stadt kamen, ebenso wenig die Matrosen auf Landurlaub. Sie werden das also verstehen, nicht wahr? Die Männer fühlen sich schrecklich einsam.«
Ein stolzes Lächeln wich seiner ernsten Miene, als Mr. Chase hinter Kendras Rücken jemanden erblickte. Kendra drehte sich um und sah zwei Leutnants der US-Armee auf sich zukommen. Sie waren jung, sauber rasiert und so adrett, als hätten sie erst gestern West Point verlassen. Als sie vor ihr standen und sich verbeugten, ähnelten sie einander so sehr, dass Kendra sie im ersten Moment nur durch die Augenfarbe unterscheiden konnte.
Der Braunäugige sprach zuerst. »Miss Logan? Ich bin Leutnant Morse. Zu Ihren Diensten.«
Der Blauäugige sagte: »Leutnant Vernon. Der Oberst hat uns die Ehre gegeben, Sie in Ihre Wohnung zu begleiten, Miss Logan.«
Kendra begann zu verstehen, was Mr. Chase gemeint hatte. Morse und Vernon waren so aufgeregt, dass sie kaum noch fähig waren, sich so würdig zu benehmen, wie es sich für Gentlemen und Offiziere schickt. Galant führten die beiden sie zu den Pferden, und ebenso galant halfen sie ihr in den Sattel.
Sie ritten die sumpfige Hafenstraße entlang. Morse und Vernon machten Konversation auf Teufel komm raus. Diese Straße, so erklärten sie, werde Montgomery Street genannt, und zwar zu Ehren des Seehelden, der als Erster die amerikanische Flagge in San Francisco gehisst habe. Sie deuteten auf ein wackliges Gebäude, das sich arrogant »New York Store« nannte, und auf einen anderen Laden mit der Bezeichnung »Bee Hive«, sodann auf Buckelews Uhrenreparaturwerkstatt und auf den Schneiderbetrieb des Lazarus Everhard. Ein Stück weiter zeigten sie ihr das Geschäft, welches den beiden Herren gehörte, die sie vorhin kennengelernt hatte, Chase und Fenway.
»Jedermann freut sich von Herzen, Sie zu sehen!«, behauptete Morse.
»Und jetzt«, meinte Vernon fröhlich, »können wir endlich ein bisschen tanzen.«
»Wir planen nämlich schon seit Langem einen Ball«, erklärte Morse, »aber wir wollten warten, bis Sie da sind.«
Die Clay Street war eine schmutzige Gasse, die sich einen Berg hinaufwand. Kendra wich erschrocken zurück.
»Guter Gott! Das ist ja, als ob man auf einen Kirchturm ritte.«
Aber es half nichts, und so machten sie sich an den Aufstieg. Wie die Hafenstraße war auch diese »Straße« nur ein Pfad, der weder eine Fahrbahn noch Bürgersteige hatte. Als sie das City Hotel erreichten, erklärte Morse, hier gebe sich die ganze Stadt ein Rendezvous. »Dort kehren wir immer ein, um zu hören, ob etwas passiert ist. Das heißt, falls überhaupt mal etwas passiert«, fügte er mit einem ärgerlichen Lachen hinzu.
»In San Francisco passiert grundsätzlich nie etwas«, stieß Vernon hervor.
Dem City Hotel gegenüber lag der Marktplatz. Die beiden erläuterten Kendra, dass dieser Platz in mexikanischer Zeit plaza geheißen habe. Auf dieser plaza erhob sich ein altes Gebäude aus Lehmziegeln, das einst ein mexikanisches Zollamt gewesen war und nun als Kaserne herhalten musste.
Es folgten Baracken, an denen Schilder hingen, die mit unbeholfener Hand bekannt gaben, dass hier Zimmerleute, Schuhmacher und Hufschmiede wohnten. Kendra sah ein paar Männer in Flanellhemden und beschmutzten schwarzen Hosen den Berg hinaufstapfen sowie einige Frauen mit Sonnenhüten und Baumwollschürzen. San Francisco glich wirklich einem Ort, an dem nie etwas passiert. Sie sagte sich: Ich werde dafür sorgen, dass etwas passiert. Ich werde etwas unternehmen. Doch in einer solchen Stadt …? Wie soll ich das anfangen?
»Erzählen Sie mir doch etwas von den Leuten, die hier leben«, bat sie hoffnungsvoll.
»Nun, also die Händler«, begann Morse, »dann ein paar Siedler, die in Planwagen eingetroffen sind, und schließlich eine Gruppe Mormonen. Sie sind per Schiff aus New York herübergekommen.«
»Und die Landstreicher«, warf Vernon ein, »und die davongelaufenen Seeleute.«
»Und die Verrückten«, ergänzte Morse, »Leute, die das Perpetuum mobile erfinden oder sich eine neue Methode ausdenken, Gold aus dem Meer zu fischen.«
»Einer von ihnen«, sagte Vernon, »ist gerade jetzt wieder da. Nur handelt es sich diesmal um Süßwasser. Ein Flüsschen in der Nähe von Sutters Fort – das liegt jenseits der Bucht. Dieser Bursche hat eine Konservenbüchse voll Kies und behauptet, das sei kein Kies, sondern Gold.«
Kendra verspürte Interesse. »Gold? Wo hat er es denn her?« Lachend setzte Vernon es ihr auseinander. »Er sagt, das Bett des Flüsschens bestehe nicht aus Sand, sondern aus Gold. Er sucht jemanden, der ihm Geld pumpt, damit er Vorräte kaufen und zurückkehren kann, um eine Million Dollar zu scheffeln.«
»Glauben die Leute das?«, fragte sie.
»Aber nein. Wir sind an solche Burschen gewöhnt. Wir lassen sie ruhig quatschen. Sie bieten wenigstens etwas Abwechslung.«
Allmählich näherten sie sich dem Gipfel des Berges. Jetzt konnte Kendra auch andere Berge erkennen, die in langen verschwommenen Linien bis zur Küste reichten. Parallel zur Montgomery Street in der Tiefe durchschnitt ein Pfad den Abhang. Entlang dieses Pfades stand eine Reihe von Häuschen, die viereckig wie Kisten und weiß angestrichen waren. Morse und Vernon sagten ihr, dies sei die Stockton Street, wo die Mormonen lebten. Einer von ihnen, ein unternehmungslustiger Mensch namens Riggs, der Zimmermann war, hatte zunächst ein Haus für seine Familie gebaut und danach andere zum Vermieten. Der Oberst Taine hatte hier eine Wohnung genommen. Sie ritten auf diese Residenz zu.
Das Haus glich allen übrigen. Das Erdreich ringsum bestand aus schwarzem Schlamm, in der Mr. Riggs eine Anzahl Trittsteine gelegt hatte. Eva trat auf die Veranda – munter, heiter und so häuslich gestimmt, als hätte sie immer in San Francisco gewohnt. Sie grüßte herzlich: »Kommt herein. Das Feuer brennt schon. Ich habe Kaffee gekocht.«
Als sie zu dritt in den Flur traten, wies sie auf eine Tür. »Kendra, das ist unser Zimmer, und das dort ist deines.« Sie öffnete eine Tür auf der andern Seite des Flurs. »Und dies hier«, verkündete sie fröhlich, »ist unser Speisezimmer und unser Wohnzimmer und unsere Bibliothek – wir nennen es großspurig unseren Salon.« Lachend schloss sie: »Ist es nicht fürchterlich?«
Kendra dachte: Aber gewiss.
Da es gerade erst fertig geworden war, roch das Haus nach rohem Holz und frischer Farbe. Der Flur führte von der Eingangstür bis zur Rückseite. Auf jeder Seite waren zwei Räume: Die Schlafzimmer auf der einen und der sogenannte Salon auf der anderen; dahinter lag die Küche.
Das war alles.
Kendra begutachtete ihr Schlafzimmer. Es war ein Stübchen mit zwei Fensterchen. Licht drang nur wenig ein, und die Läden klapperten im Wind. Es gab eine schmale primitive Schlafstelle, die vermutlich in einer der Werkstätten fabriziert worden war, an denen sie vorbeigeritten waren. Als Stuhl diente eine Holzkiste und als Frisierkommode eine zweite, auf der ein Krug und eine Waschschüssel standen.
Kendra musste an die Wohnung ihrer Großmutter in Baltimore denken, an den roten Backsteinbau mit dem weißen Balkenwerk und den Marmorstufen, an den Rasen davor und an die Blumenbeete. Sie dachte an ihr Zimmer dort mit seinen zierlichen Möbeln, gekräuselten Vorhängen und weichen Teppichen vor dem Bett …
Und ihrer Mutter gefiel dieses Leben hier!
Kendra hörte Stimmen und roch den Duft von Kaffee. Sie legte Handschuhe und Hut aufs Bett und ging in den Salon. Hier bestand das Mobiliar aus einem derben Tisch und weiteren Kisten, auf die man sich setzte, als wären es Stühle. Eva und Alex tranken mit den beiden Leutnants Kaffee aus Zinnbechern, während eine rundliche rosige Frau um die dreißig mit dem Topf hantierte. Eva stellte sie als Mrs. Riggs vor, die Frau des Zimmermannes, und bemerkte, sie komme jeden Tag und helfe im Haushalt.
»Wir werden es bald ganz gemütlich haben«, meinte sie. »Mrs. Riggs sagt, im ›New York Store‹ gibt es Stühle. Ich kann von Chase & Fenway Kattun bekommen, um Vorhänge und Bettvorleger zu machen. Und ich werde Kissen für die Stühle stopfen und kleine Teppiche mit Borte besetzen, damit die Fußböden nicht mehr so kahl sind.«
Alex lächelte den beiden jüngeren Männern zu. Vernon sagte: »Mrs. Taine, der Oberst hat uns erzählt: ›Wo sie auch hingeht, sie bringt die Zivilisation mit sich.‹«
Kendra hatte noch nie ein Kissen gestopft. Sie hatte auch keine Ahnung, wie man Teppiche mit Borten besetzt. Sie glaubte überdies nicht, dass sie dies je erlernen würde. Aber nachgerade kam sie dahinter, weshalb ihre Mutter das Leben auf vorgeschobenem Posten so genoss: Es war nicht nur das Abenteuer. Wie ein Künstler, der sich seiner Gabe erfreut, aus Ton etwas Schönes zu formen, so erfreute sich Eva ihres Talents, eine Hütte in einen Calico-Palast zu verwandeln, in ein mit Kattun herausgeputztes Schmuckkästchen.
Nach einer Weile verabschiedeten sich die Leutnants. Eva erklärte, sie habe eine Mahlzeit auf dem Herd stehen, die von Mrs. Riggs überwacht werde. Sie ging in die Küche, um mitzuteilen, dass man nun zu essen wünsche. Mrs. Riggs brachte die Gerichte herein, auf die Kendra ziemlich gespannt war. Da Mittag längst vorbei war, hatte sie Hunger; außerdem war sie nach der langen Seereise und deren begrenzten Mahlzeiten auf etwas Frisches begierig. Sie hatte sich bereits gefragt, was die Leute in San Francisco wohl essen mochten.
Sie trat an den Tisch, und ihre Hoffnung schwand dahin. Sie setzten sich auf die Kisten und aßen von Zinntellern, die der Armee gehörten, aber das hätte ihr nichts ausgemacht, wenn das Essen nicht so grässlich fade gewesen wäre: Rindfleisch, Gemüse, Kartoffeln. Und das alles bloß gekocht. Kendra aß, da dies ja immer noch besser war als gar nichts; Alex jedoch musste ihre Enttäuschung bemerkt haben, denn er sagte:
»Das Essen in Kalifornien ist meistens fade. Die Leute ernähren sich von Rindfleisch, Rindfleisch und noch einmal Rindfleisch, bis es ihnen zum Halse heraushängt. Etwas anderes ist nur selten zu haben. Der Laufbursche von Chase & Fenway wird später eine Kiste mit Lebensmitteln bringen, aber ich weiß nicht, ob sie etwas taugen.«
Als sie fertig waren, begab sich Alex in das Hauptquartier an der Küste. Ein Soldat war mit einem Pferd für ihn heraufgekommen und hatte Eva die beiden Wochenzeitungen, den Californian und den Star, gebracht. Eva indessen legte wenig Interesse für die lokalen Neuigkeiten an den Tag. Nachdem Alex aufgebrochen war, sagte sie zu Kendra, nun wolle sie mit Mrs. Riggs in deren Haus gehen.
»Mrs. Riggs möchte mir ihre Einrichtung zeigen. Wenn dieser Laufbursche von Chase & Fenway kommt, sag ihm, er soll die Lebensmittel in die Küche bringen.«
Und damit ging sie. Die Zeitungen lagen auf dem Tisch. Kendra nahm den Star zur Hand. Sie las, dass man zwei Männer eingesperrt hatte, weil sie eine Kegelbahn ausgeplündert hatten. Ein anderer Mann, offenbar ein etwas anständigerer, hatte eine Werkstatt eröffnet, wo er Tische und Stühle herzustellen gedachte.
Sie sah Anzeigen der meisten Geschäfte, an denen sie am Vormittag vorbeigekommen war. Chase & Fenway offerierten Besen, Eimer, Nägel, Äxte, Farben, Brandy, Gin, Kämme, Tabak, Pfannen, Seife, Wein und Streichhölzer. Der Schneider Lazarus Everhard gab bekannt, dass er künftig auch Uniformen anfertigen wolle. Der »New York Store« bat jedermann dringend, Gemüsepillen zu kaufen, die ein hervorragendes Heilmittel seien, das garantiert bei Pocken, Gicht, Verstopfung und Frauenleiden Linderung verschaffe. Der Bee-Hive-Laden hatte Korkenzieher, Samen, Schießpulver, Herrenhüte und Damenschals zu bieten.
In diesem Augenblick sah Kendra auf.
Und da stand er.
Sie wusste nicht – ihr ganzes Leben lang würde sie es nicht wissen –, ob sie nun zufällig aufgesehen oder ob sie seinen Blick gefühlt und deswegen den Kopf gehoben hatte. Jedenfalls sah sie auf, und über den Zeitungsrand hinweg erblickte sie ihn.
Er stand unter der Tür, ein fremder Mann, der verführerischste, den sie je gesehen hatte, und er beobachtete sie mit unverhohlenem Vergnügen. Als sich ihre Blicke trafen, lächelte er. Er mochte etwa dreißig sein. Er war groß und hager. Wie er so dastand mit der einen Hand an der Tür und der andern auf der Hüfte, hatte er etwas Schlaksiges, zugleich aber auch etwas Nobles an sich. Er trug eine Lederjacke, ein buntkariertes Wollhemd und eine Hose aus braunem Kammgarn, die in derben Stiefeln steckte, welche ihm fast bis an die Knie reichten. Einen Hut hatte er nicht auf; sein braunes Haar war vom Wind zerzaust; eine Locke fiel ihm in die Stirn bis auf die Augenbraue. Er schaute Kendra mit einem erfahrenen und wissenden Lächeln an, und Kendra fühlte augenblicklich, dass er von Frauen weit mehr verstand, als ihr über Männer bekannt war. In der Tat fühlte sie, dass er über alles mehr wusste als sie, sodass sein anerkennender Blick wohl umso höher zu bewerten war. Ganz offen zeigte er ihr seine Bewunderung.
Unverwandt blickte er sie an, und sie sah ebenso unverwandt ihn an. Er sagte nichts, und sie war außerstande, etwas zu sagen. Dies alles dauerte nur einen Moment, aber dieser Moment währte länger als notwendig, ehe er fragte:
»Wie geht es Ihnen? Ich bin der Laufbursche von Chase & Fenway.«
Kendra fuhr zusammen.
Er sah nicht wie ein Laufbursche aus. Als sie die Zeitung auf den Tisch legte, fuhr er fort:
»Ich hoffe, Ihnen nicht lästig zu fallen. Aber die Tür war offen, deshalb bin ich einfach reingekommen.«
Er sprach so ungeniert, dass ihr die Antwort ebenso leicht von den Lippen kam:
»Das ist schon in Ordnung. Wir haben Sie erwartet, Mr. …?«
»Mein Name ist Ted Parks«, entgegnete er und lächelte wieder.
»Und Sie sind Kendra Logan?«
»Aber ja. Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Mr. Chase. Er kann die Leute gut beschreiben, doch diesmal hat er mich nicht genügend vorbereitet. Ich habe kaum erwartet, jemanden zu finden, der so … so lebhaft ist.«
Ted Parks ließ seinen Blick über sie gleiten. Wiederum dauerte dies bloß einen Augenblick, doch wurde sie sich in diesem Augenblick ihrer selbst bewusst: ihrer geschmeidigen Figur und ihrer dunkelblauen Augen. Sie hatte das Gefühl, als werde sie sozusagen entdeckt, als habe nie zuvor ein Mensch sie richtig betrachtet. Dann bückte er sich und hob eine Kiste auf die Schulter. »Wohin soll ich die Sachen bringen?«
Kendra öffnete die Küchentür. Sie hatte ihre Gelassenheit noch lange nicht wiedergefunden. Die Bewunderung der Leutnants hatte sie nicht weiter erregt, nachdem Mr. Chase sie auf den Mangel an Mädchen hingewiesen hatte. Dieser Ted Parks jedoch war so herrlich unverschämt, als sei er daran gewöhnt, unter einer Vielzahl von Mädchen seine Wahl zu treffen, von denen jedes eifrig bestrebt war, von ihm gewählt zu werden. Während er ihr in die Küche folgte, fragte Kendra:
»Seit wann sind Sie schon in San Francisco?«
»Fast ein Jahr«, erwiderte er und fügte mit einem fröhlichen Augenzwinkern hinzu: »Aber Sie dürfen nicht denken, ich interessierte mich für Sie, weil die Mädchen hier rar sind. Ich bin an Ihnen interessiert, weil eben Sie es sind.«
Er hatte ihre Gedanken so deutlich gelesen, dass Kendra keine Antwort fand, aber Ted ersparte sie ihr auch. Als er die Kiste auf den Küchentisch gestellt hatte, erklärte er:
»Ich bin von Honolulu herübergekommen.«
»Und warum?«, wollte Kendra wissen, die mit einem Mal flink und neugierig geworden war.
Ted zuckte mit den Schultern. »Aus keinem besonderen Grund. Ich habe von Kalifornien reden hören und mir gesagt: Schau dir die Gegend mal an.«
Ein Wirrkopf, sagte sie sich. Ein Mensch, der ein planloses Leben führt. Alex Taine würde so jemanden nie ernst nehmen.
Ted deutete auf die Kiste. »Wollen Sie nicht sehen, was ich für Sie habe? Oder gehören Sie vielleicht auch zu den Leuten, denen es egal ist, was sie essen?«
»Ganz gewiss nicht!«, sagte sie rasch. »Ich weiß gutes Essen zu schätzen, und ich koche auch gern. Lassen Sie doch mal sehen.«
»Oh, das freut mich aber. Es macht nämlich keinen Spaß, Lebensmittel auszusuchen für Leute, die gar keinen Wert auf anständige Nahrung legen.«
»Ich werde unsere Mahlzeiten kochen«, erklärte Kendra.
Diesen Entschluss hatte sie soeben gefasst. Sie konnte aus einer Hütte keinen Palast machen, aber sie konnte aus jeder Nahrung, die nicht gerade vergiftet war, ein schmackhaftes Mahl bereiten, und eben das würde sie künftig tun. Sie hatte keine Lust, dieses geschmacklose Zeug zu vertilgen, das ihre Mutter heute serviert hatte.
Ted meinte:
»Ich nehme an, man hat Ihnen schon gesagt, dass in Kalifornien fast nur Rindfleisch gegessen wird. Hier ist welches, aber ich habe da noch ein wenig Speck, und ich hoffe, später werden wir auch Schinken kriegen. Und hier sind ein paar Appetithäppchen und Gewürze.« Er holte aus seiner Kiste Curry, Ingwer, Senf, Nelken, Muskatnuss, Oliven, Rosinen und getrocknete Äpfel. »Für die meisten Gemüsesorten ist es noch zu früh, aber ich habe immerhin Zwiebeln und weiße Rüben entdeckt.«
»Ich werde Rindfleisch mit Zwiebeln machen«, verkündete Kendra. »Und übermorgen wird es Curry geben.«
»Es freut mich, dass Sie Curry mögen. Diese Büchse ist mit der Eagle aus China gekommen.«
»Und ich bin froh, dass ich nun diese getrockneten Äpfel habe. Ich werde eine Torte backen.«
»Darf ich Ihnen einen Rat geben?«, fragte Ted und nahm eine Schachtel mit Rosinen in die Hand. »Weichen Sie ein paar Rosinen über Nacht in Wein ein, und fügen Sie sie dann der Tortenfüllung bei.«
»Eine gute Idee! Wer hat Ihnen denn das gesagt?«
»Oh, eine Frau, die ich mal gekannt habe«, antwortete er und wechselte schnell das Thema. »Haben Ihnen die Burschen von der Armee erzählt, dass sie ein Tanzfest planen?«