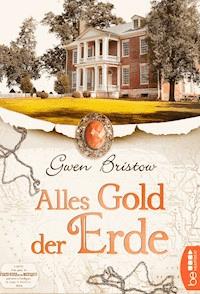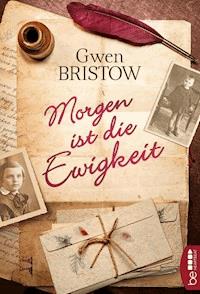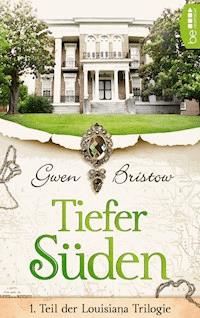6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Waise Celia Garth lebt nach dem Tod ihrer Eltern bei Verwandten, die sie jedoch lieblos behandeln und als billige Haushaltshilfe ausnutzen. Celia nimmt ihren Mut zusammen, entflieht der Abhängigkeit und baut sich als Schneiderin eine unabhängige Existenz in Charleston auf. Als sie den jungen Offizier Jimmy trifft ist ihr Glück perfekt. Doch dann bricht der Unabhängigkeitskrieg aus und nichts ist mehr so wie es war...
Ein großer historischer Roman, der in dramatischen Bildern die Wirren des Bürgerkriegs schildert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Die junge Waise Celia Garth lebt nach dem Tod ihrer Eltern bei Verwandten, die sie jedoch lieblos behandeln und als billige Haushaltshilfe ausnutzen. Celia nimmt ihren Mut zusammen, entflieht der Abhängigkeit und baut sich als Schneiderin eine unabhängige Existenz in Charleston auf. Als sie den jungen Offizier Jimmy trifft ist ihr Glück perfekt. Doch dann bricht der Unabhängigkeitskrieg aus und nichts ist mehr so wie es war …
Ein großer historischer Roman, der in dramatischen Bildern die Wirren des Bürgerkriegs schildert.
Über die Autorin
Gwen Bristow wurde am 16. September 1903 als Tochter eines Pastors in Marion, South Carolina/USA geboren. Sie besuchte die Pulitzer School für Journalismus und arbeitete als Reporterin. 1929 veröffentlichte sie ihren ersten Roman und wurde durch ihre Südstaaten-Romane weltbekannt. Sie starb 1980.
Gwen Bristow
Celia Garth
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Fritz Helke
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Mohrbooks AG Literary Agency, Zürich
Titel der Originalausgabe »Celia Garth«
Copyright © 1959 by Gwen Bristow
Copyright der deutschen Erstausgabe © 1975 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: allegro | Marzolino | Davor Ratkovic | sniegirova mariia | Aphichart | debra millet | Serg Zastavkin
E-Book-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-2780-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meine Mutter
CAROLINE WINKLER BRISTOW,
die mir zuerst von meinem revolutionären
Ahnen erzählte:
NICHOLAS WINKLER,
Erstes Kapitel
Celia Garth hatte blondes Haar und braune Augen. Das Haar war voll und weich und hatte einen goldenen Schimmer. Die Augen waren dunkel und blickten frisch und munter in die Welt. Sie hatte eine gute Figur, war stolz darauf und pflegte gerade und aufrecht zu gehen. Ihr Gesicht war sehr lebendig und von etwas unregelmäßigem Schnitt: ein eigensinniger Mund, ein eckiges Kinn und eine kecke, gerade Nase mit Sommersprossen. Es war kein klassisches Gesicht, aber es verriet Temperament, Schwung und gesunden Mutterwitz. Wenn sie das Kinn vorstreckte und das Näschen aufwarf, war man versucht, sie Fräulein Naseweis zu nennen.
Celia war zwanzig Jahre alt. Jetzt, im September 1779, war sie seit drei Monaten Lehrmädchen in Mrs. Thorleys Modesalon in Charleston, Südkarolina. Als sie an diesem Morgen vor dem Frühstück zu Mrs. Thorley ging, um ihre Anweisungen für den Tag entgegenzunehmen, bemühte sie sich, ein sanftmütiges Gesicht aufzusetzen. Dies gelang ihr nicht, aber sie wirkte unzweifelhaft interessant.
Sie trug das blonde Haar aus der Stirn zurückgekämmt; es wellte sich, sorgfältig gebürstet, unter einem flotten kleinen Käppchen aus weißem Batist. Ein weißes, über dem Busen verknotetes Halstuch deckte ihre Schultern. Das Material ihres Kleides bestand aus handgesponnenem Leinen. Dieses Leinen, von den Flachsbauern in Kingstree gewebt und in Ballen nach Charleston transportiert, war derb, billig und ziemlich gewöhnlich, aber an Celia wirkte es keineswegs so.
Die natürliche Farbe des Stoffes war ein schmutziges, unansehnliches Braun, aber Celia hatte ihn so lange gewaschen und gebleicht, bis aus dem Braun ein zartes Beige wurde, das ausgezeichnet zu ihren dunklen Augen und ihrem hellen Haar passte. Das Mieder schmiegte sich wie Satin um Brust und Taille. Die Ärmel fielen in tiefen, weißen Rüschen fast bis zu den Handgelenken herab. Der Rock bauschte sich graziös wie eine Glockenblume und war kurz genug, um ein paar Zentimeter ihrer weißen Strümpfe und ihre schwarzen Schnallenschuhe sehen zu lassen. Celia hatte in ihrem ganzen Leben kein kostbares Kleid besessen, aber sie liebte schöne Kleider, wie sie in ihre eigene hübsche Erscheinung verliebt war, und legte großen Wert darauf, immer sauber und adrett auszusehen.
Die Inhaberin des Modesalons, Mrs. Thorley, saß an ihrem Schreibtisch. Celia stand vor ihr und beantwortete jede ihrer Äußerungen mit einem gehorsamen: »Jawohl, Madam!« Dabei hatte sie hinter ihrem naseweisen Gesicht naseweise Gedanken. Sie versuchte sich vorzustellen, wie Mrs. Thorley von einem Mann geküsst würde. Sie musste unzweifelhaft einmal geküsst worden sein, denn sie war Mrs. Thorley und also einmal verheiratet gewesen, aber Celia vermochte sich das Bild nicht auszumalen. Mrs. Thorley war eine stattliche, ziemlich korpulente Dame; ihr gestärktes graues Kleid umgab sie wie eine Ritterrüstung, und ihre gestärkte weiße Haube saß wie ein Helm auf ihrem Kopf. Sie hatte blaue Augen, schiefergraues Haar und eine tiefe, grollende Stimme. Celia fragte sich, was für eine Art Mann Mr. Thorley wohl gewesen sein mochte. Es war nicht weiter wichtig, denn wie immer er ausgesehen hatte, die bloße Vorstellung, wie Mrs. Thorley von einem Mann umarmt wurde, war fürchterlich.
Celia war des Öfteren geküsst worden, allerdings nicht während der Monate, da sie hier im Modesalon tätig war. Mrs. Thorley war streng und hatte gewisse unwandelbare Grundsätze. Sie beschäftigte nur Mädchen aus ehrbaren und angesehenen Familien. Angestellte, deren Angehörige nicht in Charleston ansässig waren, wohnten in ihrem Haus und wurden wie Zöglinge eines Internates gehalten. Mrs. Thorley war sehr stolz auf die Sorge, die sie ihren Mädchen angedeihen ließ. (Sie pflegte von ihren Näherinnen stets als von ihren ›Mädchen‹ oder ihren ›jungen Damen‹ zu sprechen, obwohl einige von ihnen die vierzig bereits überschritten hatten.)
Mrs. Thorley wies Celia an, zu Mr. Bernards Lagerhaus zu gehen und die dort bestellten Rollen Seidenflor abzuholen. Seide und vor allem Florseide war knapp und teuer in diesen Tagen. Sie musste importiert werden, und nun, da sich die dreizehn Kolonien im Aufruhr gegen den König befanden, riskierten Handelsschiffe, von der Kriegsmarine des Königs gekapert zu werden. Aber gerade jetzt war es einem Schiff Mr. Bernards gelungen, von den westindischen Inseln kommend, die Blockadesperre zu durchbrechen und, mit kostbaren Gütern beladen, den Hafen von Charleston zu erreichen.
»Hören Sie zu, Miss Garth«, sagte Mrs. Thorley, »bevor Sie sich zum Lagerhaus auf den Weg machen, gehen Sie zum Nähsaal hinauf und lassen Sie sich von Miss Loring ein Stück derben Stoff geben, um die Seide darin einzuschlagen.«
»Jawohl, Madam«, sagte Celia. Sie stellte fest, dass Mrs. Thorley schrecklich viele Haare auf der Oberlippe hatte. Ein Kuss von ihr musste kratzen wie der Kuss eines Mannes, der sich lange nicht rasiert hatte.
»Nach dem Frühstück öffnen Sie den Empfangssalon«, fuhr Mrs. Thorley fort. Celia überlegte, ob ihre Stimme wohl schon immer so tief und grollend geklungen haben mochte wie jetzt. Wenn man sich vorstellte, dass eine solche Stimme zu einem Mann »Ich liebe dich« sagte! Man konnte es sich nicht vorstellen. Mrs. Thorley sagte: »Wahrscheinlich werden heute mehr Kunden kommen als sonst. Die neuen Stoffe dürften ihre Wirkung nicht verfehlen. Ich habe durch eine Anzeige in der ›Gazette‹ ankündigen lassen, dass sie heute zu besichtigen seien.«
»Jawohl, Madam«, sagte Celia.
»Mehrere Damen haben bereits Hauben aus Seidenflor bestellt«, bemerkte Mrs. Thorley. »Wenn Sie also jemand fragen sollte, sagen Sie, dass das Material eingetroffen sei.«
»Jawohl, Madam! Und – oh, bitte, Mrs. Thorley« – Celias Bemühungen, sanftmütig und respektvoll zu erscheinen, gerieten über dem Eifer, mit dem sie ihre Frage anzubringen versuchte, ins Wanken. Aber bevor sie noch antworten konnte, wurde sie schon von Mrs. Thorley unterbrochen:
»Was wünschen Sie, Miss Garth?«
»Bitte, Madam, darf ich eine dieser Hauben nähen? Ich weiß, wie man Seidenflor behandeln muss. Ich kann wunderschöne, winzige Stiche machen. Wirklich, ich kann es. Bitte, geben Sie mir Gelegenheit, Ihnen zu zeigen …«
»Miss Garth, Sie haben Ihre Arbeit zugewiesen bekommen«, sagte Mrs. Thorley. Sie war nicht ungehalten; ihre Stimme klang ruhig und bestimmt wie immer. Sie fragte: »Haben Sie die Knöpfe an den Hemden für Captain Rand angenäht?«
»Nein, Madam, aber das kann ich abends nach dem Essen machen. Die Überstunden machen mir gar nichts aus. Bitte, lassen Sie mich …«
»Tun Sie die Arbeit, die Ihnen aufgetragen wurde, Miss Garth. Wenn Sie heute im Empfangssalon Hilfe benötigen sollten, sagen Sie Miss Loring Bescheid.«
»Ja, Madam«, sagte Celia. Es hatte keinen Zweck. Sie würden ihr keine Gelegenheit geben zu beweisen, was sie konnte. Sie würde weiter kleine, unbedeutende Hilfsarbeiten verrichten müssen, Arbeiten, die sie schon leisten konnte, als sie sechs Jahre alt war. Knöpfe annähen!
»Das ist alles, Miss Garth«, sagte Mrs. Thorley.
Celia machte einen Knicks. Mrs. Thorley wandte sich ab, entnahm einer Schublade ihres Schreibtisches Bücher und Papiere und schickte sich an, Rechnungen zu schreiben. Im Sonnenlicht, das durch das Fenster hereinfiel, wurden die Haare auf ihrer Oberlippe deutlicher erkennbar. – Ich glaube nicht, dass es ihm Spaß gemacht hat, sie zu küssen, dachte Celia.
Sie ging die Treppe hinauf zum Nähsaal. Das war ein großer, sehr heller Raum, in dem die zwanzig Näherinnen, die hier arbeiteten, reichlich Platz hatten. Mrs. Thorley war nicht eben weichherzig veranlagt, aber sie wusste, dass Menschen bessere Arbeit leisteten, wenn sie äußerlich gut untergebracht waren. Ein schwarzes Mädchen wischte Staub, und ein männlicher Farbiger war damit beschäftigt, die Abfallkästen zu leeren, die zur Aufnahme von ausgefransten oder schmutzigen Stoffresten dienten. Diese Abfälle erhielt die ›Gazette‹ zum Zweck der Papierherstellung. In Mrs. Thorleys Modesalon wurde nichts vergeudet.
Die Mädchen arbeiteten noch nicht, aber die beiden Aufsichtsdamen, Miss Loring und Miss Perry, waren bereits eifrig beschäftigt. Miss Loring saß an einem Tisch und schrieb; Miss Perry lief geschäftig hin und her, öffnete Vorhänge, zog Schubladen auf und zu und traf Vorbereitungen für den kommenden Arbeitstag. Celia ging zum Tisch und wartete höflich und bescheiden, bis Miss Loring aufsah.
»Ja, was gibt es? Was gibt es?«, fragte Miss Loring.
Die Aufsichtsdame war dünn und hatte ein knochiges, hageres Gesicht, Sie machte ständig den Eindruck, als habe sie sehr viel mehr zu tun, als sie je würde bewältigen können. Sie war jetzt sicherlich noch keine halbe Stunde aus dem Bett, aber ihr Haar war bereits zerzaust, und das Häubchen saß ihr schief auf dem Kopf. Celia fragte sich, ob Miss Loring wohl jemals geküsst worden sei. Wahrscheinlich nicht. Einige der Mädchen behaupteten, sie habe einmal einen Verehrer gehabt, der gestorben sei. Celia glaubte das nicht. Sie hielt es für ausgeschlossen, dass dieses dürre Knochengestell es fertiggebracht haben sollte, in einem Mann romantische Gefühle zu erwecken. Sie fragte nach dem Einwickelstoff.
»Stoff?«, sagte Miss Loring. Sie runzelte die Stirn und machte ein Gesicht, als hätte sie das Wort noch nie im Leben gehört. Doch, dann erinnerte sie sich. »O ja, ja, natürlich! Für die Florseide. Gleich, einen Augenblick! Hier« – sie zeigte Celia die Tafel, auf der sie geschrieben hatte – »das ist die Liste der Kunden, die sich für heute angemeldet haben. Ich lege sie nachher auf Ihren Tisch.« Sie wandte sich Miss Perry zu. »Oh, Matilda«, sagte sie, »gib mir doch eben den Einwickelstoff herüber. Du stehst gerade da.«
Miss Perry war klein und dick und hatte ein rosiges Pausbackengesicht. Sie sagte: »Aber ja, meine Liebe«, nahm ein großes, eng zusammengefaltetes Stück schweren, ungebleichten Musselins aus dem Regal, vor dem sie stand, und brachte es herüber.
»Danke schön, Miss Perry«, sagte Celia, »ich gehe dann.«
Miss Perry tätschelte ihr den Arm. »Sie freuen sich sicher über den kleinen Morgenspaziergang vor dem Frühstück, nicht wahr?«, lächelte sie.
Celia sagte: »Gewiss, Ma’am«, und verabschiedete sich. Wie schrecklich es sein muss, auszusehen wie Miss Loring und Miss Perry! dachte sie. Wie schlimm, eine alte Jungfer zu sein und nichts vom Leben zu haben! Das würde ihr nicht passieren, o nein! Sie würde etwas erleben, etwas Aufregendes, ganz gewiss! Dafür würde sie sorgen, wenn es nicht von selber geschah.
Sie lief die Treppe hinab und verließ das Haus. Oh, es war wundervoll draußen! Es ging auf sechs Uhr zu, und die Sonne stand noch nicht ganz hoch, aber man sah schon, dass es ein schöner, strahlender Tag werden würde.
Die Geraniumbüsche neben der Haustür dufteten, und die Glocken von St. Michael läuteten. Ein leichter Morgenwind kam von der See herüber, zerrte an Celias Rock und spielte mit der Haarlocke in ihrer Stirn. Er brachte auch die Gerüche des Hafens mit; es roch nach Salz und Teer, nach Sirup, Kaffee und Rum. Die Dächer der Häuser wurden von den Spitzen der hohen Schiffsmasten überragt. Einige von ihnen führten ausländische Flaggen, andere die neue Fahne der amerikanischen Aufständischen. Diese Fahne war erst vor rund zwei Jahren eingeführt worden, und die Bevölkerung hatte sich noch nicht recht an sie gewöhnt. Celia fand sie sehr schön. Dreizehn rote und weiße Streifen für die dreizehn neuen Staaten und dreizehn weiße Sterne im rechteckigen blauen Feld.
Als das Glockengeläut ausklang, wurde das Singen und Zwitschern der Vögel deutlicher vernehmbar. Der Wind raschelte in den langen glänzenden Blättern der Palmen, die den Bürgersteig flankierten. Zwei Soldaten kamen die Straße herunter. Sie sahen schmuck aus in ihren kleidsamen blauen Uniformen. Die Farbe des Tuches war weder dunkel noch hell – ein kräftiges Mittelblau, von den Leuten ›Rebellenblau‹ genannt – und die Waffenröcke hatten ockerfarbene Aufschläge. Die beiden Männer zogen und schwenkten ihre gleichfalls ›rebellenblauen‹, mit ockerfarbenen Bandrosetten geschmückten Dreispitze, als sie Celia gewahrten, lachten sie an und riefen: »Guten Morgen, Madam!«
Celia erwiderte lächelnd den Gruß, senkte dann aber schnell die Augen und beschäftigte sich mit dem Musselinstoff, den sie zusammengefaltet unter dem Arm trug. Nicht etwa, weil sie sich durch die Aufmerksamkeit der Soldaten geniert oder gar belästigt fühlte, sondern weil sie vom Haus aus noch gesehen werden konnte und weil es immerhin möglich war, dass da zwei ungeküsste alte Jungfern und eine unküssbare alte Witwe aus dem Fenster blickten. Sie musste gerade jetzt sehr auf der Hut sein. Ihre kurze Lehr- und Probezeit lief in der nächsten Woche ab, und es lag in der Hand jener Damen, darüber zu befinden, ob sie den Ansprüchen des Modesalons genügte oder nicht. Wenn ja, konnte sie weiter hier in Charleston bleiben und sich, umgeben vom Glanz: und Schimmer der eleganten Welt, ihres Lebens freuen. Anderenfalls brachte Mrs. Thorley es fertig, sie zur Plantage zurückzuschicken, und sie würde wieder mit Tante Louisa, Onkel William und ihrem hochnäsigen Vetter Roy Garth das jämmerliche Dasein einer Landpomeranze führen müssen.
Ich geh’ nicht zurück, dachte sie wild. Ich geh’ nicht! Sie können mich nicht zwingen! Aber schon während sie es dachte, wusste sie, dass das nicht stimmte: Sie konnten es doch. Noch war sie zwanzig Jahre, und bis zu ihrem nächsten Geburtstag hatten andere Leute das Recht, sie nach ihrem Belieben herumzukommandieren. »Lieber Gott«, flüsterte Celia vor sich hin, »lieber Gott, hilf, dass ich in Charleston bleiben kann!«
Sie wandte vorsichtig den Kopf und blickte zurück. Mrs. Thorley besaß ein stattliches, dreistöckiges Eckhaus in der Lamboll Street, im vornehmen Südteil der Stadt. Es war früher ein Wohnhaus gewesen, und auch jetzt wies nur ein schmales Schild über der Tür mit der Inschrift AMELIA THORLEY, MODEN darauf hin, dass es nun ein Geschäftshaus war. Ein großes, auffälliges Schild würde dem vornehmen Stil des Unternehmens nicht entsprochen haben. Es würde zudem unnötig gewesen sein, denn jedermann in Charleston kannte Mrs. Thorleys Etablissement. Es war nicht nur das erste Modehaus am Platz, es war darüber hinaus zu einem Treffpunkt der eleganten Welt geworden. Man erfuhr hier alle Tagesneuigkeiten aus zweiter und dritter und nicht selten aus erster Hand. Mrs. Thorley lieferte nicht nur Damenmoden, sie nahm auch Aufträge für Herrenhemden und Krawatten entgegen, sodass in ihrem Empfangssalon regelmäßig beide Geschlechter vertreten waren. Da wurde dann oft stundenlang geschwätzt und geflirtet, und manch Aufsehen erregende Romanze hatte in diesem Salon ihren Anfang genommen.
Celia war auf einer ausgezeichneten Schule erzogen worden und hatte gute Manieren. Sie war deshalb dazu ausersehen worden, im Empfangssalon zu sitzen und die Wünsche der Kunden entgegenzunehmen. Das gefiel ihr sehr. Denn auf diese Weise erfuhr sie alles, was in der Stadt vor sich ging, und traf täglich viele Leute. Männer, die ihr bewundernde Blicke zuwarfen und Komplimente zuflüsterten, Frauen, die insgeheim der Meinung waren, Mrs. Thorley täte gut daran, eine ›etwas gesetztere Person‹ als Empfangsdame zu beschäftigen, und junge Damen, die so taten, als sei sie nicht vorhanden. Unter diesen Mädchen waren auch einige ihrer früheren Schulkameradinnen. Aber freilich, damals war Celia ›Miss Garth von der Kensaw-Plantage‹ gewesen. Jetzt, da sie ein Nähmädchen war, konnten sie sich ihrer nicht mehr erinnern. Sie musste sich wohl schon früher in der Schule in einem ganz anderen Kreis bewegt haben.
Aber abgesehen von kleinen Schikanen dieser und ähnlicher Art, machte es Celia großen Spaß, im Hause Mrs. Thorleys arbeiten zu können. In einer Woche würde sie wissen, ob sie hier bleiben durfte. Nächste Woche, dachte sie, während sie Mr. Bernards Lagerhaus zustrebte, nächste Woche! Sie hatte zeit ihres Lebens mit ihren Gedanken in der Zukunft gelebt, da die Gegenwart sich nie mit ihren Traumbildern deckte, jetzt, da sie einer so wichtigen Entscheidung entgegensah, hatte sie Angst vor dem Morgen. Wenn sie ihr doch nur die Gelegenheit geben würden, ihnen zu zeigen, was sie konnte! An ihrem fünften Geburtstag hatte Tante Louisa ihr eine Nadel in die Hand gegeben und ihr gezeigt, wie man nähte. Und sie hatte schon an diesem ersten Tag ihr Talent entdeckt; sie konnte nähen.
Jetzt, zwanzig Jahre alt, konnte sie besser nähen als die meisten Frauen, die doppelt so alt waren. Sie wusste es, aber niemand im Modesalon wusste es, und sie gaben ihr nicht die Möglichkeit, es zu beweisen. Mrs. Thorley war eine gute Geschäftsfrau, aber sie hatte keinen sehr beweglichen Geist. Für sie war sie einfach eine Anfängerin, und als solche hatte sie Nähte aufzutrennen, Knöpfe anzunähen und ähnliche lächerliche Hilfsarbeiten zu verrichten, die sonst niemand machen wollte. Celia fühlte hilflose Wut in sich aufsteigen, während sie die im Morgenlicht schimmernde Straße entlangging. Und wieder betete sie: »Lieber Gott, hilf, dass ich hier bleiben darf!«
Ihr Blick fiel auf den Kirchturm von St. Michael. »Glaube ohne Taten ist tot!« Wie oft hatte sie das Wort in der Kirche gehört! Ich will!, dachte sie. Lieber Gott, ich will etwas tun! Ich gehe nicht auf die Plantage zurück, um dort für den Rest meines Lebens die arme Verwandte zu spielen! – In diesem Augenblick kam gerade vor ihr die Sonne hoch; ihr goldenes Licht versprach einen strahlenden Tag. Sie lachte leise vor sich hin. Die Welt war voller Versprechen. Aber man musste etwas tun, damit sie zur Wirklichkeit wurden.
Die Lamboll Street begann zum Leben zu erwachen. Vor einem großen Patrizierhaus fegte ein schwarzer Junge den Bürgersteig, am Nachbarhaus war ein Mann damit beschäftigt, den bronzenen Türklopfer zu polieren. Etwas weiter die Straße herunter wischte eine junge Farbige mit vergoldeten Ringen in den Ohren die Steinstufen. Celia rief ihr im Vorbeigehen »Guten Morgen« zu, und die Schwarze antwortete: »Guten Morgen, Miss!« Celia bog in eine Nebenstraße ein, die zum Kai hinabführte.
Im Hafenviertel herrschte, ungeachtet der frühen Morgenstunde, schon reger Betrieb. Männer liefen zwischen den Hafenkontoren und den Pieren geschäftig hin und her. Aufkäufer besichtigten die von eingelaufenen Schiffen mitgebrachten Güter. Arbeiter waren damit beschäftigt, Bauholz und Reisballen abzuladen, die exportiert werden sollten. Frauen, weiße und farbige, strebten den Fischständen zu, um ihre Morgeneinkäufe zu tätigen. Matrosen schlenderten über den Kai. Soldaten in Rebellenblau ließen sich zu den Hafenforts hinausrudern. Wozu eigentlich?, dachte Celia. Sie verstand nichts von militärischen Dingen, aber sie wunderte sich, dass die Forts draußen immer noch so stark bewacht wurden. Der Krieg währte jetzt, im frühen Herbst des Jahres 1779, schon beinahe fünf Jahre, und jedermann wusste, dass er dem Ende zuging, ja praktisch schon zu Ende war. Aber die Männer in ihren leuchtend blauen Uniformen boten einen prächtigen Anblick; die Läufe ihrer Musketen funkelten in der Morgensonne. Sie schienen guter Laune; Celia hörte, wie sie lachten und scherzten und dann und wann einem hübschen Mädchen oder einer jungen Frau zuwinkten, die an der Kaimauer entlangging.
Abgesehen von ihren Offizieren, waren die hier stationierten Soldaten sehr junge Burschen, die meisten unter zwanzig. In der Regel handelte es sich um ausgezeichnete Schützen, die, bevor sie die Uniform anzogen, jahrelang in den Wäldern gelebt und sich von Jagd und Fischfang ernährt hatten. Sie gehörten nicht zu den Kontinentaltruppen, sondern zur Staatsmiliz. Die ›Continentals‹ waren als reguläre Soldaten Angehörige der Nationalarmee unter General Washington. Die Staatsmiliz bestand aus Freiwilligen, die nur in gewissen Zeitabständen dienten und zwischendurch ihrer zivilen Beschäftigung nachgingen.
Gegenwärtig befanden sich nicht mehr viele Kontinentaltruppen in Südkarolina. Die Engländer hatten zu Beginn des Krieges, noch bevor die Männer im Kongress die Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten, versucht, Charleston im Handstreich zu nehmen. Sie hatten einen heftigen Angriff gegen Fort Moultrie geführt, dessen Wälle die Hafeneinfahrt schützten. Celia war damals nicht in der Stadt gewesen, aber sie hatte so viel über das Gefecht gehört, dass sie das Gefühl hatte, dabei gewesen zu sein. Fort Moultrie war vom Zweiten Südkarolina-Regiment verteidigt worden. Die meisten der Männer damals hatten so wenig eine Schlacht erlebt wie die Jungen da draußen in den Booten, aber sie hatten den Briten ein Gefecht geliefert, das keiner, der es erlebte, je vergessen würde. Sie schossen die stolze Kriegsflotte zusammen, dass den Engländern Hören und Sehen verging. Was von den Schiffen danach noch einigermaßen kriechen konnte, stahl sich mit zersplitterten Masten in der Morgendämmerung davon. Seit jenem Tage, der nun schon über drei Jahre zurücklag, hatte man in Charleston keine britische Kanone mehr zu hören bekommen. Etwas später waren die Engländer noch einmal in Küstennähe gesichtet worden, aber sie hatten keinen Angriffsversuch mehr unternommen.
Eine Zeit lang hatten die von Südkarolina gestellten Kontinentaltruppen Fort Moultrie noch besetzt gehalten, und zwar unter dem Kommando von Oberstleutnant Francis Marion, doch nachdem sich lange Zeit nichts mehr ereignete und kein britisches Schiff mehr in Küstennähe kam, war Marion mit seinem Regiment schließlich abgerufen worden. Charleston war inzwischen zum wichtigsten Hafen der jungen, im Entstehen begriffenen Nation geworden. Die europäischen Exporteure wären nur zu gern bereit gewesen, den aufständischen Amerikanern Waren zu senden, aber das war mit erheblichen Gefahren verbunden, da die Flotte des Königs die Seewege kontrollierte, und so geschah es denn auch nur sehr selten, dass ein europäisches Schiff auf direktem Weg einen amerikanischen Hafen erreichte.
Charleston war nun freilich nicht auf Lieferungen aus Europa angewiesen, hatte es doch die Westindischen Inseln sozusagen vor den Toren. Hier, vor allem auf Kuba und Haiti, lebten Hunderte von Kaufleuten, Holländer, Franzosen, Portugiesen und sogar Engländer, denen es völlig gleichgültig war, wem sie ihre Waren verkauften. Die Rebellenschiffe aus Charleston brachten ihnen in der Hauptsache Reis und Bauholz und kehrten mit Waffen für die Truppen, Pflügen und Werkzeugen, Seidenstoffen und Luxusartikeln aller Art beladen zurück. Gab es doch in dem kämpfenden Land immerhin noch zahlreiche Leute, die reich und unabhängig genug waren, Krieg und Revolution zu ignorieren.
Ein Teil der von Westindien hereinkommenden Waren fand Abnehmer in Charleston selbst, der weitaus größte Teil wurde von dort aus weitertransportiert. Es gab da eine Anzahl verwegener Abenteurer, denen es Spaß machte, mit hoch beladenen Planwagen auf Schleichwegen nach Norden zu ziehen, die englischen Linien zu umgehen oder auch zu durchbrechen und ihre Handelsgüter an den Mann zu bringen. Sie verkauften Stoffe, Luxuswaren und Werkzeuge zu hohen Preisen an Zivilisten, die das Geld dafür hatten, und brachten Waffen und Munition zu Washingtons Armee, wo sie sich mit einem ›Dankeschön‹ begnügen mussten.
Es waren gefährliche Geschäfte, die da betrieben wurden. Des Königs Fregatten taten alles, um den Rebellenschiffen den Weg abzuschneiden, und des Königs Landtruppen mühten sich nicht weniger eifrig, die Planwagen der Rebellenhändler abzufangen. Dann und wann ging ein Schiff verloren, hier und da verließ eine Wagenkolonne Charleston, ohne ihr Ziel zu erreichen, aber die Schiffskapitäne kannten die See zwischen Westindien und Charleston besser als die Engländer, und die Führer der Wagenkolonnen kannten Schluchten und Bergpfade, von denen des Königs Soldaten nichts ahnten, und so geschah es denn, dass ein überraschend großer Teil der von den Inseln gelieferten Waren sein endgültiges Bestimmungsziel sicher erreichte.
Einer der erfolgreichsten Schiffsunternehmer, die den Handel mit Westindien betrieben, war Godfrey Bernard, zu dessen Lagerhaus Celia Garth an diesem Morgen ging. Das Lagerhaus war ein großer Backsteinbau in der Nähe des Piers, von dem aus die Soldaten zu den Forts gerudert wurden. Als Celia sich dem Gebäude näherte, spielte die Sonne mit ihren Löckchen, und das Halstuch über ihren Schultern leuchtete weiß. Die Soldaten schrien, lachten und warfen ihr Kusshände zu. Celia erwiderte lachend die Grüße, und da Mrs. Thorley und ihre Aufsichtsdamen nicht in der Nähe waren, warf sie auch ein paar Kusshände zurück.
Die Flügel des großen Doppeltors standen offen. Der Kontorraum, den Celia gleich darauf betrat, war nicht sehr groß. Eine Tür im Hintergrund führte zu einem der Lagerräume. Im Vordergrund, einen Meter vom Eingang entfernt, stand ein schmaler Ladentisch, der dem dahinter sitzenden Kontoristen gleichzeitig als Schreibtisch diente. Auf dem Tisch standen und lagen eine Waage, ein Tintenfass, eine Schale mit angespitzten Gänsefedern und ein paar Kontobücher. Dahinter saß, neben einem Fenster, ein junger Mann, der damit beschäftigt war, die ›Gazette‹ zu lesen. Dies war Darren Bernard, ein Vetter Godfreys, der seit einiger Zeit bei ihm tätig war. Darren und Celia kannten sich gut.
Darren blickte auf, als er Schritte hörte. Kaum dass er Celia erkannte, sprang er vom Sessel auf und ließ die Zeitung fallen. »Der Tag fängt gut an«, strahlte er, ihr die Hand reichend. »Die Mademoiselle kommt sicher, die Florseide zu holen?«
Darren war ein hoch gewachsener junger Mann mit einem gut geschnittenen Gesicht. Das dichte braune Haar fiel ihm in Wellen über die Schläfen und wurde im Nacken von einer sorgfältig geknüpften Bandschleife zusammengehalten. Er pflegte großen Wert auf sein Äußeres zu legen. Gegenwärtig trug er einen dunkelbraunen Schoßrock und beigefarbene Kniehosen. Den Rockausschnitt schmückte eine gefältelte Spitzenkrawatte. Seine weißen Strümpfe zeigten kein Fältchen. Seine kupfernen Knie- und Schuhschnallen blitzten. Darren besaß kein eigenes Vermögen, aber er hatte zahllose gut situierte Freunde und pflegte jeden Tag als Gast in einem anderen Hause zu speisen, sodass er es sich leisten konnte, den größten Teil seines Gehaltes für seine Garderobe zu verwenden und sich wie ein Mann von Rang und Stand zu kleiden.
Darren war an sich der Sohn wohlhabender Eltern, aber seine Mutter war sehr jung gestorben, und sein Vater hatte sein Vermögen in kurzer Zeit verspielt und vertrunken und war schließlich bei einem Duell getötet worden. So war Darren schon mit sechzehn Jahren gezwungen gewesen, die Schule zu verlassen und sich nach einem Gelderwerb umzusehen. Da er ein intelligenter Bursche war und eine gute Handschrift schrieb, hatte ihn sein Vetter Godfrey nach einiger Zeit in seinem Kontor angestellt. Sein Gehalt reichte aus, sein Zimmer zu bezahlen und sich ein Pferd und einen farbigen Diener zu halten, dessen Hauptaufgabe darin bestand, seine Kleidung in Ordnung zu halten. Wenn ihn jemand fragte, wovon er lebe, pflegte er zu sagen: »Ich spiele den Laufjungen für meinen reichen Vetter.« Er äußerte sich niemals bitter über seines Vaters liederlichen Lebenswandel und hatte augenscheinlich keinerlei Ehrgeiz, seine eigenen Glücksumstände zu verbessern. Er war stets heiter und guter Laune, genoss die Tage, wie sie kamen, und machte sich keine Sorgen um die Zukunft.
Jetzt fragte er Celia, ob sie schon gefrühstückt habe. »Ich habe einen Kessel auf dem Feuer«, sagte er, als sie den Kopf schüttelte, »würde die Mademoiselle Bedenken haben, eine Tasse Tee zu trinken?«
»Im Gegenteil«, lächelte Celia, »ich würde mich freuen.«
Darren liebte Komfort und Behaglichkeit. Wenn er am frühen Morgen im Kontor sitzen musste, pflegte er sich stets ein heißes Getränk zu bereiten. »Ich weiß nicht, warum manche Leute etwas dagegen haben, Tee zu trinken«, sagte er. »Er ist sowieso geschmuggelt, und König Georg bekommt keinen Penny Zoll dafür. Hier ist die Florseide – die Mademoiselle mag schon einen Blick darauf werfen, bis ich den Tee bringe.«
Er zog eine der großen Schubladen des Ladentisches auf und holte sieben Rollen Florseide heraus, die hier schon bereitlagen. Celia breitete ihren Einwickelstoff aus und legte die Rollen darauf. Während Darren zum Nebenraum ging, ließ sie den kostbaren Stoff bewundernd durch die Finger gleiten.
Die Florseide lag etwa einen Meter breit, und jede Rolle enthielt dreißig Meter. Dies war eine Auswahl wundervoller Farben: Zartrosa und Blau, Grün und Grüngold, Rot, Orange und Schwarz. Das Material war so hauchdünn, dass es möglich gewesen wäre, hindurchsehend ein Buch zu lesen. Als Darren mit dem Teetablett zurückkam, das er auf den Ladentisch stellte, flüsterte Celia: »O Darren, das ist exquisit!«
»Allerdings«, stimmte Darren zu, »und was werden Miss Celias zarte Finger aus dem zarten Material herstellen?«
Celia nahm die Teetasse entgegen, die er ihr reichte, trank einen kleinen Schluck und fühlte einen Knoten im Hals. »Ich?«, stieß sie heraus. »Nichts! Oh, es macht mich so wütend!« Sie brach ab und sah ihm ins Gesicht. »Sie werden das nicht verstehen«, sagte sie.
»Warum nicht?«, fragte er lächelnd.
»Sie sind so zufrieden mit Ihrem Leben. O Darren, haben Sie eigentlich niemals das Verlangen, jemand zu sein?«
Darren lachte glucksend: »Wieso? Ich bin jemand. Ich bin ein Genießer.«
»Ein – was?«
»Ein Mensch, der Dinge genießt, die andere gemacht haben.« Er grinste. »Menschen, die Dinge herstellen, benötigen andere, die sie würdigen und genießen. Stimmt’s nicht?«
Celia musste, ungeachtet ihres Grolls, lachen. Darren fuhr fort: »Ich bin nicht allzu dumm, und ich bilde mir ein, einen recht guten Geschmack zu haben. Ich würdige und genieße Bücher und Musik, schöne Kleider, Pferde, eine gute Mahlzeit, edle Weine und andere schöne Dinge. Ja, finden Sie nicht, dass dies eine wichtige und bedeutsame Tätigkeit ist?«
Sie nickte abwesend, schon wieder mit der Florseide beschäftigt. Darren, der sie beobachtete, gewahrte ihren nachdenklich verschleierten Blick. »Celia«, sagte er, »was bedrückt Sie?«
Celia sah ihn an. »Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen, Darren«, sagte sie, »aber Sie dürfen es ruhig wissen. Ich muss endlich einmal darüber reden.«
»Reden Sie, Celia«, entgegnete er, ernster als bisher. »Sagen Sie mir, was Sie auf dem Herzen haben.«
Celia erzählte ihm, dass ihre Probezeit in Mrs. Thorleys Salon sich dem Ende zuneige und dass sie fürchte, man könne sie danach zu ihren Verwandten zurückschicken. »Und wenn sie mich dabehalten sollten«, fuhr sie fort, »bin ich bange, dass sie mich weiter Nähte auftrennen und Knöpfe annähen lassen, bis eine der älteren Näherinnen heiratet oder stirbt oder, aus irgendeinem Grund, weggeht. Ich bin die beste Schneiderin in ganz Charleston«, stieß sie heraus, »ich weiß es ganz genau, denn ich sehe ja, was sie alle können. Aber außer mir selbst weiß es niemand. Darren, ob Sie es glauben oder nicht, ich kann nähen. Ich – ich könnte ein Kleid machen wie – wie ein Traum! Aber wie, um alles in der Welt, kann ich es jemals beweisen?«
Darren dachte nach. »Wie ist es?«, sagte er nach einem Weilchen. »Könnten Sie nicht Stoff kaufen und in Ihrer Freizeit ein Kleid nähen?«
»Kaufen? Wovon denn? Lehrlinge erhalten keinen Lohn, nur Unterkunft und Verpflegung. Als ich im Frühjahr nach Charleston ging, hat mein Onkel mir zehn Dollar in Noten gegeben, für den Fall, dass ich einmal ein paar Kleinigkeiten brauchte. Davon habe ich noch vier Dollar. Stoff wie der hier« – sie berührte eine der Seidenflor-Rollen – »kostet achtzehn Dollar pro Meter.«
»Irrtum!«, stellte Darren fest. »Er kostet jetzt dreißig Dollar Papier. Es gehen jetzt so viele Waren nach dem Norden, dass die Dinge in Charleston allmählich knapp und teuer werden. Aber ich verstehe nun, was Sie meinen.«
»Es ist ja auch nicht nur der Stoff«, fuhr Celia fort. »Nähwerkzeuge und Garn kommen dazu. Und es kostet Zeit. Wissen Sie, was es heißt, ein Kleid zu nähen, Stich um Stich, Tausende von Stichen? Und ich habe jeden Tag nur ein paar Stunden nach dem Abendessen. Oh, ich habe das alles immer wieder durchgedacht. Geld könnte ich mir schlimmstenfalls beschaffen, wenn das alles wäre. Ich könnte den Schmuck meiner Mutter verkaufen. Broschen und Ohrringe und ihre silbernen Schuhschnallen. Auch ein wertvoller Halsschmuck gehört dazu, ein altes Familienstück, das mein Vater ihr zur Hochzeit geschenkt hat.«
»Aber das können Sie doch nicht verkaufen«, sagte Darren entsetzt. »Bedenken Sie doch, den Schmuck Ihrer Mutter!«
»O ja, ich würde ihn verkaufen«, versetzte Celia. »Ich gehe nicht zu meinen Verwandten zurück, um mich zu Tode zu langweilen und mich außerdem noch schikanieren zu lassen. Ich bleibe hier. Ich kann nähen, und ich … «
Eine Männerstimme unterbrach sie. Sie kam von der Tür hinter ihrem Rücken:
»Könnten Sie ein Kleid nähen, das passt und das hohen Ansprüchen genügt?«
Celia fuhr herum. Darren, der auf sie und nicht auf die Tür geachtet hatte, hob den Kopf. Beide atmeten auf, als sie einen gemeinsamen Bekannten an der Tür stehen sahen.
Captain Jimmy Rand von der Staatsmiliz zog den Hut. Sein schwarzes Haar glänzte im Schein der durch das Fenster hereindringenden Sonne. Er winkte Darren mit der Hand und wandte sich Celia zu. Ein spöttisches Lächeln kräuselte seine Lippen.
Zweites Kapitel
Captain James de Courcey Rand war groß und schlank, ein dunkler Typ mit brünettem Teint und pechschwarzen Haaren. In seiner schmucken blauen Uniform wirkte er noch dunkler und schlanker. Er hatte ein im Grunde hässliches, aber gleichwohl ansprechendes Gesicht mit etwas eingedrückten Schläfen, knochigem Kinn und breiten Lippen. Sein sarkastisches Lächeln schien zu sagen, dass er das Leben im Ganzen amüsant, das Treiben der Menschen im Allgemeinen aber ziemlich lächerlich fände.
Jimmy lebte in Charleston mit seiner verwitweten Mutter. Sein Vater war Reispflanzer gewesen, und Jimmy war der jüngere von zwei Söhnen. Als zweiter Sohn hatte er beim Tode seines Vaters nur ein bescheidenes Vermögen geerbt, sodass er gezwungen gewesen war, sich seinen Lebensweg selbst zu bahnen. Aber, im Gegensatz zu Darren, war er nicht ohne Ehrgeiz. Er hatte in England die Rechte studiert und arbeitete gegenwärtig in einem Anwaltsbüro in der Broad Street. Er war tüchtig und wendig, und die Leute sagten ihm eine große Zukunft voraus. Jeder, der ihn kannte, war überzeugt, dass er die ihm durch seine Zweitgeburt erwachsenen Nachteile eines Tages aus eigener Kraft ausgleichen werde.
Miles, sein älterer Bruder, war nach dem Tode des Vaters Besitzer der Bellwood-Plantage, und Miles und Jimmy waren gute Freunde, obwohl sie den Familienbesitz wie Löwe und Maus geteilt hatten. Miles war verheiratet. Er würde, wie Celia wusste, in absehbarer Zeit einen Erben bekommen. Mrs. Miles Rand hatte nämlich bei Mrs. Thorley Babywäsche in Auftrag gegeben. – Dies war einer der Gründe, warum es Celia Spaß machte, dort zu arbeiten: Sie erfuhr immer, was in der Stadt gerade vor sich ging.
Darren Bernard hatte Jimmy gekannt, solange er lebte. Celia hatte ihn vor etwa einem Monat kennengelernt, als er eines Tages im Geschäft erschien, um Hemden zu bestellen. – Es war ein regnerischer Tag, und weitere Kunden waren gerade nicht da. Jimmy und Celia kamen ins Plaudern, und dem jungen Mann schien es nicht das Geringste auszumachen, dass Celia nur ein Nähmädchen war und auf einer anderen sozialen Stufe stand als der Sohn eines Plantagenbesitzers. Sie unterhielten sich prächtig miteinander. Seit jenem Tag war Jimmy Rand des Öfteren in Mrs. Thorleys Modesalon aufgetaucht.
Sosehr Celia sich freute, ihn hier in Mr. Bernards Warenhaus unvermutet wiederzusehen, im Augenblick war ihr wichtiger, was er bei seinem Eintritt gesagt hatte. Aber Jimmy äußerte sich einstweilen nicht weiter über diesen Punkt. An den Ladentisch herantretend, sagte er in seiner üblichen lässigen Manier: »Verdammt hübsch sehen Sie aus heute Morgen, kleine Lady. Reizender Morgengruß für einen Mann, der sich die Nacht um die Ohren geschlagen hat!« Sein Blick fiel auf ihre leere Teetasse, und er fuhr, zu dem jungen Bernard gewandt, fort: »Wie ist es, Darren? Ich komme gerade von Fort Moultrie und bin eigentlich hereingekommen, weil ich weiß, dass man bei dir um diese Zeit immer eine Tasse heißen Tee kriegen kann.«
»Ich mach’ uns eine frische Kanne«, antwortete Darren. Jimmy wandte sich Celia zu, während Darren in den Nebenraum. ging. Sein sonnengebräuntes Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln. Sein Kinn war von dichten Bartstoppeln bedeckt, aber das war auch alles, was daran erinnerte, dass er während der Nacht nicht geschlafen hatte.
»Was habe ich da vorhin gehört, kleine Lady?«, sagte er. »Sie wollen lieber den Schmuck Ihrer Mutter verkaufen, als zu Ihren Verwandten zurückzugehen?«
Celia erwiderte seinen Blick. Sie hatten oft miteinander geplaudert, aber noch nie über persönliche Dinge. »Sind Sie schockiert?«, fragte sie. »Darren war es.«
Jimmy schüttelte lächelnd den Kopf. »Es hat mich ein bisschen überrascht«, sagte er, »aber ich nehme an, Sie haben gewichtige Gründe.«
»Und ob ich die habe!«, versetzte Celia. Sie fand, Darren Bernard sei ein feiner Kerl, aber Jimmy Rand sei offenbar vernünftiger. Sie beobachtete seine Hand, die auf der Kante des Ladentisches lag. Ihr gesundes Braun hob sich scharf von dem kräftigen Blau des Uniformärmels ab. Er trommelte nicht mit den Fingern, und sein ganzes Benehmen verriet Gleichmut und unerschütterliche Ruhe. Er wirkte frisch und gespannt. »Macht es Ihnen etwas aus, darüber zu sprechen?«, fragte er.
»Im Gegenteil«, antwortete Celia, »wenn ich Sie nicht langweile.«
Darren kam mit der Teekanne zurück und füllte drei Tassen. Während Celia an ihrem Tee nippte, erzählte sie ihm und Jimmy von ihrem Onkel, ihrer Tante und ihrem Vetter Roy.
Celias Onkel, William Garth, besaß eine Reisplantage, die er von seinem Vater geerbt hatte. Sie hieß Kensaw-Plantage nach einem Indianerstamm, der früher hier seine Jagdgründe gehabt hatte. Die Besitzung lag an einem kleinen Fluss, der in den Ashley River mündete. Sie war nicht sonderlich groß, aber einträglich und befand sich, als William sie übernahm, in tadellosem Zustand. Dies blieb sie unter seiner Bewirtschaftung dann allerdings nicht lange.
William Garth war ein gebildeter, liebenswürdiger Mann, der mit den Problemen, die das Leben für ihn bereithielt, nicht fertig wurde. Er beherrschte Latein und Griechisch und war in der Geschichte und Vorgeschichte Europas und Asiens zu Hause, aber er hatte keine Ahnung, wie man Bodenfrüchte zweckmäßig anpflanzt und verkauft. Er lernte es auch nicht. Und so geschah es dann, dass die Kensaw-Plantage langsam, aber sicher zurückging. William gab sich verzweifelte Mühe, sie zu halten. Er heiratete, und seine Frau schenkte ihm zwei Kinder. Sein Leben erschöpfte sich in dem fruchtlosen Bemühen, seinen daniederliegenden Besitz wieder ertragfähig zu machen und seiner Familie ein Leben zu ermöglichen, wie es seine Frau als selbstverständlich voraussetzte.
Williams jüngerer Bruder, Edward, Celias Vater, war tüchtiger. Da er selbst kein Land besaß, arbeitete er als Buchhalter im Kontor eines Reisgroßhändlers in Charleston. Er heiratete eine Waise, die ihm aber eine gute Mitgift ins Haus brachte. Als Celia geboren wurde, schien ihre Zukunft gesichert.
Aber das Schicksal wollte es anders. Als Celia ein Jahr alt war, etwa zur Zeit, als Georg III. in England zum König gekrönt wurde, griff in Charleston eine Epidemie um sich, die ihre Eltern in kurzer Zeit hintereinander dahinraffte. Onkel William, ihr einziger Verwandter, kam nach Charleston, um das kleine Mädchen zu holen. Er hatte seinen Bruder geliebt und hielt es für seine selbstverständliche Pflicht, sich seiner kleinen Nichte anzunehmen. Aber ihm war nicht wohl zumute bei dem Gedanken an die neue Last, die ihm da aufgebürdet werden sollte. Er wusste schon nicht, wie er sich und die Seinen einigermaßen anständig durchs Leben bringen sollte. Aber dann wartete seiner eine angenehme Überraschung. Als er Edwards Papiere durchsah, stellte er fest, dass sein Bruder offenbar ein besserer Rechner gewesen war als er. Er hatte die Mitgift seiner Frau nicht nur nicht angerührt, sondern sie durch eigene Ersparnisse noch vergrößert. Eine Last fiel ihm von den Schultern, und auch Louisa, seine Frau, war nicht wenig erleichtert.
Celia wuchs auf der Kensaw-Plantage zusammen mit Williams Kindern auf. Roy, der Sohn, war vier Jahre älter als sie und Louisas ganzer Stolz. Celia mochte ihn nicht, obwohl er zu einem hübschen Jungen heranwuchs und auch klug und geschickt war. Denn er war gleichzeitig ein verzogener Bengel und schon als Junge fest davon überzeugt, dass die Welt sich um ihn zu drehen habe.
Gott sei Dank hatte sie nicht viel mit ihm zu tun. Die Mutter schickte ihn schon mit acht Jahren nach Georgetown, wo er im Hause ihres Bruders lebte und Gelegenheit hatte, eine erstklassige Schule zu besuchen, die dort von den Indigo-Pflanzern gestiftet worden war. Er kam nur in den Ferien nach Hause. Ein paar Jahre später wurde er nach Europa geschickt, um eine Schule in England zu besuchen. William konnte sich das eigentlich nicht leisten, aber was sollte er tun? Von einem Plantagenbesitzer erwartete man nun einmal, dass er seine Söhne auf eine englische Schule schickte. Und William hielt es für seine Pflicht zu tun, was man von ihm erwartete. Niemand konnte von William Garth behaupten, dass er nicht zeit seines Lebens versucht habe, das Beste zu tun.
Sein zweites Kind, Harriet, war ein scheues kleines Mädchen. Sie hatte nichts von ihrem Bruder und dessen hochfahrendem Wesen, sondern war schüchtern und anlehnungsbedürftig. Celia, die sehr viel selbstbewusster war, kam gut mit ihr zurecht.
Louisa behandelte Tochter und Nichte völlig gleichmäßig und zog Harriet in keiner Weise vor. Beide Mädchen hatten immer die gleichen Spielzeuge und trugen gleiche Kleider. Sie genossen auch dieselbe Erziehung. Wenn sie nicht viel Zärtlichkeit von Louisa erfuhren, lag das daran, dass die viel beschäftigte Frau nicht mehr zu vergeben hatte. Sie liebte ihren Mann, fühlte sich aber mehr als seine Beschützerin, und sie vergötterte Roy, aber damit war der Quell ihrer Liebe auch erschöpft. Bei den Mädchen tat sie, was sie für ihre Pflicht hielt. Sie tat immer und überall ihre Pflicht.
Da William in allen praktischen Dingen versagte, mühte Louisa sich nach Kräften, diesen Mangel ihrerseits auszugleichen. Sie versah ihre Hausarbeit mit großer Sorgfalt und viel Geschick. Im Haus herrschte immer eine so peinliche Ordnung, dass man denken konnte, es werde überhaupt nicht bewohnt. Die Mahlzeiten wurden pünktlich auf die Minute serviert. Das Essen war kräftig und gesund. Reste gab es nie, sämtliche Überbleibsel fanden anderweitige Verwendung. Ungeachtet der unsicheren finanziellen Verhältnisse fehlte dank Louisas Geschick nie etwas im Haus. Ja, die tüchtige Frau brachte es sogar fertig, Roy laufend einen großzügigen Wechsel nach England zu schicken und Jahr für Jahr einen größeren Betrag für Harriets Aussteuer zurückzulegen.
Den beiden Mädchen brachte Louisa Rechnen und Schreiben bei; sie lehrte sie früh, zu spinnen und zu nähen. Als Celia zehn und Harriet neun Jahre war, schickte sie beide nach Charleston auf die Schule. Sie erhielten dort außerdem Unterricht im Tanzen, in feinen Nadelarbeiten und in anderen Fähigkeiten, die man von jungen Damen der Gesellschaft erwartete. Sie blieben drei Jahre in Charleston und kehrten dann auf die Plantage zurück. Von da an hatten sie nichts mehr zu tun, als heranzureifen und darauf zu warten, dass Männer kamen, um sie zu heiraten.
Der Krieg begann, als Celia sechzehn Jahre alt war. Roy hatte gerade seine Studien auf der Schule in England abgeschlossen und befand sich auf einer Vergnügungsreise durch Frankreich. Revolution und Kriegsausbruch führten indessen in den Kolonien zu einer schweren finanziellen Krise, sodass es Louisa nicht länger möglich war, ihrem Sohn Geld zu schicken. Roy musste nach Hause kommen. – Ein gut gewachsener, vornehm gekleideter junger Herr mit eleganten Umgangsformen und kostspieligen Gewohnheiten, erschien er eines Tages auf der Kensaw-Plantage.
Roy war entsetzt, als ihm klar wurde, wie es um die Besitzung bestellt war. Er hatte sich bisher für einen reichen und unabhängigen jungen Mann gehalten. Aber er war praktischer und vor allem in finanziellen Dingen weit weniger unsicher als sein Vater. Und er war fest entschlossen, seine Lebensumstände in kürzester Zeit zu verbessern. Ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu diesem Ziel schien ihm die schnelle, angemessene Verheiratung der beiden Mädchen.
Er sah sich persönlich in der Nachbarschaft um und umwarb und umschmeichelte jedes Mädchen aus guter Familie, das einen unverheirateten Bruder mit solider Vermögensgrundlage hatte. Und es währte denn auch nicht lange, bis Harriet mit einem jungen Mann namens Ogden verlobt war. Mr. Ogden hatte wässerige Augen, eine Habichtsnase und ein abfallendes Kinn. Im Profil sah er aus wie ein Fisch. Aber er war der älteste Sohn einer Familie, der eine große Plantage am oberen Ashley River gehörte. Roy Garth hatte unzweifelhaft das Talent seiner Mutter zur Bewältigung schwieriger Probleme geerbt.
Roy gab sich redliche Mühe, auch Celia unter die Haube zu bringen, hatte dabei aber weniger Erfolg als bei seiner Schwester. Celia schlug hintereinander zwei Heiratsanträge aus. Sie erklärte, beide Männer kämen für sie nicht infrage.
Der erste Bewerber war Mr. Hawkins, ein reicher, aber ungewöhnlich geiziger Mann. Er machte mehrere ziemlich lächerliche Versuche, den romantischen Liebhaber zu spielen, aber Celia zweifelte nicht einen Augenblick, dass er mit seinem Antrag weit weniger romantische Zwecke verfolgte. Ihn reizte, von ihrer Mitgift abgesehen, offenbar, dass sie perfekt spinnen und nähen konnte. Celia war überzeugt, er hatte sich ausgerechnet, dass ihn ihr Unterhalt keinen Penny kosten würde.
Ihr zweiter Verehrer, Mr. McArdle, war ein Witwer mit drei kleinen Kindern. Celia verzichtete. Sie machte sich wenig aus Kindern. Und ganz gewiss hatte sie keine Neigung, die Kinder einer anderen Frau aufzuziehen.
Celia hatte es mit dem Heiraten nicht eilig. Sie wusste, dass ein Mädchen, dem seine Eltern eine Mitgift hinterlassen hatten, jederzeit Verehrer vor seiner Tür finden würde.
Einstweilen arbeitete sie eifrig an Harriets Aussteuer. Das machte ihr Spaß, denn sie nähte gern, und sie erwartete als ganz selbstverständlich, dass sie eines Tages, wenn sie selbst heiratete, eine entsprechende Aussteuer mitbekommen würde. Es wurde eine prächtige Hochzeit, und William, Louisa und Roy bekamen erst hinterher einen Schreck, als ihnen nämlich klar wurde, was sie gekostet hatte.
Roy erklärte seinen Eltern, dass es keinen Sinn habe, Celia länger im Unklaren zu lassen; sie müsse wissen, wie ihre Angelegenheiten ständen. Also sah Celia sich eines Nachmittags in Onkel Williams Studio ihren Verwandten gegenüber. Louisa und William saßen nebeneinander auf dem Diwan. Louisa hatte ein Kontobuch auf dem Schoß, und William machte Knoten in sein Taschentuch. Er sah bekümmert aus. Tante Louisa sagte, was zu sagen war.
Sie sagte, Mr. McArdle, der ehrsame Witwer, sei sehr betrübt gewesen, als er Celias Abweisung erfahren habe. Aber sie glaube, dass er sich entschließen würde, seinen Antrag zu wiederholen, wenn man ihm zu verstehen gäbe, dass sie, Celia, ihre Meinung geändert habe.
Celia antwortete verblüfft, sie habe ihre Meinung in keiner Weise geändert. Alles, was Mr. McArdle wünsche, sei ein Kindermädchen für seine drei Gören, und sie denke sich schon, dass es ihm Spaß machen würde, eine Mitgift dazu zu bekommen.
Als Celia so weit mit ihrer Erzählung gekommen war, legte sie eine Pause ein. Sie trank einen Schluck von ihrem Tee, stellte die Tasse zurück und sah Darren und Jimmy gedankenvoll an.
»Ich hatte gar keine Mitgift mehr«, sagte sie.
Jimmy nickte weise, als habe er genau das zu hören erwartet. Darren wollte es genau wissen: »Sie meinen, Ihre Verwandten hätten Sie darum betrogen?«
»O nein«, versicherte Celia. »Mein Geld war einfach aufgebraucht. Tante Louisa hatte alle Unterlagen zur Hand. Mein Unterhalt hatte alles bis auf den letzten Penny verschlungen. Meine Kleider, Wäsche, Bücher, Schul- und Pensionsgelder und was da sonst noch alles war. Sie hatten genau Buch geführt und konnten alles belegen. Tante Louisa meinte, sie hätten gehofft, sie würden es mir nicht zu sagen brauchen. Sie hätten gehofft, ich würde einen Mann heiraten, der mich um meiner selbst willen liebte. Denn sie könnten es sich leider nicht leisten, mir selbst etwas mitzugeben.«
Celia hielt abermals inne. Die Männer schienen interessiert, und so fuhr sie nach einem Weilchen fort:
»Nun«, sagte sie, »ich wünschte Mr. McArdle auch unter diesen Umständen nicht zu heiraten. Und da ich keine Lust hatte, meinen Verwandten weiter auf der Tasche zu liegen, beschloss ich, mir Arbeit zu suchen. Das gefiel ihnen gar nicht. Vor allem Roy war zunächst entsetzt. Er hatte vermutlich Angst, die Leute könnten denken, den Garths ginge es schlecht, wenn sie ihre Nichte arbeiten ließen. Mir war es egal, was er dachte. Ich sagte, wenn sie mich jetzt hinderten, müsste ich mich natürlich fügen, aber dann würde ich mir Arbeit suchen, sobald ich volljährig sei. Die Rechnungen für Harriets Hochzeit waren noch zu bezahlen, und es kamen immer noch neue dazu. So sagte Roy schließlich, sie sollten mir meinen Willen lassen. Wahrscheinlich hatte er sich überlegt, dass es immer noch besser sei, als wenn sie mich auf dem Hals hätten. Er dachte vielleicht auch, dass ich ohne Mitgift überhaupt keinen Mann finden würde und dass Nähen eine Beschäftigung sei, die man einem Mädchen aus gutem Hause allenfalls gerade noch zumuten könne. Sicher hatte er Angst, ich könnte ihnen anderenfalls eines Tages als alte Jungfer zur Last fallen. Tante Louisa stimmte ihrem Liebling zu, und Onkel William fuhr mit mir nach Charleston und brachte mich bei Mrs. Thorley als Lehrmädchen unter.«
Celia zuckte die Achseln und lächelte flüchtig. »Der arme Onkel William! Es gefiel ihm gar nicht. Ich glaube, er schämte sich. Bevor wir fuhren, forderte er mich auf, mit ihm ein Stück am Fluss entlangzugehen. Dort gab er mir dann den Schmuck meiner Mutter und sagte, ich sollte ihn in Ehren halten, vor allem den kostbaren Halsschmuck. Das sei ein altes Erbstück. Er wisse nicht genau, wie alt er sei, aber die ersten Garths, die vor rund hundert Jahren von England herüberkamen, brachten ihn schon mit. Onkel William erklärte mir, mein Großvater habe ihn meinem Vater in seinem Testament vermacht, und deshalb gehöre er mir. –
Ich würde ihn natürlich nur sehr, sehr ungern verkaufen«, fuhr Celia fort, »aber ich gehe nicht nach der Kensaw-Plantage zurück. Unter keinen Umständen! Verstehen Sie das?«
»O ja«, versicherte Darren, und Jimmy setzte hinzu:
»Sie sind noch nicht volljährig jetzt?«
»Nein. Erst in etwa sieben Monaten. Nächsten April.«
»Dann könnten Sie den Schmuck vor April ohnehin nicht verkaufen«, stellte Jimmy fest. »Aber Sie sollten sich deswegen jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Erinnern Sie sich, was ich Sie fragte, als ich hereinkam?«
Celia nickte: »Sie fragten, ob ich ein Kleid nähen könnte, das passte und das hohen Ansprüchen genügte. Ich kann’s.«
Jimmy langte nach der Teekanne. Er grinste: »Ich habe vor ein paar Tagen zufällig gehört, wie eine Dame sagte, in ganz Charleston gäbe es keine Schneiderin, die es könnte.«
»Ich kann’s«, versicherte Celia abermals.
Jimmy hob seine wetterbraune Hand; die Bewegung schien zu sagen: Vorsicht, mein Kind! Das sarkastische Lächeln spielte wieder um seine Lippen.
»Die Dame, die ich im Sinn habe, ist nicht leicht zufriedenzustellen«, sagte er.
»Oh, lassen Sie es mich versuchen, Jimmy!«, bat Celia erregt.
»Sie ist sehr reich«, fuhr Jimmy ungerührt fort. »Sie hat sich ihre Garderobe normalerweise stets in Paris anfertigen lassen.«
Celias Blick streifte Darren, der auf der anderen Seite des Ladentisches stand und das Kinn in die Hand stützte. Sein Gesichtsausdruck verriet Erstaunen und Unruhe. Er sah aus wie jemand, dem soeben ein Licht aufgegangen ist.
»Nun«, fuhr Jimmy fort, »die Dame, an die ich denke, ist gerade von ihrem Landsitz zurückgekommen. Vor ein paar Tagen waren Mutter und ich abends bei ihr eingeladen. Bei der Gelegenheit hörte ich sie lamentieren. Sie war jetzt, wegen des Krieges, fünf Jahre nicht mehr in Paris. Sie meinte, sie habe es wiederholt mit hiesigen Schneiderinnen versucht, aber die seien ja einfach unmöglich. Sie habe auch nicht eine gefunden, die in der Lage sei, ein wirklich passrechtes Kleid zu schneidern.«
»Nicht einmal Mrs. Thorley?«, fragte Celia.
Jimmy schüttelte den Kopf. »Offensichtlich nicht. Die Dame meinte, sie sei völlig ratlos, denn ihre Kleider begännen allmählich auseinanderzufallen. Ich halte das für erheblich übertrieben, denn die Kleider, in denen ich sie sah, saßen und standen ihr großartig, einige fand ich geradezu wundervoll. Das habe ich ihr denn auch gesagt.«
»Und?«, fragte Celia atemlos. »Was hat sie geantwortet?«
»Sie meinte, ich solle den Mund halten und nicht von Dingen reden, von denen ich nichts verstände. Ich sei nicht einmal in der Lage, ein Kleid von einem Scheuertuch zu unterscheiden.« Er grinste: »Nun, was meinen Sie?«
»Vorsicht, Celia!«, sagte Darren, und er sagte es sehr betont. Celias Gesicht fuhr zu ihm herum: »Was heißt das? Kennen Sie die Dame, von der Jimmy spricht?«
»Ziemlich genau«, versicherte Darren. »Er spricht ohne Zweifel von Vivian Lacy.«
Jimmy lachte.
»Und – wer ist das?«, fragte Celia.
»Mrs. Herbert Lacy von Sea Garden«, sagte Darren. Er wandte sich Jimmy Rand zu. »Jimmy«, stieß er heraus, »du solltest nicht – ich meine, du solltest Miss Celia zumindest erst sagen, was sie von Vivian zu erwarten hat.«
Da Jimmy immer noch kicherte, hielt Celia sich an Darren.
»Was ist mit ihr?«, stieß sie heraus. »Sagen Sie es mir.«
»Ich will es versuchen«, seufzte Darren. »Zunächst einmal: Sie ist an die fünfundsechzig, glaube ich. Möglicherweise älter.«
Celia war ein bisschen enttäuscht. Es würde ihr sehr viel mehr Spaß gemacht haben, Kleider für eine junge, schöne Frau zu nähen. Aber das war schließlich nicht das Wichtigste. »Das ist mir ganz egal«, sagte sie. »Ich mag nette alte Damen sehr gern.«
Darren ließ abermals einen Seufzer hören, der schon mehr ein Stöhnen war, und Jimmy lachte schallend.
»Celia«, sagte Jimmy schließlich, »ich will Ihnen nichts vormachen. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Vivian ist keine ›nette alte Dame‹.«
»Aber …«
»Vivian hat ihre eigene, höchst einmalige Art zu leben; sie hatte sie schon immer.«
Celia fühlte sich allmählich doch ein bisschen beklommen. »Wie lange kennen Sie sie denn schon?«, fragte sie.
»Ich habe sie gekannt, seit ich auf der Welt bin«, antwortete Jimmy. »Mein Vater war mit einem ihrer Männer verwandt.«
»Mit – einem ihrer Männer? Wie viele hatte sie denn?«
»Fünf«, grinste Jimmy, und Darren setzte hinzu:
»Und jeder von ihnen ließ sie, als erstarb, reicher zurück, als sie vorher gewesen war. Bis auf Mr. Lacy. Der ist auch reich, aber er lebt noch.«
»Sind Sie etwa auch mit ihr verwandt?«, fragte Celia.
»Ja. Durch Heirat«, antwortete Darren. »Mit einem anderen ihrer Ehemänner. Sie ist Godfrey Bernards Mutter.«
Celia blickte verblüfft von einem zum anderen. »Was passierte mit all diesen Ehemännern?«, fragte sie. »Hat sie sie vergiftet?«
»O nein«, grinste Jimmy. »Wenn Vivian Lust verspürte, einen Mann umzubringen, würde sie es vermutlich tun, aber sie würde sich gewiss nicht eines so schleichenden Mittels wie Gift bedienen. Sie würde eine Pistole nehmen und ihm mitten auf der Broad Street eine Kugel in die Brust schießen.« Er setzte, ein wenig ernster, hinzu: »Vielleicht hat Darren recht, Celia, und Sie sollten erst gar nicht versuchen, für sie zu arbeiten. Es wäre bestimmt keine einfache Sache.«
Celias Hände ballten sich zu Fäusten, und ihre Augen blitzten. »Darauf will ich es ankommen lassen«, sagte sie. »Ich würde es versuchen, und wenn sie des Teufels Großmutter wäre. Ich habe gerade vorhin den festen Entschluss gefasst, von mir aus etwas zu tun, um in Charleston bleiben zu können und eine ständige Arbeit zu finden. Und wenn sich mir jetzt eine Chance bietet, dann werde ich sie mir um nichts in der Welt entgehen lassen.«
Jimmy lächelte sie verständnisinnig an. »Ich kann natürlich überhaupt nichts versprechen«, sagte er. »Aber ich werde Vivian erzählen, bei Mrs. Thorley sei eine junge Dame, die perfekt nähen könne. Vielleicht – ich sage ausdrücklich: Vielleicht! – entschließt sie sich dann, zu Mrs. Thorley zu schicken und ihr sagen zu lassen, dass sie Sie sprechen möchte.«
Celia wurde schrecklich aufgeregt. Sie öffnete gerade den Mund, um etwas zu sagen, als draußen die Glocken der Turmuhr von St. Michael anschlugen. »Großer Gott!«, stieß sie heraus. »Ist es schon sieben? Packen Sie die Seide ein, Darren, ich muss machen, dass ich fortkomme.«
Jimmy nahm ihr das Bündel ab und sagte, dass er sie begleiten werde. Celia hatte Mühe, ihre Erregung zu verbergen.
»Wann werden Sie Mrs. Lacy sprechen?«, fragte sie, während sie nebeneinander über die Lamboll Street gingen.
»Wenn es ihr gefällt, mich zu empfangen, kleine Lady«, versetzte Jimmy heiter. »Man geht nicht zu Vivian, wenn man nicht ausdrücklich gebeten wurde. Man fragt höflich und bescheiden an, wann man die Ehre haben dürfe.«
Celia seufzte. Lieber Gott, dachte sie, wie schön muss es sein, wenn man sich sein Leben so ganz nach seinen eigenen Wünschen einrichten kann!
Vor dem Haus von Mrs. Thorley reichte Jimmy ihr das Bündel mit der Florseide. »Ich gehe jetzt zu meiner Mutter«, sagte er. »Ich werde ein bisschen mit meinem Hund spielen und mich dann aufs Ohr legen. Aber ich verspreche Ihnen, Vivian noch vor dem Abend ein paar Zeilen zu schicken. – Und hier«, setzte er hinzu, »das möchte ich Ihnen schenken, kleine Lady.«
Er holte eine silberne Uhrkette aus der Tasche seiner Uniformweste. An ihrem Ende hing ein Gegenstand, den er losnestelte. »Das ist die linke Hinterpfote eines Kaninchens«, grinste er, »geschossen am Freitag, dem 13.«
»Oh!«, rief Celia entzückt. »Ich bin an einem Freitag, dem 13., geboren.«
»Dann müssen Sie das Ding erst recht haben. Mein Negerboy Amos hat das Kaninchen geschossen und mir die beiden Hinterpfoten als Glücksbringer gegeben. Die eine habe ich meinem Hund ans Halsband gehängt, diese hier habe ich bisher mit mir herumgetragen.«
Er drückte ihr die Kaninchenpfote in die Hand. »Ich werde sie immer bei mir tragen«, versicherte Celia.
Sie lachten sich an. Jimmy war kein schöner Mann, aber Celia fand, während sie jetzt zu ihm aufsah, er habe ein sehr bemerkenswertes Gesicht.
Jimmy drückte ihre Hand mit der Kaninchenpfote, sagte: »Viel Glück!«, und nickte ihr ermutigend zu. Celia blickte ihm noch einen Augenblick nach, wie er mit langen Schritten davonging, und betrat herzklopfend das Haus, die Kaninchenpfote fest mit der Hand umklammernd.
Drittes Kapitel
Der Gong rief zum Frühstück, als Celia Miss Loring im Nähsaal die Florseide ablieferte. Die Mädchen, die schon eine Stunde gearbeitet hatten, legten Nadeln und Fingerhüte beiseite und liefen die Treppe hinab.
Der Speisesaal befand sich im Erdgeschoss hinter dem Empfangssalon. Mrs. Thorleys Armsessel stand am Kopfende einer langen Tafel. Neben ihr saßen zur Linken und Rechten Miss Loring und. Miss Perry. Die Schneiderinnen und Nähmädchen folgten nach dem Grad ihrer Wichtigkeit für das Geschäft. Celias Platz war ganz unten, beinahe am Fuß der Tafel.
Die Mädchen standen hinter ihren Stühlen, und die beiden farbigen Bedienerinnen warteten vor der Tür. Die Mädchen boten mit ihren weißen Häubchen und Halstüchern und ihren frischen Leinenkleidern ein hübsches Bild. Durch die Tür kam der Duft gebratenen Schinkens.
Neben jedem Teller stand ein Glas Milch. Mrs. Thorley ließ weder Tee noch Kaffee servieren. Dies sollte zum Ausdruck bringen, dass sie in dem im Lande tobenden Krieg keine Partei zu ergreifen wünsche.
Die Bewohner von Charleston waren in ihrer Meinung geteilt. Die meisten hielten es mit den Rebellen, aber es gab auch eine beträchtliche Anzahl von Tories, die dem König nach wie vor die Treue hielten. Tories nannte man sie nach der gleichnamigen Aristokratenpartei im Mutterland.
Wie in anderen Staaten hatten die Tories auch in Südkarolina eigene Regimenter gegen die Rebellen ins Feld gestellt, die grüne Waffenröcke trugen und Schulter an Schulter mit den Rotröcken, den von Übersee herangeführten regulären Truppen, gegen die Revolution kämpften. Mrs. Thorley pflegte auf die Frage, auf welcher Seite sie mit ihren Sympathien stehe, zu antworten, sie sei eine einfache Schneiderin und verstehe nichts von Politik. Sie sprach nie über Krieg und Revolution und verbot auch ihren Angestellten, darüber zu sprechen. Auf diese Weise behielt sie ihre Kunden. Das Servieren von Tee oder Kaffee in ihrem Haus hätte, wie sie meinte, eine Parteinahme bedeutet.
Es gab Rebellenfamilien, in denen Tee getrunken wurde, aber eifrige Revolutionäre taten es nicht. Für sie war Tee gleichbedeutend mit einem Symbol der britischen Tyrannei, zumal die von der Krone verfügte Teesteuer für die Kolonien zu Beginn der Revolution eine bedeutsame Rolle gespielt hatte. Sie tranken stattdessen Kaffee. Da aber vor dem Kriege Kaffee in Charleston als Frühstücksgetränk nicht üblich gewesen war, hätte der Genuss dieses Getränks nach Mrs. Thorleys Meinung gleichfalls eine Parteinahme bedeutet. Die Tories in der Stadt pflegten neuerdings bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Tee zu trinken, um auch auf diese Weise ihre unverbrüchliche Treue zu König Georg zum Ausdruck zu bringen. Mrs. Thorley wünschte nicht in den Geruch zu kommen, eine Tory zu sein. Deshalb ließ sie zum Frühstück Milch servieren.