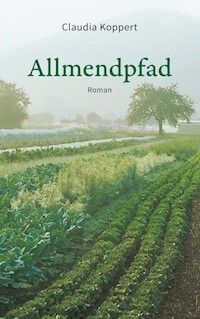
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nichts und niemand sollte einen dazu bringen, etwas aufzugeben, bloß weil abzusehen ist, dass es verschwinden wird." Am Allmendpfad liegen die Äcker, die Luzie von ihren Eltern geschenkt bekommt, und plötzlich zieht es sie mit Macht zurück ... Aber kann man heute noch vom Land leben? In einem Roman, der sich über drei Generationen erstreckt, erzählt Claudia Koppert bildhaft und zugleich sehr realistisch von einer verschwindenden Welt und dem Versuch, sie sich auf neue Art zurückzuholen. "... ein Roman von naturbelassener Kraft, spröde im Ton, aber direkt - wie frisch gepflückt. Lesen! Alles andere ist Plastik." STERN "Claudia Koppert hat viel Gespür für das bäuerliche Leben. Den Fallen der Idyllik und des Heimatkitschs entgeht sie durch ihren lakonischen, unaufgeregten Ton. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG "Dieses Buch ... ist voller Klugheit, Schönheit, Poesie. Selbst das 'Viehische' der Menschen berührt zutiefst. Es ist ... eine Liebeserklärung an das Land, der Hände Arbeit und deren Früchte." DIE WELT
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claudia Koppert, 1958 in Heidelberg geboren, ist nach einem Studium der Sozialarbeit als Lektorin tätig, seit langem freiberuflich. Daneben eigene publizistische Arbeiten zu politischen Themen.
Allmendpfad war ihr erster Roman, ein zweiter erschien 2014, Sisterhood – eine Sehnsucht, 2019 folgte der Erzählband Im Vogelgarten. Sie lebt zwischen Bremen und Hamburg auf dem Land. Mehr unter: www.claudiakoppert.de
Die Fähigkeit, in einer Welt zu leben, kann sich nur in dem Maße realisieren, als Menschen gewillt sind, die Lebensprozesse zu transzendieren und sich ihnen zu entfremden, während umgekehrt die Vitalität und Lebendigkeit menschlichen Lebens nur in dem Maße gewahrt werden können, als Menschen bereit sind, die Last, die Mühe und die Arbeit des Lebens auf sich zu nehmen.
Hannah Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Erstes Kapitel
DER JUNGE MANN erwartet sie schon an der Ecke. Es ist kaum jemand unterwegs. Wer unter der Woche im Feld arbeitet, verschläft sonntags die Zeit zwischen Mittagessen und Kaffee. Den beiden ist nicht nach Schlafen, sie sind verlobt, und der Sonntagnachmittag ist ihre einzige Zeit für sich allein. Vorm Eckhaus läuft Spülwasser über den Gehweg, die junge Frau springt drüber, dann ist sie da. Besonders er ist sehr verlobt, er legt den Verlobungsring bei der Arbeit nicht ab, was die Männer gewöhnlich tun, er streift ihn nur vom Finger, um die betreffende Stelle und den Ring selber zu schrubben. Seine Schwestern machen sich darüber schon lustig, was ihn nicht im Geringsten stört. Die junge Frau trägt den Ring zwar auch immer, aber dann wundert sie sich plötzlich doch wieder, wenn sie ihn an ihrer Hand gewahr wird, und vorstellen kann sie sich das alles noch nicht recht: dass sie heiraten und zusammen Äcker bestellen werden.
Sie entfernen sich schnell vom Ort. Er läuft auf dem Fußweg neben dem Gleis, alle paar Schritte zu ihr hinsehend, stolz und froh; sie balanciert auf den Schienen. Meistens gehen sie hier entlang, denn niemand außer ihnen geht hier spazieren, und in den Obst- und Gemüsegärten rechts und links des Gleises ist sonntagnachmittags kein Mensch. Sie erzählen sich, was unter der Woche war, im Feld, im Stall, daheim; lachen über Vogelscheuchen, sich zersetzende Pferdeäpfelhaufen, darüber, wie es klingt, wenn er einen Schotterstein vom Fußweg zurück aufs Gleisbett kickt und der an die Schiene prallt; besprechen, was sie gern essen, was überhaupt nicht gern und was am liebsten, denn in nicht allzu ferner Zeit werden sie zusammen essen, nicht mehr sie bei ihren Eltern, er bei seiner Mutter.
Er bricht mitten im Satz ab, merkt, irgendwas geht ihr durch und durch. Sie steht auf der Schiene, ein Bein in der Luft, starrt ihn an, nein, sie sieht ihn überhaupt nicht, Gott, wie ist sie schön, was sie bloß hat. Er ist dabei zu erzählen, dass der Herr Bramsig nach der letzten Probe auf dem gemeinsamen Stück Heimweg zu ihm gesagt hat: »Dann geht doch nach Kanada!« Herr Bramsig, der sich mit Vereinsorchester-Dirigieren über Wasser hält, seit er aus der Kriegsgefangenschaft zurück ist. Der junge Mann hatte ihm gesagt, seine Verlobte und er wüssten nicht, wie und was, es sei einfach nicht an Äcker heranzukommen. Er bringt kein Wort mehr heraus, so, wie sie jetzt da steht, hat er sie noch nie gesehen. Da fängt ihr Gesicht an zu leuchten, man denkt, alles Schöne auf der Welt ist in dem Gesicht. »Ja«, sagt sie, »warum eigentlich net noch Kanada?«, lacht, springt vom Gleis zu ihm auf den Weg, lehnt sich im Weitergehen vertrauensvoll an ihn. Überrascht und erleichtert nimmt er ihre Hand in seine. Fest und warm und groß kommt ihm seine Hand plötzlich vor.
»Kanada!«, sagt er lachend und schüttelt den Kopf; merkt, wie sie so gehen, dass sie ihm diesmal ihre Hand nicht nur überlässt, sondern seine von sich aus festhält. Die Äcker dort seien bestimmt riesengroß, sagt sie, ihr Vater habe während des Kriegs solche Äcker in Russland gesehen, kein Grenzstein, bis zum Horizont nicht, unermesslich große Äcker. Jetzt macht es ihm gar nichts aus, daran erinnert zu werden, dass er seinen Vater das letzte Mal gesehen hat, als er acht war. Nichts von russischen Äckern hat der erzählt, immer nur, dass er so Heimweh habe, dableiben wolle, und dann musste er doch wieder fort. – Sie läuft jetzt auf den Schwellenenden, die Hand fest in seiner, ihr Blick sagt etwas, was sie ihm noch nie gesagt hat: dass sie zu zweit etwas anfangen können, was Neues, weg von den Eltern und allem, was schon immer so und so war und zu sein hat; sie beide zusammen; dass das das Glück ist. Der junge Mann merkt, wie es sich in ihm ausbreitet. Nicht wie hier alle fünf Meter ein Grenzstein, sagt sie und springt vom Gleis. Etwas Eigenes werden sie anfangen, wie sie es haben wollen, er ist ganz sicher. Ab und zu gerät Rainfarn zwischen sie, eine Dolde reißt er ab: kleine Blütenkuchen, gelb, kreisrund und fest. Die junge Frau nimmt wieder seine Hand.
Diesmal laufen sie bis zur Eisenbahnbrücke. Hier verschwindet das Gleis über den Fluss Richtung Güterbahnhof, hier endet der Fußweg.
Sie kehren um. Vorne das Feld, dahinter die Berge, am Übergang von beidem die Stadt. Dem jungen Mann ist der Anblick vollkommen vertraut, und doch kommt es ihm so vor, als ob er zum erstenmal richtig hinsähe. Hier draußen liegen die Getreide-, Klee- und Kartoffeläcker, Richtung Ort nimmt das Gemüse und Obst zu, man sieht es schon von weitem an den Bäumen. Rechts ein schöner Kartoffelacker, die Stauden beinah einen drei viertel Meter hoch und voll in Blüte. Der Boden ist gut, außerordentlich fruchtbar, noch dazu bei der Lage: vor dem Gebirgszug, der den kalten Ostwind abhält, die Sonnenstrahlung und den Regen dagegen einfängt.
Ihre Blicke treffen sich, sie gehen nun langsam, wie im Abschied. Die Grundstücke werden kleiner; hier schräg aufs Gleis zulaufend, sind sie selbst im spitzesten Winkel bestellt. Hundertjährige Kirschbäume mit bis auf den auf den Boden herabreichenden Zweigen, Spaliere von Tafeltrauben, Beerensträucher, Pfirsichbäume, deren voll behangene Äste abgestützt werden müssen, Stangenbohnen- und Tomatenreihen, Krautäcker. Mittendrin das Gleis, auf dem die Ernte in der Saison waggonweise abtransportiert wird.
Am Gleis hat es zwischen ihnen im Grunde genommen auch angefangen, auf der nördlichen Strecke unterhalb der Berghänge, nach einem Fest im Nachbarort. Hier versuchten sie zum erstenmal, für sich zu zweit nebeneinander herzulaufen, zurückzubleiben hinter ihrer Korona vom Musikverein. Sie gingen langsam und langsamer, aber je langsamer sie gingen, desto langsamer wurden auch die anderen. Kurz vor der Gabelung im Ort, wo sie sich hätten trennen müssen, probierten sie es andersherum, überholten und marschierten den anderen davon, immer am Gleis entlang.
Sie sprechen nicht wieder von Kanada, am nächsten Sonntag nicht, am darauf folgenden nicht. Die junge Frau sagt nur noch einmal, in dieser und jener Gegend, keine fünfzig Kilometer entfernt, ständen Höfe zum Verkauf, habe der und der Händler erzählt. Der junge Mann hat jetzt eine Zuversicht, von der er vorher überhaupt nichts wusste, merkt, sie beide haben sie, sie gehört ihnen zusammen, es ist das, was sie zusammen ausmacht. Seine Schwestern mokieren sich nicht mehr. Der Herr Bramsig sagt nichts mehr von Kanada, aber es scheint ihm immer eine Freude zu sein, wenn er sie beide trifft. Alle sehen, dass sie zusammen bis nach Kanada kämen, wenn’s sein müsste.
Es ist nicht notwendig. Seine Mutter wird rechtzeitig aktiv: Kauft einer ihrer Schwestern einen Acker ab, warum die den hergibt, man weiß es nicht; sie tauscht, beruhigt ihre Töchter, spricht ihnen gegenüber von Bauerwartungsland, was viel mehr wert sei als Ackerland. Die Eltern der jungen Frau wollen sich nicht lumpen lassen und geben einen Acker und Frühbeetkästen dazu. Nach zwei Jahren Spazierengehen am Gleis bleiben die beiden, wo sie sind: im Feld; mit einem Rechen, den sie an der Stelle gefunden haben, wo der mittlere Hauptweg das Gleis kreuzt, und behalten können, weil sich auf die Fundanzeige hin niemand meldet; etwas Ackerland, vierzig Metern Frühbeetkästen und siebzig Quadratmetern Gewächshaus.
Ihre Tochter Luzie wird im späten Herbst geboren, da sind sie bereits seit einem Jahr verheiratet und die Spaziergänge so gut wie vergessen. Die junge Frau hört abends im Rundfunk die Callas als Lucia di Lammermoor, eine Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera, als sie gegen halb elf zu dem jungen Mann sagt: »Jetzat gäihn mer awwer.« Sie fasst sich ein Herz, nimmt das braune Köfferchen, das neben der Nähmaschine bereitsteht, und den Mantel, er geht schon eine ganze Weile nicht mehr zu. Die Luft draußen ist feuchtkalt.
Die Diakonissen lassen den jungen Mann gar nicht erst herein, er fährt wieder nach Hause. Was soll sie auch jetzt mit ihm. Nach Stunden wirft der Strudel aus Schmerz, Angst, Hilflosigkeit sie kurz an die Oberfläche, sie sieht das Gesicht der Oberschwester dicht heranfahren, die Schwesternwangen blühen, nur die bläulich schimmernde Ader an der Schläfe tritt hervor. »Stellen Sie sich nicht so an!«, liest die junge Frau von den Oberschwesterlippen. Da wird sie schon wieder fortgerissen.
Als sie am nächsten Morgen zu sich kommt, ist sie völlig erschöpft, würde am liebsten wieder in den Schlaf zurücksinken, erschrickt, wie hell es ist, es muss mitten am Tag sein, für Augenblicke sehnt sie sich nach dem seligen Vergessen der Lucia aus Lammermoor, dann ist sie wach. »Hoffentlich werd’s ’in Bu’, dass der Nome weitergäiht«, hieß es zuletzt dauernd. Die Schwester bringt ihr ein Mädchen. Es hat einen weißen Baumwollstreifen ums winzige Ärmchen mit dem Zeichen für weiblich, dem Datum, ihrem angeheirateten Namen, das soll jetzt ihr Kind sein. Draußen kreischen Straßenbahnen.
Am Nachmittag springen und klettern Leute vorm Krankenhaus aus der Straßenbahn; diejenigen, die den Krankenbesuch schon hinter sich haben, steigen ein, die alten Frauen halten ihre Taschen mit dem zusammengefalteten Blumenpapier fest an sich gedrückt. Unter den Einsteigenden ist die Schwiegermutter der jungen Frau, Luzies Oma Babette.
Sie lässt sich auf einen Einzelplatz am Fenster fallen, froh, dass sie den Besuch hinter sich hat. Ein Mädchen, Hauptsache, es fehlt ihm nichts, ist ja nur das erste… Man sagt halt, was man so sagt, Oma Babette versucht mit sich zufrieden zu sein, das hat sie ihrer Schwiegertochter auch empfohlen: Das wird wieder, man braucht nur Zuversicht im Herrn. Nächste Woche stehst du wieder auf dem Acker.
Immerhin war ich heut schon dort, sagt Oma Babette sich, ihre eigene Mutter besucht sie erst morgen; von vorgestern, wie die ist, hat die Angst vorm Straßenbahnfahren, und der Günther muss sie hinbringen. Kurz scheint die Straßenbahn in den Schaufensterscheiben auf, bremst kreischend, beim Anfahren ruckt sie, so dass sich Oma Babette mit beiden Händen an der Vorderbank festhält, als fahre sie Karussell. »Treue, Fleiß und Redlichkeit, führt mich durchs Leben allezeit«, gewohnheitsmäßig schiebt sie einen Spruch im Mund herum; speziell dieser vertreibt einem üble Nachgeschmäcke, hat sie früher mal herausgefunden, »Glaube, Lieb, Bescheidenheit, führt mich in die Seligkeit.«
Ihr ist trotzdem flau. Da sitzt man am Bett, sagt halt irgendwas, und jedes Wort scheint für die Schwiegertochter ein Schlag ins Gesicht zu sein. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht gemerkt hätte. Sie ärgert sich über die Schwiegertochter, die es immer so anstellt, dass Oma Babette sich wie eine Dampfwalze vorkommt. Was glaubt die denn? Kinderkriegen ist halt nicht so pläsierlich wie Kindermachen. Hätte ich ihr nicht unbedingt auf den Kopf zusagen müssen, meint Oma Babette jetzt doch.
Die feinen Nerven werden der schon noch gezogen, kann man in unserem Geschäft nicht brauchen, sie macht die Lippen zu einem Strich, packt die Handtasche und stellt sich zum Aussteigen an die Tür. In Gedanken ist sie bereits auf dem Weg zum Rosenkohlacker und überschlägt die Erntemenge; wem sie den Rosenkohl anbietet, wieviel sie verlangen kann.
Als die junge Frau mit dem Kind den Hof betritt, kommen nacheinander alle angelaufen, schieben den Zipfel des Kopfkissens, in dem es liegt, zur Seite und stellen fest: »Do isch sie jo, die Luzzi.«
»Des heeßt net Luzzi, des heeßt Luh-zie«, versucht die Mutter sie zurechtzuweisen, unsicher, ob das mit dem Namen wirklich richtig war, katholisch, wie er ist.
Luzie lebt bei der Mutter und dem Vater. Sie hat zwei Omas, einen Opa, eine Urgroßmutter, neun Cousinen und Cousins, drei Onkel, vier Tanten, fünfzehn bis zwanzig Großonkel, Großtanten. Dazu kommen die Geschichten von den Vorfahren. Manche Geschichten gehören zum Alltag wie die grau angelaufenen Suppenteller, manche werden zusammen mit den goldgeränderten Sammeltassen hervorgeholt, aber die meisten sind draußen im Feld in einem alten Haisel, unter einem Kirschbaum oder Pfostenstapel und suchen die Leute bei der Arbeit auf.
Zum ersten Geburtstag bekommt Luzie die erste Sammeltasse geschenkt und die ersten Kaffeelöffel des hundertzweiundzwanzigteiligen Silberbestecks, Basis, Ausrüstung und Ausweis jedes Mädchens vom Feld. Unterdessen bringt sie es schnell hinter sich: hilflos weinen und wimmern, alles und jedes anlachen, krabbeln, sitzen, stehen, die ersten Gehversuche. Dann kippt Luzie den Laufstall am oberen oder unteren Ackerrand um und marschiert los. Sie hält sich bei den Leuten der umliegenden Äcker auf. Irgendjemand ist meistens da. »Wann’s Zeit isch, schickt mi’ hohm«, lernt sie bald sagen, damit sie rechtzeitig zum Nachhausefahren wieder zurück ist auf dem Acker der Eltern.
Gelegentlich sind sie in Feldgegenden, wo Luzie sich nicht auskennt, so zum Kartoffelnlesen. Luzie wetzt in den Furchen von einem zum anderen, Eltern, Tanten, Onkel, Oma, alle machen Kartoffeln aus, ein gemeinsamer Kartoffelacker für Oma Babettes Kinder, Kindeskinder und sie selber. Zuletzt verkriecht Luzie sich in ihrer Aufregung unter einem Heubock auf dem Nachbaracker.
Die Stimmen sind weit weg, im Halbdunkel unterm Heubock sieht sie die offen liegenden Mausegänge, und wo kein Mausegang ist, sind harte Grasstorzel. »Die isch fort, die Luzie«, hört sie es rufen. »Wu isch sie dann, die Luzie?« Schließlich: »Do misse mer uhne die Luzie hohmfahrn«, ganz nah. Da krabbelt sie doch lieber unter dem Heubock hervor, die Mutter und der Vater sitzen davor in der Hocke, nehmen sie in Empfang. Als Luzie im darauf folgenden Jahr fragt, wann wieder Kartoffeln ausgemacht werden, erfährt sie, dass es das letzte gemeinsame Kartoffelnausmachen war, Oma Babette und Luzies Eltern kaufen ihre Kartoffeln jetzt im Landhandel.
Oft liegt ein Zittern in der Luft, dass Luzie kaum zu atmen wagt. Halb von einem Baum verdeckt oder im Schatten eines Schuppens stehend, beobachtet sie, wie einer im Vorbeifahren an seinem Acker anhält, weil der Nachbar frisch gepflügt hat, aussteigt, sich in Höhe des Grenzsteins breitbeinig hinstellt und über den aufgerichteten Daumen, das eine Auge zugedrückt, die Furche peilt. Die Luft zittert, egal, ob der Nachbar die Grenze gehalten hat, eine Handbreit auf seiner Seite blieb oder einen halben Meter herüberkam. Am meisten zittert die Luft und mit ihr Luzie, wenn sich das Peilen an einem Acker ihrer Eltern abspielt.
Luzie hat das merkwürdige Talent, dort aufzutauchen, wo sich etwas zusammenbraut; spätestens, wenn es sich entlädt, ist sie zuverlässig da. Wenn Opa Schorsch und Oma Sannsche – vorgefahren, um die abgetrockneten Zwiebeln einzuholen – schon von weitem sehen, dass alles nass ist, weil der Nachbar die letzten beiden Tage ihr Zwiebelstück mitgewässert hat, und Opa Schorsch Richtung Nachbar brüllt: »Du Stier, du u’verschämter!«, und dabei seinen Stock in die Luft stößt, erscheint Luzie hinter ihnen auf dem Gewanneweg.
Sie ist es auch, die Onkel Karl dabei hat, als er Pfirsiche ernten fährt in den grasischen Weg und dort zum ersten Mal glasig gelb anläuft, wie eine kranke Hühnerleber, denn der grasische Weg ist fort, und die Pfirsiche sind auch fort. Die Pfirsichbäume finden sie auf einem haushohen Haufen zusammen mit dicken Kirschbaumstämmen, Johannisbeer- und Stachelbeerbüschen. Schweigend wendet Onkel Karl das Fuhrwerk auf der seltsam glattgeschobenen Fläche. Im Hof springt er vom Wagen, spannt nicht einmal ab, so eilig hat er es, in die Küche zu Tante Magda zu kommen. Luzie stellt sich unters Küchenfenster, Tante Magda pfeift mit ihrem Wellensittich, dann geht die Küchentür, die Wörter vom Onkel Karl rumpeln und pumpeln durch die Küche, Töpfe klappern im Spülstein, bis Tante Mag da schließlich ganz laut sagt: »Du bringsch jo aa dei’ Maul net uf!«
Oma Babette scheint Bescheid zu wissen, von ihr lässt es sich Luzie auseinandersetzen: Die Flur um den grasischen Weg wird für Kliniken gebraucht und die neue Universität. Sie hätten verkaufen sollen. Jetzt wird enteignet, wenn sie die Äcker nicht doch noch hergeben. »Wer nicht will im Guten, muss bluten«, sagt Oma Babette.
Oma Babette kennt sich aus. Sie verkauft Feld, lässt bauen und zahlt Luzies Vater und Tanten vorzeitig Erbe aus. Sie schmeißt nicht einfach alle Schreiben auf den Küchenschrank mit dem Satz: »Die solle na erscht emol kumme.«
Im Winter, wenn gerade kein Feldsalat gerichtet wird und kein Rosenkohl, wenn Luzie da ist, bald auch ihr Bruder Kurt und die Cousine Helga, dann holt Opa Schorsch mit ihnen den Schellenbaum aus dem Stall für die Höllenmusik. Oma Sannsche stopft sich noch mehr Watte in die Ohren, als sie sowieso drin hat, weil es ihr im Ohr klingelt, und verzieht sich ins Nähen.
Der Schellenbaum ist so groß wie Opa Schorsch, wenn er sich aufrichtet; am Querholz hängen Glocken vom alten Schlittengeläut, Schuhwichsdosen mit krummen Nägeln drin, zwei Topfdeckel, mit Draht so befestigt, dass sie zusammenscheppern, wenn man daran zieht. An die Spitze hat Opa Schorsch einen Bethlehemstern montiert, mit Goldbronze bemalt.
Über die Vorderseite sind dicke Drähte gespannt, darüber ratscht Opa Schorsch mit einem gezahnten Stecken, stampft den Baum auf die Küchendielen. »…ahoi, ahoi, ahoi.« Luzie und Kurt hüpfen im Takt auf der Bank, »wir warn im Osten, wir warn im Westen«, selbst jetzt steht Helga hinter Opa Schorsch auf einem Hocker und frisiert ihm die Haare, sein Nacken ist hoch ausrasiert, aber oben stehen sie dicht und silbern, »doch in der Heimat, da ist’s am besten.« Helga verarbeitet alle Haarnadeln aus Oma Sannsches Frisierdose, rafft Strähnen mit alten Zopfspangen zu kurzen Schwänzen zusammen, baut Schleifen ein, während es scheppert, ratscht, klingelt, stampft und sie gemeinsam schreien: »Blaue Jungs, blaue Jungs von der Waterkant!« Tränen laufen ihnen übers Gesicht von soviel Durchputzen. Höllenmusik ist besser als Rizinus, sagt Opa Schorsch.
Zwischendrin singt er solo, ohne Schellenbaum und ohne sich aufzustützen, dann ist seine Stimme wie aus einer anderen Zeit; Luzie, Helga auf dem Hocker und Kurt nehmen Haltung an. »…einen Kameraden, einen bessren findst du nicht.« Eine Träne rollt links über die Backe, auf den einen Zahn zu, den Opa Schorsch noch hat, aber am Mundwinkel biegt sie ab. Der Kamerad war der Selbische Fritz, der soll auch einen Schellenbaum gehabt haben. Der Selbische Fritz ist im Krieg geblieben, in Russland. Oma Sannsche zischt: »Bisch still, vor de’ Kinner«, aber das schert Opa Schorsch nicht.
Auf dem Nachhauseweg schärft Luzie Kurt ein, nichts zu sagen. Und bloß nicht singen. Aber kaum sind sie in der Tür, hebt er an: »…in der Heimat forzt’s am besten«, lacht, zappelt, und der Vater sagt, sie gehörten jedesmal verdroschen, wenn sie von dort kommen. Und zwar bevor sie überhaupt Gelegenheit hätten, den Mund aufzumachen, damit sie zur Besinnung kämen. Die Mutter regt sich über den Vater auf: »Hosch du vielleicht o Minut Zeit fär dei’ Kinner?«
Luzies Leute wohnen in der Arbeit, deshalb glaubt sie zuerst, es komme vor allem darauf an, was man ist. Zwischen vier und neun will sie Metzgereiverkäuferin werden – statt Gärtnerin, wozu ein Mann notwendig ist, aber die guten Männer sind alle schon vergeben und zu alt. Eine Metzgereiverkäuferin dagegen kommt auch ohne Mann aus.
Samstag vormittags wird Luzie mit einer Tasche, darin Einkaufszettel und Portemonnaie, in die Metzgerei zwei Häuser weiter geschickt. Erst von der Mutter, dann von Oma Babette. Die Kundinnen stehen dicht gedrängt, aber irgendeine sorgt immer dafür, dass Luzie nach einer Weile vor die Theke gelangt und ihre Tasche abgeben kann. Bei gutem Wetter liegt der Collie vor der Ladentür und lässt die Kundschaft an sich vorbeidefilieren. Er erhebt sich nie.
Luzies Augen folgen den Händen der Verkäuferinnen. Die Haut um das Nagelbett erinnert nicht an das gebrochene Leder alter Schuhe; nirgends Schrunden. Die Finger sind aufgedunsen rosig wie die der Mutter nach der Strumpfwäsche am Sonntag. Ruckzuck ist der Aufschnitt sortiert, das Fleisch mit dem Blockmesser gleichmäßig geschnitten und die Kalbsleberwurst am Ende akkurat abgeschrägt.
Eine der Frauen hat himbeerrot angemalte Lippen, ihre Hände fliegen nur so durch die Auslage; wenn jemand Suppenknochen verlangt, hantiert sie mit dem Schlachterbeil sicher, den Schwung genau bemessen, so dass Luzie, wenn sie dabei zusieht, jedesmal einen Atemzug auslässt. Die Verkäuferin käme bestimmt auch woanders zurecht, in der weiten Welt, vielleicht in Frankfurt. Aus den Augenwinkeln verfolgt Luzie jede ihrer Bewegungen, und bis sie an der Reihe ist, hat sich das alles zu etwas zusammengezogen, Wunsch und Versprechen in einem, wie es auch sein könnte, überall und himbeerrot, so dass Luzie ihre Augen verlegen an die Würste und Schinken heftet, die aufgereiht hinten an der gekachelten Wand hängen, und sie nicht mehr davon losbringt.
Im Winter hilft Luzie manchmal Opa Schorsch eine dicke Scheibe Griebenwurst, die sie vorher vom Supermarkt geholt hat, in allerkleinste Würfel zu schneiden. Wegen seiner steifen Hüften steht er auf die Ellenbogen gestützt am Küchentisch, Luzie kniet auf der mit rotem Plastik bezogenen Bank, die jetzt an der Stelle ist, wo vorher die Holzbank mit der steilen Rückenlehne stand. Als sie eines Tages hinkam, war nicht nur die Holzbank verschwunden, sondern auch der Misthaufenplatz neben der Haustür. Der Abort war jetzt im Flur, es bestand nicht mehr die Gefahr, in das stinkende, dunkle Loch zu fallen, und wo vorher der von tausend graugelben Äderchen durchzogenene Spülstein war, stand nun ein kleiner weißer Schrank mit einem Edelstahlbecken.
Wenn Opa Schorsch meint, jetzt ist es fein genug, wickelt er die Wurst wieder ins Papier und steckt sie in die Hosentasche. Seine Manchesterhosen, abgewetzt, tabakbraun, riechen nach Vergehen und Geborgenheit wie die Laubhaufen im Winter. Auf zwei Stöcke gestützt geht Opa Schorsch schrittchenweise in den hinteren Hof. Dort klemmt er sich die Stöcke unter den Bauch, aus allen Winkeln kommt es angegackert, er leert mit weiten Armen das Papier aus – ein königlicher Schatzmeister, der zur Feier des Tages dem Volk Münzen hinstreut. Die Mauern und Bretterwände ringsum weichen zurück vor der hysterischen Wolke aus Staub, Gefieder, Gekreische, die sich augenblicklich bildet, wenn die Hühner über die Wurstbröckchen und einander herfallen.
Sein letztes Huhn, die alte Hexi, kocht Opa Schorsch im Herbst, bevor er sich an einem Fenstergriff erhängt, vier Stunden lang; dann wirft er es in die Mülltonne, weil es zäh bleibt wie ein alter Schuh.
Alles kommt und geht, Winter, Frühjahr, Sommer, Herbst, sagt die Mutter zu Luzie, das Leben schleudert uns wie ein Kettenkarussell immer im Kreis herum. Wenn eins nicht mehr kann oder nicht Obacht gibt, fällt es herunter, manche, wie der Opa Schorsch, springen ab. Kaum ist etwas da, ist es schon wieder vorbei. Luzie denkt an das Abendrot Ende September, Anfang Oktober, das den ganzen Horizont Richtung Amerika entflammt, weil die Engel den Ofen der Himmelsbäckerei anfeuern, wie die Mutter früher beim Feldsalatausgrasen immer erzählte. Kaum hat Luzie sich an dieses Abendrot gewöhnt, kommt es nicht wieder, sind die Äcker leer, senkt sich der Himmel auf den Boden, nass und kalt, wird es draußen ganz still. Aber nur kurz, gleich nach Weihnachten setzt das Gezucke und Gebebe wieder ein, die Krähen scheinen es als erste zu merken, hüpfen auf den Januarfeldern herum und machen sich darüber lustig, wie sie sich über alles lustig machen, das sagt auch die Mutter. Die Salatkeimlinge in der beheizten Anzucht sind dann schon einen halben Finger hoch, die Apfelknospen dick, Monate vor dem neuen Austrieb, noch im tiefen Winter, aber Luzie kommt es vor, als sei halb Frühling und der Winter schon wieder halb verloren.
Im Herbst sieht Luzie in die aufgerissenen Augen frisch abgeschlagener Hühnerköpfe, die neben dem Hackklotz liegen, die flach gezackten roten Kämme jämmerlich gekippt, Staunen und Schreck im verloschenen Blick. Luzie ist beim Federnrupfen dabei, lässt sich von der Mutter die blassroten Eierstöcke mit Eiern zeigen, klein wie Stecknadelköpfe bis groß wie Hühnereier. Die größeren Eier werden gepflückt und in einer Schüssel gesammelt. Ihre Schalen, durchscheinend wie Pergament, sind noch weich. In den folgenden Tagen landen sie in der Holländischen Soße oder als Eierstich in der Suppe.
Die für die Pflanzenanzucht vorbereitete Erde lagert unter einem provisorischen Dach im Freien, fein gesiebt, gedämpft, um dem Unkraut die Keimkraft zu nehmen, und mit Torf vermischt. Frühjahr für Frühjahr fällt es einer Häsin ein, hier ihr Wochenbett anzulegen. Nach einer Zeit stellt der Vater die Falle am Eingang des Baus auf. Ob Luzie sich wünschen soll, dass die Häsin wegbleibt; besser, die Jungen verhungern, und sie lebt? Aber Luzie ist dann doch mehr dafür, dass sie weiter zu den Jungen kommt, sie um keinen Preis im Stich lässt. Anfangs scharrt die eine oder andere Häsin die Falle mit Erde zu. Aber irgendwann schnappt die Eisenscheibe hoch und klemmt die Häsin gleich hinterm Schulterblatt zwischen zwei schweren Bügeln ein; manchmal auch nur den Kopf oder ein Bein. Keiner gelingt es je, sich freizubeißen, bevor der Vater wieder nach der Falle sieht.
Der Vater erschlägt die Jungen; er erschlägt die Häsin und präsentiert sie der Mutter. Abziehen und so weiter, das ist ihre Sache. Im Gesicht hat er dann dieses schmale Grinsen, das anzeigt, dass sein Herz frisch entgiftet ist.
Obwohl es jedes Frühjahr dasselbe ist, wechselt die Mutter, wenn der Vater ihr die Häsin hinlegt, jedesmal die Farbe. Luzie und Kurt gehen in Deckung. Sie fängt an, um sich zu schlagen: Es sei wider die Natur, die Jungen und die Alte umzubringen, er sei ein hinterhältiger Vernichter … sie heißt den Vater alles zusammen, aber es nutzt nichts, sie kann schimpfen, soviel sie will, die volle Wucht kriegen ihre Worte nicht. Luzie überlegt, ob sie den Vater umbringt und die Häsin an den Hund verfüttert. Am Sonntag gibt es Hasenbraten. Beim Spaziergang an den bewaldeten Berghängen singen sie »Horch, was kommt von draußen rein« und Kanons.
Am Sonntagnachmittag, während der Vater schläft, bügelt die Mutter. Die Woche schwingt aus wie ein Pendel, gegen fünf ist der Umkehrpunkt erreicht. Die Mutter holt den seltsam geformten schwarzen Pappkoffer in die Küche, packt die Notenblätter und die Klampfe auf den Tisch, legt sich den Riemen über die Schulter und setzt sich.
Auf diesen Augenblick wartet Luzie die ganze Woche. Leise schiebt sie einen Stuhl heran. Die Mutter spielt Walzer, Ländler, sie singt »Ein Jäger aus Kurpfalz« und mit hoher Singstimme: »Drei Zigeuner fand ich einmal … wenn uns das Leben umnachtet, wie man’s verraucht, verschläft und vergeigt und dreimal verachtet.« Sie spielt und lacht und lässt sich zurücktragen in den Schoß der Angst und des Frohseins, in den Luftschutzkeller, zu ihrer Klampfenlehrerin, in den Chor, auf die Gass, unerreichbar für Luzie, die, bevor das Pendel wieder in Fahrt kommt, sich immer »Ännchen von Tharau« wünscht, »mein Reichtum, mein Gut, du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut.« Luzie, in den Stuhl gedrückt, legt die Hände aufeinander und fällt vom Glück ins Elend und vom Elend ins Glück.
Luzie will das Ziehen unter den Rippen betäuben, sie träumt vom abweisenden Schimmern des Perlmutts in Oma Sannsches Knopfschachtel. Luzie hat ihre eigene Schlachterei. Sie operiert Puppen defekt, zerstückelt Wegschnecken zu Salat oder lässt die langen grauen mit dem großen Gehäuse an einem Faden ins Gießwasserbecken hinunter und beobachtet, wie sie sich winden. Gelingt es einer, am Rand hochzukriechen, stößt Luzie sie ins Wasser zurück. Bis die Schnecke sich verausgabt hat. Gelegentlich machen andere Kinder mit. Aber das gibt hinterher nur Ärger.
Luzie verfolgt mit der Hand Gänge bis zur weichen Nestkugel aus Gras, Moos, Haaren, ein grauseidenes fiepsendes Gewimmel. Je nach dem, wie weit die Mäuse entwickelt sind, drängen sie sich zusammen oder stürzen blind davon. Luzie erschlägt sie mit einem Stein alle auf einmal oder einzeln nacheinander. Oder fängt eins ein, besieht sich seine Angst, lässt es wieder laufen, fängt es wieder, merkt, wie es sich in der sacht geschlossenen Hand bewegt. Ungeziefer, das sagen alle.
Luzie unterhält mehrere Friedhöfe: im Hausgarten, beim Gewächshaus und auf Brachäckern. Vom Auto überfahrene Katzen und Vögel werden von den Erwachsenen aufgeschippt und landen entweder in der Mülltonne oder auf dem Misthaufen, wenn Luzie nicht aufpasst und dazwischengeht. Luzie bestattet die Kadaver in Ehren, nagelt aus Kistenlatten ein Kreuz zusammen, pflanzt Veronika oder Gundermann auf die Grabstelle. Nach einem Gewitter gelingt es ihr meist, Dahlien mit abgeknicktem Stiel zu organisieren für einen Blütenteppich.
»Jetzt bisch im Katzehimmel«, sagt Luzie zum Schluss. Oder Karnickelhimmel, Amselhimmel, Taubenhimmel, Spatzenhimmel. Einmal ist es der Rotkehlchenhimmel.
»Warum blouß muss souwas passiern?«, rief die Mutter aus, als sie das Rotkehlchen entdeckte, im Rohr des Trichters eingeklemmt, der außen an der Schuppenwand hängt. Es habe in dem Trichter bestimmt eine Spinne fangen wollen.
»Die Dampfwalz kimmt, die Dampfwalz kimmt, die fährt durch jeden Gaade un’ macht eich all zu Flade«, singt Luzie, eiert mit dem Rad über den Feldweg und überrollt Spinnen, Regenwürmer, Schnecken, Ameisen. Dann wieder traut sie sich kaum aufs Rad, weil sie ja versehentlich ein Viech überfahren könnte.
Auf der Suche nach Opa Schorsch, Oma Sannsche, Oma Babette, verwandten und nicht verwandten Tanten, Onkeln radelt Luzie zu deren verstreuten Äckern, auf dem Gepäckträger ihr Holzschwert, Vogelmiere für die Hühner oder Löwenzahn für die Hasen. Sie hat zu tun. Im September, wenn Starenschwärme ins Feld einfallen, als wäre es ihr Bahnhof, vertreibt Luzie sie von den Trauben.
»Des hot wenigschdens mol ’in Sinn«, sagt der Vater.
Das Gesicht mit Koks geschwärzt, in der Hand eine Latte, fährt Luzie mit dem Rad unter den Stromleitungen hin und her, denn auf den Stromleitungen erwarten sie die Abreise. Sobald sich ein Starenschwarm in der Nähe des Obstackers niederlässt, rast Luzie auch dorthin, schreit und fuchtelt mit der Latte.
Eines Tages trifft sie dabei auf die beiden Damen. Die zwei kommen auf Stöckelschuhen daher wie zehenkranke Hähne. Sie haben sich untergehakt und gleichen sich aufs Haar, das wiederum bei beiden mit einem feinen Netz überzogen ist; das Gesicht, die Nägel sind angemalt, rosa, rot, blassblau in allen Schattierungen. Noch Stunden später hängt das Parfüm über ihrer Wegstrecke. Die beiden stellen sich vor Luzie quer, als sie Stare vertreibend an ihnen vorbeifahren will. In der Not holpert sie über den Rainstreifen. »Unerhört«, »freches Ding«, die Wörter setzen ihr hinterher. Luzie verkriecht sich im Schuppen. »Gockel un’ Geier, die lege ko Eier. Un’ was seid ihr? – Gockel uf Sockel. – Un’ was werd eich blühe? – Die wern eich die Haut abziehe.« Schwarze Schleier von Staren tanzen über den Bäumen, fallen auf die Stromleitungen, blähen sich auf am Himmel und sinken regelmäßig in die Reben.





























