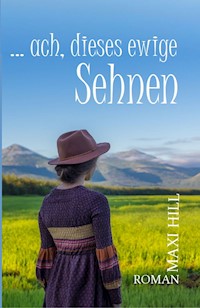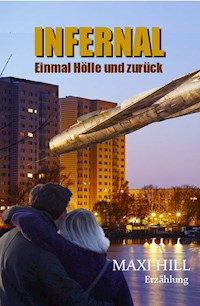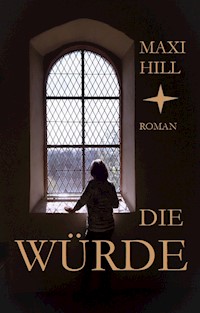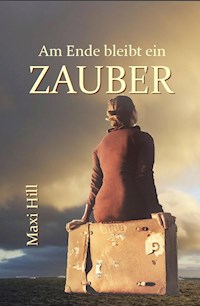Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Wochen im Jahr 1963. Die neunzehnjährige Toni ist verunsichert. Erst benimmt sich ihre Mutter wegen ein paar Minuten Verspätung ziemlich merkwürdigt, dann hört sie von verschiedenen Nachbarn Halbsätze, die allesamt mit ihr, zumindest aber mit einem Geheimnis ihrer Mutter zu tun haben. Ist sie das Kind eines Russen? Je länger sie darüber nachdenkt, desto größer werden ihre Zweifel. Erst als Mutter Merthe erkrankt, kann sie heimlich nach der Wahrheit suchen und versinkt beinahe in einem Chaos an Widersprüchen. Schließlich ist es Merthe selbst, die über das Schreckliche spricht, das ewig unausgesprochen bleiben sollte … Eine bedrückende Geschichte, warum Menschen mit ihrer Vergangenheit nicht umzugehen verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maxi Hill
Als Merthe schwieg
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Toni
Im Dorf
Was ist passiert?
Die Last des gewöhnlichen Lebens
Du bist vom anderen Schlag
Das Leben ist ein mieser Zeitgenosse
Merthe Jacob
Toni und die Dinges des Lebens
Trübe Aussichten und ein Lichtblick
Die Entdeckung
Heiner
Die Liebe einer Mutter
Die Todesnachricht
Neues Leben
Auf der Flucht
Tonis Erinnerung
Das ganz normale Leben
Die Last der Vergangenheit
Merthe schweigt nicht mehr
Das Unvorstellbare
Epilog
Maxi Hill
Impressum neobooks
Toni
Der Tag ist noch jung, die Luft ist frisch. Toni legt mehr Kraft in ihre Beine. Die Räder des nagelneuen Sportrades surren, die Kette knackt bei jeder Umdrehung. Der staubige Weg führt durch einen winzigen Ort vorbei an Feldern dem Wald entgegen, wo hinter den hohen Kiefern die kleine Siedlung des größeren Dorfes beginnt, das ihr Leben bedeutet. Diesen Weg hat sie jetzt täglich zu fahren, seit ihre Mutter krank liegt. Doch es macht ihr nichts aus. Sie ist verliebt, das hüpfende Herz vertreibt die Trübsal des Lebens.
»All΄ mein΄ Gedanken, die ich hab«, summt sie vor sich her und tritt vergnügt in die Pedale. Es ist das Lied ihrer Mutter. Manchmal, wenn Merthe glaubt, allein zu sein, singt sie dieses Lied mit dunkler Stimme, aber ihr Gesicht wird dabei hell.
Gleich wird Toni wieder in sanfte Ruhe gleiten, mit der sie daheim ihrer kranken Mutter begegnen muss. Auf einmal hat sie das Gefühl, dass - abgesehen von ihrer jungen Verliebtheit – ihre Verantwortung um Mutters Krankheit das Einzige ist, was sich an ihrem Leben seit neunzehn Jahren grundlegend geändert hat. Ganz heimlich denkt sie sogar, dass sich gar nichts ändern soll. Sie hängt an ihrer Mutter und kann sich nicht vorstellen, einmal im Leben von zu Hause wegzugehen, wo alles vertraut ist und alles beständig.
Noch ahnt sie nicht, dass ihre Sicht auf die Beständigkeit der Dinge durch die Ereignisse der nächsten Stunden – ja durch einen einzigen Satz ihrer Mutter – tief erschütterte wird.
Vor dem Haus in der kleinen Siedlung am Rande des Dorfes stellt sie ihr Fahrrad vor der Haustür ab und nimmt eine Papierrolle vom Gepäckträger. Trotz schwerer Last hüpft sie leichtfüßig die knarrenden Holzstufen hinauf, greift nach dem Schlüssel, der tagsüber immer im Türschloss steckt, und dreht ihn herum. Das blankgeputzte Namensschild wirft etwas von ihrem Lächeln zurück. Es gibt nichts Edleres in diesem Haushalt, als das Schild aus feinem Messing, das den Namen ihres Vaters trägt – Anton Jacob.
Sie kennt ihren Vater nicht, hat ihn nie gesehen. Auch er hat sie nie gesehen. Der Vorteil liegt bei ihr. Sie lebt. Und sie kennt sein Bild an der Wand; sein glattes gescheiteltes Haar, seinen schmalen Mund im kantigen Gesicht. Aber sie weiß nicht, wie er sich anfühlte, wie er roch.
Schon sehr früh hat man ihr beigebracht, dass in die kleinen Wandvasen aus weißem Porzellan und feinem Goldmuster, die es zu beiden Seiten des Bildes gibt, stets frisches Wasser zu füllen ist, damit das Immergrün nicht verwelkt, das nur sommers mit ein paar Blüten ergänzt wird.
Das tun sie seit neunzehn Jahren gemeinsam: Mama, sie und ihre vier Geschwister.
Seit einigen Jahren ist das schwarze Band von der Ecke des Bildes verschwunden, weil die Trauer verblasst ist. Die Erinnerung verblasst nicht, sagt Merthe Jacob.
Kaum ein Tag ist vergangen, an dem Toni Jacob nicht an diesen Mann denken musste, dessen Namen sie trägt. Es führt ja kein Weg vorbei an dem blanken Schild an der Tür, das man aus Prinzip nicht erneuert hat, das samstags mit Sidol blankgeputzt wird. Papa hätte diese Sorgfalt gefallen, sagt Mama von Zeit zu Zeit. Hätte man ihn vergessen, würde man das Schild entfernt haben?
Es gibt so vieles im Leben ihrer Mutter, was sie hartnäckig verdrängt, als ob sie es wirklich vergessen wollte. Nur das Namensschild eines Toten bleibt hartnäckig an seinem Platz, wie ein Hoffnungsknoten im Taschentuch. Vielleicht fehlte nur das Geld für ein neues Schild?
Hier wohnt Merthe Jacob mit ihren fünf vaterlosen Kindern.
Mit einem Schwung wirft sie das Haar aus der Stirn: Jeder Mensch hat einen Vater. Unser Vater lebt nur nicht mehr.
Im düsteren Flur riecht es nach Bohnerwachs. Die Dielen knarren.
Toni lässt die Jacke von den Schultern gleiten, tastet in der Dunkelheit nach dem Kleiderhaken an der hölzernen Garderobe und öffnet die Tür. Das Licht des Tages fällt auf ihr junges Gesicht. Ein Blick in den Spiegel. Das dunkle Haar rasch mit einer Hand geordnet, die Haut geprüft: Alles in Ordnung! Piet hätte seine Freude an ihr. Aber Piet kämpft gegen den Feind, hält den Himmel der kleinen Welt im Blick. Erst am Samstag hat er Ausgang. Gott, wie lang die Tage bis dahin noch sind.
Die breite Küchentür knarrt. Sie tritt über die Schwelle, auf der sie als Kind gestanden und Lieder vorgesungen hat, Gedichte auswendig sprach oder im Türrahmen mit nackten Füßen nach oben gegrätscht ihre Sportlichkeit beweisen durfte.
Mit dem nächsten Schritt ist sie zurück im Bannkreis ihrer Kindheit, wo die Melodie der Armut noch immer von den Wänden tönt.
»Toni, bist du es?« Merthes Stimme klingt gequält.
»Ja ich, Mama.«
»Es hat wohl länger gedauert?«
Toni schaut auf die Zeiger ihrer kleinen Armbanduhr, weil der Wecker nicht auf seinem Platz im Küchenschrank steht. Noch nicht einmal elf Uhr?
Sie hat sich beeilt und eigentlich war sie sehr rasch wieder aus der Firma heraus gewesen, weil man ihr Problem notgedrungen geschluckt hat. Außer einem kurzen Stopp an der Kreuzung war nicht eine Minute unnütz verstrichen. Nicht einmal für viele Worte zu den Kollegen hat sie sich Zeit genommen.
Nur später an der Kreuzung … Die zwei Militärposten haben ihr Russisch ohnehin schlecht verstanden. Keine drei Minuten, schätzt sie.
»Stell dir vor, Mama, an der Kreuzung hinterm Wald stehen seit Tagen zwei junge Russen. Ich glaube, um die kümmert sich keiner.«
Die Tür zum Schlafzimmer ist einen Spalt breit geöffnet, aber Merthe antwortet nicht, gibt nur gequälte Laute von sich. Auf dem runden Tischchen eines Ensembles aus Korbgeflecht, das irgendwer nicht mehr gebraucht und es Merthe geschenkt hatte, steht ein kleines braunes Radio. Telefunken steht in erhabenen Buchstaben darauf, aber Goebbels-Schnauze sagen die Leute aus alter Gewohnheit. Sie dreht am Knopf und tritt erst jetzt durch die Tür. Der erste Blick ihrer Mutter ist vorwurfsvoll, als habe das Kind etwas Entsetzliches getan. Ihr Atem geht schwer.
»Stört dich die Musik, Mama? «
»Nein …«, sagt Merthe, aber Toni spürt, dass der Rest des Satzes in Mutters Kehle stecken bleibt. Toni weiß, wie elend sich ihre Mutter fühlt und sie ahnt: Die Schmerzen sind der Grund für diesen furchtbaren Blick?
Toni streift behutsam unter Merthes Rücken und legt ein Handtuch auf das Kopfkissen. Sachte drückt sie den Körper zurück in die Liegeposition. Merthe bläst schwerem Atem aus ihrer Brust, als könnte sie die Schmerzen einfach wegpusten. Es gibt keine Erklärung für Merthes Leiden. Der Arzt sagt, es könnte das Herz sein und verschreibt Bettruhe und Pectocor-Salbe …
»Was hat dein Chef gesagt?«
»Kein Problem. Solange ich Arbeit für daheim habe, ist es in Ordnung. Ich hatte nur das Gefühl, er glaubt mir die Geschichte nicht. «
»Wenn es eben nicht geht …«
»Es geht, Mama. Ich fahre jeden Tag einmal hin. Da sehen die, was ich schaffe. «
Die Rolle Plakate hat sie bereits auf den großen Esstisch gewuchtet. So an die fünfzig Stück. Papier hat Gewicht, die Botschaft weniger. Die Plakate sollen zum Tanz in eine der Dorfkneipen einladen. Nichts für Toni. Zum Tanzen fährt sie nie über Land und jetzt, wo sie Piet hat, erst recht nicht mehr. Aber sie beschreibt die Plakate gut und auch gern mit dem Pinsel, und sie hat ihre Freude an der Kunstfertigkeit.
»Herrje, immer durch den Wald …«, sagt Merthe, dreht den Kopf hin und her und presst die Lippen aufeinander.
Irgendetwas ist heut mit ihrer Mutter. Seit unendlich langer Zeit hat sie nicht mehr herrje gesagt, weil sie den Herrn nie bemüht. Sie glaubt, dass es gar keinen Herrgott gibt. Kein göttliches Wesen kann so ungerecht sein, hat sie den Kindern stets gesagt. Und wenn es Gott den Herrn nicht gibt, warum sollte sie ihn im Munde führen. Sie hat ihn längst von ihrer Zunge verbannt und mit jenen Worten ersetzt, auf die sie sich verlassen kann.
Wer sich auf sich selbst verlässt, wir nie verlassen sein. So hat sie es die Kinder gelehrt, und so hat sie es in ihrem Leben immer gehalten.
Meinje, diese Worte schiebt nur ihre Mutter so zusammen, seit Toni denken kann.
»Mama! Durch den Wald ist es nur ein kleines Stück, dann kommt freies Feld, acht Kilometer lang. Was soll schon passieren?«
Sie drückt die Hand ihrer Mutter und streicht behutsam über die welke Haut: »Versuch noch ein bisschen zu schlafen, bis das Essen fertig ist. Was möchtest du essen?«
Wieder trifft sie dieser ungenaue Blick und es dauert, bis Merthe zwischen den Schmerzen die Kraft für Worte findet. Eine Antwort ist es nicht.
»Was habe ich nur verbrochen, dass ich so gestraft werde …?«
»Was wirst du schon verbrochen haben?« Toni lächelt in derselben Art, wie Piet lächeln würde, wenn er die Schwere aus ihrem Blick zu wischen beabsichtigt. »Die, die etwas verbrochen haben, sitzen woanders. Also? Was soll ich kochen?«
Nichts, was Mutter je von ihr verlangt hat, hat sie ausgeschlagen. Sie war ein braves Kind gewesen, ein viel zu braves, eines, das ihrer Mutter immer Recht gegeben hat. Jetzt spielt sie eine andere Rolle. Jetzt muss sie ihrer Mutter das Gefühl geben, sie stehe über den Dingen und sie sei ihre Stütze. Genau genommen war Mama immer das Wichtigste in ihrem Leben, ein Teil von ihr, so, wie sie einmal ein Teil von ihr gewesen war, vor unendlich langer Zeit. Sie war die Hälfte ihres Herzens, ihrer Seele, ihrer selbst, achtzehn Jahre lang. Ihr ganzes junges Leben. Was kann sie dafür …? Sie kann dafür, dass Toni zu Piet gefunden hat, der an diese Stelle drängt. Nicht von außen her. Nein, er drängt von innen in ihr Herz, von ihrem eigenen Inneren, und sie kann nur hoffen, Piet geht es ebenso.
Irgendwo tief in ihr ist dennoch der Glaube lebendig, sie würde immerzu für ihre Mama da sein. Immerzu?
»Grießflammeri«, sagt Merthe zögernd. »Mit Zitrone und Ei-Schaum. Kannst du das?«
Nein, sie kann es sicherlich nicht, aber sie will es probieren.
Im hellbraunen, mit edlen Zierleisten beschlagenen Küchenschrank gibt es nicht viel, was ihr zum Kochen zur Verfügung steht, aber immer, wenn sie eine der oberen Glastüren vor hauchzarten Gardinen öffnet, stößt sie auf die rosa Kelche, die, solange sie denken kann, nie gebraucht wurden, die ihre Mutter aber ebenso hütet, wie das Messingschild an der Tür.
Wie viel Zeit waren Mama und Papa für ihre Stunden zu zweit geblieben, für Momente mit diesen Kelchen? Sie hatten schon vier Kinder und eigentlich waren damit die wenigen Jahre ihrer Ehe ausgefüllt, bis Anton Jacob zwangseingezogen wurde in den mörderischen Krieg.
Und trotzdem ist auch sie selbst als fünftes Kind in den schweren Jahren noch auf die Welt gekommen...
In ihrem Kopf ein Gedanke macht sie ganz rasend: Wenn Mama gewusst hätte, was noch kommt, hätte sie fünf Kinder geboren? Ich würde nicht leben, ich ganz bestimmt nicht.
Es ist die alte Dankbarkeit, die in diesem Moment für Toni Jacob einen neuen Namen bekommt: Leben.
Sie rührt mit feuchten Augen im Topf herum, damit der Flammeri nur nicht anbrennt. Sie ahnt, wie ihre Mutter leidet – unter ihren Schmerzen und zugleich unter ihrer Hilflosigkeit, die sie niemals zu zeigen so verdammt war wie jetzt. Nur den Vorwurf in ihrem Gesicht hat sie nicht verdient, nicht wegen drei Minuten, die sie unterwegs angehalten hat.
Über die jungen Wangen rollt eine Träne, nicht wegen des stillen Vorwurfs. Sie sucht für den Schmerz in ihrer Brust andere Gründe: Sorge um die geliebte Mutter und Enttäuschung über die Ungerechtigkeit der Welt, die manchem Menschen zu viel abfordert. Sie krümmt ihren Körper und lässt den Druck vom Herzen entweichen. Die aufgewühlten Gefühle verzerren die Züge ihres jungen Gesichts.
Wie sie so steht und für Merthe den Flammeri rührt, weiß sie, dass es für sie wieder schön sein wird – am Samstag, wenn Piet sie in seine Arme nimmt. Wer aber nahm all die Jahre die noch junge Witwe Merthe in seine Arme?
So gerne sie stark sein möchte, so tapfer sie sich vor den Menschen gibt, sie spürt, wie ihr die alte Traurigkeit, die sie seit ihrer Kindheit nie wirklich verlassen hatte, die Ruhe nimmt. Diese Traurigkeit würde ein Leben lang bei ihr bleiben und ihre Unbefangenheit blockieren, die ein Mädchen ihres Alters haben darf, wenn sie nicht alles gibt, was ein Kind der Mutter schuldig ist. Hat sie Recht, wenn sie zuweilen sagt: Eine Mutter kann fünf Kinder durch die schlimmste Zeit des Lebens führen, aber fünf Kinder schaffen es nicht, einer Mutter das Leben zu gestalten, das ihrer Würde entspricht. Warum sagt sie das? Wir sind doch ordentliche und gute Kinder. Alle fünf.
Toni füllt den Flammeri in eine flache Schale. Solange er abkühlt, kühlt sie ihr gerötetes Gesicht unter dem Wasserstrahl, richtet ihr dunkles Haar und probiert vor dem Spiegel im Flur ein Lächeln. Ein schelmisches? Ein unbeschwertes? Ein mitleidvolles?
Mit einfachem Lächeln auf den Lippen trägt sie den Flammeri vor sich her und neckt schon von der Tür her mit denselben Worten, die Merthe früher gebraucht hatte, als Toni an Ziegenmilch gewöhnt werden musste:
»Und dass mir ja nichts übrigbleibt! «
Sie wedelt den aromatischen Duft gegen Merthes Gesicht und wahrhaftig zeigte sich auch dort ein Lächeln, wenn auch mühevoll.
Solange Merthe Flammeri isst, sitzt Toni dabei und denkt so bei sich: Wo ist der Glanz im lockigen Haar, das keines der Kinder geerbt hat. Wo die rosige Haut, wo man sich anschmiegen konnte und wo man glaubte, für immer angeschmiegt bleiben zu können?
Das Haar der Mutter ist jetzt weit aus der Stirn gestrichen, Schmerzen und Sorgen ziehen ungleiche Furchen über die Stirn, quer und tief. Die vielen Fältchen um die Augen verraten das Leid und den Schmerz, das nächtliche Grübeln über ihr schweres Los, das sie allein zu tragen hatte, weil Verbrecher die Welt in Flammen legten und Väter wie Söhne im Kugelhagel sterben ließen.
Toni sieht ihre Mutter im hellen Kleid mit breitem rotem Saum, das lachende Gesicht, frisch, beinahe exotisch, wenn sie als Kind zum Schlagbaum der Fabrik gelaufen war und von dort ihrer Mama die Arme entgegenstreckte. Sie weiß, dass die Erinnerung sich mischt aus Bildern, die sie von den alten Fotos kennt, und jenen, die sie selbst erlebt hat. Wenn die Arbeiter an ihr vorbeiströmten, suchte sie in Wahrheit nach einem ernsten Gesicht in der Menge, nach einem ein wenig nach vorn gebeugten Körper, als trage er eine Last auf dem schmalen Rücken. Merthe Jacob kam selten lachend daher, meist matt und mit stumpfem, vom Porzellanstaub angegrautem Haar. Ihr Gesicht ausgezehrt und ihre Augen trüb. Geliebt hat sie sie trotzdem über alles.
»Das war wirklich gut, aber es ist zu viel«, hört sie ihre Mutter wie von fern. Nachdem Merthe noch rasch einen Löffel Brei zwischen ihre Lippen schiebt, sagt sie: »Heb es auf, ich esse den Rest am Abend.«
Solange sie denken kann - und noch Jahre später wird sie so denken - war es nur das eine, was sie an ihrer Mutter nie leiden konnte: Mit vollem Mund zu sprechen.
Toni nimmt die Schale von Mutters Schoß, faltet das Tuch zusammen, das sie über die Bettdecke gebreitet hat, und zieht das dicke Stützkissen hinter dem Rücken hervor.
»Das musst du nicht mehr essen. Ich bringe etwas Frisches mit. Ich muss nachher noch mal hoch ins Dorf.«
»Hetzt dich nicht immer so ab … oder musst du … wegen der Arbeit?«
»Nein Mama. Ich muss einkaufen. Wir brauchen Marmelade und Margarine, und das Waschpulver für die große Wäsche muss auch noch her. Vielleicht gibt es ja noch frisches Gemüse ...«
Der Blick zur Uhr sagt ihr längst, dass genau diese Hoffnung illusorisch ist. Heute hat sie noch einen anderen Gedanken in ihrem Kopf, bei dem der Teller in ihrer Hand einen übermütigen Bogen nimmt. »Und ich will für die armen Kerle an der Kreuzung Limonade kaufen und Russischbrot. «
Ein kleines Jauchzen kommt aus der jungen Kehle. Natürlich weiß sie nicht, ob das Russischbrot wirklich etwas mit den Russen zu tun hat, aber der Einfall ist amüsant und der ist ihr die paar Groschen wert.
»Meinst du diese … diese Russen?«, sagt Merthe entsetzlich verzerrt.
An der Tür bleibt Toni stehen und dreht ihr Gesicht noch einmal verschmitzt zurück: »Ja. Die Freunde haben mal wieder Manöver. «
Sie hatte vom ersten Moment an einen kleinen Triumph gefühlt, als sie diesen Einfall hatte, und sie hat ihren Plan mit so leichtem Herzen ausgesprochen, dass ihr jetzt keine Idee dafür kommt, was Merthe in so schreckliche Unruhe treibt.
»Untersteh dich nicht, noch ein einziges Mal dorthin zu gehen!«
Ohne jede Hilfe sitzt Merthe plötzlich aufrecht im Bett. Äußerlich sind es nur zornige Augen, die erst langsam quälende Sorge spiegeln. Es ist wie ein schwerer Klumpen, der auf Merthes Brust liegt, der nichts mit den Schmerzen zu tun hat, die sie ans Bett fesseln. Dieser Klumpen steckt tief und ist in jahrelanger Angst verhärtet. Dieser Klumpen sitzt auf der Seele. Er bewegt sich nicht mehr und drückt doch wieder an der empfindlichen Oberfläche eines alten Zornes, den Merthe nie ausgelebt hat, so, wie sie ihren seelischen Schmerz um Anton sich nie auszuleben erlaubt hat.
»Mama …! «
»Ich verbiete dir heute und morgen und ein- für allemal, zu diesen Russen zu gehen. Hörst du? Du gehst nicht, sonst muss ich … «
Der Schrei ist der einer Ertrinkenden. Das Gesicht gleicht der einer Erhängten und die Ohnmacht, die Merthe zurück ins Kissen schlägt, gleicht der einer Vergewaltigten.
Toni ist beklommen zumute. Sie kommt sich klein und hilflos vor und glaubt doch nichts Schlechteres, als dass der Schmerz in Mutters Brust ihren letzten Lebensmut zerstört hat, sie ängstlich macht und ungerecht.
Im Dorf
Der Nachmittag vergeht ohne Worte. Merthe liegt wieder in den Kissen, doch sie schläft nicht. Toni sitzt vor dem Stapel Plakate am Küchentisch, taucht den Pinsel in die Farbe, setzt ihn aber nicht an der markierten Zeile an. Wenn sie jetzt einfach nach nebenan gehen und fragen könnte, was der Grund für diese Ängste ist. Sie geht nicht und auch ihre Gedanken bleiben steif in ihr hocken. Da steckt etwas ganz tief drinnen, was sie unbedacht berührt hat. Irgendetwas wühlt tief in ihrer Mutter. Soll sie wirklich daran rühren? Soll sie eintauchen in Vergangenes, das vielleicht gar nicht mehr zu ändern ist; jetzt, wo sie krank ist und ein quälendes Leid zu verkraften hat? Sie kommt mit sich überein, in irgendetwas ist sie völlig falsch verstanden worden.
Sie gibt sich einen Ruck, benetzt den Pinsel und schreibt mit lockerer Hand die ersten Zeilen. Der kleine Ruck gegen ihre schlechten Gedanken ist beileibe kein Trost für das junge Mädchen. Schon nach wenigen Augenblicken ist das alte Gefühl wieder da: Der Grund für den inneren Aufruhr ihrer Mutter ist kein gewöhnlicher. Es ist ein uralter, und der steckt in ihr fest.
Sind es die Russen? Was für ein Unsinn. Seit all den Jahren sind die Russen hier, was sollte heute anders sein? Was sollte überhaupt ein Grund sein? Es muss etwas anders sein. Wird sie ausgeschlossen von einem Wissen um etwas Grundlegendes? Ist das feste Band, das sie noch immer an ihre Mama kettet - das tiefe, seelische, das die Nabelschnur ersetzt, durch irgendetwas zerrissen? Hat sie selbst es zerrissen, weil sie sich abgenabelt hat? Weil sie Piet liebt?
Auf ihrem regelmäßigen Gesicht liegt ein Ausdruck von Verlorenheit, Minuten lang. Nie hat sie ihrer Mutter etwas verheimlicht - warum sagt sie nicht, was sie bedrückt?
Gerade als Toni so grübelt und gerade als Merthe die Lähmung ihres Entsetzens überwunden hat, klingelt es an der Wohnungstür. Holger Alex steht davor, in Motorradkluft, den zerkratzten Sturzhelm unter den Arm geklemmt.
»Ich will nur mal nach dem Rechten sehen«, sagt er und wartet nicht, bis er hereingebeten wird. Beinahe schiebt er Toni mit seiner kräftigen Statur beiseite.
Schon immer unsicher, ob sie etwas falsch macht, jetzt überdies noch schamvoll, einen der Chefs im äußerst einfachen Haushalt zu empfangen, sieht Toni willenlos zu, wie der Mann durch die Küchentür tritt. Auf dem großen Tisch, der einst der ganzen Familie Mittelpunkt war - und es gab eine Zeit, das saßen acht Leute daran, zwei Umsiedler inbegriffen - liegt der Stapel buntbedruckten Papiers. Am Pinsel klebt Farbe, die letzte Zeile ist noch nicht getrocknet, und einige fertig bearbeitete Exemplare liegen ausgebreitet auf der Liege an der Wand. Schon ruft der Mann:
»Fleißig, fleißig. Und, wie geht es deiner Mutter?«
Toni zeigt nur zur angelehnten Tür, obwohl sie ahnt, wie unangenehm ihrer Mutter der hilflose Zustand vor einem Fremden ist.
Später, weil Merthe die Sprache wiedergefunden hat, sagt auch sie ganz ruhig, dass sie nun ins Dorf fahren werde und dass sie sich bemühen will, diesmal nicht so lange zu bleiben.
Das Misstrauen ihrer Firma rührt sie weniger. Auf ihrem Weg bis zum Schuppen durchlebt sie alles noch einmal, was sie zuvor erschreckt hat. Sie dreht jedes Wort ihrer Mutter vorwärts und rückwärts, den Ton, den Blick und die machtlose Verzweiflung, hinter der sich etwas verbirgt, was Toni nicht in Worte fassen kann. Schlimmer. Sie kann dem Ganzen keine Logik abringen. Glaubt Mama, die Russen sind schuld an ihrem Leben? Glaubt sie, die Russen wollten diesen Krieg, der abertausend Unschuldige ins Verderben riss?
Sie hat die ganzen Jahre geglaubt, auch ihre Mutter ist in der neuen Zeit angekommen, in der das Bild der Sieger mit ihrer dunkelgrünen Militärmaschinerie dazugehört. Schon immer wurde die Geschichte von den Siegern geschrieben, schon immer malten die Sieger die Bilder dieser Welt mit ihren Farben aus. Das war so und wird immer so sein in der Geschichte der Menschheit.
Sie nimmt ihr Fahrrad und passiert die Siedlung: Sieben Häuser – ein kleiner Flecken für sich – abgeschnitten vom Puls der Zeit. 46 Familien kann man getrost als Nachbarn bezeichnen. Nicht wenig Menschen, aber wenig versorgt. Alles, was man zum Leben braucht, gibt es oben auf dem Hügel, wo sich das Dorf erstreckt. Drei Läden für Lebensmittel, einer für Haushaltwaren, das Kino – wenn auch nur im Saal einer Kneipe der Landfilm abgespielt wird, es ist ein Kino für die Menschen da - und zwei Kneipen mit Sälen für den Tanz am Samstag gibt es auch. Beklagen kann man sich nicht. Auch wer nicht ständig in der Stadt zu tun hat, kann im Dorf alles kaufen, was dringend benötigt wird. Keiner muss lange Wege gehen – die Leute der Siedlungen ausgenommen - um Schuhe, Bekleidung und Papierwaren zu kaufen. Drei Bäcker versorgen das Dorf und zwei Fleischer. Schneider und Schuhmacher haben ordentlich zu tun. Sogar eine Bibliothek gibt es hier, wenn auch nur an drei Tagen in der Woche für ein paar Stunden geöffnet ist.
Die Straße verläuft im großen Bogen um den Bahnhof herum. Ist sie zu Fuß unterwegs, springt sie zumeist flugs über die Gleise – verbotenerweise.
Heute hat sie das Fahrrad genommen, obwohl der Berg doch wieder abzusteigen gebietet. Während ihre Füße kraftvoll in die Pedale treten, ringt Toni nach Luft und die Kette möchte bei jeder Umdrehung dem Zahnrad ihren Dienst versagen. Auf halber Höhe, hier, wo Oma Maria einst wohnte, steigt sie ab. Wie immer freut sie sich auf die Schussfahrt zurück, wenn nur die schweren Taschen nicht das Lenken unmöglich machen.
An der Einbiegung steht eine Frau mit einem Netz hell leuchtender Frühkartoffeln. Sie hatten unlängst davon geredet, die Einkellerungskartoffeln müssten bestellt werden. Also nicht geradeaus zum großen KONSUM, sondern nach rechts zum kleinen Privathändler.
Gerade biegt sie ein in die kleine Bahnhofstraße, die ihr Abkürzung bedeutet, als auf der großen Bahnhofstraße ein dunkelgrüner Lastwagen mit dem weißen Zeichen CA angedonnert kommt und waghalsig die Kurve nimmt. CA - Sowjetarmee. Vielleicht wird Iwan jetzt abgelöst, denkt sie. Iwan und sein Genosse Jewgeni können nicht Deutsch, aber Toni kann nach fünf Jahren Unterricht ein wenig Russisch. Die beiden blutjungen Muschkoten in schweren Knobelbechern, mit harten Koppeln um die Hüften, mit Schweißrändern an senfgelben Blousons unter dicken Lodenmänteln, mit schrägen Käppis auf fast haarlosem Kopf und mit dem Gewehr über der Schulter, diese Jungen haben ungefähr ihr Alter und sie tun ihr leid. Doch diesmal sticht ein Gedanke schärfer in ihrer Seele.
Was hat Mama gegen diese armen Kerle, die auf freiem Feld bei Wind und Wetter, wie bei brütender Hitze, schon ein paar Tage vergessen an der Kreuzung herumlungern. Freilich werden sie hin und wieder einem Fahrzeug den Weg zum Manöverplatz weisen. Aber was essen und trinken die beiden und wo schlafen sie?
Die kleinen Häuser links und rechts der Straße hat sie hinter sich gelassen. Die meisten der Leute, denen die Häuser gehören, kennt sie nicht, nur eines glaubt sie noch immer: Wer ein Haus besitzt, ist reich.
Auf freier Strecke zwischen den Feldern riecht es nach verbrannten Erbsen mit Speck. Sie weiß, es ist das Gas aus dem Gasometer der Fabrik, deren Schornsteine rechtsseitig das Wäldchen überragen. Dort werden die Tunnelöfen mit Gas beheizt, um das Porzellan brennen zu können. Von einem Rundofen spricht ihre Mutter bisweilen. Toni kennt die Fabrik nur vom Schlagbaum her, wo sie als Kind sehnsuchtsvoll stand, die Zeiger der großen Uhr am Bürohaus verfolgte, die Sekunden mitzählte, bis die Sirene erklang. Aber Merthe Jacob kam immer sehr spät, später als die meisten heimwärts Hastenden. Damals hat sie diesen Geruch nicht gespürt. Er zieht nur bei nordwestlichem Wind hier herüber und steigt auf in die Höhe dieses Hügels. So wie sie die Nase in den Wind hält, fällt ihr ein ähnlich rauchiger Geruch ein:
Sie war noch sehr klein, als ein Russe zu Hause im breiten Rahmen der dunklen Küchentür stand. Er hielt zwei Laibe Brot in den Händen und eine ganze Wurst. Der Mann mit dem breiten, freundlichen Gesicht hatte seine Mütze weit aus der Stirn geschoben. Die rote Litze am oberen Rand lag wie ein Heiligenschein hinter seinem Kopf. Er strahlte über das rötliche Gesicht und sang ein paar Worte, die sie nicht verstand. Diese Wurst aber roch ähnlich rauchig, wie das Gas der Fabrik an manchen Tagen riecht. Ob es russische Wurst war? Man sagt, die Russen auf der Kommandantur bestimmten damals das gesamte Leben. Also waren es Brote vom hiesigen Bäcker und die Wurst von einem der zwei Fleischer, die das Dorf damals hatte. Die Russen, denen man in den Schulbüchern die Gerechtigkeit auf den Leib geschneidert hat, könnten es für die Hungernden konfisziert haben. Warum aber bekam nicht jeder seine Ration? Es hungerten alle Menschen. Fast alle. Dass diese Ration außergewöhnlich war, ahnt Toni, weil die Mutter den größeren Geschwistern eingeredet hatte, sie dürfen niemandem davon erzählen, nichts von dem Soldaten und nichts von den Broten und der Wurst.
Viel später erst hatte ihre Schwester Elfi die alte Kutzer sagen hören: Die Russen mögen uns Alte nicht, sie mögen nur junge Frauen und kleine Kinder.
»Mein je«, soll ihre Mutter sich erbost haben. »Ich hab΄ fünf hungrige Mäuler, und wie die sich freuen, einmal satt zu werden!«
Warum denkt sie nicht mehr an diese noble Geste eines Besatzers? Auch wenn die Leute Angst vor den Russen hatten, dieser sah fröhlich aus. Das wenigstens weiß Toni noch. Aber fröhlich von Gemüt? Oder froh gelaunt von »цто грам« – hundert Gramm, wie man zu einem gut gefüllten Glas Wodka sagte? Was weiß ein Kind über den Grund für ein aufgekratztes Mannsbild?
Viele Körnchen Erinnerung fliegen durch ihren Kopf. Zu einem Bild werden sie nicht, sie bleiben in Unordnung:
Da muss noch mehr sein, was Mama bis heute nicht vergessen kann.
Nun bedient man sich der Logik, wenn man keine Bücher hat, die einem die Klarheit bringen können. Eine Logik findet sie nicht, und in keinem ihrer Lehrbücher hat sie gelesen, was Menschen in Erstarrung versetzt, wenn sie das Wort Russen hören. Geschichtsbücher sprechen stets von einem heroischen Volk. Alles Mögliche hat sie gelesen, weniges hinterfragt, das meiste hingenommen aus der geltenden Meinung. In all den Filmen, die sie gesehen hat, war der Russe ein friedlicher Mensch mit viel Gastfreundschaft, mit großer Nächstenliebe und ohne Eigennutz.
Seit diesem Tag ist sie aufgeschreckt, will mehr erfahren über die Zeit nach der »Endzeit«, wie die Alten den Untergang ihres einstigen Reiches nennen. Sie nicht nur das Angenehme wissen, auch die herben Seiten der Sache sind ihr wichtig.
Die Händlerin fragt nach Merthe, und etwas von Anerkennung liegt in ihrem Blick. Vielleicht hat Toni ihren Entschluss, in Zukunft mehr mit den Menschen zu reden, erst in diesem Moment gefasst. Vielleicht aber lag die Absicht, über ihre Mutter zu reden, die ganze Zeit vor ihr, die sie sich abgemüht hatte, die hügelige Seitenstraße zu nehmen, ohne abzusteigen.
Die Händlerin kennt Merthe gut, und sie kennt auch Toni. Sie war es, die vor Jahren immer zum Einkaufen geschickt wurde, wenn kein Geld im Hause war und wenn angeschrieben werden musste. Toni weiß nicht mehr, wie sie sich dabei gefühlt hat, aber sie weiß noch, wie sie sich für die Schlepperei mit angeknabbertem Brot, mit ausgebrochenen und roh verspeisten Blumenkohlröschen, zuweilen auch mit abgeschleckter Sahne aus der Milchkanne gerächt hat. Mama hat es großmütig übersehen. Ihr war das allemal lieber, als die Scham der Armut ertragen zu müssen.
Noch immer stehen die Glasballone auf dem Ladentisch aufgereiht, die sie als Kind so sehnsuchtsvoll betrachtet hat. Himbeerbonbons, Schaumstücke und der Bruch von Karamelle. Nur sehr selten standen Süßigkeiten auf ihrem Einkaufszettel. Die kinderreiche Kriegswitwe Merthe Jacob brauchte die Zuckermarken zum Tausch gegen gebrauchte Kleidung, die den Kindern anderer Leute nicht mehr passte oder nicht mehr gut genug war. Toni profitierte am meisten davon. Elfi trug die Sachen von Rica ab, bis sie – mehrmals aufgetrennt und die Teile gewendet und wieder zusammengenäht - nicht mehr zu gebrauchen waren. Und Heiner, der einzige Junge, bekam hin und wieder etwas von seiner Patentante Adda, die eigentlich Marie Hering hieß. (Weil aber Heiner das Wort Tante nicht sagen konnte, blieb sie von nun an für alle die Adda.)
Damals hatte Adda im Sechs-Familien-Haus als einzige Frau das Privileg, keine Kriegswitwe zu sein. Zwar hatte sie einen Sohn verloren, aber seit Heiner auf der Welt war, diente er als Ersatz für Addas überschüssige Mutterliebe.
Solange Toni denken kann, war Inga, die älteste Schwester, schon aus dem Haus und arbeitete bei Neschwitz auf einem Bauernhof – in Stellung. Diese Arbeit junger Mädchen in fremden Haushalten grenzte zuweilen an Leibeigenschaft, gegen die dennoch niemand aufbegehrte.
»Was sagt denn der Doktor?«, will die Händlerin wissen.
»Er meint, es könnte das Herz sein.«
»Ein Wunder ist das nicht. Deine Mutter hat ein zu schweres Leben gehabt. Sie war ja nie eine von den Kräftigsten. Zart wie du war sie … «
»Ja, es ist ungerecht ... «
Sie hütet sich, vor jedem, den der Krieg verschont hat, von Ungerechtigkeit zu reden. Für wen wäre gerecht gewesen, was Merthe passiert ist? Die Kriegstreiber ausgenommen. Kein Mensch hat es verdient, am Rand des Abgrundes tagtäglich mit all seiner Kraft seinen Sturz verhindern zu müssen, während andere, schuldbeladene gar, schon wieder in der Hängematte liegen und vom Schlaraffenland träumen.
Merthes Träume waren immer profan. Sehr profan. All mein Gedanken, die ich hab, das hieß für sie viele Jahre lang nur noch: durchhalten, überleben.
Diese Erkenntnis gibt dem Bild, das Toni bisher von ihrem Leben hatte - und wenn sie Leben sagt, ist immer Mama eingeschlossen - eine starke Farbe des Zornes, was die Händlerin missdeutet, gottlob nicht im schlechten Sinne. Sie schiebt ihre Sauerkraut-Hand über den Ladentisch und drückt für einen flüchtigen Moment Tonis Hand:
»Sie ist stark. Sie schafft das schon. «
Mehr als ein schwacher Trost sind die Worte der Frau nicht.
Ja, sie ist stark, aber das Leben ist ungerecht. Ihre Nächte sind quälend, ihre Tage in dieser elenden Fabrik, wo alle Menschen krank werden, nicht minder. Staublunge nennt man die Krankheit lapidar, als könnten die Menschen den Staub einfach wieder aushusten, wenn sie sich Mühe geben. Hat sie Staublunge und man will es nicht wahrhaben? Man darf es nicht wahrhaben, wegen der teuren Kuren und Therapien, die kaum einer verschrieben bekommt? Man hört von solchen Sachen, aber man glaubt nicht daran. Diese Gesellschaft sei die menschlichere von beiden, die auf dem Boden der Verlierer wachsen. Die gerechtere Gesellschaft, das lässt Toni gelten, weil sich niemand an der Arbeit des anderen bereichert. Die Fabrik des Hermann Schomburg liegt längst in Volkes Hand und ist der Broterwerb für die meisten Menschen dieser Gegend. Elektroporzellane werden immer gebraucht, für Stromleitungen allerorts. Bruder Heiner erzählte einmal, dass die Margarethenhütte weltweit bekannt sei und ab jetzt sogar für Afrika produziere. Dafür habe man extra grüne, stumpfe Glasur zu entwickeln gehabt, damit die Affen nicht mit Kokosnüssen nach den weiß-reflektierenden Isolatoren werfen. Heiner macht gerne seine Späßchen. Ob das einer war? Sie weiß es nicht. Sie weiß nur: Wenn einer so etwas wissen muss, dann ist es Heiner. Er arbeitet als Porzellandreher in der Fabrik. Er formt mit einfachen Schablonen und bloßen Händen aus der öligen Masse die mannshohen Hochspannungsisolatoren. Wenn er doch jetzt arbeiten dürfte...
Toni glaubt, die Angst um ihren einzigen Sohn macht der Mutter zusätzlich zu schaffen. Der Staub frisst die Lungen der Menschen, und die giftige Glasur ätzt ihnen die Haut. Aber das, was Heiner jetzt macht, ist gefährlich und wäre doch unnütz wie ein Kropf, wenn die Welt eine bessere wäre.
Deine Kraft gegen die imperialistische Bedrohung, und, Der Friede muss bewaffnet sein. Das waren die Parolen, und dann begannen sich Mühlen zu drehen, deren Existenz kaum einer vermutet hatte. Kaum einer fand ein Argument, warum er den freiwilligen Dienst an der Waffe verweigere. Man hielt Heiner eine Feder hin und das Papier, und die Gesten waren klar. Der Mensch hinter dem edlen schweren Schreibtisch, der noch dem alten Hermann Schomburg gehört haben musste, konnte Heiners Lebensplanung, ja seine kleine Hoffnung, mit einem einzigen Federstrich vernichten. Nach Wochen konnte Heiner nicht anders, als sich einfangen zu lassen. Das ganze Gerede von den Besten, die man an der wahren Front brauche, war nichts als ein Leimtopf für einen der vielen Spatzen, die man als Kanonenfutter im Kalten Krieg brauchte.
Diese Front liegt nun im Thüringischen, wo die Grenze quer durch das Herz des Vaterlandes sticht, durch die Herzen der Menschen gar, die schon lange keine Brüder mehr sein dürfen. Heiner, der freiwillig niemals an diese Grenze gegangen wäre, der lieber mit seinem Motorrad bis an seine Grenzen gegangen wäre, lag nichts so am Herzen, wie die Vorsicht, an einer bestimmten Stelle nicht negativ aufzufallen, aber an einer anderen, nicht als feig zu gelten. Es half nichts, wenn man auch ahnte, dass ein Gesetz in Vorbereitung war, das die allgemeine Wehrpflicht besiegeln sollte. Dieses Gesetz kam kurze Zeit später, da lief Heiner bereits durch hohen Schnee im Thüringischen und haderte mit sich und der Waffe, die er zu schultern hatte.
Toni ist alt genug, um zu wissen, dass man jedes Risiko zu vermeiden hat, dass man nicht anecken darf an den Kanten der Macht. Dennoch ist so ein Gefühl in ihr, Zeuge erpresserischer Macht zu sein. Darüber kann man als Schwester denken wie man will. Für eine Mutter ist der Gedanke an den Sohn mit der Waffe in der Hand so oder so kein guter Gedanke.
Auf einmal wird Toni klar, wie es ihrer Mutter gehen muss. Ihre Abscheu gegen alles Militärische wird auf ekelhafte Weise immer an ihr kleben. Es war unmöglich, Heiner da rauszuholen. Es hat Leute geben, die mehr von Heiners Dilemma wussten, als er seine Mutter wissen ließ, aus Rücksicht. Er hat seine Mutter nicht gefragt, ob sie einverstanden ist. Nicht einmal sein Bedauern hat er ausgedrückt. Es hätte ihr nicht geholfen. Im Gegenteil. Wenn Toni es recht bedenkt, gab es nicht viele Dinge, die Heiner mit seiner Mutter gründlich besprach – aus Rücksicht.
Jetzt, wo Toni über all das nachdenkt, muss sie sich vorwerfen, Heiner selbst nicht verstanden zu haben. Dabei war sie froh, als Heiner sein Bett nicht mehr brauchte. Seit diesem Tage hatte sie endlich ein eigenes Bett.
Was ist passiert?
Ohne es wahrzunehmen, ist sie schon wieder auf der Rückfahrt vom Dorf zur Siedlung, und da, wo es noch eben nach rauchigem Gas gerochen hatte, fällt Toni der Satz der Händlerin wieder ein: Sie ist stark, sie schafft das schon.
Jetzt ist ihr, als habe sie sich in diesem Moment sehr zusammennehmen müssen, um der Frau nicht zu sagen: Was weißt du denn schon, wie es ist, den geliebten Mann zu verlieren, fünf Kinder allein durchzubringen?
Was wisst ihr alle denn? Und als hätte sie eine ganz bestimmte Frage bei der Händlerin vergessen, schreit sie gegen den Wind:
»Was ist mit Merthe Jacob passiert. Sagt es mir. Ihr wisst es doch! «
Es ist nicht das erste Mal, dass sie glaubt, die Leute hätten ihr Gewissen im Dickicht des Wissens verborgen. Zählt Mama dazu? In diesem Falle entschuldigt die Selbstentblößung …
Diese Siedlung ist durch die Bahnlinie vom Dorf abgeschnitten und liegt eingebettet in Wald. Rechtsseitig schöner kräftiger Mischwald, links ein Wald aus hohen Kiefern. Mitten durch diesen Wald verläuft die Straße, die sie bisweilen zu nehmen hat, wenn sie mit den Rad nach Radibor zur Außenstelle ihrer Firma fährt. Hinter dem Wald ist das freie Feld, wo die armen Kerle herumlungern, ohne Wasser und Brot. Viel schlimmer kann es im Karzer nicht sein.