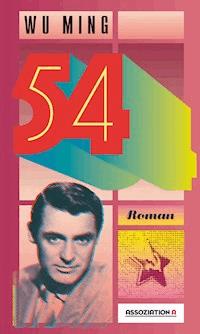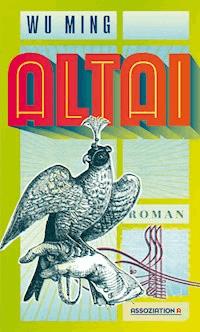
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Assoziation A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Venedig 1569. Eine gewaltige Detonation erschüttert die Nacht, der Himmel lastet rot auf der Lagune. Das Arsenal, die Werft der Serenissima, steht in Flammen, die Jagd auf die Schuldigen wird eröffnet. Ein Agent des Consigliere wird zu Unrecht verdächtigt und flieht nach Istanbul. Hier trifft er Joseph Nasi, der von einer Heimstätte für die verfolgten Juden träumt. "Altai" ist ein Roman über Macht, Verfolgung, religiöse Toleranz und das Verhältnis von Mitteln und Zwecken. Dem italienischen Autorenkollektiv Wu Ming ist mit "Altai" ein spannender Folgeband für den Roman "Q" gelungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WU MING
ALTAI
Altai: © 2009, 2011 and 2014 Wu Ming Published by arrangement with Agenzia Letteraria Santachiara © 2009, 2011 and 2014 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino
The partial or total reproduction of the work and its diffusion by telematic means is permitted, provided that this is not done for commercial purposes and that the following wording is reproduced: The authors defend the right to free library lending and are opposed to norms or directives which limit access to culture by monetizing this service. The authors and the publisher renounce any claim to royalties deriving from library lending of this work.
© der deutschsprachigen Ausgabe: Berlin, Hamburg 2016 Assoziation A, Gneisenaustraße 2a, 10961 Berlinwww.assoziation-a.de, [email protected], [email protected] Gestaltung: Andreas HomannISBN Print: 978-3-86241-452-9ISBN EPub: 978-3-86241-620-2
WU MING
Seit 1994 trat unter dem Phantomnamen Luther Blissett u.a. eine Gruppe subkultureller Aktivisten aus Bologna auf, die nach zahlreichen spektakulären Aktionen im Stile der Kommunikationsguerilla ihr Tätigkeitsfeld auf die Literatur verlegten. Mit ihrem Reformationsepos »Q« (dt. Neuausgabe bei Assoziation A, Februar 2016) gelang ihnen ein Überraschungserfolg. Der historische Thriller wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und avancierte zum internationalen Bestseller.
Anschließend setzten die Autoren ihre Arbeit unter dem Namen »Wu Ming« fort. Seitdem hat das Kollektiv mehrere Romane veröffentlicht, denen gemein ist, die offizielle Geschichte gegen den Strich zu bürsten, um gegen das Kontinuum der Herrschaft Räume der Utopie zu öffnen. Im Februar 2015 erschien ihr Roman »54« in deutscher Erstausgabe bei Assoziation A und schaffte es auf Anhieb auf die KrimiZEIT-Bestenliste.
»Altai« ist der Folgeband zu »Q« und schließt historisch und personell an ihn an. Er liegt hiermit in deutscher Erstausgabe vor. Weitere Übersetzungen von Titeln des Autorenkollektivs (u. a. der Partisanenroman »Kriegsbeile«, 2017) sind in Vorbereitung.
Für Valerio Marchi
ALTAI
Übers Meer jagen die Schiffe in schneller Fahrt. Reffen wir die Segel, gut so, die Taue gelöst. Bändige den Wind und rette die Freunde, Damit dein Name erinnert wird. Erwehr dich der Furcht, weck sie nicht in andern. Wie hoch auch immer die Wellen sich türmen. Von dir hängt alles jetzt ab.
Archilochos, 7. Jh. v.Chr.
PROLOG
Konstantinopel, 23. Juni 1569(8. Muharram 977)
Kein Laut dringt aus den Räumen des Palastes. Der Atem des Bosporus und der Gesang des Muezzins begleiten die Lebenden durch einen Abend äußerlicher Stille. In den geöffneten Fenstern leuchtet golden und purpurfarben der Himmel. Fischerboote haben vom asiatischen Ufer abgelegt und schaukeln in der honiggelben Strömung.
Gracia hebt die Hand mit der Feder nachdenklich vom Blatt. Auch der geschickteste Künstler der Welt – und sie hatte einige kennengelernt, als sie in Europa lebte – kann all die Schönheit nur nachahmen, die Gott uns geschenkt hat, erreichen wird er sie nie.
Sie schließt die Augen und lauscht dem Gesang. Als die letzte Note verklungen ist, unterschreibt und versiegelt sie den Brief und lässt sich gegen die Lehne fallen.
Dana schaut sie an und wirft dann einen Blick auf den Schreibtisch, auf die bereits versiegelten und die noch unbeantworteten Briefe. Es gibt noch viel zu tun, aber seit einiger Zeit lassen die Kräfte nach, die Senyora ist zu erschöpft, um den Abend mit Schreiben zu verbringen. Alle wollen ihren Rat, von überall aus Europa und rund ums Mittelmeer kommen Briefe von Vertriebenen, von verfolgten Juden, sephardischen Händlern und aschkenasischen Rabbinern.
»Hilf mir, ich will aufstehen«, sagt Gracia.
»Ihr solltet nicht stehen, Senyora, ihr solltet nicht einmal am Schreibtisch sitzen, ihr solltet euch hinlegen«, ermahnt sie Dana.
Die Rollen der abendlichen Komödie sind fest verteilt. Donna Gracia wird den Befehl wiederholen, Dana wird gehorchen, die Senyora wird ihr einen Arm um die Schulter legen, ein paar Schritte durch den Raum machen und gleichgültig dem Knacken der Gelenke lauschen.
Der Wandspiegel ist mit einem grünen Tuch verhängt. Gracia verzichtet schon lange auf Prunk und Pracht und deren Zurschaustellung, aber heute Abend schiebt sie das Tuch zur Seite und betrachtet ihr Spiegelbild. Sie hat sich in den letzten Jahren vernachlässigt, aber jetzt kümmert sich Dana um ihren Körper und widmet ihm jeden Morgen größte Aufmerksamkeit.
Sie ist neunundfünfzig, und im Spiegel sieht sie das Gesicht einer alten Frau, mit Falten um Augen und Mund, schlaffer Haut am Hals, spitzer Nase und stumpfem, silbergrauem Haar. Sie erforscht die Falten dieses Gesichts, hinter denen sich das Kind verbirgt, das eines Nachts heimlich einen neuen Namen erhielt und am nächsten Tag christlich getauft wurde, um es vor der Inquisition zu schützen. Beatriz de Luna Miquez.
In ihren Augen sucht Gracia nach Licht und Schatten der Gassen Lissabons, sie sucht das Haus ihrer Kindheit und frühen Jugend, den kleinen Joseph, der sie »Tante« nannte. Erinnerungen, die Stimme ihrer Mutter, Erzählungen von der Flucht der Miquez aus Spanien.
Unter den Schichten der Zeit, in den Bögen der Augenbrauen ist noch immer das junge Mädchen zu erkennen, das Francisco Mendes heiratete, el Gran Judío, den sie bald darauf begrub und der sie mit einer kleinen Tochter zurückließ und mit dem immensen Vermögen der Familie, das in Sicherheit gebracht werden musste.
Für einen langen Abschnitt ihres Lebens war sie die reiche jüdische Witwe gewesen, die mit Fürsten, Königen und Kaisern Geschäfte machte und Kämpfe mit ihnen ausfocht, zunächst in den Niederlanden, dann in Venedig und schließlich in Konstantinopel.
Dana sieht im Gesicht der Senyora das Antlitz einer alternden Königin, deren Untertanen in aller Welt verstreut leben, und die die letzten fünfzehn Jahre dafür geopfert hat, sie nach und nach in den sicheren Grenzen des Osmanischen Reichs um sich zu sammeln. Gleichwie ein Hirte dem Löwen zwei Knieeoder ein Ohrläpplein aus dem Maul reißt, also sollen die KinderIsrael herausgerissen werden, Amos 3, 12. Und dies ist nur der erste Schritt eines ehrgeizigen Vorhabens, das unter tausend Schwierigkeiten schließlich dort unten, in Tiberias, vollendet werden soll, an dem Ort, an dem die Senyora sterben will.
Dana blickt hinaus auf den Meeresarm vor dem Palast. Sie fragt sich, ob der Brief je ankommen wird. Sie weiß, dass er an einen Mann gerichtet ist, der in weiter Ferne lebt und von dem die Senyora hin und wieder voller Liebe und Leidenschaft spricht, in Sätzen, die von einer intimen Vergangenheit zeugen.
Gracia lässt erschöpft das Tuch zurück über den Spiegel fallen. Dana führt sie zum Bett, rückt ihr die Kissen im Rücken zurecht und öffnet ihre Bluse. Gemeinsam beobachten sie die Wellen und die Schiffe auf dem Meer.
»Es wird Zeit, dass ich endlich gehe«, murmelt Gracia mit halb geschlossenen Augen.
»Nehmt mich mit, Senyora«, bettelt Dana.
Aber die Senyora streicht ihr übers Gesicht, nimmt eine Hand in die ihre und sagt:
»Nein, meine Kleine, du bleibst bei Reyna, du sollst leben.«
Sie reckt das Kinn in Richtung Schreibtisch:
»Übergib den Brief, du weißt, an wen.«
ERSTER TEIL
Mi star (Der bin ich)13. September – 10. Dezember 1569
1.
Als es krachte, war ich noch wach. Ich saß bei Kerzenlicht am Tisch, blätterte in Anzeigen und Anschuldigungen und lernte Namen und Adressen von Spionen auswendig. Meine Trommelfelle schienen zu platzen, der Fußboden bebte und ein Hagel aus Glassplittern und Putz ging auf mich nieder, wovon ich noch Tage später Reste in meinen Haaren fand.
Im Zimmer war es jetzt dunkel. Nur in der Fensteröffnung war ein heller Lichtschein wie beim Sonnenaufgang zu sehen, obwohl es tiefe Nacht war. Der Wind trug den Geruch von Pulver und Kanonen herein.
Ich beugte mich aus dem Fenster und sah eine riesige Feuerfackel hinter der Turmspitze von San Francesco bis zu den Sternen hinauflodern.
Das müssen die Tezoni, die Hallen für die Salpetergewinnung, sein, fuhr es mir durch den Kopf, die Docks, das Gebäude des Arsenals. Das Herz der Serenissima stand in Flammen.
Hals über Kopf stürzte ich die Treppe hinunter. Das Eingangstor war aus den Angeln gebrochen, wurde aber von einem Trümmerhaufen aufrecht gehalten. Durch einen schmalen Spalt schlüpfte ich ins Freie. Auf der Straße herrschte bedrohliche Stille, entsetzte Gesichter schauten sich fragend an. Besonders Mutige flüsterten etwas von Erdbeben oder Apokalypse, Familien verließen ihre Häuser, ein paar Menschen sprangen von Balkonen wie von der Bordwand eines untergehenden Schiffes.
Die zweite Explosion trieb die Menge in einer Wolke aus Asche und Geschrei wieder auseinander. Ich sprang mitten auf die Straße, um einer Lawine aus Dachziegeln auszuweichen. Als ich nach oben blickte, sah ich sie: Zwei Gondeln taumelten wie verletzte Vögel mit brennenden Flügeln in einer unregelmäßigen Kurve über den Himmel Venedigs. Die erste zerschellte am Glockenturm, der unentwegt Feueralarm läutete, die zweite verschwand hinter den Dächern aus meinem Blickfeld.
In den folgenden Stunden und Tagen hörte ich unzählige Geschichten aus jener Nacht, in denen stets andere Dinge vom Himmel fielen: Eichenstämme, Salpetermahlsteine, Säcke voller Pech, verbrannte Kadaver von Menschen und Pferden stürzten herab, Sterne explodierten, Drachen, Kometen, die Heilige Jungfrau, Luzifer und wahlweise der gekreuzigte oder der auferstandene Christus rasten über den roten Himmel.
Ich musste sofort zum Arsenal und meine Männer zusammentrommeln, um so viele Menschen wie möglich zu befragen. Meine Beine rannten los und mit den Ellenbogen bahnte ich mir einen Weg durch die Menge. Graue Schleier legten sich auf Stadt und Menschen, auf Verletzte, die wie umgestürzte Statuen aussahen, auf die Kanäle von Castello, die voller Asche und Trümmer waren und deren Wasser aussah, als wäre es Stein. Sie legten sich auf Träger, die Weinfässer in Sicherheit brachten, auf Alte, die stumm auf die Skelette ihrer Häuser starrten, auf am Boden ausgestreckte Körper, die nur aussahen wie Leichen, aber keineswegs tot waren. Es hatte etwa zwanzig Tote gegeben, aber viele Menschen waren aus Angst, der Himmel stürze auf sie herab, unfähig sich zu erheben.
Ich überquerte den Campo San Francesco und stieg über Männer und Frauen hinweg, die auf Knien Psalmen sangen und das Jüngste Gericht erwarteten. Ich weiß nicht, ob es meine staubverklebten müden Augen, die rauchgeschwängerte Luft oder einfach nur Einbildung war, aber ich weiß noch, dass ich den Kirchturm anschaute und mir einen kurzen Moment sicher war, dass er sich vom Boden löste und in die Luft erhob. Ich war kurz davor, mich ebenfalls auf die Knie zu werfen, von Wundern zu faseln und meine Pflichten zu vergessen.
Schließlich erreichte ich die Porta da Terra. Die kalte Eleganz des Marmors rahmte ein wirres Durcheinander aus Stoßen, Schieben, Rennen und Geschrei ein. Von oben betrachtete der Löwe von San Marco das Gewühl mit halb geöffnetem Rachen und der Pranke auf dem Evangelium.
Ich durchquerte das Atrium und verschaffte mir mit den Armen Platz. Das Feuer breitete sich auf der gegenüberliegenden Seite aus, dort wo das Pulverlager war.
Ich rannte an Kalfaterern und Freiwilligen vorbei, die sich in einer Reihe aufgestellt hatten und Eimer und Lederschläuche weiterreichten. Überall verstreut lagen Balken und Metallteile, aber die Hauptgebäude waren anscheinend unbeschädigt geblieben. Der Wind hatte die Flammen über die Begrenzungsmauer hinaus in Richtung der Wohnhäuser und des Celestia-Klosters getrieben.
Ich wurde von den Flammen angezogen wie die Motte vom Licht, obwohl die Hitze auf meinem Gesicht brannte und mein Körper kochte und schweißgebadet war. Rußgeschwärzte Zimmerleute trugen große Bretter aus einer vom Feuer bedrohten Werkstatt.
In diesem Augenblick hörte ich zum ersten Mal, dass jemand den Namen Giuseppe Nasi rief, und bald sollte er überall zu hören sein. Er war es gewesen! Das Judenschwein, der Speichellecker des Sultans und Erzfeind der Serenissima. Sein teuflisches Hirn sollte diese Katastrophe ausgebrütet haben.
Ich erreichte das Becken der Galeassen. Das Feuer verzehrte zwei weitere Tezoni, und die von der Explosion aufgepeitschten Wellen hatten eine Galeere aus der Werft herausgespült. Sie dümpelte jetzt brennend auf dem Wasser des Beckens, aber man kam nicht nahe genug an sie heran, um den Brand zu löschen.
Als die Kaimauer einstürzte, loderten die Flammen hoch auf, und das jetzt rasch eindringende Wasser der Lagune lud die Galeere zu einer Reise ein. Der brennende Schiffskörper schwebte langsam davon; die Flammen schienen aus dem Meer zu steigen und züngelten an Masten, Tauwerk und Segeln empor und bewegten sich wie Standarten im Wind.
Sie war ein Sinnbild für das, was die kommenden Tage bringen sollten.
2.
Wir trieben über ein regloses, trübes Meer. Ein Blatt Papier trieb auf uns zu, ein Ruderschlag brachte es näher heran. Ich beugte mich aus dem Boot und nahm es an mich. Es war die Seite eines Buches, dessen verbrannte Ränder Tintenschlieren umrahmten; nur ein Satz war noch lesbar.
Et tulerunt Ionam et miserunt in mare; et stetit mare a fervore suo.
(Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer; da stand das Meer still von seinem Wüten. Jonas 1, 15.)
Die Bibel, das Buch Jonas. Jonas‘ Schiff gerät in einen Seesturm. Er wendet sich an die Mannschaft und verlangt, ins Meer geworfen zu werden. Er allein trage die Schuld an dem Sturm, weil er dem Herrn ungehorsam gewesen sei. Sie tun, wie er befohlen hat, und das Meer beruhigt sich sofort.
Vielleicht konnte mir dieses Orakel helfen. Auch ich musste einen Sturm besänftigen, dem Consigliere einen Schuldigen präsentieren, Venedig von der Angst befreien.
Ich musste nach Bruchstücken suchen, nach Bausteinen, aus denen sich das Mosaik der Katastrophe zusammensetzen ließ.
Der Kanal der Galeassen war ein einziges Trümmerfeld: Eichenstämme, Balken, zerbrochene Kisten, zerfetzte Segel, Leinwände, Schiffszwieback, Tauwerk, verkohlte und zerfetzte Kadaver von Maultieren und Pferden und die Leiche eines Mannes, der mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb.
Die Szene ließ an eine Seeschlacht denken, wenn die letzten Schiffe mit Ruderkraft oder vom Wind getrieben den Ort des Grauens verlassen haben und nur noch Überbleibsel, Fragmente und Körper als Erinnerung an vergangene Grausamkeiten zurückbleiben.
An Land dagegen herrschte große Aufregung. Überall waren Werftarbeiter und Neugierige zu sehen, Leute, die schimpften und sich beschwerten und denen im Weg standen, die Arbeiten zu erledigen hatten. Deshalb waren wir im Boot unterwegs. Vom Wasser aus konnte ich mir einen besseren Überblick verschaffen, nachdenken und mit meinen Männern reden, die mich durch die Trümmer ruderten.
Stille. Die vom Ufer herüberdringenden Geräusche erstarben im Klatschen der Wellen an der Bordwand. Man hörte nur das heftige Atmen Tavosanis‘, des Mannes aus Friaul. Ich atmete mit offenem Mund im selben Rhythmus, als ruderten wir gemeinsam.
»Was für ein Chaos!«, murmelte Rizzi, der Mann aus Rovigo, und ließ seinen Blick übers Wasser schweifen, auf dem es aussah, als sei die Apokalypse angebrochen. Ein Blick nach oben jedoch genügte, um festzustellen, dass es so tragisch auch wieder nicht war. Das Feuer hatte drei Lagerhallen vernichtet, über deren Trümmern schwarze Rauchsäulen standen, aber die anderen Gebäude am Hafenbecken waren zum größten Teil unbeschädigt geblieben. Geplatzte Fensterscheiben, aus den Angeln gehobene Eingangstore, wenig mehr.
Vielleicht hatte das Wasser verhindert, dass sich das Feuer stärker ausbreitete. Ich musste penibel genau ermitteln und Schritt für Schritt versuchen, das Unglück zu verstehen. Ich musste den eigentlichen Ort der Explosion genau unter die Lupe nehmen.
Dort war die Mauer, die den Bereich der Schwarzpulverherstellung in diesem abgelegenen Bereich des Arsenals umschloss.
Auf Höhe der drei niedergebrannten Lagerhallen sprang ich an Land. Auf dem Weg zum Pulvermagazin mussten wir eine von ihnen komplett durchqueren. Sie war noch leer gewesen, wie alle Gebäude in diesem neuerbauten Flügel, weil die Arbeiten an den Galeassen noch nicht begonnen hatten. Die großen Handelsschiffe, die hier ausgebessert und kriegstauglich gemacht werden sollten, lagen unbeschädigt in einer Ecke des Hafenbeckens.
Rizzi packte mich an der Jacke und zog mich an die Reste einer Wand. Vom schwarzen Dachgerippe regnete es Trümmerteile. Hastig gingen wir weiter.
Die Arbeiter aus der Pulverherstellung waren in heller Aufregung. Tavosanis warf ihnen finstere Blicke zu und bahnte uns einen Weg zum Rand eines schwarzen Kraters, bis zu der Stelle, an der das Pulverdepot gestanden hatte. Weit und breit waren keine Steine mehr zu sehen, als habe die Explosion das ganze Depot auf den Mond katapultiert. Ich verlangte den Waffenmeister zu sprechen. Jemand zeigte auf die Pulvermühle, die nur noch ein Haufen Schutt war.
Arbeiter wühlten in Trümmern, trugen einzelne Teile fort, erstellten Inventare und prüften, was noch zu gebrauchen und was endgültig verloren war. Ein großer Mahlstein hatte sich ins Erdreich gebohrt, wie ein riesiges Rad, dessen Reise abrupt geendet hatte.
Der Mann, den ich suchte, blickte wie ein verängstigtes Kind, das eben aus einem Alptraum erwacht ist.
»Signor De Zante, schaut euch das an! Alles kaputt! Ihr wisst ja, ich hab ‘s schon immer gesagt, seit dreißig Jahren sag ich das schon, Pulver darf man nicht da herstellen, wo Schiffe gebaut werden. Der Senat hat mir Recht gegeben und will die Depots auf die kleinen Inseln verlegen, und ausgerechnet jetzt diese Bescherung! Zum Glück wurde gestern die Hälfte der Fässer weggeschafft.«
Der Redefluss konnte seine Angst nicht verbergen. Er wusste, dass ich gekommen war, weil die Republik Antworten verlangte, und dass die einfachste Antwort war, ihn der Nachlässigkeit zu beschuldigen.
»Bleibt ruhig, ich will wissen, was passiert ist.«
Er breitete die Arme aus.
»Was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung! Alle meine Männer sind äußerst vorsichtig, fünf Mal am Tag mache ich einen Rundgang durch das ganze Arsenal, seit Monaten gibt es keinerlei Probleme.«
»Umso besser, aber ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Ich will wissen, wie der Brand entstanden ist, wie das Feuer sich ausgebreitet hat.«
Er zeigte in Richtung San Francesco hinter der Begrenzungsmauer.
»Der Nachtwind hat die Flammen hinausgetrieben. Das Celestia-Kloster und die angrenzenden Häuser sind zerstört. Hier hat es nur einen Toten gegeben, eine Wache. Aber drüben ...«
»Meister, Meister! Hier ist was!« Ein Arbeiter in der Nähe winkte uns erregt herbei.
Es hatte sich bereits eine aufgeregt palavernde Gruppe gebildet. Gesichter verzogen sich angewidert zu Grimassen, einige blickten bestürzt. Der Name Giuseppe Nasi ging von Mund zu Mund. Giuseppe Nasi, das Judenschwein, der größte Feind der Serenissima.
»Das war kein Unglücksfall! Das ist das Werk der Türken, die Hunde wollen Krieg!«
Wir schoben uns nach vorne, Tavosanis hinter mir und Rizzi an meiner linken Seite.
Auf dem Boden, im Mittelpunkt eines Kreises, der von den Umstehenden gebildet wurde, waren zwei handtellergroße schwarze Flecken zu sehen.
Der Arbeiter, der uns gerufen hatte, zeigte auf sie:
»Pech, Meister! Das ist Pech!«
Ich bückte mich, fuhr mit dem Finger über einen der Flecken und roch daran.
Es war zweifellos Pech. Pech in einer Pulverfabrik ist wie Marderscheiße im Hühnerstall.
»Das Ganze ist eine Schmierenkomödie, alles nur Theater«, knurrte Rizzi. Tavosanis lenkte das Boot zu den Gießereien. »Man braucht kein Pech, um ein Salpeterdepot in Brand zu stecken. Ein Funke genügt.«
»Einverstanden«, sagte ich. »Und warum dann das ganze Theater?«
Er begann an den Fingern aufzuzählen. Erstens: »Findet man Pech, muss es jemand hingebracht haben. Zweitens: Wenn es jemand hingebracht hat, war es kein Unfall. Drittens: Wenn es kein Unfall war, hat es mit ihnen nichts zu tun, und sie sind unschuldig.«
Rizzis Beobachtungen hatten einiges für sich, aber ich war noch nicht ganz überzeugt.
»Warum glaubst du trotzdem an einen Unfall?«
Er zeigte auf die großen Schornsteine der Schmelzöfen auf dem Gelände, das wir gerade kontrollieren wollten.
»Die Türken hätten das Feuer an einer zentralen Stelle gelegt, dann hätte es einen viel größeren Schaden angerichtet.«
»Es gibt auf der Welt nicht nur Türken.«
»Gott sei Dank! Aber was ich gesagt habe, gilt für alle: Wenn jemand das Arsenal zerstören will, zielt er aufs Herz und nicht auf die Ferse.«
Ich nickte. »Außerdem würde man nicht warten, bis die Hälfte der Fässer weg ist, und man würde sich keine Nacht mit starkem Nordostwind aussuchen, der die Flammen hinaustreibt.«
Tavosanis hob die Ruder aus dem Wasser, holte tief Luft und bohrte seine Augen in meine.
»So präzise arbeitet nur der Zufall.«
»Der Zufall.« Ich tauchte eine Hand ins Wasser, als suchte ich dort einen Hinweis. »Oder es war gar nicht der Türke, sondern ein anderer Feind, einer, der keinen allzu großen Schaden anrichten wollte.«
3.
Wie ich schon vermutet hatte, waren die Gießereien unversehrt geblieben, die Entfernung zum Explosionsherd war zu groß.
Während Tavosanis und Rizzi die Umgebung inspizierten und ich festgestellt hatte, dass die ersten beiden Werkstätten noch verschlossen waren, trat ich in die dritte, offen stehende Werkstatt ein, aus der Hammerschläge zu hören waren. Langsam ging ich durch alle Abteilungen. Bei den Schreinern befand sich kein Werkzeug am falschen Platz. Die bereits bearbeiteten Stämme waren nach Typ und Durchmesser sorgfältig gestapelt. Dass in der Formerei eine gewisse Unordnung herrschte, war normal. Säcke mit Kalk, Rinderhaar, Wachsabdrücke für Reliefdekorationen, alles lag ohne ersichtliche Ordnung auf großen Tischen oder war in den Ecken abgestellt worden. Aus offen stehenden Behältern stieg der Gestank von Talg auf. Nur die für den Bronzeguss vorbereiteten Tonformen waren sorgfältig aufgereiht. Auf der gegenüberliegenden Seite standen die Bohrgestelle, an den Drehbänken und an den Drillbogenbohrern für die Zündlöcher arbeitete niemand.
Als ich zu den Ablagen für die fertigen Stücke kam, hörte ich ein metallenes Geräusch.
Auf meine Frage »Ist da jemand?« antwortete mir eine dünne Stimme, und kurz darauf tauchte hinter einer außergewöhnlich langen Feldschlange der graue Kopf Varadians auf, des armenischen Artilleristen, der an der Entwicklung von Prototypen arbeitete. Bevor ich ihn fragen konnte, ob er irgendetwas Außergewöhnliches bemerkt habe, sagte er:
»Signor De Zante, gut dass ihr gekommen seid, wenigstens einer.«
Er blickte verwirrt um sich, und obwohl die Brennöfen erloschen waren und es kalt war, standen dicke Schweißperlen auf seiner Stirn.
»Was hat euch so erschreckt?«
Er riss die Augen auf, als stehe hinter mir ein Geist. Fast hätte ich mich umgedreht, um nachzusehen, ob dort tatsächlich jemand stand.
»Das waren die Türken! Sie müssen mir glauben, ich kenne mich aus, ich habe für sie gearbeitet. Das Feuer ist nur der Anfang, sie werden wieder angreifen. Der Architekt Savorgnan verstärkt die Verteidigungsanlagen am Eingang der Lagune. Das ist gut, denn das ist eine wichtige Vorsichtsmaßnahme, aber hier bei mir ist heute Morgen noch kein Mensch aufgetaucht, keine Wache und kein Arbeiter, obwohl hier die Schätze lagern, die unsere Feinde am meisten interessieren. Ich bin der Einzige, der diesen Bereich bewacht, dabei müsste der besser geschützt werden als alle anderen.«
»Wo sind die Arbeiter?«
»Sie waren die ganze Nacht bei den Löscharbeiten, sie haben eine Lohnerhöhung erhalten und ruhen sich jetzt auf ihren Lorbeeren aus.«
Ich bemühte mich um einen beruhigenden Tonfall. Varadian wusste, dass Renegaten bei den Muslimen verhasst sind. Er hatte zunächst jahrelang als Ingenieur in Konstantinopel gearbeitet, war dann Christ geworden und nach Venedig gekommen. Die Republik förderte seine Forschungen über den Rückstoß bei Kanonen und finanzierte die dafür notwendigen Experimente. Der zuständige Kriegswesir in Konstantinopel hatte das für überflüssig gehalten und seiner Arbeit keine Beachtung geschenkt. Die Osmanen erwarteten von einer Kanone nur eins: Sie musste riesig sein, so groß wie eben möglich. Das Feuerrohr war der aufgerissene Rachen des Teufels, die Bombarden spuckten die Hölle aus und ließen die Welt erzittern. Warum sich Gedanken über den Rückschlag machen?
»Ich rede mit dem Chef der Wachen und lasse sofort jemanden schicken. Ich werde den Schutz Eurer Person und Eurer Arbeit verdoppeln lassen, Signor Varadian. Aber Ihr könnt Euch beruhigen, ich glaube, die Türken haben mit der ganzen Angelegenheit nur wenig zu tun.«
Seine Hand ergriff die meine, seine Stimme triefte vor Dankbarkeit.
»Danke, Signor De Zante. Aber glaubt mir, das war ihr Werk, ich kenne sie zu gut.«
Als wir gegen Abend in den Palast zurückkamen, hatten einige meiner Leute, die sich durch besonderen Eifer und große Erbarmungslosigkeit auszeichneten, den Reigen bereits eröffnet. Sie hatten einige aufrührerische Elemente und Störenfriede abgeholt, von denen bekannt war, dass sie Schmählieder auf den Dogen und die Adligen sangen und in illegale Geschäfte verwickelt waren.
Auf dem Folterrad hatte ein Arsenalarbeiter gestanden, Giuseppe Nasi und ein Sohn des Teufels zu sein. Ein Schmied aus Chioggia hatte geschworen, er sei schon immer Türke gewesen, er sei Janitschar und ein Freund des Paschas, der ihm persönlich befohlen habe, den Brand zu legen. Ein Waldarbeiter unbekannter Herkunft hatte angefangen in einer ganz eigenen Sprache zu reden und behauptet, das sei die Sprache Kleinasiens. Er hatte lateinische Brocken beigemischt, die er wahrscheinlich aus der Messe kannte.
Unsinnig vergossenes Blut, Gestank von Exkrementen; Folter bringt die Wahrheit nicht ans Licht. Ich war angewidert und befahl ihnen aufzuhören.
Der Vorarbeiter hatte mir eine Liste mit den Namen von Hitzköpfen und unzufriedenen Arsenalarbeitern übergeben. Ich beauftragte Rizzi, zu prüfen, ob jemand von den Festgenommenen auf der Liste stand.
Es waren zwei.
Ich befahl Tavosanis, mit dem Ersten zu beginnen.
Normalerweise wartete ich mindestens eine halbe Stunde, bevor ich den Raum betrat. Tavosanis stellte in der Zwischenzeit Fragen ganz allgemeiner Art und arbeitete nur mit den Fäusten. Heute war ich ungeduldig, ich brauchte dringend etwas, das ich am Abend dem Consigliere vorweisen konnte.
Der Mann saß festgebunden auf einem Stuhl, sein Kopf hing auf der Brust; anscheinend war er bei Bewusstsein. Tavosanis flüsterte mir ins Ohr, was er bisher erfahren hatte. Jetzt war ich an der Reihe.
»Wie ging das Lied, das du vor ein paar Tagen in der Osteria gesungen hast? ›Der Türke kommt und befreit uns von unseren Herren ...‹. So ähnlich war’s doch, oder?«
Schweigen. Tavosanis blickte mich an. Ich gab ihm ein Zeichen zu warten. »Wir wissen, was du gesungen hast, und wir wissen, mit wem du gesungen hast. Wir wissen, was du gegessen hast, wie viel du getrunken hast und wann du pinkeln gegangen bist. Wir wissen alles.«
»Und was wollt Ihr dann noch von mir?« Der Mann blickte mich flehend an.
Federnden Schrittes lief ich um seinen Stuhl herum. Der Wolf umkreist seine Beute.
»Es ist besser für dich, wenn du redest. Denk an den Magistrat, denk an‘s Rad. Du würdest diesem Stuhl und der Faust dieses Mannes noch nachweinen.«
Tavosanis schlug zu und traf ihn am Unterkiefer.
»Wir wissen, dass dein Freund Battiston immer wieder einen Satz gesagt hat: ›Ich weiß, was wir tun müssen, damit sie uns besser bezahlen.‹ Stimmt das?«
»Ich war betrunken, ich kann mich an nichts erinnern.«
Er erinnerte sich an nichts und weinte. Er war bereit aufzugeben, wollte aber seinen Freund nicht belasten.
»Ihr habt ja die Lohnerhöhung tatsächlich gekriegt, oder etwa nicht? Als Prämie dafür, dass ihr den Brand gelöscht habt.«
Er schwieg weiter. Ich baute mich vor ihm auf und hob sein Kinn an. Sein Blick war leer, der Hass verschwunden.
Er würde jetzt die Wahrheit sagen.
4.
Der Palast des Consigliere lag am Canal Grande, aber Dunkelmänner wie ich betraten ihn von der Landseite. Der Zugang vom Wasser war für die Aristokratie. Von jener Seite hatte ich ihn nur einmal betreten. Damals wurde ich dem Hausherrn vorgestellt, und ich war mit meinem Vater über den mit einem Seidenteppich belegten Landungssteg bis zu den Sirenen aus Marmor geschritten, die das Eingangsportal bewachten. Eine Audienz beim Papst hätte nicht aufregender sein können.
Den Hintereingang hatte man mir ein paar Tage später gezeigt, und seitdem benutzte ich nur diesen. Der Weg führt durch einen großen Garten, der von der Straße nicht einsehbar ist und durch eine hohe Mauer geschützt wird. In seinem Zentrum stehen ein Brunnen und ein steinerner Engel mit ausgebreiteten Flügeln, dessen angespannter Körper bereit scheint aufzufliegen; sein beutegieriger Blick ist der eines Raubvogels. Der Anblick versetzte mich jedes Mal in Unruhe, und eines Tages erzählte ich es meinem Herrn. Er antwortete, der Grund dafür sei mein schlechtes Gewissen, meine Arme-Sünder-Seele.
Ein Diener geleitete mich in den Palast, bis an die Schwelle des Raumes, in dem sich der Consigliere aufhielt. Der Diener klopfte und hieß mich dann eintreten.
Der Consigliere stand kerzengerade am Fenster und schien die Wolken zu beobachten, die sich in der Lagune spiegelten. Ich betrachtete die hohe, schlanke, in ein langes, bis auf die Knöchel reichendes Gewand gehüllte Gestalt mit dem graumelierten Haar, die nichts nach außen dringen ließ, deren Gedanken unerforschlich waren.
Er gab mir ein Zeichen näherzutreten. Ich wusste, dass ich mich zu setzen hatte und dass er, um seine Dominanz zu unterstreichen, mir die ersten Fragen stehend stellen würde.
»Ihr tretet entschlossen auf heute Morgen.« Er fixierte mich, als wisse er nicht, wen er vor sich habe. »Ich nehme an, Ihr kommt gut voran mit Euren Ermittlungen!«
»Wir haben dreiundzwanzig Verdächtige verhört.« Ich machte eine Pause, damit die Zahl nicht unterging. »Die meisten haben Angaben ohne jede Bedeutung gemacht, aber zwei Arbeiter aus dem Arsenal haben aufschlussreiche Einzelheiten erzählt und Namen genannt.«
»Sehr erfreulich, De Zante. Erspart mir die Einzelheiten, ich weiß Eure Gewissenhaftigkeit zu schätzen.«
Ich holte tief Luft. Der Consigliere war kein Freund großen Überschwangs. Ich hatte meine Vermutungen durchdacht und emotionslos vorzutragen, ganz so, als gäbe ich die Gedanken eines anderen wieder. »Die Kalfaterer fordern seit Monaten eine bessere Bezahlung. Ein paar von ihnen glaubten‚ die beste Methode, dieses Ziel zu erreichen, wäre es, einen Brand zu legen und ihn dann zu löschen.«
Er nagte an seiner Unterlippe; ein Zeichen, dass die Nachricht nicht nach seinem Geschmack war. Ich musste herausfinden, warum das so war.
»Und wie viele sind ›ein paar‹?«
»Das kann ich noch nicht mit Bestimmtheit sagen, Exzellenz. Wir haben fundierte Beweise, die einen gewissen Erio Battiston belasten, den wir seit gestern Abend suchen. Er soll der Anstifter sein. Leider reichen die Beweise noch nicht aus, um mit Sicherheit sagen zu können, wer die Ausführenden waren.«
Seine Finger trommelten auf Holz, er war ungeduldig und mir war nicht klar, was ihn störte.
»Ich werde meine Männer anweisen, alle Anstrengungen auf die Ergreifung des Battiston zu richten und ...«
Er unterbrach mich mit lauter Stimme: »Seid Ihr wirklich der Ansicht, ein unzufriedener Arsenalarbeiter könnte ein solches Unheil anrichten? Kommt, De Zante! Ihr beleidigt Eure eigene Intelligenz!«
Mir lief ein leichter Schauer über den Rücken. Ich biss mir auf die Zunge, um nichts Unüberlegtes zu erwidern – Impulsivität kann ins Verderben führen – und nahm mir Zeit, um meine Gedanken zu ordnen.
»Erlaubt, dass ich mich besser erkläre, Exzellenz. Verschiedene Dinge deuten auf eine Provokation hin, die aus dem Ruder gelaufen ist. Die Ausführenden hatten bestimmte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass ...«
»Vorsichtsmaßnahmen?« Er bedachte mich mit einem undurchdringlichen Lächeln. »Es ist nicht unsere Aufgabe, nach mildernden Umständen für die Schuldigen zu suchen.«
Er ließ sich emphatisch in einen Sessel fallen, um mir zu zeigen, dass meine Beschränktheit ihn ermüdete, und begann, Blätter auf seinem Schreibtisch zu ordnen, so als müsse er sich erst einmal beruhigen.
»Hört zu, De Zante!«, er hob den Kopf, der Ton seiner Stimme kündigte eine Strafpredigt an: »Ich kenne Euren Eifer, und ich kann mir vorstellen, wie sorgfältig und unbeirrt Ihr diese Fakten zusammengetragen habt. Aber das genau ist das Problem. Ihr betrachtet die Dinge aus allzu großer Nähe. Dabei entgeht euch das große Ganze, euch entgeht das, was außer Euch in Venedig alle von Anfang an gewusst haben.«
Meine Halsmuskeln verkrampften sich.
»Nehmen wir ruhig mal an, die Arbeiter wollten mehr Geld und haben etwas damit zu tun. Fändet Ihr es in Ordnung, Venedig für ein paar Dukaten mehr in die Knie zu zwingen? Würdet Ihr Euer Leben für eine zusätzliche Scheibe Brot riskieren? Sicher nicht, es müsste schon um mehr gehen. Und wer könnte Euch das bieten?«
Mir wurde plötzlich klar, auf was er hinauswollte.
»Wir haben in den letzten Wochen mehrere türkische Spione verhaftet und sie zum Sprechen gebracht, aber es gab keinerlei Anzeichen für eine derartige ...«
»Ihr messt den Spionen der Straße zu viel Bedeutung bei, De Zante. Wer die Schlange ergreifen will, darf nicht erst das Kaninchen fragen. Es muss einen Verräter geben, der wichtiger ist als ein Arsenalarbeiter oder ein einfacher Spion. Einen, der Spione, Aufwiegler und Hitzköpfe aus dem Arsenal für sich arbeiten lässt, der die Kontakte knüpft zwischen ihnen und dem Geld von Giuseppe Nasi.«
Nasi. Der Name, der in aller Munde ist, das Fleisch gewordene Wort des Volkes. Wenn ich ihn ausgeschlossen hatte, dann war das gewiss nicht aus Unachtsamkeit geschehen.
»Habt Ihr irgendwelche Hinweise?«
»Es muss jemand sein, der einen wichtigen Posten hat, der unverdächtig, aber kein Patrizier ist und der in der Lage ist, einen Angriff auf das Arsenal zu planen. Jemand, der etwas zu verbergen hat und deshalb von den Türken erpresst werden kann. Nach Möglichkeit einer, der nicht aus Venedig stammt. Ich vertraue auf Euch, De Zante. Ihr werdet den dazu passenden Namen sicher finden, sodass sogar ein solches Unglück der Republik zu neuem Ruhm verhilft.«
»Ich verstehe. Der perfekte Schuldige.« Ich versuchte, einen klaren Kopf zu behalten.
Der Consigliere machte eine zustimmende Kopfbewegung, erhob sich, und als sei nichts geschehen, starrte er wieder ins Grau der Wolken.
Als ich zur Tür ging, versuchte ich selbstsicher aufzutreten. Ich wusste, dass er meinen Schritten lauschte, aber so sehr ich mich auch bemühte, mein Gang war weit unsicherer als bei meinem Eintritt.
5.
Ich durchstreifte ziellos die Stadt, die ich für mein Zuhause hielt, und dachte über die Bedeutung der Worte des Consigliere nach.
Ich dachte an die, die zu bezahlen hatten, zuerst mit Schmerzen, dann mit dem Leben. Ich wollte ihn nicht enttäuschen, niemand durfte je Bartolomeo Nordio enttäuschen, also suchte ich nach dem von ihm Verlangten, aber kein Name, kein Gesicht, kein Mensch mit den Merkmalen des perfekten Schuldigen fiel mir ein.
Niedergedrückt von der Last meiner Gedanken ging ich den Ruga Rialto hinunter, nahm eine Abkürzung durch die Calli und beobachtete auf der Riva del Vin die Boote auf dem Kanal und die lärmenden und geschäftig hin und her eilenden Menschen. Ich brauchte einen Namen.
Als ich weiterging, wurde mir bewusst, dass ich einem bestimmten Ziel zustrebte. Arianna hatte ihren unsichtbaren Faden gesponnen, und ohne es zu merken, war ich ihm bis in die Calle del Paradiso gefolgt.
Ich klopfte an die mir bestens vertraute Haustür. Ihre Dienerin öffnete, begrüßte mich und stieg dann die Treppen hinauf, um mich bei ihrer Herrin anzumelden.
Arianna schien nur wenig erstaunt, als sie mich sah. Ein leichtes Lächeln umspielte ihr sommersprossiges Gesicht.
»Ich habe dich nicht erwartet, aber ich freue mich immer über deinen Besuch.« Sie betrachtete mich von oben bis unten. »Du schaust so finster, ist was passiert?«
»Ganz Venedig weiß, was passiert ist. Ich erzähle es dir später.«
Ich war ein schlechter Liebhaber. Wie ein Verdurstender in der Wüste saugte ich überhastet und brutal an ihren Lippen. Wie ein Verhungernder ein Stück Brot packte ich ihre vollen, schweren Brüste und bewegte meine Hüften wie ein Betrunkener, der die letzten Tropfen aus der Flasche schüttelt.
Vielleicht spürte sie mein Unbehagen, denn auch sie war nicht ganz bei der Sache, aber dann war auch dieser Liebesakt zu Ende.
»Sag mir, was dich bedrückt.«
Ich schaute sie an. Sie war eines der schönsten Wesen, das ich je gesehen hatte. Mit ihrem blonden, lockigen Haar und den dunklen, leuchtenden Augen war sie eine der auffälligsten Kurtisanen in Venedig gewesen; dann gehörte sie nur noch mir.
Seit einigen Jahren zahlte allein ich für ihre Dienste. Mein Beruf verbot es mir, Freudenhäuser aufzusuchen, wo sich Nachrichten und Gerüchte allzu schnell verbreiten. Arianna hielt mich von allem Unheil fern.
»Ich brauche dringend einen Schuldigen für den Brand im Arsenal. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, wobei es keine Rolle spielt, ob er das Verbrechen tatsächlich geplant oder ausgeführt hat.«
»Einen Sündenbock«, sagte sie.
»Genau.«
»Oft werden von uns Dinge verlangt, die wir nicht wollen«, sagte sie, aber ich hörte kaum zu und dachte halblaut nach.
»Nordio will den perfekten Täter, jemanden, den man dem Volk von Venedig zum Fraß vorwerfen kann. Er soll unverdächtig sein und ein Doppelleben führen.«
Ich schloss die Augen und atmete tief durch. Die Worte meines Chefs gingen mir immer wieder durch den Kopf, ich drehte und wendete sie hin und her und versuchte das Gesagte in all seinen Bedeutungen zu erfassen.
Ein Unverdächtiger.
Jemand, der eine ziemlich hohe Stellung bekleidet.
Jemand, der etwas verheimlicht, ein Betrüger.
Neben mir spürte ich die Wärme des Körpers meiner Geliebten.
Ein Unverdächtiger.
Ich drehte mich zu Arianna um. Sie lächelte unsicher und blickte verstohlen zur Tür.
Jetzt ging alles sehr schnell. Ich blickte an mir herab. Das Geheimnis.
Mein schlaffer Penis lag auf der Seite.
Der Betrüger.
Der Penis ohne Vorhaut.
Der Jude.
Ein schrecklicher Gedanke durchfuhr mich. Panisch sprang ich auf und starrte Arianna an. Sie hatte die Arme vors Gesicht gelegt. Ich rannte zum Fenster, das auf die Calle hinausging, und blickte durch den Spalt zwischen den Läden.
Neben dem Eingang warteten fünf Polizisten. Zwei von ihnen waren meine engsten Vertrauten.
Gualberto Rizzi und Marco Tavosanis.
Alles, was sie waren, verdankten sie mir. Aber der Mensch hasst seine Wohltäter. Tue jemandem etwas Gutes, und in neun von zehn Fällen hast du dir einen unerbittlichen Feind gemacht. Sie brachten alle Voraussetzungen mit, um mich ergreifen zu wollen.
Meine Geliebte war ans Ende des Bettes zurückgewichen und bedeckte sich mit dem Bettlaken. Ihre Angst zeigte sich in Form von Scham. Ihre Augen waren feucht.
»Sie haben mich gezwungen, Emanuele. Ich habe es nicht gewollt.«
Meine Geliebte, die einzige Person, der ich vertraute, hatte das Geheimnis meiner Herkunft verraten. Entkleidet Emanuele und ihr entdeckt Manuel, den jüdischen Jungen aus Ragusa.
Sie brauchten einen Schuldigen für das Geschehene et tulerunt me (und sie nahmen mich), den Juden, den Betrüger, den Lügner, et stabit Venetia a fervore suo (und Venedig ließ ab von seinem Wüten).
Mein erster Gedanke war hinauszustürmen und mich mit offenem Visier auf die Greifer zu stürzen, auf das Überraschungsmoment zu setzen und auf meinen Dolch; zwei, drei Männer würde ich aus dem Weg schaffen können, aber nicht alle.
Flucht bedeutet nicht Wegrennen vor denen, die dich verfolgen.
Flucht bedeutet Verschwinden.
Arianna machte ein paar Schritte auf mich zu und ließ das Leintuch fallen. Angst und Entschlossenheit standen in ihrem Gesicht.
»Sie kriegen dich nicht, wenn du tust, was ich dir sage. Es gibt einen Durchgang zum Nachbarhaus, es ist unbewohnt. Du kannst es durch den Hintereingang wieder verlassen.«
Für einen Moment blieb ich unbeweglich stehen. Dann machte ich mich davon.
6.
Gott musste Mitleid mit mir gehabt haben, wenn es mir gelungen war, den Händen Rizzis und Tavosanis zu entkommen, den Händen, die willig meine Befehle ausgeführt hatten und die mir jetzt Freiheit und Leben rauben wollten. Genau wie ich, der ich in den Straßen und auf dem Wasser Venedigs sein Auge, sein Ohr und sein Mund gewesen war, waren auch sie die Werkzeuge des Inquisitors.
Nordwestwind fegte über einen düsteren Himmel und vertrieb den Sommer. Ich rannte durch die Calli, die nie mehr mein Zuhause sein würden. Venedig entledigte sich meiner so, wie man einen Splitter entfernt, der sich nach einem Sturz unter der Haut festgesetzt hat, man schneidet ins Fleisch und drückt ihn mit dem Blut heraus.
Die Menschen wurden auf mich aufmerksam. Ich musste langsamer gehen und aufhören, mich ständig umzuschauen. Mein Verhalten zeigte, dass ich auf der Flucht war. Jemand zeigte mit dem Finger auf mich, aber ich war schon um die Ecke gebogen und rannte wieder los; noch eine Ecke und noch eine, dann ging ich wieder normal. Niemand hatte mich verfolgt. Ich musste einen klaren Kopf behalten und nachdenken.
In mein Haus konnte ich nicht zurück, es wurde mit Sicherheit überwacht. Ich musste sofort verschwinden. Das Geld, das ich in der Tasche hatte, würde gerade genügen, um die Stadt zu verlassen, aber ich verfügte über beträchtliche Einlagen bei der Bank der Brauns im Fondaco dei Tedeschi. Ich hatte das Geld für Notfälle beiseitegelegt, und jetzt war der Augenblick gekommen, es abzuheben. Ich hatte es einer deutschen Bank anvertraut, um es vor indiskreten Blicken zu schützen.
Mein Instinkt riet mir, sofort zum Meer zu laufen und ein Boot zu nehmen, aber ich brauchte unbedingt Geld und musste zuerst ins Stadtzentrum. Ich zwang mich zur Ruhe und wurde kalt und berechnend wie beim Verhör von Verdächtigen. Ich eilte in Richtung Rialto und benutzte nur wenig begangene Calli. Als ich in der Nähe des Fondaco war, wartete ich einige Minuten, bevor ich mich, dicht an der Mauer, dem Eingang näherte. Ein unbestimmtes Gefühl, eine Ahnung, jahrelange Erfahrung hielten mich zurück. Wie oft hatte ich Spionen oder Verrätern aufgelauert? Ich machte ein paar vorsichtige Schritte, blieb stehen, und gedeckt vom Hin und Her der Karren und des Personals, drückte ich mich an ein Portal. Im Gewimmel der Waren und Menschen, inmitten unaufhörlicher Bewegung entdeckt das Auge schnell das Bewegungslose.
Der Erste stand an eine Mauer gelehnt an der Ecke einer Calle. Er blickte träge umher und überprüfte alle, die an ihm vorübergingen.
Der Zweite stand direkt neben dem Eingang. Sein schwarzer Umhang hüllte ihn von den Schultern abwärts vollständig ein und verdeckte mögliche Waffen.
Es gab noch einen Dritten. Es gibt immer einen Dritten. Ich hatte ihn nicht sofort bemerkt, weil er sich ganz in meiner Nähe befand. Er kontrollierte das Stück Straße, das mich vom Eingang trennte.
Als er seinen Kopf in die andere Richtung drehte, schlüpfte ich aus meinem Versteck und tauchte wieder ein in die düsteren Eingeweide Venedigs. Weg, dem Tod entfliehen, der mich am Eingang erwartete. Dem Fluchtinstinkt gehorchend, flogen meine Füße übers Pflaster.
Um meinen Hals hing eine goldene Kette mit einem Medaillon. Sie war ein Geschenk meines Vaters. Auf der einen Seite das heilige Kreuz, auf der anderen der Löwe von San Marco mit dem geschlossenen Buch und dem gezogenen Schwert. Das Kriegsbanner der Armada.
Krieg. Die Republik befand sich im Krieg mit Emanuele De Zante, ihrem treuen Diener.
Einem verratenen Diener. Einem Diener, der ein flüchtiger Verräter war.
Das Medaillon konnte ich zu Geld machen, wo immer mich das Schicksal hin verschlagen sollte.
Ich ging zu einem Boot, verhandelte kurz mit dem Gondoliere und gab ihm mehr Geld, als ihm zustand. An diesem frühherbstlichen, bleifarbenen Nachmittag herrschte noch überall rege Geschäftigkeit. Die Stadt pulsierte, Boote flogen übers Wasser, am Ufer diskutierten erregt ein paar Männer und fahrende Musikanten spielten, als die Gondel ablegte und dem langen Bogen des Canal Grande folgend dahinglitt.
Nostalgie, Trauer und Wut verschlossen mein Herz und machten mich stumm.
Im Halbdunkel glitten Paläste vorbei. Ich nahm sie nicht einzeln wahr, spürte aber ihre erdrückende Größe. Wo das Auge nicht sieht, füllt Erinnerung die Leere.
Die vor meinem geistigen Auge auftauchenden Bilder gruben sich tief in meine Seele ein. Die Noten, die bei meiner Abreise erklangen, setzten sich als Echo fort.
So verließ ich Venedig und war mir sicher, dass ich es nie wiedersehen würde.
7.
»Ti volir cunciar partida, Tuota?«
»Hast du Lust auf ein Spielchen, Tuota?« waren die ersten Worte nach Tagen hartnäckigen Schweigens in jenem Winkel der Erde, in dem der Po sich windet und schlängelt und immer wieder teilt, bevor er sich ins Meer ergießt. Mein schlammverkrustetes Gesicht produzierte ein schiefes, müdes Lächeln, und gleichzeitig streckte ich meine rechte Hand vor, als bettelte ich um Almosen, aber in Wirklichkeit lagen zwei Würfel darin, Dinge, die man mitten im Sumpf kaum erwartete. Ich hatte sie aus Pappelholz geschnitzt und die Zahlen mit der Messerspitze eingeritzt: I, II, III, IV, V und VI. Es sollte die kleine Komödie eines Spaßvogels sein, und den spaßig launenhaft Empfang hatte ich mir ausgedacht, um den Mann zu begrüßen, den ich hier zu treffen hoffte, den Mann, der mir einst den Vater ersetzt hatte.
Lass uns würfeln! Gestern noch trug das Schicksal mich auf Händen, heute hat es sich gegen mich gewandt und packte und zerquetschte mich wie einen faulen Apfel.
Über Nacht hatte es aus einem venezianischen Edelmann einen flüchtigen Juden gemacht, der angeklagt ist, die Republik verraten zu haben. Ich stand mit den Füßen im Schlamm und bewegte den Satz in meinem Kopf.
»Ti volir cunciar partida, Tuota?«
Ich sagte es in genau dem Sprachengemisch, das alle Ausländer benutzen, von Genua bis Tripolis, von Smirne bis Gibraltar, in der levantinischen Sprache der Korsaren, der Händler, der Schmuggler, in der Sprache all jener, die krumme, illegale Geschäfte machen, und die in allen Häfen des Mittelmeeres gesprochen wird, sogar hier im Röhricht auf einer kleinen Insel im Podelta, beim Ruf des Uhus und der Schleiereule. Hier, auf den letzten Meilen seiner Existenz, bildet der Po delle Fornaci Labyrinthe, Rinnsale und hybride Formen aus Wasser und Land, bevor er sich in den großen Golf ergießt, um sich endgültig mit dem Meer zu vereinen.
Hier hatte ich mich nach meiner Flucht aus Venedig in einem halb verfallenen Schuppen versteckt. Ich war völlig durcheinander, meine Gedanken waren so verworren wie der Lauf des Flusses, aber ich wusste, früher oder später würde ein Boot kommen, und auf diesem Boot würden Gesetzlose sein. Ich wusste es, weil ich einst selbst einer von ihnen gewesen war.
Und jetzt stand ich da, mit diesen grob geschnitzten Würfeln in der Hand, vor mir das Boot, eine Batana, und auf der Batana der Tuota. Der Mond beschien ihn, sodass ich ihn sofort erkannte, und auch er erkannte mich sofort.
»Du hast verdammt viel Mut, auf diese Art hier wieder aufzutauchen. Du kannst von Glück sagen, dass ich dich rechtzeitig erkannt habe, sonst wärst du jetzt tot«, sagte er in Vegliotto, der Sprache des nördlichen Dalmatiens.
Natürlich hatte er mir nicht verziehen, und die Überraschung, mein Aussehen und meine Scherze trugen dazu bei, seinen Groll gegen mich wieder aufflackern zu lassen.
»Ich bin auf der Flucht, Tuota. Venedig will meinen Tod.«
Tuone Jurman schüttelte den Kopf, wie damals, wenn ich als Junge leichtsinnig gehandelt hatte. Das Alter hatte sein Gesicht kaum gezeichnet, nur der Bart war grau geworden. Tuone Jurman. Der Tuota.
Ich hätte ihm gerne von den Jahren unserer Trennung erzählt, von dem, was vor wenigen Tagen geschehen war, von meinem geheimen Leben, von meiner Arbeit als Schattenmann.
Er hätte mir vielleicht zunächst zugehört und dabei so getan, als wäre er mit anderen Dingen beschäftigt, als beobachte er das Röhricht, suche das Ufer nach Lichtern ab, oder er hätte seinen beiden Gehilfen, die noch sehr jung waren und die ich nicht kannte, mit leiser Stimme Befehle erteilt. Wenn ich ihm dann Einzelheiten aus meinem zweiten Leben (oder war es das dritte?) erzählt hätte – wer weiß, was der alte Schmuggler getan hätte. Vielleicht hätte er mir mit seinem Fischmesser die Kehle durchschnitten und mich ins Wasser geworfen, vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte er mich nur mit schweigender, peinigender Verachtung gedemütigt.
Ich erzählte nichts, und er stellte keine Fragen. Er fragte auch nicht, warum ich ausgerechnet zurück nach Ragusa wollte, in die Stadt alter Erinnerungen, die von Spionen wimmelte, in deren Straßen es genügend Augen und Ohren gab, die mich wiedererkennen würden, und in deren Schänken die Gefahr groß war, dass man mich für einen Judaslohn verkaufte.
In den Tagen der Einsamkeit hatte ich mir diese Frage gestellt: Warum nach Ragusa, in eine Stadt, die noch in Reichweite der Pranke des Löwen liegt?
Er war die Antwort: Tuone Jurman.
Meine Mutter hatte aus mir einen guten Juden machen wollen, der in Treue zur Tora aufwuchs, aber es war anders gekommen. Schon als Junge zog ich den Hafen und das Knarren der Landungsstege der Schule der Rabbiner und der Langeweile der Midraschim vor. Dort hatte ich den Tuota kennengelernt. Er war der Einzige, der so mit mir redete, dass ich mich zuerst als Mensch und dann erst als Jude fühlte. Ich hatte früh angefangen, für ihn zu arbeiten. Wir fuhren zu den dalmatinischen Inseln, um kleinere Handelsgeschäfte abzuwickeln, transportierten Schmuggelware, und hin und wieder fuhren wir zur gegenüberliegenden Küste, zu den unsichtbaren Anlegestellen zwischen Venedig und Ferrara, um jemanden übers Meer zu fahren, der den Christen den Rücken kehren wollte oder es schon getan hatte, und der sein Glück im Reich des Türken suchte. Hatte nicht Herakles an den Ufern des Pos die Nymphen gefragt, wo die Bäume mit den goldenen Früchten wüchsen? In unserem Jahrhundert kam die Antwort von mohammedanischen Nymphen, die den Weg hinaus über die Mündung des Flusses in Richtung Orient wiesen. Sie erzählten von Sultanen und Kalifen, die reicher und toleranter waren als der italienische Adel. Wer sich überzeugen ließ, ob Artillerist, Arzt, Seemann oder Weber, kam zu uns, und wir brachten ihn nach Dalmatien, und von dort reiste er weiter in Richtung Süden oder Osten.
Der Tuota, seine Freunde und ich, wir befuhren diese Route, bis mein Vater in die Stadt zurückkam, mein richtiger Vater, der Abstammung und dem Namen nach, und danach sollte sich mein Leben für immer ändern.
Jetzt war ich wieder bei Tuone Jurman, bei dem Mann, den ich zwar verlassen, den ich aber niemals verraten hatte.
Während meiner Jahre im Dienst der Serenissima hatte ich niemals etwas unternommen, um die Geschäfte zu unterbinden, die ich in meiner Jugend betrieben hatte, noch hatte ich je darüber geredet, und jetzt brauchte ich ihn, jetzt war ich derjenige, der verschwinden und alle Brücken hinter sich abbrechen musste, dessen Reise nur in eine Richtung wies. Der Tuota würde kommen und gehen, hin und her, wer weiß, wie lange noch. Ich aber musste gehen, ohne die Möglichkeit der Rückkehr.
Finstere Blicke, malmende Kiefer, Schweigen, ab und zu ein ungeduldiges oder resigniertes Schnaufen; ausgerechnet uns musste das passieren!
Tuone Jurman. Wer sonst hätte mich übers Meer bringen und mir den Weg in eine neue Welt weisen können?
Wir verließen die Mündung des Po und wurden vom adriatischen Meer aufgenommen, der Fährmann von einst wurde übergesetzt.
Kurz darauf erreichten wir das Boot. Das viereckige Segel sah genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte.
Als ich die Strickleiter hochkletterte, spürte ich ein Stechen, das mich schwanken ließ. In jenem anderen Leben hatte ich dieselben Handgriffe Hunderte Male ausgeführt, aber jetzt konnte ich nicht weiter.
Der Tuota war hinter mir, er bemerkte meine Verwirrung und berührte meine Ferse. Du fällst nicht, sagten seine Finger.
Ich war zurück am Ausgangspunkt. Ich kehrte zurück nach Ragusa, nach Dobro Venedik. Das Gute Venedig nannten es die Türken und entstellten den slawischen Namen, um es vom schlechten Venedig auf der anderen Seite des Meeres zu unterscheiden; Freihafen, nicht Orient nicht Okzident, eine Stadt im Niemandsland, in der früher oder später alle anlegten, die auf der Suche nach Schutz vor einem Unwetter, auf der Jagd nach guten Geschäften oder auf der Flucht vor dem eigenen Schicksal waren.
Am nächsten Tag bei Sonnenuntergang sah ich es, ein Häuserhaufen eingezwängt zwischen Bastionen: Dubrovnik. Während wir uns der Stadt näherten, hatte ich versucht, mir vorzustellen, was ich bei diesem Anblick empfinden würde. Ich kam näher und entfernte mich doch, ich floh und kam doch nach Hause.
Meine Finger spielten in der Jackentasche mit den Würfeln.
8.
Der Tuota stieg vor mir die Leiter hinauf zur Luke, die auf den Dachboden des alten Lagerhauses führte. Modergeruch schlug mir entgegen, als ich mich durch die Luke schob.
Ich erkannte den Strohsack in der Ecke, die Schüssel und den von Holzwürmern zerfressenen Tisch. Hier hatten wir nachts den günstigsten Zeitpunkt abgewartet, wenn wir aufs Meer hinausfahren wollten. Ich erinnerte mich an den ersten Abend, das Warten hatte mich verzehrt, und das Herz schlug mir bis zum Hals, und dann war es plötzlich so weit, ich sollte aufstehen und mitkommen. Jahrelang hatte ich so gelebt, und als ich mich für ein neues Leben entschied, blieb ein kleiner Teil von mir hier zurück.
Jetzt war ich zurück und dachte an mein Haus in Venedig, wo ich ein bequemes Leben im Wohlstand gelebt hatte. Ich musste grinsen. Der Tuota sah es und schaute mich komisch an.
»Du kennst dich ja aus hier. An deiner Stelle würde ich mich draußen nicht sehen lassen«, knurrte er. Er blickte sich um und fügte hinzu: »Ich bringe dir was zu essen.«
Er wollte gehen.
»Tuota ...«
Er blieb stehen, und ich schwieg und betrachtete sein sonnenverbranntes Gesicht. Er war noch immer stark wie ein Baum, so wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich verspürte den Wunsch, ihn zu umarmen, wie ich es als Junge nie getan hatte, seine Muskeln, seinen schützenden Körper zu spüren.
Ich löste das Medaillon von meinem Hals und reichte es ihm, das Medaillon mit dem Kriegssymbol Venedigs. Weil ich ihm die Wahrheit verheimlichte, wollte ich mir seine Hilfe erkaufen.
Der Tuota betrachtete den wertvollen Gegenstand, drehte ihn in der Hand hin und her und gab ihn mir zurück, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Dann verschwand er in der Luke, die sich über seinem Kopf wieder schloss, und ich hörte nur noch das Knarren der Sprossen und die sich entfernenden Schritte.
Im Speicher war ein kleiner Austritt, durch den Licht einfiel und durch den man aufs Dach gelangte. Von hier aus gesehen bestand Ragusa aus einer Handvoll roter Dachziegel und weißer Steine zwischen dem Grün der Berge und dem Türkis des Meeres. Als Junge hatte ich aus dieser Luke die in den Hafen einfahrenden Schiffe beobachtet, und an klaren Tagen im Mai oder September hatte ich den Horizont nach den Umrissen des Gargano abgesucht, nachts die Sternbilder bewundert und mit offenen Augen geträumt.
An einem Sommertag vor vielen Jahren war ich zum Hafen gerannt und hatte aufgeregt gerufen: »Tuota, Tuota!« Ich hatte mich im Messerwerfen geübt, und weil ich es jetzt zu können glaubte, wollte ich es ihm zeigen. Ein paar herumstehende Seeleute meinten, Tuota sei eine kindliche Art »Tuone« zu sagen, also Ante, Toni, Antumi, Antal, und weil sie fanden, es höre sich gut an, benutzten es alle, obwohl die Dalmatiner wussten, dass das Wort »Tuota« von der Insel Veglia stammt und dasselbe wie Baba auf Türkisch, Tata auf Kroatisch, Pare auf Venezianisch und Papa im Jüdischen bedeutet. Anfangs hatte ich ihn Papa genannt, in der Sprache meiner Mutter und der spanischen Juden, aber er sagte, das Wort gefalle ihm nicht, weil der Papa der König aller Priester sei und er Priester und Könige nicht leiden könne. Er erlaubte mir, ihn Tuota zu nennen, so wie er seinen Vater genannt hatte, und das ließ ich mir mit meinen acht Jahren und einem unbekannten Vater nicht zwei Mal sagen. Alle im Hafen wussten, dass Tuone Jurman nicht verheiratet war und keine Kinder hatte und dass er die Vorstellung, jemand könne ihn Vater nennen, vermutlich urkomisch fand. So wurde Tuota sein offizieller Spitzname, und mich nannten sie el Feil, den Sohn, und den Hund, der immer in meiner Nähe war, nannten sie Spirit Sant, Heiliger Geist; für einen jüdischen Jungen war das alles mehr als seltsam.
Ich machte es mir auf der Liege bequem, starrte die Wände an und beschäftigte mich abwechselnd mit der Vergangenheit und einer ungewissen Gegenwart. Ich vertrieb mir die Zeit mit meinen Würfeln, spielte gegen mich selbst und verlor, auch wenn ich gewann. Es dauerte lange, bis ich endlich einschlief.
Das Geräusch der Luke weckte mich. Instinktiv griff ich nach meinem Stilett unter der Decke. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war, aber draußen war es schon hell.
Über dem Fußboden tauchte der graue Kopf des Tuota auf, gefolgt vom Rest des Körpers. Einem Sack entnahm er ein Päckchen Brot, Sardinen und eine Feldflasche mit Wasser.
Ich machte ein enttäuschtes Gesicht.
»Ich hatte gehofft, du bringst mir etwas von deinem Grappa.«
»So kalt ist es noch nicht, du brauchst keinen Grappa.«
Mit dem Tuota diskutierte man nicht, er hatte sich nicht verändert. Schweigend verzehrten wir unser Frühstück. Er sprach als Erster.
»Du hast mir noch nicht gesagt, wohin du willst.«
»Ich weiß noch nicht. Irgendwohin, wo sie mich am Leben lassen. In jedem Fall weit weg von Venedig.«
»Ich werde ein Schiff für dich suchen, aber das dauert ein paar Tage. Wenn die Venezianer dich wirklich suchen, muss ich vorsichtig sein. Schließlich hast du dich in ihrem Hinterhof versteckt.«
Ich wollte ihn provozieren.
»Als ich Ragusa verließ, hatte die Stadt sich die Freiheit auf ihre Fahnen geschrieben. Garantiert der Sultan nicht mehr für eure Sicherheit?«
Der Tuota pfiff leise durch die Zähne.
»Freiheit! Wer das Wort zu oft im Munde führt, will sie in Wirklichkeit nicht. Ich bin Pirat und habe mich noch nie jemandem unterworfen. Schon meine Vorfahren waren Feinde Julius Cäsars. Die Adligen dieser Stadt sind genau solche Despoten wie deine Herren in Venedig, nur ein bisschen kleiner.«
»Du wirst alt und verbittert, Tuota. Früher warst du stolz auf die Unabhängigkeit Ragusas. Du selbst bist mit mir zur Burg von San Lorenzo hinaufgegangen, um mir das Motto zu zeigen, das über dem Tor eingemeißelt ist. Erinnerst du dich? Da steht, dass man seine Freiheit nicht für alles Gold der Welt verkauft.«
»Und du hast es auswendig gelernt, um anschließend darauf zu spucken.«
Ich konnte meine Zunge nicht im Zaum halten.
»Du beurteilst alles immer nur vom Standpunkt des Seefahrers aus, Tuota. Glaubst du, Venedig kämpft nicht für seine Freiheit? Eine kleine Republik zwischen Riesen. Alle wollen sie sich einverleiben, die Osmanen, das Heilige Römische Reich und die Römische Kirche, die keine Intrige auslässt, mit der sich ihre Macht ausdehnen ließe. Aber Venedig hält stand. Es bleibt frei.«
»Dann hättest du ja bleiben können«, sagte er, und damit war die Diskussion beendet. Ich war auf der Flucht, das Land, in dem ich gelebt hatte und das ich in meinen Reden immer noch verteidigte, wollte meinen Tod.
»Ich werde dir helfen, aber ich will nicht wissen, warum du auf der Flucht bist, und auch nicht, was du für die Venezianer getan hast«, nahm der Tuota das Gespräch wieder auf. Er stand auf. »Morgen früh bei Sonnenaufgang fahre ich weg. In den nächsten Tagen kommt Dinka und bringt dir dein Essen. An deiner Stelle würde ich mich eine Weile nirgends blicken lassen. Solltest du der Versuchung rauszugehen nicht widerstehen können, denk daran, dein Stilett hier zu lassen. Mit Juden, die bewaffnet herumlaufen, machen sie hier kurzen Prozess.«
Sein Blick war unverändert scharf. Er hatte das Stilett unter der Decke bemerkt.
»Ich bin kein Jude mehr.«
Er schüttelte den Kopf.
»Wir sind hier nicht in Venedig, es gibt sehr viele, die sich an Manuel erinnern, an Sarahs Sohn, und das genügt.«
9.
Die Zeit verging schleppend, und ich langweilte mich. Am nächsten Tag kam Dinka, eine wortkarge alte Frau, brachte mir Essen und leerte den Eimer aus. Sie forderte mich auf, meine venezianischen Kleider abzulegen und gab mir ein paar zerschlissene Hosen und eine Jacke, der man ihre Herkunft nicht ansah. Die Zeichen meines früheren Lebens verschwanden, und ich bekam ein neues Aussehen. Im Glas einer Karaffe betrachtete ich mein Spiegelbild: kratziger, langer Bart, blasses Gesicht, unsteter Blick. Ein anderer Mann. Die Raupe hatte sich auf der Flucht verpuppt, aber es war kein Schmetterling entstanden, nur eine neue Raupe.
In diesem Zimmer gab es nichts anderes zu tun, als meine Geburtsstadt so lange von oben zu betrachten, bis die Augen brannten. Die Manöver der Schiffe wurden vom Geschrei der Entladearbeiter und dem Bellen der Hunde begleitet. Der Wind bewegte Wäsche, die an Fenstern zum Trocknen hing, und hin und wieder, wenn der Wind heftig in ein Betttuch fuhr, knallte es, als habe jemand geschossen. Beobachten und Schlüsseziehen gehörten zu meinem Beruf, also versuchte ich, mir das Leben dieser Menschen vorzustellen. Auf diesem weißen Leinen hatten Männer und Frauen geschlafen, Alte und Kranke waren darauf gestorben, Kinder waren zur Welt gekommen.
Zwangsläufig führten meine Gedanken mich zu meiner Mutter, und mit aller Macht drangen Erinnerungen ans Licht. Ich sah ihre schwarzen Augen und hörte die alten spanischen Lieder, mit denen sie mich in den Schlaf gesungen hatte. Ich sah das Kind im Bett, das eines Morgens im November ungeduldig und herzlos von der schrillen Stimme der alten Abecassi geweckt wurde.
Alles ist wie immer. Sie öffnet die Tür und reißt mich mit dem immer gleichen dummen Spruch aus dem Schlaf, mit einem ihrer zahlreichen sephardischen Redensarten, die ich gelernt habe zu hassen.
»Aufwachen! Wer eine Moza heiraten will, darf nicht warten, bis er alt ist.«
Ich fahre hoch aus einem Traum, der im schönsten Moment unterbrochen wird, ich versuche noch, ihn festzuhalten, ihn nicht zu vergessen, aber als ich mein Gesicht wasche, hat er sich schon verflüchtigt, und ich kann mich an nichts mehr erinnern. Draußen ist es noch dunkel, das Wasser ist kalt, mein Herz schlägt schnell. Ich bin gerade sieben Jahre alt geworden.
Sprichwörter und Redensarten. Noch auf dem Sterbebett, als sie mich der Abecassi anvertraute, sagte meine Mutter mit dem letzten Atemzug, der ihr noch blieb:
»Ke darse mi ijo, ke seyga en Teshabeav.«
Möge mein Sohn im Tempel predigen, und sei es am Tishab‘Av, am Tag der Trauer. Sie wollte damit sagen, sorgt dafür, dass auch unter diesen unglücklichen Umständen aus meinem Sohn ein guter Jude wird, dass er die Gesetze einhält und in die Schule der Rabbiner geht. Und ich, der ich bisher in der Nähe des Hafens gelebt hatte, musste ins Ghetto ziehen, in die Via dei Giudei, ins Haus einer Megäre, einer Freundin meiner Großmutter noch aus spanischen Zeiten – das jedenfalls behauptete sie, obwohl das unmöglich ist, denn als sie Toledo verließen, war meine Großmutter noch ein Kleinkind.