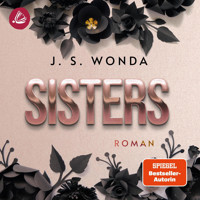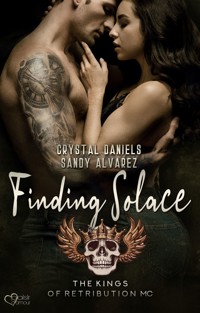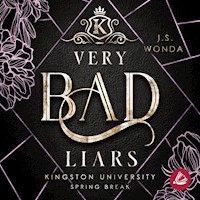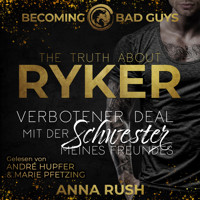Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Der Versicherungsvertreter, der mit Unkrautvernichtung gegen Krisen angeht; die Freunde, die sich durch nichts irritieren lassen; der Wissenschaftler, der zu magischen Mitteln greift; der lüsterne Zwerg, der alles ausprobiert. Die Helden der Geschichten sind alt oder versoffen, endlich am Ziel oder im falschen Film. Sie tun ihr Bestes oder was sie dafür halten - und sie schaffen es beinahe. Das geht nicht immer gut und auch wenn alles gut geht, ist nicht alles gut. Immerhin bleibt das Begehren. Wenn es bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Überhaupt verspricht man sich zu viel von der Erfüllung seiner Wünsche.
Inhalt
Ein Schritt in die richtige Richtung
Unkraut
Fleisch
Altes Begehren
Müll
Big Brother
Wasser
Der Kenner
Das Amt
Talkshow
Infarkt
Nie wieder chinesisch
Älterer Herr im Wunderland
Bekenntnisse eines Kleinwüchsigen
Ein Schritt in die richtige Richtung
Noch auf dem Parkplatz hatte er Zweifel. Jedes Mal wenn er sich in den letzten Wochen der Einfahrt genähert hatte, hatte es ihn gereizt einzubiegen. Jedes Mal war er weitergefahren. Das Studio befand sich mitten in der Kleinstadt in einem Gehöft, dem seine Vergangenheit als Dreiseithof noch anzusehen war. Die kalkweiße Wand der ehemaligen Scheune mit dem lila-gelben Logo im schiefwinkligen Stil der frühen 1960er Jahre, dazu der anglisierende Name weckten in ihm die Vorstellung einer notdürftig in die Neuzeit gelifteten Trainingsdiele für Rocky und seine Jünger. Im Geschmack einer ländlichen Kleinstadt. Das hatte ihn lange zögern lassen.
Jetzt ging er entschlossen über den Parkplatz auf den Eingang zu. Er zog die Glastür auf und trat in einen Vorraum. Auch hier war alles weiß gestrichen. Auf den freien Flächen waren gelbe und lila Plastikdreiecke wild verteilt, dazwischen eingestreut – ebenfalls dreieckig – Spiegelscherben. Späte Echos der Zeit von Milchbar und Musicbox. Links an der Wand stieg eine Treppe in den ersten Stock, aus dem das Klirren aneinander schlagender Eisenteile zu hören war. Neben der Treppe führte ein Gang an Schuhregalen entlang zu mehreren Türen, wohl den Umkleideräumen. Rechts hinter einer weiteren Glastür lagen Gymnastikbälle auf dem Parkett eines kleinen Saales. Nach zwei Schritten stand er an der kurzen Seite eines L-förmigen Tresens, dessen langer Schenkel sich in die Tiefe des Raumes streckte und an dem drei Barhocker standen.
Hinter dem Tresen ein Mittdreißiger, eine Sportskanone in weiß. Weißes T-Shirt, weiß-blonder Schädel nah an der Glatze, blonde Wimpern, auf dem linken Bizeps ein Tattoo. Das Gegenbild zu seinen eigenen Schwimmringen und schlaffen Oberarmen, das wandelnde Körperbewusstsein. Der Schutzreflex seiner Selbstachtung flüsterte ihm »Blondy« ein. Blondy ließ die Muskeln etwas spielen, gerade so viel, dass es noch als Zufall durchgehen konnte, brachte sein Tattoo zur Geltung und wandte sich nach diesem Kurzprogramm mit der überlegenen Langsamkeit des Eingeborenen an den Besucher.
»Halloo!«
Blondy streckte ihm über den Tresen hinweg die Hand entgegen. Das ging ihm eigentlich zu schnell, denn er wollte ja erst einmal fragen. Aber er nahm die Hand, immerhin wollte er ja fragen und er wollte Auskunft bekommen. Er nahm also die Hand, erwiderte Blondys Blick und sagte forsch:
»Hallo! Ich wollte mal wissen, wie das hier so läuft und wie die Konditionen sind.«
Zufrieden befand er: Das hatte selbstsicher geklungen. Jetzt wandte sich der Mann um, ging nach hinten um den Tresen herum und kam an den Barhockern vorbei zu ihm nach vorn. Noch einmal streckte er die Hand aus und diesmal sagte er: »Ich bin der Sven.«
Es stellte sich heraus, so einfach ging das nicht. Er konnte keineswegs gleich losturnen, selbst wenn er es gewollt hätte. Sven hatte nämlich keine Zeit für Einweisungen und Vertragsabschluss. Dafür musste ein eigener Termin ausgemacht werden. Heute durfte er nur »mal kurz gucken«. Also zog er die Schuhe aus und Sven geleitete ihn die Treppe hinauf. Zu sehen gab es, über einen ausgebauten Dachboden verteilt, vor allem Eisen. Überall standen stählerne Konstruktionen herum, mit lila Polstern an den Stellen, an denen Mann oder Frau Kontakt zu ihnen herstellen sollte. In einem zweiten Raum standen elektrische Fahrräder, ein Laufband und zwei oder drei weitere seltsame Gebilde, deren Funktionsweise sich ihm nicht recht erschloss. Zu seiner Erleichterung sah er an den Kraftmaschinen zwei Rentner, mager an den falschen Stellen wie er und nicht annähernd so rollengerecht aufgeputzt wie Sven. Das gab den Ausschlag. Eine Woche später unterschrieb er den Vertrag. Heute kennt er sich aus. Wenn er ankommt, ruft er »Hallo!« in die Runde. Dann geht er an die Schultermaschine und schweigt wie die anderen.
Unkraut
Eine Zeit lang hatte er es damit versucht, sein Haar zu gelen. Um seinen 40. Geburtstag herum erschien ihm das eines Morgens lächerlich. Die lichten Stellen auf seinem Schädel waren nicht mehr zu kaschieren. Er hatte nie einer von jenen ältlichen Jugendlichen werden wollen, deren Scheitel von Jahr zu Jahr zentimeterweise ohrwärts vorrückte, nur um lange Haare zu rekrutieren, die, in Formation gelegt, verlorenes Territorium wieder besetzen sollen. Also gab er das mit dem Haargel auf.
Den Druck im Kopf war er davon ohnehin nicht losgeworden. Im Gegenteil, die Migräne schraubte immer öfter an dem spanischen Eisen in seinem Schädel. In Gesellschaft spielte er das herunter mit dem Scherz:
»Wer Migräne hat, dem kann Sex nicht zugemutet werden. So bleibt Zeit für wichtigere Dinge.«
Er forderte gelegentlich sogar das Recht des Mannes auf seine Migräne ein. Viel meinte er sowieso nicht zu versäumen. Seine Frau war noch nie, was er »wild« genannt hätte. Auch waren mit den Jahren die jugendlichen Explosionen zu bloßen Verpuffungen abgeflacht. Aber immerhin, sie waren planbare Posten im Wochenlauf. Und von Leistungsdruck konnte keine Rede sein. Fiel der Mittwochabend-Termin aus, dann war das beim Frühstück am Donnerstag durchaus kein Thema. Und auch später nicht.
Es gab Anderes. Der Einkauf musste geplant werden, die Tochter war zum Flötenunterricht zu bringen, der Kompost umzusetzen und das Unkraut auf dem Gehweg vorm Haus musste beseitigt werden.
Für letzteres, er nannte es die »Zernichtung« des Unkrautes, hatte er eine seltsam zähe Leidenschaft entwickelt. Das lag an dieser Art Flammenwerfer, den er im Baumarkt gekauft hatte. In der einen Hand hielt er eine Flasche mit Flüssiggas, in der anderen den Brenner. Der befand sich am Ende eines gut einen Meter langen Rohres, an dessen anderem Ende der Gasanschluss war und der Handgriff. So konnte er in – wie der Verkäufer gesagt hatte – ergonomischer, aufrechter Haltung die Flamme der Vernichtung auf die Unkräuter richten.
Das gleichmäßige kraftvolle Brausen des Brenners hob ihn fast augenblicklich in eine weiche Trance. Wenn er zusah, wie sich in der Hitze der Brennerflamme die Blätter des Löwenzahns zuckend streckten und gleich darauf herabsanken; wenn er dabei zusah, lockerte sich der Reifen, der von innen an Schädel und Augäpfel drückte. Sekunden des Friedens. Aber schon die nächste Falsche Kamille regte ihn wieder auf, wenn sie weder wankte noch welkte. Die Gebrauchsanleitung des Gerätes behauptete zwar, auch diese Pflanzen würden den Spätfolgen des Feuerschocks erliegen, trotzdem empörte ihn die Widerständigkeit mancher Kräuter, von denen er nicht einmal die Namen kannte.
Der natürliche Platz der Unkraut-Zernichtung im Wochenplan war der Samstagnachmittag. Diese Zeit hatte er mit Bedacht gewählt.
Seit Jahren verkaufte er im Außendienst Versicherungen. Sein Abteilungsleiter bestellte alle Außendienstler, die ihre Vorgaben nicht schafften, am Sonnabendvormittag ins Büro. Offiziell, um sie gründlich zu schulen. Inoffiziell blies er ihnen drei Stunden lang den Marsch.
Heute kam er zum dritten Mal in diesem Monat von dieser Veranstaltung nach Hause. Stier und ohne ein Wort zu sagen umrundete er das Haus. Das Unkraut auf der Terrasse lag welk, die Garageneinfahrt und der Fußweg zur Haustür waren perfekt entkrautet.
Nach dem Kaffeetrinken zog er seinen Blaumann an, schlüpfte in die groben Arbeitsschuhe, steckte die Reserve-Gasflasche in den Rucksack und schulterte ihn. Dann ergriff er den Brenner samt angeschlossener Gasflasche und ging die Vorstadtstraße hinunter bis zur Hauptstraße.
Dort bog er ab.
Fleisch
Prostata. Als das Wort bei seinem Vorsorge-Check zum ersten Mal im Zusammenhang mit ihm gebraucht worden war, hatte K. nicht gleich verstanden.
»Entschuldigung!?«
»Ihre Prostata ist vergrößert«, hatte der Arzt wiederholt.
Schon die Untersuchung, bei der er mit dem Gesicht zur Wand auf einer Pritsche gelegen hatte und den Finger des Arztes in seinem Hintern spürte, hatte ihm Kunststücke der Selbstverleugnung abverlangt. Jetzt auch noch diese Diagnose. Sein Gehirn schaltete sich fast vollständig ab. Für Minuten konnte er keinen Gedanken fassen. Äußerlich folgte er abgeklärt aufmerksam den Erklärungen des Arztes. Der sprach von Klarheit verschaffen; Routineoperation; minimalinvasivem Eingriff und Termin ausmachen. Schließlich nickte K., er wollte es sich in Ruhe überlegen.
Draußen setzte er sich hinter das Lenkrad seines Autos, fuhr aber nicht los. Prostata! So etwas haben alte Männer, die schlecht riechen. Oder ist man mit vierundfünfzig schon alt? Gut, das Pinkeln war etwas langwierig geworden in den letzten Monaten. Aber Prostata?!
Er zwang sich, die Lage nüchtern zu betrachten. Denn was er seinen Studenten predigte, das galt auch jetzt und für ihn erst recht: Defekt erkannt – Gefahr gebannt! Zunächst war anzuerkennen, dass da etwas war. Es ging nicht um die Frage, ob er schon alt war oder nicht, er war jedenfalls alt genug für eine vergrößerte Prostata. Systematisch ging er die Alternativen durch, legte Kriterien fest, bewertete, verwarf und grenzte ein, wie er es gewohnt war. Jetzt war er so effizient, wie er es liebte. Schnell war klar, es war sinnvoll, erst einmal zu klären, ob die Prostata nur altersbedingt gewachsen war, wenn auch etwas über die Norm, oder ob doch etwas anderes dahinter steckte. In die Stille des leeren Autos sprach er aus, was dieses andere sein könnte: Krebs. Die Fakten lagen auf dem Tisch, er nahm sie zur Kenntnis und ging die Probleme an. Also gut, er würde der Biopsie zustimmen. Er startete das Auto.
Heute war der zweite Tag. Gestern war der Arzt mit einem kleinen Apparat in ihn eingedrungen und hatte eine Nadel durch die Darmwand gestochen, um aus der Vorsteherdrüse Gewebe zu entnehmen. Die Prozedur war nicht sonderlich schmerzhaft, aber sie peinigte seine Seele. So biologisch, so auf Gewebe reduziert hatte er sich noch nie gefühlt.
»Ein kleiner Eingriff, aber doch ein Eingriff«, hatte der Arzt anschließend gesagt. Und, nein, er solle nicht gleich wieder arbeiten, sondern sich ausruhen.
Das war leichter verlangt als getan. So krank fühlte er sich nicht, er hatte kein Fieber, ihm tat nichts weh. Nur auf dem Sofa zu liegen und sich zu schonen, das war er nicht gewöhnt, und auch nicht die Gedanken, die seit gestern durch seinen Kopfe kreisten. Mit dem Zentrum im Unterleib, in dem kleinen Organ, von dem er natürlich gewusst hatte, das aber erst jetzt einen Platz in seinem Bewusstsein beanspruchte. Dann schon lieber ein bisschen arbeiten.
Er wollte es langsam angehen. Vielleicht den Artikel von letzter Woche noch einmal durchgehen und die Diplomarbeiten auf dem Schreibtisch bewerten. Beides ging im Sitzen und strengte nicht an.
Langsam und methodisch räumte er die Frühstücksgedecke in den Geschirrspüler. Seine Frau war vor einer Stunde zur Arbeit gegangen, er war allein und konnte sich Zeit lassen. Er stellte die Marmeladegläser in den Kühlschrank, die Butter, den Quark, die Milchtüte. Zum Schluss wischte er den Tisch feucht ab. Dann war er fertig. Zufrieden setzte er sich an den Küchentisch, um kurz auszuruhen. Eine Operation war eben doch eine Operation. Auch die Antibiotika waren anscheinend nicht ohne.
Er saß noch nicht lange als er spürte, wie es in seiner Hose feucht und warm wurde. Das konnte nur Urin sein. Inkontinenz konnte vorkommen, war aber selbstredend ärgerlich, weil so unsagbar überflüssig. Auf Inkontinenz war er vorbereitet. Er stand auf und ging zur Toilette, um zu tun, was jetzt nötig war.
Aber es war kein Urin. Er pisste Blut, ohne zu pissen. Dunkelrot lief es aus der Harnröhre, als wäre sein Penis nur das Ende eines Katheters, der in irgendeinem Blutreservoir seines Körpers steckte. Der Leber oder der Lunge oder sonst wo. Es lief langsam und stetig. Und es war viel. Viel zu viel.
Seine Gedanken überschlugen sich: Mist! Mist, Mist, Mist! Es ist schief gegangen. Ich verblute. Tut gar nicht weh. Was wird das werden? Jetzt bin ich hin. Schluss mit lustig. Kein Mann mehr. Darf doch nicht wahr sein! Kein Ständer. Kein Sex. Hin. Endgültig. Vorbei. Blut. So viel Blut! Es hört nicht auf. … Es soll aufhören! Aufhören! Es hört nicht auf. Es blutet. Es blutet. Ich verblute! ... Muss was machen. Schnell. Gleich. Umschläge! ... Kalte! ... Fleisch! Ja, Fleisch. Frisches. Gesundes Fleisch. Starkes Fleisch! ... Fleisch. ... Kraft! … Ich muss los. Stark. ... Fleisch!
Mit fliegenden Händen stopfte er Zellstofftaschentücher in die Unterhose. Dann zog er sich an und ging auf die Straße. Er hatte sich eine Aufgabe gestellt, das half ihm, die Panik zu verdrängen. Keiner sollte erkennen, was mit ihm los war.
Wie er die zweihundert Meter zum Fleischer geschafft hatte, wusste er hinterher nicht mehr. Am liebsten wäre er gerannt, fürchtete aber, das würde den Blutfluss verstärken. Schleichen durfte er auch nicht, wollte er nicht wertvolle Minuten verlieren. Konzentriert ging er die Straße hinunter, wie ein Betrunkener kurz bevor er abstürzt. Sein Blick war eng und nur auf das Fleischergeschäft gerichtet.
Endlich hatte er es erreicht. Außer ihm war keine Kundschaft im Laden. Er ließ sich vier große Scheiben von einem Stück dunkelrotem Fleisch schneiden. Jede gut zwei Zentimeter dick, nicht solche kraftlosen dünnen Lappen, wie sie in der Vitrine lagen.
Als er aus dem Geschäft trat, schöpfte er Hoffnung. Er konnte es schaffen. Seit er das Haus verlassen hatte, hatte er befürchtet, er könnte zusammenbrechen oder die Taschentücher in seiner Hose könnten das Blut nicht mehr aufnehmen und es würde an den Beinen entlang über die Schuhe laufen. Aber es war gut gegangen. Er ging den Rückweg genauso konzentriert wie den Hinweg. Nur deutlich schneller. Sein Verstand, sein Gefühl, jeder Muskel waren eins mit dem, was er vorhatte.
In der Wohnung angekommen, ging er ins Bad. Aus der Hausapotheke nahm er das Verbandszeug und legte es auf den Fußboden. Dann zog er die Hosen aus. Das Blut lief immer noch. Ohne weiter darauf zu achten, warf er seine Unterhose mit dem blutigen Zellstoffklumpen zur Seite. Blutverschmiert wie er war, legte er sich auf die Fliesen und zog die Steaks aus der Tüte. Das erste legte er sich auf den Damm und um den Hodensack. Danach zwei an die Innenseiten der Oberschenkel. Sie bedeckten die Leisten und lappten über das erste. Das vierte schnitt er mit der Schere aus der Hausapotheke an einer Seite etwa zehn Zentimeter tief ein. Die entstandenen Flügel legte er sorgfältig um die Peniswurzel, den Rest auf den Unterbauch. Jetzt war sein Unterleib lückenlos von dem Fleisch umhüllt.
Er zog lange Streifen Heftpflaster über die Fleischstücke und klebte sie an Oberschenkeln und Hüften an. Streifen um Streifen, bis die Pflasterrolle leer war. Langsam wurden seine Bewegungen wieder fließender und runder. Die kühle Kraft des Fleisches beruhigte ihn. Sein Atem ging tiefer. Die Panik ebbte ab. Er legte eine dicke Lage Zellstoff über seinen Penis, um das Blut aufzufangen. Sein Gesicht entspannte sich, die harten Ringe um die Augen lösten sich. Das Entscheidende war getan.
Vorsichtig stand er auf, darauf bedacht, den erlösenden Fleischumschlag nicht zu verschieben. Auf dem Handtuchhalter hing seine alte Jogginghose, die zog er vorsichtig über. Dann schlurfte er in den Korridor zum Telefon. Einen kurzen Moment lang wollte er seine Frau im Büro anrufen, dann wählte er die 112.
Altes Begehren
An diesem späten Septembertag begann für K. der Abend schon am Mittag. Als erstes heizte er das Schlafzimmer. Normalerweise tat er das nur im tiefsten und frostigsten Winter. Deshalb wusste er nicht, wie er die Heizung an diesem milden Spätsommertag einstellen musste. Einerseits sollte man nicht frieren, wenn man sich unbekleidet im Zimmer aufhielt, andererseits wollte er auch gut schlafen können, ohne ständig in Schweiß auszubrechen. Er drehte den Regler probeweise auf einen knapp mittleren Wert und hoffte, das Resultat noch korrigieren zu können, bevor er aus dem Haus musste. Bis dahin waren zwar noch vier Stunden Zeit, aber die Fußbodenheizung reagierte sehr träge und er wollte sicher gehen. Er erwog, das Bett frisch zu beziehen, ließ es aber bleiben. Erstens war nicht sicher, dass Sabine heute Nacht wirklich hierher käme und zweitens könnte zu viel Vorbereitung leicht die Täuschung stören, es habe keinen Plan gegeben, sondern es sei einfach so passiert. Diese Illusion schien ihm wichtig zu sein, wahrscheinlich sogar nötig. Sie war Teil des Spiels. Also schüttelte er das Bett nur auf und zog es glatt. Dann stellte er sich in den Türrahmen des Schlafzimmers und bemühte sich, das Zimmer mit ihren Augen zu sehen. War es adrett genug? War es zu perfekt? Aus der Küche holte er den Blumentopf mit der roten Azalee und stellte ihn auf den kleinen Schreibtisch am Fenster. Jetzt war er zufrieden.
Mit der gleichen Sorgfalt begann er, sich selbst zurechtzumachen. Er hatte immer noch viel Zeit und die wenigen eitlen Handgriffe, die er kannte, um sich ansehnlich zu machen, ließen viel Raum für Tagträumereien. Die nahmen über kurz wieder die Bahn, die sie in den letzten Tagen schon oft gegangen waren. Ein ums andere Mal spielte er alle denkbaren und auch alle ersehnten Szenarien durch. Er wollte gewappnet sein und sich den Abend nicht durch dumme Ungeschicklichkeiten verderben. Um sich Mut zu machen, rief er sich immer wieder die Anzeichen ins Gedächtnis, die ihm sagten, er hätte verstanden, was sie wollte.
Vor einigen Jahren – er hatte sein Studium noch nicht lange beendet – leitete er an der Universität ein kleines Projekt, an dem auch zwei Studenten mitarbeiteten. Eine davon war Sabine. Sie war klein, knapp über einen Meter fünfzig, schmal, blond, intelligent und sehr zartgliedrig. Androgynie nah an der Vollendung. Und sie war jünger als ihr Name erwarten ließ, gerade mal einundzwanzig. Junge Frauen hießen in dieser Zeit Kristin oder Kerstin, nicht Sabine. Er hatte sich gefragt, wie viel Traditionsbewusstsein in diesem Namen stecken mochte oder ob sie ein sehr später Nachzügler nicht mehr junger Eltern war. Es brauchte eine kleine Weile, bis er den ältlichen Namen für das aufregende Mädchen nicht mehr unpassend empfand. Bei ihrer ersten Begegnung ruhte sein Blick nicht einfach mit Wohlgefallen auf ihr, sondern seine Blicke tasteten ruhelos und schwärmerisch die jungenhaften Konturen ab. Das war ihr natürlich nicht entgangen und obwohl er später auf ihre Erscheinung vorbereitet war und sie nicht mehr so aufdringlich musterte, hatten sie von Anfang an das berufliche Verhältnis überschritten, das sonst zwischen Studenten und Lehrern üblich war. Zwischen ihnen knisterte es, wenn sie die nächsten Schritte im Projekt besprachen. Ihre Augen trafen sich über den Kaffeetassen in der Cafeteria länger als nötig. Manchmal tauschten sie Verschwörerblicke, wie Männer und Frauen, die sich ihrer gegenseitigen Sympathien so sicher sind, dass man fast von Verliebtheit sprechen kann. Eine Verliebtheit, die unschuldig ist, die aber ihre Beschwingtheit daraus bezieht, sich auch schmutzige Dinge mit dem anderen vorstellen zu können. Entscheidend für das Flirren der Gefühle ist jedoch, dass jeder zu wissen glaubt, der andere wisse, dass man sich Sex mit ihm sehr gut vorstellen kann.
Sie waren beide verheiratet und genau an diesem Spiel mit dem Versprechen interessiert. Und das war die Hauptregel: niemals deutlich zu werden, immer einen Rest Zweideutigkeit zu belassen. Sie trafen sich niemals ohne offiziellen Anlass. Es gab niemals ein Rendezvous. Daran, die Zuneigung auszuleben, dachte keiner von beiden. K. nicht und er vermutete, auch Sabine nicht. Es war gut so, wie es war.
Das Projekt ging zu Ende, Sabine beendete ihr Studium und fand irgendwo eine Anstellung. K. verlor sie aus den Augen und aus dem Sinn, aber nicht aus dem Gedächtnis, wie sich herausstellen sollte.
In den Jahren darauf brachte er seine Promotion und eine Scheidung hinter sich. Dann verließ er die Universität und arbeitete freiberuflich. Die Suche nach Aufträgen führte ihn eines Tages in ein Forschungsinstitut. Dort befasste sich eine Arbeitsgruppe mit Managementsystemen in der Wohnungswirtschaft und brauchte für bestimmte Aufgaben Unterstützung von außen. K. und der Leiter des Teams kannten sich aus Uni-Tagen. Aber nicht nur sie. Schon am ersten Projekttag traf K. auf dem Korridor des Institutes Sabine. Beide stockten, stutzten kurz, dann gaben sie sich freudig die Hand und schon war die alte Vertrautheit wieder da.
Sie trafen sich nach seiner Beratung in ihrem Zimmer, tranken Tee und überbrückten die zurückliegenden Jahre. Sabine hatte inzwischen zwei Kinder, war immer noch mit Franz verheiratet und zufrieden mit ihrem Leben. Immer noch war sie knabenhaft und blond und intelligent. Aber sie schien nicht mehr so unschuldig wie früher. Er fand, sie redete etwas zu laut und einen Stich offizieller als nötig gewesen wäre. Sie vermied es, ihm direkt in die Augen zu sehen, gleichzeitig ließ sie kaum eine Gelegenheit ungenutzt, ihn zu berühren. Auch wie sie öfters kokett mit der linken Hand zum Nacken ging, um ihre langen Haare zurechtzulegen, bestärkte ihn in seiner Vermutung, dass sie es genauso empfand wie er: Sex spielte jetzt eine andere Rolle zwischen ihnen als früher. Jetzt war es gut denkbar, noch lag es nicht nahe, aber es lag in der Luft. Es war denkbar, miteinander zu schlafen. Nicht aus einer aktuellen Verliebtheit, die gab es gar nicht. Es fühlte sich eher an wie das Einlösen eines Versprechens, das sie sich vor Jahren gegeben hatten. Als sie geglaubt hatten, nur das Spiel des Versprechens zu spielen.
In den nächsten Wochen sahen sie sich öfter. Es stellte sich heraus, dass sie sich nicht viel zu sagen hatten, nachdem sie sich wechselseitig über ihre Lebensumstände informiert hatten. Schon als sie sich zum dritten Mal im Institut sahen, begann die Frage sich in den Vordergrund zu schieben: Wie machen wir das? Ohne dass sie je darüber sprachen, bestimmte diese Frage immer stärker ihre Begegnungen. Dennoch wäre sie lange in der Schwebe geblieben, wahrscheinlich sogar so lange, dass sich die Spannung, die sich in seinem Gehirn ballte wie ein Kugelblitz, allmählich gelöst hätte, wäre nicht die Einladung von Sabines Chef gekommen, seinen Doktorhut zu feiern. Es war diese Doktorfeier, für die er sich jetzt präparierte. Er hatte mit Sabine nicht darüber gesprochen, er hoffte einfach, sie würde da sein.
Am frühen Abend fuhr er mit Straßenbahn und Bus an den Stadtrand. Gefeiert wurde im Landgasthof Moordorf, den er von früheren Doktorfeiern kannte. Als er eintrat, war die Gaststube schon voller Gäste, er war einer der letzten. Er gratulierte dem »Herrn Doktor« zur bestandenen Prüfung und überreichte ihm das Bändchen mit Aphorismen, von dem er sich einen kleinen Vorrat zugelegt hatte, um bei Gelegenheiten wie dieser nicht in Verlegenheit zu kommen. Dann ging er herum und begrüßte die Leute; wen er kannte mit Handschlag, den anderen nickte er zu. Aus Gründen der Taktik und der Furcht vermied er, zu schnell in Sabines Nähe zu kommen. Erfreut bemerkte er, dass sie seinen Blick suchte. Trotzdem zögerte er die direkte Begegnung hinaus, weil er fürchtete, sie könnte seine Offerte zurückweisen, im Spiel die nächste Runde zu eröffnen. Und darin lag die taktische Raffinesse seiner demonstrativen Zurückhaltung. Sabine sollte heute Abend den ersten Zug machen. Dann würde er klarer sehen, woran er war.
Gegen Ende der Begrüßungstour richtete er es so ein, dass er in ihre Nähe kam. Äußerlich unaufgeregt wie bei allen anderen ging er auf sie zu und sagte mit etwas trockener Kehle:
»Grüß’ Dich, Sabine! Bist Du alleine gekommen? Ich sehe Franz nirgends.«
»Grüß’ Dich! Franz ist zu Hause bei den Kindern. Diesmal war er dran.«
»Na, bis später! Ich mache erst mal die Runde. Ein bissel networken.«
Langsam neigte sich die Feier ihrem Ende zu. Die meisten Gäste waren schon gegangen, nur der Gastgeber und die wackersten Trinker waren noch da und die, die sich etwas erhofften. Man rückte um einen großen Tisch zusammen und wie selbstverständlich setzte sich Sabine neben ihn. Die Stimmung war aufgekratzt. Man kalauerte und erzählte Witze, die immer zotiger wurden, dann verstummten die ersten in der Runde, stierten mit glasigen Augen vor sich hin oder schliefen. Kurz nach eins bildete sich eine Taxi-Fahrgemeinschaft, zu der außer Sabine und K. noch ein Ehepaar gehörte, das bei weiträumiger Auslegung des Begriffes in dieselbe Richtung wollte wie sie beide. K. brachte so lange irgendwelche Scheingründe vor, bis zuerst zur Wohnung des Ehepaars gefahren wurde. Sie fuhren schweigend. K. vorn neben dem Fahrer, die anderen hinten im Fond. Sie schwiegen aus unterschiedlichen Gründen. Das Ehepaar, weil es müde war und sich schon alles erzählt hatte. K., der angespannt auf die kleinsten Regungen von Sabine lauschte, schwieg, weil er keinen Fehler machen wollte. Noch war nichts entschieden und er fürchtete, wenn er jetzt zu deutlich würde, könnte sie ihre kleinen Einverständnisse der letzten Stunden widerrufen, statt sie in das große Einverständnis münden zu lassen.
Vor der Wohnung des Ehepaares stieg K. aus dem Taxi und verabschiedete sich von den beiden. Als sie im Haus verschwunden waren, setzte er sich zu Sabine auf die Rückbank. Der Fahrer fragte nach dem nächsten Ziel. Sabine reagierte nicht und K. wusste nicht, was jetzt richtig wäre. Dann sagte er: »Erst mal zu mir«, und nannte die Adresse. Wieder fuhren sie schweigend. Einzig ihre Hände berührten sich leicht auf den Sitzpolstern. Sein ganzes Denken, sein ganzes Sein konzentrierte sich in den wenigen Quadratzentimetern seines kleinen Fingers, die sich an ihrer Haut erwärmten. Es war an diesem Abend die erste Berührung, die nicht durch irgendeine Konvention gerechtfertigt war. Ihre einzige Rechtfertigung war sein längst erwachtes, aber jetzt erst zugelassenes Verlangen nach körperlicher Nähe.
Das Taxi hielt und er stieg aus. Sie blieb auf der Rückbank sitzen und rührte sich nicht.
»Na komm, steig aus!«, munterte K. sie auf.
»Oder willst du gleich weiterfahren?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte sie brüchig.
Gleichzeitig machte sie vage Anstalten auszusteigen.
Er zahlte schnell beim Fahrer, ging dann zur hinteren Tür der Beifahrerseite und öffnete sie auffordernd. Sie stieg aus und das Taxi fuhr davon. Sie stand abwesend neben ihm auf dem Bürgersteig und sie sahen dem Taxi nach, bis es um die Ecke verschwand. Auch dann bewegten sie sich nicht, als lauschten sie dem verklingenden Trommelwirbel der Reifen auf dem Kopfsteinpflaster nach. Einen Augenblick war es still.
Dann sagte er »Komm!«, und legte den Arm um sie.
Als er in Richtung Haustür gehen wollte, spürte er, wie sich in ihr etwas in ihr versteifte.
»Willst du gehen?«, fragte er eine Spur zu barsch für eine ehrliche Frage.
Sie schüttelte den Kopf. Mit behutsamer Bestimmtheit nahm er sie in die Arme, mehr tröstend als leidenschaftlich. Es war die richtige Geste, aber aus den falschen Gründen. Denn er wollte damit die gläserne Mauer niederreißen, hinter welcher er die Verheißung der Einswerdung irrlichtern sah, mit der sie ihn aber von sich fern hielt. Sie sollte sich ausliefern, damit er sie verschonen konnte. Seelisch oder leiblich, das war ihm egal.
Er schob die schwere Haustür nach innen und sie betraten das Treppenhaus. Sie ging ohne Überzeugung mit ihm, der Logik der Situation gehorchend. Auf der Treppe löste sich die Starre in ihrem Körper bis auf einen kaum wahrnehmbaren Rest. Sie begann leise zu wimmern. Unartikulierte Laute, die aus denselben Regionen kamen, wo eben noch die Starre gesessen hatte, schienen um Liebe zu bitten und gleichzeitig um Schutz zu flehen. Das Wimmern wurde mit jedem Treppenabsatz lauter. Wortfetzen mischten sich darunter.
»Nein«, sprach sie winselnd wieder und wieder vor sich hin.
»Was, nein?«, fragte er, erst besorgt, dann gereizt.
Ihr Verhalten verwirrte ihn. Seit dem Verlassen des Gasthofes, hatten sie noch keinen einzigen noch so kleinen Moment jener fließenden Übereinstimmung gehabt, auf die er gehofft hatte, die er sogar für die einzig mögliche Tonlage eines heimlichen Zusammenseins mit ihr gehalten hatte. Enttäuschung und Ernüchterung machten sich in ihm breit. Sie antwortete nicht auf seine Frage. Sie sah ihn nicht einmal an. Stattdessen lehnte sie sich an ihn als suche sie Schutz. Sie wimmerte als müsste sie Dämonen in Schach halten, die drohend vor ihrem inneren Auge aufstanden und sie schaudern machten. Von Stockwerk zu Stockwerk greinte sie lauter. Vor den Wohnungen im zweiten Stock dachte er zum ersten Mal an die schlafenden Hausbewohner und bedeutete ihr, leiser zu sein. Schließlich standen sie vor seiner Wohnungstür, er zog den Schlüssel aus der Tasche und steckte ihn in das Schloss. Sie stand daneben und schlotterte am ganzen Leib.
»Ich kann nicht!«, zitterte es aus ihr heraus.
Der Satz hatte keinen Adressaten, den man sehen konnte. Sie hatte ihn in den Raum gerufen. Er drehte sich zu ihr um, und es klang wie ein Ultimatum als er sagte:
»Komm nur erstmal rein. – Oder willst du lieber nach Hause gehen?«
Wieder schüttelte sie den Kopf, ohne zu sagen, was sie damit meinte, beruhigte sich ein wenig und trat in den Korridor.
Minutenlang standen sie dann da und hielten sich umschlungen. Sie bewegten sich nicht. Er spürte ihr dünnes Schlüsselbein in der rechten Hand. Alles an ihr fühlte sich zerbrechlich an. Er atmete ihren Geruch ein, der ihm überraschend fremd war. So nah waren sie sich noch nie gekommen. Vorsichtig und verhalten küsste er sie auf den Mund. Ebenso verhalten erwiderte sie die Zärtlichkeit. Das versöhnte ihn wieder mit der Situation. Die hatte er nicht mehr verstanden, seit ihre seltsamen Ausrufe angefangen hatten. Die Nähe weckte seine Wollust wieder. Aber er verhielt sich still, er wollte herausfinden, was sie bewegte und trieb. Immer noch schniefte sie leise. Mit ruhiger, fast flüsternder Stimme fragte er:
»Was ist los? Was hast du? «
»Geht es um Franz? Willst du es mir erzählen?«
Die Antwort brauchte einige lange Sekunden:
»Nichts. – Nein, nichts.«
Sie löste sich von ihm.