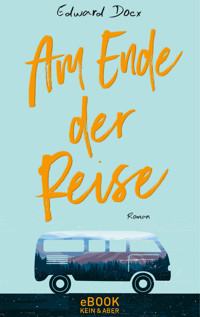
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lou fährt seinen unheilbar kranken Vater Larry zu einer Klinik in Zürich – sein Vater möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen, was in seiner Heimat England gesetzlich verboten ist. Als nach vielen Kilometern in ihrem 80er- Jahre-VW Lous ältere Halbbrüder nach erstem Widerstand doch noch dazustoßen, deckt die Reise immer mehr innerfamiliäre Befindlichkeiten auf. Sie kämpfen, streiten, lachen, betrinken sich, philosophieren über das Leben und sich selbst – ein Roman, in dem sich jede Leserin und jeder Leser sofort finden wird!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Edward Docx, geboren 1972 als Sohn eines Briten und einer Russin, arbeitet als Journalist und Schriftsteller. Er schreibt regelmäßig für den Guardian, wurde mehrfach ausgezeichnet und ist Autor von vier Romanen, von denen derzeit zwei verfilmt werden. Sein Roman Pravda wurde für den Man Booker Prize nominiert. Edward Docx lebt mit seiner Familie in London.
ÜBER DAS BUCH
Was auf den ersten Blick aussieht wie ein abenteuerlicher Roadtrip in einem alten VW-Bus, ist in Wahrheit die letzte gemeinsame Reise einer etwas aus den Fugen geratenen Familie: Lou fährt seinen unheilbar kranken Vater Larry in eine Zürcher Klinik, wo er Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Als Lous Halbbrüder auf dem Weg dazustoßen, kochen die Gefühle hoch: Sie lachen, sie streiten, sie betrinken sich und philosophieren über den Sinn des Lebens. Werden die Brüder den Vater von seinem Plan abbringen?
»Ein umwerfender Autor.«
Hanif Kureishi
»So menschlich, humorvoll und bewegend.«
The Guardian
»Wie Edward Docx mit diesem Thema umgeht, hat etwas Erlösendes.«
The Times
GLOSTER. Laß mich nun los!
Hier, Freund, ist noch ein Beutel, drin ein Kleinod,
Kostbar genug dem Armen. Feen und Götter
Gesegnen dir’s! Geh nun zurück, mein Freund:
Nimm Abschied; laß mich hören, daß du gehst!
EDGAR. Lebt wohl denn, guter Herr!
– Shakespeare, König Lear
4. Aufzug, 6. Szene: Gegend bei Dover
»Zuerst muss man aufräumen.«
– Iwan Turgenjew, Väter und Söhne
Oh God said to Abraham, »Kill me a son«
Abe says, »Man, you must be puttin’ me on«
God say, »No« Abe say, »What?«
God say, »You can do what you want Abe, but
The next time you see me comin’ you better run«
Well Abe says, »Where do you want this killin’ done?«
God says, »Out on Highway 61«
– Bob Dylan, Highway 61 Revisited
ERSTER TEIL
Porträt eines Vaters
Dover
Ich hätte mich niemals darauf einlassen sollen. Das ganze Ausmaß wird mir leider erst klar, als wir in Dover ankommen und zum Fährterminal abbiegen. An der Passkontrolle kurbele ich das Fenster herunter, ein kalter Windstoß bläst herein – Meeresluft, Diesel, Schiffsrost –, und die Möwen kreischen, als wäre gerade jemand umgebracht worden.
Ich reiche der Kontrolleurin unsere Pässe.
»Urlaub?«, fragt sie.
Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Ja.«
Sie wirft einen Blick auf Dad, und ich lehne mich zurück, damit sie an mir vorbeischauen und entscheiden kann, ob wir möglicherweise aus irgendeinem irrwitzigen Grund die Fähre in die Luft jagen wollen. Wir sitzen in einem heruntergekommenen Campingbus, weil wir kein richtiges Auto haben. Dad schläft auf dem Beifahrersitz, und das fühlt sich komplett falsch an, weil er sonst jeden Sommer in dieser Situation hinter dem Steuer saß, noch lange, nachdem meine älteren Brüder nicht mehr mitkommen wollten und nur noch ich und meine Eltern übrig waren.
Ich bekomme die Pässe zurück und stecke sie in das kleine Fach unter dem Lenkrad, als hätte ich hier das Sagen. Dann atme ich bewusst die Meeresluft ein, tue so, als würde mich das total überraschen, was es auch jedes Mal tut, und rolle auf das nächste Häuschen zu, wo einem ein Typ von der Fährgesellschaft so einen länglichen Zettel gibt, auf dem die Nummer der Schlange steht, in die man sich einreihen soll. Auf unserem steht »76«, fünf Jahre älter als Dad. Ich hänge ihn an den Rückspiegel und fahre zu den aufgereihten Autos, die es alle kaum erwarten können, auf das Schiff zu gelangen. Und plötzlich wallen die Emotionen in mir auf, und ich weiß nicht, wo ich hinschauen oder wie ich mich verhalten soll.
Zu diesem Zeitpunkt sprang Dad nämlich immer aus dem Auto, um Tee aufzusetzen, als wäre er einer dieser Formel-1-Mechaniker, bei denen jede Sekunde zählt. Und weil der Bus damals zu vollgestopft war, um unterwegs mal eben die Kochplatte auszupacken, und er wahrscheinlich Ralph und Jack nicht stören wollte, die gerne mal einen Aufstand anzettelten, hockte er sich stattdessen mit dem kleinen Campingkocher auf den Asphalt. Und ich hockte mich jedes Mal daneben und beobachtete, wie das blaue Flämmchen im Wind flackerte, die Hände auf die Knie meiner besten Sommerferienjeans gestützt, fünf Jahre alt, aber im Geiste ebenfalls bei Ferrari unter Vertrag. Meine Brüder lasen währenddessen im Bus, und meine Mutter ließ die Hand mit der Lucky-Strike-Zigarette aus dem Fenster hängen und hoffte inständig, dass wir nicht dran wären, bevor das Wasser kochte, da sie wusste, dass Dad sein »Tässchen Tee« brauchte, wie sie gerne mit übertriebenem britischen Akzent sagte.
Als Nächstes muss ich jetzt also überlegen, ob Dad und ich einen Tee trinken sollen, während wir in der Schlange warten, den ich selbst aufsetzen müsste, da seine Feinmotorik schon dabei ist, »kontinuierlich nachzulassen«, wie es in einem der achthundert PDFs heißt, die ich zum Thema »Was auf Sie zukommt« und »Wie Sie sich am besten vorbereiten« gelesen habe. Und das hier ist nur eine weitere unmögliche Entscheidung, die wir zu treffen haben.
Ein Mann in Warnweste winkt uns in »Spur 76« zu den anderen Kleinbussen und Geländewagen. Ich fahre vor, und die Handbremse knarzt wie eine alte Uhr, die man bis zum Anschlag aufzieht. Und da ich zu aufgewühlt bin, um mit Dad zu reden, öffne ich meine Tür und steige aus, alles in einer einzigen, schnellen Bewegung – als wäre ich derjenige, der dauernd Krämpfe in den Beinen bekommt.
Ich bereue jedoch sofort, den beschissenen Bus verlassen zu haben. Jetzt stehe ich nämlich auf dem Parkplatz vor den getönten Scheiben eines Geländekombis mit Kajaks auf dem Dach und Fahrrädern am Kofferraum, und der Familienvater steigt aus und sagt: »Alles klar, zwei Cappuccinos und einen Latte«, und er wirft mir über die Motorhaube einen Blick zu, als wäre er irgendein großer Anführer oder so, und als müsste ich wissen, was für ein toller Vater er sei und was für einen tollen Krieger er abgeben würde, wenn er denn müsste, was nicht der Fall ist. Und ich zittere und denke, vielleicht jage ich die Fähre ja doch noch in die Luft. Ich drehe mich um und schiebe die quietschende Seitentür des Busses auf, die mal wieder geölt werden müsste, aber wann bitte sollen wir das machen?
»Wir gehts dir, Dad?«, frage ich.
»Gut.« Er dreht sich lächelnd zu mir um. Er trägt scheußliche Klamotten, so wie immer – einen puddinggelben Fleecepullover, ausgewaschene beigefarbene Chinos, extraleichte Wanderstiefel, auf die er unerklärlich stolz ist. »Vielleicht geh ich noch eben eine Runde joggen«, fügt er hinzu.
Ich nicke langsam. Dieser Tage rudern wir zwischen Witzen und Sarkasmus hin und her, als hätten wir Angst vor dem Ufer.
»Hab ich schon hinter mir«, erwidere ich. »Du hast noch geschlafen.«
»Schon wieder einen Halbmarathon?«
»Jep. Und dann hab ich noch mit dem Kajak ein bisschen Strecke gemacht.«
Er gibt ein missbilligendes Geräusch von sich. Wir hassen solche Ausdrücke wie »Strecke machen«.
»Vielleicht schmeiß ich mich noch schnell in ein paar brutale Yogaposen«, sagt er.
»Die Atmosphäre da draußen ist jedenfalls schon mal ziemlich spirituell.«
Er mustert die aufgereihten SUVs und legt innerlich die Zukunft in Schutt und Asche, welche die Menschheit womöglich noch erwartet. Sein Kiefer krampft sich manchmal zusammen, und er gähnt oft.
Die Meeresluft hat sich mir um die Schultern gelegt und mich abgekühlt. Ich steige ein, und Dad fummelt an einem Hebel herum, um den Sitz nach hinten zu drehen. Ich fülle Wasser in den Kessel. Anscheinend ziehen wir das mit dem Tee echt durch. Ich klappe den grauen Plastiktisch auf, an dem wir schon so viele gesellige Mahlzeiten eingenommen haben. Dad hat den Bus 1989 gekauft, kurz vor meiner Geburt; ein altmodischer, kastenförmiger VW aus den Achtzigern in Blau-Metallic, den man selbst geschenkt nicht haben wollte. Aber er hat Charakter – zumindest finden wir das. Und das zählt. Oder sollte es zumindest.
Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie Dad mit dem Sitz kämpft. Wenn man es nicht mit den Beinen hat, kann man einfach die Füße gegen den Boden stemmen und sich umdrehen. Aber in Dads Beinen kribbelt es oft, er leidet unter »Funktionseinschränkung der unteren Extremitäten«. Gleichzeitig will ich ihm aber auch nicht alles abnehmen, und ich habe keine Ahnung, was angebracht wäre – hier, jetzt, wann auch immer. Also lasse ich ihn machen und widme mich dem Campingkocher.
Auf der einen Seite denke ich, wehe, wenn Ralph nicht kommt. Auf der anderen Seite sind wir ohne ihn vielleicht besser dran und bleiben lieber so lange wie möglich unter uns – nur ich und Dad –, da Ralph an einer Art metaphysischer Tollwut leidet. Und außerdem frage ich mich, wie Jack das alles sagen und tun kann, was er sagt und tut. Wie kann er sich jetzt noch weigern, mitzukommen? Wann erkennt er endlich, dass Dad es eben doch ernst meint? Jack ist schlimmer als Ralph, ein Ausbund an passiver Aggressivität. Ralph ist wenigstens einfach nur aggressiv.
Ralph und Jack sind Zwillinge und eigentlich nur meine Halbbrüder. Ralph ist der Dünne von beiden, Jack eher weniger. Sie nehmen Dad ganz anders wahr. Als wäre er für sie ein ganz anderer Mann. Meine Mutter meinte früher immer, sie wären von ihm »psychologisch beeinflusst« worden. Aber wer weiß – vielleicht liegt es auch an den Genen? Irgendwo hab ich mal gelesen, dass Gene sozusagen die Zutaten sind, und das Familienumfeld ist die Art, wie man sie zubereitet.
Ich werfe einen Blick zu Dad. Er kniet jetzt im Fußraum und stemmt sich mit der Schulter gegen den Sitz. Er hebt den Kopf, und wir sehen uns zum ersten Mal richtig in die Augen, seit er aufgewacht ist – oder zumindest so getan hat. Und dann stellt er mir rundheraus die gleiche Frage, die ich ihm gestellt habe: »Und wie gehts dir, Louis?«
»Ging schon mal besser.«
Er nickt. »Nur damit du’s weißt, Lou, und um deine Frage zu beantworten: Ich bin gerade echt glücklich.«
Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, also sage ich: »Vielleicht hättest du dich öfter mal im Fußraum von klapprigen Campingbussen rumtreiben sollen.«
Und dann lächelt er mich richtig an, so wie er es jetzt ständig macht, traurig-aber-glücklich, reuevoll-aber-froh, als wäre zwischen uns alles geklärt. Das hilft mir nicht gerade, und manchmal frage ich mich, ob das mit seinen Medikamenten zu tun hat. Aber das rechtfertigt noch lange nicht, dass er mich alle fünf Minuten so anlächelt. Und es ist auch nicht so, als wäre ich hiermit einverstanden. Zumindest nicht mehr. Nicht jetzt, wo wir es tatsächlich machen.
Ich stelle mich in die Kochnische und tue so, als hätte ich mit dem Tee alle Hände voll zu tun.
Er hat den Sitz umgedreht und scheint sehr zufrieden mit sich. Er zwängt sich durch die Lücke – seine Arme funktionieren noch einwandfrei – und plumpst mit einem theatralischen Seufzer auf das Polster.
»Wie lange haben wir noch?« Er deutet mit dem Kopf Richtung Meer.
Das ist so ziemlich die schlimmste Frage, die er hätte stellen können, aber das wird ihm erst hinterher klar.
»Ich meine, wie lange, bevor wir ablegen.«
»Wir haben noch jede Menge Zeit.«
Und das ist die schlimmste Antwort. Das Problem haben wir natürlich schon seit achtzehn Monaten. Die Hälfte von dem, was wir sagen, klingt zu bedeutungsvoll, und die andere Hälfte so hohl, dass ich mich frage, weshalb wir überhaupt Zeit damit verschwenden. Vielleicht fallen wir deswegen ständig auf Witze zurück. Vielleicht sind wir deswegen schon immer auf Witze zurückgefallen. Aber wir versuchen eben, im Moment zu leben, was auch immer das heißen mag. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wir müssen weiterreden. Wir sind eine Redefamilie. Das Reden – Sprache an sich – hat uns zum erfolgreichsten Hominiden aller Zeiten gemacht, würde Dad sagen. Sagt er auch. Oft.
»Du bist wohl mit Bleifuß gefahren, hm?«
»Eigentlich nicht«, antworte ich. »Die Straßen waren frei.«
»Zum Glück haben wir nicht den Maserati genommen.«
»Ja, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon da.«
Dad denkt kurz darüber nach, als würde er womöglich ein ernsteres Thema ansprechen wollen. Aber dann sagt er: »Slow Driving, das könnte der neueste Trend werden, oder?«
»So wie Slow Food und Slow Cities?«
»Genau.« Die Idee gefällt ihm, und seine Gesichtsmuskeln erwachen zum Leben. »Wir könnten so tun, als wäre Slow Driving die neuste Philosophie, und gut bezahlte Vorträge vor Leuten mit zu viel Freizeit halten. Ich sehe das Buch schon vor mir.« Er bildet mit Daumen und Zeigefingern einen imaginären Bilderrahmen. »›Das allzu Offensichtliche neu verpackt – für all diejenigen, die es die ersten drei Male verpasst haben.‹ Dann noch ein paar Zitate von den Griechen aus dem Internet, und voilà!«
Dad hat es mit den Griechen. Das Christentum nennt er immer »den großen Ideenklau«.
»Ich dachte, die Griechen hatten damals noch gar keine Autos.«
»Ich meine ja auch Zitate über das Leben. Dreh das einfach um.«
»Was soll ich umdrehen?«
»Na, dein Argument.«
»Ich hab doch gar kein Argument.«
»Hast du wohl. Du sagst, dass die Griechen intensiver über das Leben nachdenken konnten, eben weil sie so viel langsamer gefahren sind als wir.«
»Ich sage überhaupt nichts.«
»Die ganze Philosophie, das Theater, die Demokratie, die Bildhauerei, die Olympischen Spiele, das war nur möglich, weil die Griechen die ursprünglichen Slow Driver waren.« Er holt schulmeisterlich Luft, als würde er zu einer Ansprache vorm allwöchentlichen Treffen der Life Coaches in Notting Hill ansetzen. »Meine Damen und Herren, wir wissen doch alle, dass die Leute früher glücklicher waren. Die Frage lautet, weshalb?«
»Die Frage lautet in der Tat, weshalb.«
»Lassen Sie es mich erklären.«
»Moment, Sie müssen uns vorher noch das Honorar abknöpfen.«
»Zum Beispiel das alte Griechenland. Wir haben unser Glück verloren …« Er legt eine gespielt tiefgründige Pause ein. »Wir haben unsere emotionale Mitte verloren, als wir das Slow Driving aufgaben.«
Ich schüttele den Kopf. Dad und ich haben eine ganze Liste mit Wörtern und Ausdrücken, die wir nicht leiden können. Die »emotionale Mitte« spielt da ganz oben mit, zusammen mit »Strecke machen« und Wörtern wie »Legende«, »eklektisch« und »kuratiert«. Wir wissen selbst nicht genau, warum, aber es vereint uns auf geheimnisvolle Weise, dass wir bestimmte Vokabeln nicht ausstehen können; Taschenlampen, mit denen wir über den nebligen Sumpf leuchten, der zwischen uns liegt.
Dampf legt sich auf das Fenster, dessen schäbigen kleinen Vorhang Dad zurückgezogen hat, und wir fühlen uns wieder gut.
»Hast du die Croissants dabei?«, fragt er.
Croissants, pikante Nierchen und Austern: die drei Leibspeisen meines Dads.
»Klar. Sechs Stück.«
»Worauf wartest du dann noch?«
Ich hole die Croissants und die Milch aus der blauen Kühlbox, die immer mit uns reist, und dann ziehe ich die zwei Metalltassen hervor – im Übrigen ein echter Überraschungserfolg –, die ich mal in New York gekauft hatte, als wir dort über Weihnachten meine amerikanisch-russischen Großeltern besuchten. Dann schenke ich den Tee so ein, wie ich es tausendmal bei Dad beobachtet habe – den Kessel hoch oben in der Luft, damit das Wasser auf dem Weg nach draußen mit Druck über die Teeblätter rauscht, als könnten wir so die Tatsache kompensieren, dass wir ihn jedes Mal zu früh ausschenken. Und jetzt lassen wir uns Tee und Croissants schmecken, hören die Wellen an einen nahegelegenen Kiesstrand schlagen und sehen zu, wie das apricotfarbene Morgenlicht durch die Frontscheibe hereinströmt und die gesammelten Spuren der unzähligen Kilometer aufleuchten lässt, die wir schon gemeinsam zurückgelegt haben.
Wir haben gerade mal drei Schlucke des viel zu heißen Darjeeling getrunken, da beschließen sämtliche Geländewagenfahrer ringsum, ihre beschissenen geländetüchtigen Motoren anzulassen, als könnte die Fähre jeden Moment ohne sie ablegen und auf Nimmerwiedersehen mitsamt Frankreich verschwinden. Ich schüttele den Kopf – nach dem Motto, jedes Mal das Gleiche –, und wir amüsieren uns beide köstlich.
Jetzt müssen wir also den Tee runterstürzen und verbrennen uns dabei die Kehle, damit wir uns eine stärkere Portion nachschenken können, denn die zweite Tasse ist erst so richtig das Wahre. Und wir stopfen uns die Croissants in den Mund wie meine dreijährigen Neffen. Und in der Schlange nebenan geht es bereits voran.
»Dann machen wir uns wohl besser mal auf die Socken«, sagt er.
Das ist einer seiner Lieblingsausdrücke.
Und kurz fühlt es sich so an, als würden wir tatsächlich in den Urlaub fahren.
Mein Vater wurde in Yorkshire geboren, in den letzten Stunden von Churchills Kriegsregierung; seine erste Milch trank er unter Clement Attlee. Das erzählt er zumindest gerne. Und manchmal, trotz der Jahrzehnte in London, kann man noch ein anderes England in seiner Stimme hören – die alten Balken, die unter den Wiederaufbauten, Anbauten und Fassaden knarzen.
Er war ein Einzelkind. Sein Vater kam aus Yorkshire und besaß dort einen renommierten Steinmetzbetrieb. Er war für seine Inschriften bekannt, verdiente sein Geld aber hauptsächlich mit der Beaufsichtigung des Wiederaufbaus Tausender Kilometer Trockenmauer. Meine Großmutter war eine Damenschneiderin aus Lancaster. Sie arbeitete ebenfalls ihr ganzes Leben lang und unterhielt einen lukrativen Nebenjob, indem sie Vorhänge nähte. Die beiden waren finanziell viel besser dran, als sie je zugegeben hätten, besonders am Ende. Aber nachdem mein Dad seine erste Frau für meine Mutter verlassen hatte, brachen sie jeglichen Kontakt zu ihm ab.
Meine Großmutter verstarb entsprechend zerstritten mit ihrem Sohn. Keine Zeit, um noch etwas zu ändern oder zu verstehen. Manchmal denke ich darüber nach. Sie verbrachten ihr ganzes Leben miteinander, unzählige Stunden zog sie ihn auf, und dann plötzlich ein Streit; dann Schweigen, kein einziges Wort mehr, nie wieder. Ich glaube, mein Großvater unternahm irgendwann mal einen Versöhnungsversuch, aber er hatte Alzheimer, und sein Ende war unschön und zermürbend.
Ich habe die Eltern meines Vaters nie kennengelernt. Ralph und Jack dagegen erinnern sich noch ziemlich gut an sie. Sie spielten oft auf dem Hof voller Steine neben dem alten Haus am Stadtrand von Halifax. Ralph beschreibt sie als übertrieben hochmütig, kleingeistig und insgeheim grausam – nachtragende, verängstigte Leute, denen es eigentlich elend ging. Jack hält sie für anständige, entschlossene, hart arbeitende, gewissenhafte, gesetzestreue Bürger, die ihren Weg im Leben gefunden hatten und keine Rücksicht auf diejenigen nehmen konnten, denen es anders ging. Ich kann das nicht entscheiden – ich habe Fotos der beiden aus den 1950er-Jahren gesehen, und ihre Welt ist unvorstellbar weit von meiner entfernt. Wie sie da stehen – offensichtlich nicht vertraut mit der Kamera und unfähig zu einem Lächeln, da (das scheinen sie einem sagen zu wollen) man sich ein Lächeln erst verdienen muss. Als Dad mir als kleinem Jungen Sachen beibrachte – die Planeten, die Länder der Welt, europäische Geschichte –, stellte er es immer so dar, als wäre er der letzte Überlebende der Rosenkriege. Aber jetzt meint er, dass selbst dieser letzte Nachhall langsam verstummt und Großbritannien eine Geschichte ist, von der niemand mehr weiß, wie man sie schreiben soll.
Bevor er meine Mutter kennenlernte, waren meine Großeltern von einem tiefsitzenden Stolz auf ihn erfüllt, der jedoch unausgesprochen blieb. Dad ging auf eine katholische Knabenschule und schaffte es irgendwie, den pädophilen Priestern zu entgehen. Er arbeitete hart, war hochintelligent und schnitt in sämtlichen Prüfungen hervorragend ab. Er kam ganz nach oben. Und noch weiter. Bis er schließlich Dekan der Fakultät für englische Literatur am University College in London wurde. (Daher auch die entsprechenden Neigungen seiner drei Söhne.) Er hält die englische Sprache immer noch für unser größtes Geschenk an die Menschheit. Nicht die moderne Demokratie, die Eisenbahn, das Internet, Newton, Keynes, Darwin, staatliche Gesundheitsfürsorge oder was auch immer manche Leute glauben, was England ist, war, gemacht oder erfunden hat, sondern die Sprache selbst, ihre Reichweite, ihren Facettenreichtum, ihre Poesie. Er ging sogar noch weiter und behauptete, Literatur stelle uns durch Sprache das Rohmaterial zur Verfügung, das wir zum Denken bräuchten – im Gegensatz zu den nichtsprachlichen Künsten. Auf zahllosen Autobahnfahrten erinnerte er mich daran, dass Sprache »das definierende, erlösende und herausragende Charakteristikum der Menschheit« sei. Und, da nahm er kein Blatt vor den Mund, die englische Sprache sei die großartigste von allen.
Ich habe keine Ahnung, wie viele andere Sprachen er beherrscht – ein bisschen gebrochenes Deutsch, Französisch etwas besser –, aber sein Glaube war unerschütterlich. Wir gurkten durchs ganze Land, damit er Vorträge über die »Natur des Betrugs« bei Shakespeare oder die »Natur der Beständigkeit« bei John Donne halten konnte. Oder er schleppte mich mit zu diesen Literaturfestivals, die immer in Zelten auf einer matschigen Wiese stattfanden und wo er in der Jury irgendeines Lyrikpreises saß. Ich habe es zwar nie ausprobiert, aber wenn ich zu ihm sagen würde: »Dad, das interessiert doch keine Sau«, würde er garantiert zurückgeben: »Mich schon.«
Unser Haus ist praktisch eine Privatbibliothek. In ein paar Jahren bekommt man so was sicher überhaupt nicht mehr zu Gesicht. Bücher, meine ich. Regale. Buchrücken. Dad hat selbst mehrere Bücher verfasst, darunter eins über Literaturtheorie, das ihn auf der Karriereleiter nach oben katapultierte. Nicht, dass heutzutage noch jemand so was lesen würde, Studenten vielleicht mal ausgenommen. Wobei, meine Kommilitonen haben sich damals auch nicht die Mühe gemacht. Womöglich bin ich der Einzige, der Dads »Hauptwerk« in den letzten zehn Jahren gelesen hat, und so richtig packend fand ich es nicht; ich nahm einfach nur die Wörter auf wie ein Wal, der das ganze Meer schluckt und dann wieder ausspuckt, in der Hoffnung, dass etwas Nahrhaftes in den Barten hängen bleibt. Von Mum mal abgesehen, das sollte ich vielleicht dazusagen. Sie las es vor ihrem Tod noch einmal und unterstrich dabei bestimmte Sätze. Da wären wir also zu zweit. Keine Ahnung, ob Ralph oder Jack es je gelesen haben – gute Frage eigentlich. Das einzige Buch von Dad, das mir richtig gefallen hat, war das über Shakespeares Sonette. Ich kann es jederzeit aufnehmen, beiseitelegen und wieder weiterlesen, ohne dass es mich verwirrt oder ich mich zum Konzentrieren in ein Kloster zurückziehen müsste. Andererseits leide ich wie jeder andere heutzutage unter akuter Hirnflechte und kann mich nicht länger als zwanzig Sekunden auf irgendetwas konzentrieren.
Es gibt übrigens kein Thema auf der Welt, für das Dad sich nicht interessiert. Vom Higgs-Boson über vergessene U-Bahn-Stationen bis hin zu J. S. Bach, J. M. W. Turner und dem Schicksal der Neandertaler – er hat davon gelesen, darüber nachgedacht und eine Meinung dazu. Mum meinte einmal, sie habe seine Neugier geheiratet. Und da war etwas dran. Seine Neugier färbt ab. An seiner Seite kommt einem alles interessant vor, weil er sich echt für alles begeistern kann – bis auf Golf, Realityshows und religiöse Menschen. Mum sagte oft, er sei der lebende Beweis dafür, wie weit man es mit angelesenem Wissen und einer Portion Eigenständigkeit bringen könne. (Sie nannte ihn immer Laurence.) Und auch das stimmt: Neben oder unter seiner Selbstgefälligkeit und Eitelkeit trägt Dad etwas Starkes und Ehrliches in sich – etwas, das man weder kaufen noch verkaufen noch verleumden kann. Und ich glaube, dafür hat er öfter mal gebüßt. Zum Beispiel schaffte er es nie zum Professor. Aber das Seltsamste an dieser Eigenschaft, was auch immer sie sein mag: Es scheint ihm fast unmöglich, sie in seiner eigenen Familie anzuwenden. Ja, er besitzt eine entwaffnende Offenheit und Direktheit, nur eben nicht seinen Kindern gegenüber, oder den zwei Frauen, die er liebte.
Und vor allem ist es superschwer, ihm zu widersprechen. Er besitzt eine moralische Intensität, die einem nicht nur das Gefühl gibt, falschzuliegen, sondern auch noch ein schlechter Mensch zu sein. Damit will ich nicht sagen, dass er nicht gerne diskutiert. Auf der anderen Seite ist er nämlich mit einem Eifer bei der Sache, den man nicht jeden Tag erlebt. Er will Gespräche führen – ständig, mit Gott und der Welt, über Gott und die Welt. Vielleicht ist das auch seine Haupteigenschaft: Er will um jeden Preis ein Gespräch führen.
Was seltsam ist: Mein Vater liebte meine Mutter über alles. War verrückt nach ihr. Das scheint ja nicht in allen Ehen der Fall zu sein. Heute spricht er nicht mehr darüber, weil das damals die schwierigen Jahre mit Ralph und Jack waren, aber einmal, als Mum im Sterben lag, nutzte ich die Gelegenheit und fragte ihn, wie sie sich kennengelernt hatten. Er antwortete, er sei wegen irgendeiner völlig sinnlosen Konferenz in New York gewesen und eines Abends auf eigene Faust losgezogen, »um sich neue Literatur anzuhören« und »diesen ganzen Windbeuteln zu entfliehen, die sich über Jane Austen und den verflixten Postmodernismus ereiferten«. Er sagte, sie habe eine Lyriklesung gehalten, und da habe er es einfach gewusst, genauso plötzlich wie unbestreitbar. Das sagte er wirklich so.
Wir einigten uns vor einer ganzen Weile auf die Fahrt, an einem Samstagmittag im ausklingenden Frühling, in einem Café namens Clowns an einem vergessenen Ort in Süd-London, in der Nähe des Flusses. Wir waren früh dran, und bis auf einen beschürzten Alten hinter der Theke, der den Sportteil auf Italienisch las und dessen Miene darauf schließen ließ, dass ihm im Leben bisher noch nichts begegnet war, was seiner vorgefertigten Meinung über die Welt widersprochen hätte, war der Laden leer. Die Wände waren mit riesigen Fotos und Zeichnungen von Clownsgesichtern gepflastert – unheimlich, albern, grell. Bei der Kasse hingen Clownspostkarten. Ein Clownsspiegel, der einem sein wahres Selbst zeigt. Clownstassen. Darauf war ich nicht gefasst gewesen. Ich weiß noch, wie wir uns unter totenbleichen, von schwarzen Herzen umrahmten Augen an einen Tisch im hinteren Teil setzten und die blutroten Münder uns schweigend auslachten.
Zehn Minuten später kämpfte ich mit einer merkwürdigen Pastete und einem Karottensalat, während Dad sich selbstvergessen seinen Weg durch eine Ziegenkäsequiche bahnte. Er isst immer nur mit einer Hand und schneidet mit der Seite seiner Gabel, wenn er sie nicht gerade durch die Luft schwenkt, um eines seiner zahllosen Argumente zu unterstreichen.
»Wie oft bin ich schon geflogen, Lou?«
»Keine Ahnung, Dad. Fünfhundert Mal?«
»Kein einziges Mal mehr als absolut nötig. Ich hasse Fliegen.«
»Ich weiß. Ich war öfters mal dabei. Du hast da keine Zweifel aufkommen lassen.«
»Es liegt ja nicht am Fliegen selbst.«
Mir ist aufgefallen, dass so eine Einleitung meistens das Gegenteil bedeutet und es durchaus an der fraglichen Sache liegt. Ich mühte mich weiter mit meinem Essen ab und dachte über den Unterschied zwischen Reiben und Raspeln nach.
»Ich kann diese Sicherheitsleute einfach nicht ausstehen.«
»Das ist doch nur am JFK so schlimm, und da kann man das ja wohl nachvollziehen.«
»Die erinnern mich an die Nazis.«
»Wie viele Nazis kennst du denn persönlich?«
Dad quetschte sich ein Stück von seiner Quiche ab. Seltsamerweise fängt er mit seiner freien Hand überhaupt nichts an. Er hält sich einfach leicht an der Tischkante fest, als könnte jeden Moment ein Erdbeben ausbrechen oder so.
»Das hat man davon, wenn man strohdumme Leute in Uniform steckt – Rache. Die Rache der aufgeblasenen Strohdummen.«
»Der aufgeblasenen Strohdummen?«
»Ganz genau. Als ob wir nicht wüssten, dass die Dummheit dieser Leute in der Schule vielleicht noch peinlich war und sie deswegen jede Klausur versemmelt haben, die die Regierung sich hat einfallen lassen, um die Wahrheit zu verschleiern, nämlich dass Dummheit sehr wohl auch Privilegien mit sich bringt, Vorteile, Nutzen auf lange Sicht, und wir wissen ja, wer zuletzt lacht.«
»Die Nazis.«
»Jetzt tu doch nicht so, als würdest du diese Sicherheitsleute mögen, Lou. Ich schwörs dir: Die halten sich für Mitglieder einer strohdummen Herrenrasse und bemerken nicht mal das Paradoxe daran.«
»Sind wir jetzt die Juden?«
»Die glauben echt, sie würden ihr Vaterland jedes Mal vor einer Katastrophe retten, wenn sie einem verbieten, Flüssigkeiten mit an Bord zu nehmen.«
»Flüssigkeiten sind nun mal nicht erlaubt.«
Er zeigte mit der Gabel auf mich. »Eins kann ich dir sagen, Lou. Die Terroristen haben gewonnen. Das denke ich mir jedes Mal am Flughafen. Stell dir nur mal die Milliarden Stunden vor, die sie uns gestohlen haben. Milliarden Stunden unseres Lebens, die wir jetzt damit verbringen dürfen, uns vor übergewichtigen Sicherheitsmonstern auszuziehen und unser Gepäck durchwühlen zu lassen.«
»Ich schätze, Fliegen kommt also nicht infrage.«
Er aß ein Stück Quiche. Jetzt kamen wir der Sache schon näher.
»Ich werde fahren. Ich will fahren.«
»Dad, du kannst überhaupt nicht mehr selbst fahren.«
»Deswegen fährt mich auch Doug.«
»Dad.«
»Er hat sich schon bereit erklärt.«
»Aber Doug …«
»Was hast du denn gegen ihn?«
»Du kennst ihn halt erst seit fünf Jahren oder so.«
»Behalt dein ›halt‹ für dich.«
»Doug ist Automechaniker.«
»Und das reicht dir als Gegenargument?«
»Natürlich nicht, ich meine bloß, Doug ist nur irgendein Typ, den du bei einer römischen Ausgrabung oder was auch immer kennengelernt hast.«
»Altpaläolithische Ausgrabung, Lou, das war lange vor den Römern.«
»Von mir aus. Nur weil er in der Nähe wohnt und dir mit dem Haus hilft, heißt das jedenfalls noch lange nicht …«
»Doug besucht mich oft. Wir waren schon bei drei, vier Ausgrabungen zusammen.«
»Weil er dich in der Vergangenheit mal zu ein paar frühmenschlichen Überresten gekarrt hat, soll er dich jetzt zur Dignitas bringen?«
»Es geht doch nur darum, dass ich mich an ihn als Fahrer gewöhnt habe. Er kennt mich gut.«
»Dad, jetzt versteh mich doch nicht absichtlich falsch.«
»Tut mir leid. Ich verstehe wirklich nicht, was du meinst. Es war jedenfalls keine Absicht.«
»Dann eben unbewusst.«
»Unbewusstes kann man nicht mit Absicht machen.«
»Du machst es schon wieder.«
Ich atmete einmal tief durch.
»Ich will damit nicht sagen, dass Doug ein schlechter Mensch ist. Aber ich kann nicht zulassen, dass er dich fährt.« Ich zwang mich, meinem Vater ins Gesicht zu schauen. »Ich muss das machen.«
Er zögerte. »Das kann ich nicht von dir verlangen.«
»Ich weiß. Und ich will es ja auch nicht machen, weil du es von mir verlangst. Ich fahr dich dahin, weil ich das möchte.«
»Das kann ich dir nicht zumuten, Lou.«
»Du mutest mir gar nichts zu, sondern die Situation. Die Krankheit. Aber tu wenigstens nicht so, als wäre Doug als Fahrer eine gute Idee.«
»Ich tu doch gar nicht so! Ich kann bloß nicht …«
»Dad. Denk doch mal nach. Was soll ich denn machen? Dir zum Abschied zuwinken und mich dann in dem leeren Haus mit einem Bier vor den Fernseher setzen? In dem Haus, wo ich mein ganzes Leben lang mit dir und Mum gewohnt habe?«
Der Hieb saß.
»Jack wird sich in London verabschieden«, sagte Dad. »Das wünscht er sich so.«
»Ach, hör doch auf. Jack wünscht sich überhaupt nichts. Er ist komplett dagegen. Und das weißt du auch ganz genau, verdammt noch mal.«
Dad schwieg.
»Jetzt lass uns mal bei den Tatsachen bleiben«, fuhr ich fort. »Jack will nicht mitkommen, weil er dich nicht noch ermutigen will. Und außerdem glaubt er nicht, dass du es ernst meinst.«
»Ich meins aber ernst.«
»Mir ist das auch klar. Aber Jack … egal. Lass uns wenigstens nicht so tun, als würde er sich in London ›verabschieden‹ wollen. Scheiße, was für ein blödes Wort.«
»Ich dachte eben, wir könnten uns in Zürich treffen. Du könntest dich wegen der Flüge mit Ralph absprechen.«
»Mit Ralph?«
»Na, damit ihr zur gleichen Zeit …«
»Ralph ist der Letzte, auf den ich mich verlassen würde. Wir können uns ja nicht mal …«
»Dann trefft ihr euch eben im Hotel.«
»Dad, verdammt noch mal!«
»Lou.«
»Sorry, tut mir leid, aber die Flugzeiten und der Treffpunkt sind hier wirklich nicht das Problem. Das wird der schlimmste Tag meines Lebens.«
»Nein, wird es nicht. Nein.« Seine Augen schimmerten feucht. Er ist immer dann am verletzlichsten, wenn ich ihn dazu zwinge, sich in mich hineinzuversetzen. Seine ganze Selbstsicherheit und sein Lebenswille – sein Sterbewille – scheinen ihn dann zu verlassen, und die Schmerzen seiner Krankheit stehen ihm ins Gesicht geschrieben. Deshalb tue ich ihm das meistens nicht an. Aber unser Mitgefühl füreinander kehrt verrückterweise alles ins Gegenteil: Wenn ich mich in ihn hineinversetze, will ich ihm um jeden Preis einen selbstbestimmten Tod ermöglichen, und wenn er sich in mich hineinversetzt, will er weiterleben.
»Lou, das haben wir doch schon besprochen.«
»Haben wir. Immer und immer wieder. Wir haben uns in eine Sackgasse manövriert.«
»Nein, wir haben zu einer Entscheidung gefunden.«
»Dad.«
»Und wir können es uns jederzeit anders überlegen. Jederzeit. Bis ich in diesem Zimmer liege. Ich will nichts tun, womit du nicht einverstanden bist, kein bisschen. Falls du es dir …«
»Dad, ich will das jetzt nicht alles noch mal durchkauen. Nicht hier.« Ich konnte ihn plötzlich nicht mehr ansehen, und so blieb mir nur noch der clownsgeschmückte Raum. »Ich meine bloß, dass Fliegen nicht infrage kommt. Doug kann dich auch nicht fahren. Am Ende wird er noch wegen Mordes angeklagt.« Ich biss mir auf die Lippe. »Wir bereiten das alles zusammen vor, darauf hatten wir uns doch geeinigt, oder? Dass wir es planen. Dass wir so bereit sind wie möglich. Dass wir die Kontrolle darüber haben.« Ich kämpfte mit meiner Stimme, die in ein Quietschen abzurutschen drohte. »Ich meine doch bloß, dass dich nun mal irgendwer fahren muss, und …«
»Doug.«
»… und da Mum nun mal tot ist und Ralph und Jack es garantiert nicht machen, bleibe nur noch ich übrig.« Ich rang mir ein Lächeln ab. »Ich will dich fahren. Doug hat damit nichts zu tun. Ich mach das schon.«
Jetzt konnte er die Tränen nicht mehr wegblinzeln. »Das kann ich nicht von dir verlangen.«
»Ich weiß. Und das tust du auch nicht. Ich mache das aus freien Stücken.«
Zwei Nebenwirkungen laut der PDFs sind »tränende Augen« und »emotionale Labilität«. Ersteres liegt an einer »Erschlaffung der Gesichtsmuskulatur, wodurch reguläre Tränenflüssigkeit austritt«. Und mit Letzterem meinen sie, dass »emotionale Reaktionen zu unfreiwilligem Lachen oder Weinen führen«, doch man dürfe »nicht vergessen, dass diese Verhaltensänderungen medizinischen Ursprungs sind«.
»Dann muss Jack aber auch mitkommen«, sagte Dad leise.
»Ja, Dad. Jack muss mitkommen.«
Aber Jack hat schon erklärt, dass er nicht mitkommen will. Denn Jack wollte aus Prinzip und definitiv nicht wahrhaben, was mein Vater aus Prinzip und definitiv beschlossen hatte. Und er glaubte nicht, dass mein Vater es wirklich ernst meinte. Und auf seine Weise ging es Ralph genauso. Meine Brüder vermuteten, dass er die Situation manipulierte – sie beide manipulierte. Ich erklärte ihnen natürlich, dass es ihm so ernst sei, wie seine Krankheit ernst sei, und ernster gehe es wohl nicht mehr. Aber jedes Mal kamen sie mir mit der gleichen Antwort: Schon, aber meinst du, er zieht das durch? Meinst du echt?
»Natürlich muss Jack mitkommen«, sage ich. »Ich rede noch mal mit ihm.«
Alles hinterlässt Spuren
Ich stehe auf der Fähre in irgendeiner Schlange an, keine Ahnung, wofür, und sehe quer durch die Lounge rüber zu Dad. Der sitzt auf einem unbequemen Stuhl am Fenster und liest. Wir sind zusammen durch ganz Europa gereist, und ja, vielleicht hat er nur deshalb eine »besondere Beziehung« zu mir (Moms Formulierung), weil er sich mit Ralph und Jack überhaupt nicht versteht, aber trotzdem … Trotzdem, als ich jetzt zu ihm rübersehe, wie er da sitzt und liest, er liest einfach immer und überall, da geht mein Herz auf, das sonst immer zur Faust geballt ist, und streckt die Finger nach ihm aus wie auf diesem Michelangelo, den er mir mal im Vatikan gezeigt hat, als ich noch viel zu jung war, um mich dafür zu interessieren oder ihn wertzuschätzen, und einfach nur ein Eis wollte. Ich hätte gern, dass er sich zu mir umdreht und wir uns ansehen, keine Ahnung, warum. Ich will diesen Gesichtsausdruck von ihm sehen, den er früher immer hatte, als ich noch klein war und wir zusammen vor dem Fernseher saßen, wo irgendein Politiker absolute Scheiße von sich gab. Dann warf er mir immer diesen Blick zu, so ein »Hast du eine Ahnung, warum der so einen Schwachsinn erzählt, Lou?«
»Die Schlange ist zu lang«, sage ich.
Dad sieht auf. Er war so sehr in seine Lektüre vertieft, er hat gar nicht mitbekommen, dass ich schon wieder zurück bin.
»Das deprimiert mich zu sehr.«
Er seufzt, als hätte er schon seit Langem vermutet, dass ich meine ganz eigene Dunkelheit mit mir herumtrage, und klappt sein Buch zu.
»Willst du noch hierbleiben?«, frage ich.
Konsumgestöber braut sich rings um uns zusammen. Er setzt zu einer Antwort an – warum nicht? – merkt aber offenbar, dass es mir nicht gut geht, und sagt stattdessen: »Nein, lass uns mal lieber an Deck gehen, ein bisschen frische Luft schnappen.«
»Ich glaub, wir müssen da vorn lang, am Duty-free-Shop vorbei.«
»Okay. Wir haben ja keine Eile.« Er stemmt sich mühsam hoch. »Ich dachte, Duty free gäbs gar nicht mehr.«
»Gibts ja auch nicht, die nennen das nur immer noch so, damit die Leute weiter da einkaufen.«
Jetzt steht er, seinen Stock in der Hand, fertig zum Abmarsch. »Aber man muss ganz normal Steuern auf die Sachen zahlen?«
»Jep.«
»Klasse. Na, dann wollen wir uns mal mit Parfüm eindecken.«
Ich habe mich darauf gefreut und gleichzeitig davor gefürchtet. Wir gehen immer an Deck; das ist eins von unseren Sommerferienritualen, vielleicht so eine Art Parodie auf uns als Seemänner, die nur wir lustig finden. Vielleicht hat es auch wirklich was mit frischer Luft zu tun, oder damit, die Entfernung, den Unterschied zwischen Urlaub und Alltag körperlich wahrzunehmen. Dort verschwindet die vertraute Küste. Hier kommt das Unbekannte. Aber jetzt mache ich mir Sorgen, ob das für Dad mit dem Gehen klappt, weil das Schiff angefangen hat, ein wenig zu schwanken.
Und wie aufs Stichwort merke ich auf Höhe des Duty-free-Shops, dass er total angespannt ist. Er zeigt es nur nicht. Er zieht den linken Fuß ein wenig nach, aber das war auch schon mal schlimmer. Vielleicht reißt er sich allerdings auch nur mit aller Kraft zusammen. An der Plastikwand verläuft ein Geländer, und er hält sich daran fest. Er lächelt sogar, aber ich sehe genau, wie es ihn tief drinnen unglaublich schmerzt, nicht nur die körperliche Anstrengung, sondern auch die Tatsache, dass das Gehen mittlerweile überhaupt eine Anstrengung bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich zu ihm hingehen oder lieber Abstand halten soll.
Eine Durchsage, viel zu laut: »Unser Bordshop ist nun geöffnet. Markenartikel – unschlagbar günstig! Zum Beispiel Kokorico, der neue markant-männliche Duft von Jean Paul Gaultier.« Und jetzt wird mir richtig schlecht, weil ich meine Reisetabletten vergessen habe, und weil ein paar Kinder stehen geblieben sind und Dad anstarren, wie es Kinder nun mal tun. Er geht einfach weiter. Und da wird mir plötzlich klar, dass er das gerade für mich tut. Ich wollte unbedingt an Deck, aber er war in dem Moment eigentlich nicht in der Lage dazu. Genau solche Situationen wollte er eben nicht durchmachen müssen in den nächsten neun Monaten oder wie viel Zeit ihm nun genau bleibt, bevor seine Atemmuskulatur so schwach geworden ist, dass sein Körper nicht mehr ohne fremde Hilfe atmen kann. Das, was ich von ihm brauche, ist genau das, was ihn am meisten demütigt. Und mehr noch, wird mir klar: Er will nicht, dass ich seinen Verfall mitbekomme. Gerade ich nicht. Wäre es jemand anderes, der ihm dabei zusieht, Doug zum Beispiel, dann würde er das vielleicht nicht mitmachen.
Meine Kiefermuskeln sind angespannt. Ich fahre mir mit der Zunge über die Zähne. Ich hoffe, dass die Kinder nicht auch noch anfangen, Dads Gang nachzumachen. Ich weiß nicht, ob ich ihn seinen Mann stehen lassen oder ihn stützen soll. Also rühre ich mich einfach nicht vom Fleck, und das Herz schlägt mir bis zum Hals, als ob es mich ersticken will. Und da steigt wieder diese Welle an Gefühlen in mir auf. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, es ist jedenfalls deutlich spürbar wie Gift oder das Gegenteil von Verliebtheit und breitet sich in mir aus, bis jede meiner Zellen damit gefüllt ist; aber ich kann mich nicht übergeben, ich kann es nicht loswerden, ich muss es aushalten, angespannt, voll bis an den Rand, ein Gefühl, als würde ich ertrinken, aber von innen.
Die Kinder laufen weg. Ich entspanne willentlich meine Kiefermuskeln und zwinge mich, zu Dad zu schauen. Unglaublich, wie schwer es mir mittlerweile fällt, ihn anzusehen. Er wird demnächst einen Rollstuhl brauchen. In der Klinik für Motoneuronerkrankungen in Oxford wurden uns die vier Stufen genannt: Krankheitsbeginn, Krücken, Rollstuhl, Bett. Es gibt natürlich noch eine fünfte Stufe, aber die haben sie nicht erwähnt.
Wir gehen an einer Gruppe belgischer Trucker vorbei, die im Halbkreis um einen Spielautomaten herumstehen und ihn mit Münzen füttern, als wäre es immer noch 1983. In diesem Moment würde ich ihnen allen am liebsten einen Kuss mitten auf die dicken, weißen Gesichter drücken, einfach dafür, dass sie überhaupt keine Sorgen zu haben scheinen. Ja, denke ich, alles wird gut. Wir haben ja keine Eile. Irgendwann kommen wir schon noch auf Deck an, denn wenn Dad sich was vornimmt, dann bringt er es auch zu Ende. Ich nehme meine Jacke von einer Hand in die andere und bin froh, dass ich auch an Dads Windjacke gedacht habe. An Deck ist es nämlich immer viel kälter, als man denkt.
Wir sind gleich da, haben fast die Lounge durchquert und sehen schon die weiße Tür, die nach draußen führt, als uns eine besonders hohe Welle trifft und ein Ruck durch die Fähre geht. Dad hält sich kurz an einer Stuhllehne fest, kommt dabei anscheinend an den Kopf des Mannes, der dort sitzt, und der zuckt daraufhin zusammen und verschüttet einen winzigen Schluck Kaffee.
»Verdammte Scheiße!« Der Typ dreht sich um, voller selbstgerechter Empörung, als hätten wir gerade einen Luftangriff auf seinen E-Reader gestartet. »Was sollte das denn jetzt, bitte schön?«
»Tut mir furchtbar leid.«
»Kann ja wohl nicht wahr sein!«
Auf dem Bildschirm ist eine kleine Schliere zu sehen, aber der Typ veranstaltet ein Riesengewese, wischt hektisch mit ein paar Servietten daran herum und dreht sich dann wieder zu Dad um. Ich spüre, wie mir die Schamesröte ins Gesicht steigt.
»Und was sollte das nun?« Der Typ ist etwa fünfundfünfzig und trägt eine teure Brille, bei der der Markenname auf dem Gestell steht, als ob das irgendwen interessieren würde. Ihm gegenüber sitzt seine übertrieben jugendlich gekleidete Frau und runzelt missbilligend die Stirn. Sie wirft Dad einen Blick zu, der Mitempörung ausdrücken soll, aber noch etwas anderes zeigt, eine Art Schadenfreude darüber, dass dem Mann, mit dem sie ihr Leben verschwendet, wieder mal etwas Unangenehmes passiert ist.
»Es tut mir wirklich leid«, erwidert Dad ruhig. »Das war keine Absicht. Ich bin eben Leichtmatrose.« Er schaut auf den Bildschirm. »Ist mit dem Gerät alles in Ordnung?« Ich weiß, dass er gleichzeitig zu erkennen versucht, was der Typ liest.
»Keine Ahnung, schwer zu sagen. Der Bildschirm ist jedenfalls irgendwie beschlagen …«
»Tut mir leid«, wiederholt mein Vater. »Falls es kaputt ist, kaufe ich Ihnen natürlich ein neues.« Er lächelt den Typen traurig-aufmunternd an.
Aber der guckt, als ob er außer Genervtheit schon lange keine anderen Gefühle mehr wahrnimmt und als wäre ausgerechnet Dad schuld daran. Einen Moment lang steht die Zeit still, wir bewegen uns alle sanft mit dem Schiff auf und ab, sind seekrank und todunglücklich, unter uns der leere schwarze Ozean der Ewigkeit, nur weil dieser Typ nicht mitbekommen hat, dass Dad nicht richtig laufen kann, und seinen Gehstock nicht sieht. Und klar, wenn er sich nicht bewegt, wirkt er ja auch ganz normal, also warum steht er jetzt bitte einfach da, hält sich an der Stuhllehne fest und lächelt müde, anstatt anzubieten, noch ein paar Servietten oder einen neuen Kaffee zu holen? Vor allem, warum lässt er nicht endlich die Stuhllehne los?
Ich merke, dass Dad Angst hat. Nicht vor dem Mann, sondern davor, weiterzugehen, weil das Schiff mittlerweile ziemlich stark von einer Seite zur anderen schwankt, wie diese münzbetriebenen Schaukeltiere vor Supermärkten, die meine Neffen so mögen.
Die Frau sieht Dad an. Sie steht ihrem Mann bereitwillig zur Seite, um ein bisschen Feindseligkeit an einem Dritten auszulassen. »Und, funktioniert er noch?«
Und plötzlich bin ich wieder da.
»Na komm, Dad«, sage ich. »Ich will Ralph noch anrufen und Bescheid sagen, dass wir losgefahren sind, bevor wir keinen Empfang mehr haben.«
»Ja, scheint zu funktionieren«, sagt der Mann.
»Hier ist mein Name und meine Telefonnummer.« Dad reicht ihm eine seiner altmodischen verzierten Visitenkarten, die er für solche Fälle immer dabeihat. »Falls doch was sein sollte, melden Sie sich bitte. Wir bestellen Ihnen dann einen neuen.«
Er zögert einen Moment, als ob ihm noch ein neuer Gedanke gekommen ist oder er seine Meinung geändert hat. »Darf ich Ihnen ein Buch empfehlen, das ich vor Kurzem gelesen hab?«
»Dürfen Sie nicht, nein.«
Dad ignoriert ihn und kritzelt etwas auf die Rückseite der Karte. Die Stuhllehne lässt er dabei nicht los.
»Komm, Dad«, sage ich und reiche ihm meinen Arm. »Lass uns abhauen.«
Aber Dad schreibt weiter. Er zeigt auf den E-Reader: »Mit diesen Dingern wird nie wieder ein Buch vergriffen sein. Toll, nicht? Ein echter Fortschritt für die Menschheit. So, bitte schön. Lesen Sie mal rein. Wird Ihnen gefallen, das verspreche ich Ihnen.«
Der Typ tut mittlerweile so, als könnte er meinen Vater weder sehen noch hören, deshalb tritt mein Vater hinter dem Stuhl hervor, beugt sich über den Tisch und gibt der Frau die Karte. Seine Stimmung hat sich verändert. Er ist nicht böse, sondern eine Mischung aus resolut und tadelnd. Lehrerhaft.
Die Frau sieht hoch. Sie möchte gern noch feindseliger wirken, aber sie ist verunsichert, und Dad hat diese beeindruckende Art, einen auf Oberlehrer zu machen.
»Also dann.« Er richtet sich auf. »Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub. Und bleiben Sie bitte nicht zusammen, wenn Sie das eigentlich gar nicht wollen.«
»Wie bitte?«, fragt die Frau.
Aber das wars, wir gehen weiter, und zum ersten Mal, seitdem das alles angefangen hat, legen wir einander den Arm um die Schulter, wie zwei Soldaten, die von der Front nach Hause humpeln, während es hinter uns Bomben und Kugeln hagelt und alles explodiert. Und mir geht durch den Kopf, wie seltsam und ungewohnt und gleichzeitig nah und vertraut sich das anfühlt, wie ich Dads echten, lebendigen Körper stütze, seinen Atem, sein Gewicht, seinen Puls und den Rhythmus seines Schlurfens spüre, der sowohl der Rhythmus seiner Krankheit ist als auch der Rhythmus seines Wesens.
Meine Mutter hieß Yuliya. Ein weiterer Grund dafür, dass sich mein Vater so Hals über Kopf in sie verliebte, bestand sicher darin, dass ihre Eltern aus Russland kamen und sie dadurch einen authentischen Kommunistenschick mitbrachte. Außerdem hatte sie es in jüngeren Jahren mal zu ungefähr zehn Minuten Ruhm als Dichterin gebracht. Und sie hatte türkisblaue Augen und Wahnsinnshaare in einem Kupferton, den man nicht färben kann, mit dem man geboren werden muss, und damit schlug sie jegliche Konkurrenz um Längen. Mein Dad hat immer gesagt, er hätte mal gelesen, eine gut aussehende, zufriedene Frau, die nichts dafür tun muss, gut aussehend und zufrieden zu sein, würde einfach jedem den Kopf verdrehen. Männer sowieso, aber auch Frauen.
Meine Mutter starb vor vier Jahren wenig überraschend an ihren Zigaretten. Wir haben sie bis zum Schluss gepflegt, na ja, hauptsächlich Dad. Sie war in New York aufgewachsen, und wir fuhren mindestens einmal im Jahr hin, weil es für uns gratis war. Wir konnten immer bei meinen Großeltern oder bei Tante Natascha übernachten, obwohl Tante Natascha später wegen eines blonden Schadenregulierers namens Andrew nach Yonkers gezogen ist, der selbst einen gehörigen Schaden hatte, was ich ziemlich lustig fand, aber natürlich für mich behalten musste. Jedenfalls – wenn man vom Krebs mal absieht, hatte ich es schon gut mit Mum und New York. Eine Zeit lang behauptete ich, ich wäre waschechter Amerikaner, bis Dad irgendwann zu mir meinte: »Lou, du musst nicht mal so tun. Du bist doch wirklich Halb-Amerikaner.« Jedenfalls kann man wohl sagen, dass die USA mein zweites Zuhause sind. Ich hoffe, sie sind bald mein richtiges Zuhause. Demnächst wirds ja nicht mehr viel geben, was mich in London hält, außer Jack und seinen Kindern.
Ich habe den Eindruck, Mum hat Dad von dem befreit, was er früher mal war. Und jetzt, wo sie weg ist … entwickelt sich Dad zurück, kommt wieder zum Vorschein. Einmal, da war ich zwölf oder so, habe ich gelesen, was Dad für Mum vorn in sein Buch über Sonette geschrieben hat. Das muss er ihr irgendwann ganz am Anfang geschenkt haben. Da stand: »Wenn man in der Liebe etwas vermisst, weiß man nie, was es genau ist, bis man es irgendwann findet. Dann vergisst man es nie wieder.«
Ich bin unglaublich erleichtert, als wir endlich oben an Deck sind. Der Wind pfeift, und die Wolken rasen vorbei wie eine Parade verrückter Altherrenhaarschnitte. Wir stehen am Heck, und mein Blick fällt sofort auf den Schaum der Wellenkämme, die wir hinter uns zurücklassen: Erst dick und weiß, dann teilen sie sich, sehen aus wie Seifenschaum, werden immer mehr auseinandergezogen und verschwinden schließlich ganz, bis alles wieder nur noch grau-grünes Meer ist, als wäre die Fähre nie da gewesen. Keine Ahnung, warum, aber auf einmal ist es mir unheimlich wichtig, dass die Welle, die das Schiff produziert, nicht einfach so verschwindet, und ich sehe genau hin, ob nicht doch ein Unterschied im Wasser zu entdecken ist, ob nicht doch irgendetwas von uns noch eine Weile bleibt.
Dad und ich, immer noch Arm in Arm, gehen rüber zu den im Boden verankerten Plastikstühlen und setzen uns. Dad atmet tief ein und aus, als würde er seine Atemzüge zählen, und ich starre immer noch aufs Meer hinaus, als plötzlich eine Gruppe Hippie-Studenten auftaucht und sich ans andere Ende des Tisches setzt. Sie rauchen Selbstgedrehte und benehmen sich, als wären sie in einem brasilianischen Slum aufgewachsen und dort nur knapp dem Tod entronnen, indem sie bedeutungsvolle Lieder schrieben, bevor sie per Anhalter den Weg über zwei Kontinente bis hierher schafften. Ich höre einen von ihnen sagen, er wäre »echt total offen für alle neuen Erfahrungen«, und denke mir, irgendwann reichts auch. Deshalb laufen Dad und ich wieder los, die Längsseite des Schiffs hinunter, bis zu einer weißen Kette, auf der »Kein Zutritt« steht und über der eine Reihe Rettungsboote hängt.
Hier unten weht der Wind ein wenig stärker. Ich ziehe meine Jacke an und gebe Dad seine. Ich versuche, bloß nicht hochzugucken und über Rettungsboote nachzudenken und darüber, dass vielleicht ein Heilmittel für Dads Krankheit gefunden wird, und was, wenn das nächstes Jahr passiert oder sogar schon nächste Woche? Scheiße.
Also spreche ich es jetzt doch einfach aus: »Wenn Mum noch leben würde, würden wir das hier trotzdem machen?«
Mein Dad zieht den Reißverschluss seiner Windjacke hoch und sieht mich an. »Nein. Würden wir nicht.«
»Dachte ich mir.«
»Du weißt doch auch, warum.«
»Eigentlich nicht.«
»Lou.«
Er sieht mich unter den grauen Brauen hervor an. Sein ruhiger, blauer Blick scheint zu fragen, ob ich das wirklich alles noch mal durchgehen will. Und ich weiß, wenn ich Ja sage, dann machen wir das auch. Das Problem ist nur, dass ich es auf immer und ewig durchgehen will. Also sage ich stattdessen: »Ich habe auf der Arbeit eine neue Lesegruppe gegründet.«
Komplett gelogen. Ich fühle mich auch sofort unglaublich schlecht. Doch er wird das natürlich nie rausfinden, und das macht es noch schlimmer.
Aber dann sagt er: »Gibst du mir eine Zigarette?«
Wären in diesem Moment fünfzehn Delfine mit Mundharmonikas und Gitarren aus dem Meer aufgetaucht und hätten angefangen, dieses blöde Mr. Tambourine Man zu singen, hätte ich nicht überraschter sein können.
»Du rauchst doch gar nicht, Dad.«
»Ich fange wieder damit an. Ich musste fast fünfunddreißig Jahre auf meinen Rückfall warten.«
Ich zögere. Ich wusste nicht, dass er weiß, dass ich rauche.
Wir sind beide so scheinheilig. Und Mum und Ralph und Jack auch. In meiner Familie sollte jeder ein Schild mit sich rumtragen, auf dem steht: »Ich meine genau das Gegenteil von allem, was ich mache und sage.«
»Ist schon okay«, sagt er lächelnd. »Auf seinen Vater muss man hören.«
Ich suche in der Jackentasche nach der Packung, die ich da versteckt habe. »Warum?«
»Diese Frage habe ich schon immer gehasst.«
»Deine Antwort darauf habe ich mindestens genauso gehasst.« Ich hole eine Zigarette aus dem zerknautschten Päckchen. Ich finde Rauchen eigentlich total schrecklich, die Gründe sind ja offensichtlich. Ich mache es nur, um mich selbst noch mehr zu ärgern. Ich reiche Dad eine. Der nimmt sie, steckt sie aber nicht in den Mund. »Was habe ich denn geantwortet?«
»›Darum.‹ Mehr hast du nie gesagt. Nur immer ›darum eben‹. Darum eben. War nicht gerade hilfreich. Und auch nicht sehr clever.«
»Wenn du selbst mal Kinder hast, wirst du das verstehen.« Er hebt die Hand, damit ich ihn nicht unterbreche. »Glaub mir, das wirst du. Manche Sachen muss man einfach für seine Eltern tun, darum eben. Soll ich mir die hier eigentlich mit den Zähnen anzünden oder was?«
Ich gebe ihm mein Zippo. Ich werde sie ihm bestimmt nicht auch noch anzünden. Alles hat seine Grenzen.
Aber mittlerweile hört der Wind gar nicht mehr auf, also hocken wir uns hin, die Köpfe dicht beieinander, jeder mit seiner Zigarette im Mund, und versuchen, sie anzuzünden. Und er zieht seinen Reißverschluss wieder auf, um aus seiner Jacke ein Zelt zu formen, aber es klappt immer noch nicht, bis ich das Gleiche mit meiner Jacke mache und die Flamme von beiden Seiten geschützt ist. Jetzt gibt es nur noch uns zwei hier, ich spüre den Schlag seiner Wimpern, spüre das Blut in seinen Ohren und die Wärme seines Atems. Der Rauch steigt ihm in die Augen, und als wir wieder aufstehen und zur Reling gehen, sieht es deshalb aus, als würde er weinen. Also sage ich schnell: »Du hast früher mal geraucht? Wann war das denn?«
Er blinzelt und kneift die Augen zusammen, und es ist ihm peinlich, aber er rückt trotzdem mit der Sprache raus: »Als ich in deinem Alter war. 1978 habe ich aufgehört, bevor deine Brüder geboren wurden. Ob du’s glaubst oder nicht, ich wollte ihnen mit gutem Beispiel vorangehen.« Er lacht leise sein Lachen, das immer klingt, als würde ihm gerade aufgehen, wie wenig wir wirklich über das Universum wissen und dass man es eigentlich nur staunend hinnehmen kann. »Und jetzt schau dich an. Du rauchst in letzter Zeit wie ein Schlot.«
»Ich hatte eben eine Menge Stress, Dad.«
»Stell dir mal den Stress vor, seinem Sohn dabei zusehen zu müssen, wie er genau das macht, was seine Mutter umgebracht hat.«
»Ich hör ja bald auf.«
»Na ja … wenn ich wieder anfange, machst du das vielleicht wirklich.« Er sieht mich an. »Umgekehrte Psychologie. Bei deinen Brüdern funktioniert es zumindest. Keine Ahnung, was bei dir funktioniert, Lou. Bestechung? Oder – was wäre denn das Gegenteil von umgekehrter Psychologie?«
»Wahrscheinlich Ermutigung, Dad.«
»Stimmt. Na gut, dann ermutige ich dich, mit dem Rauchen aufzuhören, auch wenn ich wieder damit anfange. Versprochen?«
»Versprochen«, sage ich. »Ich hasse es sowieso.«
Durch die Fähre geht so ein typisches lautes Fährenrumpeln.
»Und was für eine Lesegruppe hast du jetzt gegründet?«
»Eine Slow-Reading-Gruppe.«
»Nein!« Dad sieht mich an, als ob er mir gern glauben möchte. »Im Ernst?«
Die Lüge ist so unverfroren, dass ich mir jetzt richtig Mühe geben muss. »Ja, wirklich. Jeden ersten Montag im Monat. Im Moment sind wir etwa zu zehnt. Wir lesen alle dasselbe, ein Gedicht oder ein paar Seiten aus einem anspruchsvollen Roman, und dann reden wir gemeinsam darüber. Es geht darum, dass man sich richtig darauf konzentriert, also auf die Literatur.« Meine Seele zerfällt in mir drin zu Asche, deshalb sage ich das Einzige, was garantiert für einen Themenwechsel sorgen wird. »Ich mache das zusammen mit Eva. Ein paar von ihren Arbeitskollegen sind auch dabei.«
Dad will wieder zu mir schauen, tut es jedoch nicht. Wir reden nie über meine Freundinnen. Ich bin mir sicher, dass er gern ab und zu so ein Gespräch unter Männern hätte, aber ich bin ziemlich gut darin, das Thema zu meiden. Er ist so altmodisch und ungeschickt, was das angeht, dass es mir peinlich ist. Indem ich also nur ihren Namen sage, öffne ich ihm bereits diese Tür. Und das weiß er. Deshalb will er nicht rübergucken, damit ich nicht sehe, dass er gerade versucht hereinzukommen, und die Tür vielleicht wieder zuschlage. Ich muss sie jetzt aber natürlich sowieso sperrangelweit offen lassen, als Strafe dafür, dass ich ihn angelogen habe, und fühle mich abgrundtief schlecht – das kommt jetzt noch zu den vielen anderen Sachen dazu, wegen denen ich mich eh schon abgrundtief schlecht fühle, wegen allem eigentlich.
»Wer war Eva noch mal?«, fragt Dad, ohne mich anzusehen. »Die, die dich voranbringt, oder die, die dich zurückhält?«
»Dad.«
»Ich hatte den Eindruck, das letzte Jahr war ganz schön … hektisch für dich.«
»Sag nicht ›hektisch‹.«
»Beschäftigt. Stressig.«
»Das war früher.«
»Wo kommt sie denn her?«
»Tufnell Park.«
»Ah, eine Londonerin.«
»Ihr Dad ist aus Yeovil. Ihre Mum kommt aus Eritrea.«
»Und was hält sie davon, mit jemandem aus Stockwell zusammenzusein?«
»Sie hat so einen Nacktscanner wie am Flughafen vor der Zimmertür stehen.«
»Bestimmt seltsam.«
Ich bin kurz davor, einen Witz über Ganzkörperdurchsuchungen zu machen, und dass ich praktischerweise immer schon meinen Gürtel ausgezogen habe, wenn ich zu ihr komme, aber das fühlt sich irgendwie falsch an. Deshalb sage ich nur: »Ihr Dad hat früher eine komplett unrentable Tapas-Bar geführt, und ihre Mum ist Teilhaberin von einem äthiopischen Restaurant in Tufnell Park. So haben sich die beiden auch kennengelernt. Eva meint, sie würden die schlimmste Ehe führen, die sie je gesehen hat.«
»Gibt bestimmt schlimmere, Lou.«
»Nein, wirklich, die spielen ganz oben mit. Eva hat erzählt, wie sich ihre Mum zu Weihnachten mal als Weihnachtsmann verkleidet, in ihr Zimmer geschlichen und Geschenke hingelegt hat. Eva hat so getan, als würde sie schlafen. Fünf Minuten später kam ihr Dad rein, auch als Weihnachtsmann verkleidet, und hat die Geschenke wieder mitgenommen.«
»Interessant.«
»Und zehn Minuten danach kam ihr Dad noch mal rein und hat die Geschenke wieder hingelegt, aber er hatte die Schrift ihrer Mum mit kleinen weißen Etiketten überklebt.«
»Ach du Scheiße.«
»Und dann kam ihre Mum zurück, immer noch im Weihnachtsmannkostüm, hat sich die Geschenke angeguckt und war völlig fassungslos darüber, was Evas Dad gerade getan hat. In dem Moment kommt ihr Dad dazu, um zu sehen, was ihre Mum da treibt, und sie fangen an, sich zu streiten. Sie werden immer lauter, und Eva liegt hellwach da und sieht diesen zwei Weihnachtsmännern dabei zu, wie sie vor ihrem Bett stehen und sich durch ihre Rauschebärte hindurch anschreien. Und das alles am Abend vor Weihnachten.«
»Hat das Spuren bei ihr hinterlassen?«
»Alles hinterlässt doch Spuren«, antworte ich.
Dad sieht mich an. Ich erwidere seinen Blick.
»Und was macht sie?«
»Das Gleiche wie ich.«
Er kann seine Geringschätzung kaum verbergen. »Sie ist Datenbankmanagerin?«
»Nein, Anwältin. Mit ›das Gleiche‹ meinte ich, dass sie auch ziellos in den flachen Gewässern von Sinn- und Zwecklosigkeit umhertreibt.«
Er runzelt die Stirn. Er kann es nicht ausstehen, wenn ich Witze über meinen Job mache, und ich will nicht, dass die gute Stimmung zwischen uns gleich wieder hin ist, deshalb frage ich schnell nach dem Buch, das er immer noch in der Hand hält. »Was liest du da eigentlich?«
»Die Sonette. Nummer vierundsiebzig, ›Doch sei getrost‹.«
»Kannst du das auswendig?«
»Ja.«
»Sag es mal auf.«
»Nein.«
»Eine Zeile wenigstens?«
»›Doch sei getrost! Wenn mich der harte Spruch des Todes ohne Schonung einst ereilt, lebt etwas noch von mir in diesem Buch …‹«
Der Wind fährt ihm durch die Haare. Ich sehe ihm an, dass es ihm hier draußen besser geht. Und deshalb geht es auch mir besser. Er rezitiert den Vers zu Ende: »› … das zum Gedächtnis ewig bei dir weilt.‹«
»Ich würde so was auch gern auswendig können«, sage ich, weil es stimmt und weil ich Dad so gern zuhöre, wenn er über Sachen redet, die ihm viel bedeuten.
»Du hast das ganze Internet auf deinem Telefon, Lou. Du musst überhaupt nichts mehr wissen. Zu meiner Zeit mussten wir uns noch Sachen einprägen, damit wir sie abrufen konnten, falls wir sie später noch mal brauchten. Sonst musste man jedes Mal mit dem Bus in die verflixte Bibliothek fahren, wenn man was wissen wollte. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Gibt es überhaupt noch Bibliotheken? Die Fortschrittslücke zwischen meiner und deiner Generation ist bestimmt die größte, die es je gab.«
Dad sieht sich nach etwas um, wo er seine Zigarette ausdrücken kann. Hinter uns steht ein Eimer mit Sand. Er wartet ab, bis wir die nächste Welle hinter uns haben, dreht sich auf seinen Stock gestützt ein Stück, macht einen Schritt nach vorn, lässt die Zigarette in den Eimer fallen, richtet sich auf und greift wieder nach der Reling.
»Du findest bestimmt, dass früher alles besser war, oder?«, frage ich.
»In der Tat, ja.«
»Wieso?«
»Wenn man was auswendig lernt, wenn man es sich für immer einprägt, dann hat man die Wörter in sich drin, biologisch oder chemisch, oder wie das Gehirn halt funktioniert.«
»Über Neuronen.«
»Genau. Jedenfalls existieren die Wörter dann in einem drin, also in den Neuronen. Und können an andere Neuronen abgegeben werden. Und wenn einem Gedanken durch den Kopf blitzen, dann blitzen sie gleichzeitig an ganz viel Shakespeare vorbei, und das hilft garantiert dabei, Dinge besser zu formulieren und sich besser auszudrücken.«





























