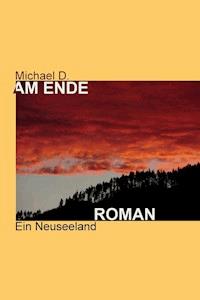
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Michael D., ein Mann in der Lebenskrise, fliegt alleine ans Ende der Welt und plant seinen Freitod im Paradies. Seine Reise durch Neuseeland wird zu einem Natur- und Seelentrip. Detailliert schildert er seine intimsten Erlebnisse und Gedanken in einem Word-Tagebuch. Er wird mit Religion, seinen sexuellen Begierden und Naturkatastrophen konfrontiert, begegnet dabei Menschen, die sein Schicksal in neue Bahnen lenken könnten und erinnert sich an Ereignisse vor zwei Jahren, welche vielleicht seine Entscheidung beeinflusst haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael D.
AM ENDE
Ein Neuseelandroman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhalt und Autor
TAG 1
TAG 2
TAG 3
TAG 4
TAG 5
TAG 6
TAG 7
TAG 8
TAG 9
TAG 10, 11, 12, 13
TAG 14
TAG 15
TAG 16
TAG 17
TAG 18
TAG 19
TAG 20
TAG 21
TAG 22
TAG 23
TAG 24, 25, 26
TAG 27
NACHBEMERKUNGEN
Impressum neobooks
Inhalt und Autor
Michael D.
AM ENDEEin NeuseelandROMAN
Michael D., ein Mann in der Lebenskrise, fliegt alleine ans Ende der Welt und plant seinen Freitod im Paradies. Seine Reise durch Neuseeland wird zu einem Natur- und Seelentrip. Detailliert schildert er seine intimsten Erlebnisse und Gedanken in einem Word-Tagebuch. Er wird mit Religion, seinen sexuellen Begierden und Naturkatastrophen konfrontiert, begegnet dabei Menschen, die sein Schicksal in neue Bahnen lenken könnten und erinnert sich an Ereignisse vor zwei Jahren, welche vielleicht seine Entscheidung beeinflusst haben.
Michael D. wurde 1963 in der Nähe von Köln geboren. Seine Eltern und die jüngere der beiden Schwestern, die an einer Psychose litt, sind bereits verstorben.
TAG 1
NORDINSEL
Mein Gott, so viele Grüntöne, ist mein erster Gedanke. Und mein zweiter: in spätestens sechs Wochen werde ich tot sein!Sechs Wochen. Das sind 42 Tage. Deswegen zähle ich ab Tag 1.Es ist der 10. Februar 2013.
Ich sitze im Taxi und befinde mich auf dem Weg in die City von Auckland. Vor einer Stunde bin ich in Neuseeland gelandet, nicht zum ersten Mal, aber zum letzten Mal.
Vor zwanzig Jahren bin ich zum ersten Mal hier angekommen. Seitdem hat sich einiges verändert. Die Bevölkerung ist von 800.000 auf 1.400.000 angewachsen, was sich erheblich auf den Verkehr auswirkt. Damals hat mich irgendjemand scherzhaft gefragt, was ein Stau in Auckland wäre? Auf meinen fragenden Blick hat er geantwortet:
„Wenn zwei Autos hintereinander an einer Ampel stehen.“
Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Die Autokolonnen haben fast die Dimension europäischer Großstädte erreicht. Und von der häufig beschriebenen Relaxtheit der Neuseeländer ist hier kaum etwas zu spüren. Aucklander begreifen sich in erster Linie als Städter und je weiter man nach Süden reist, umso mehr neigen die Einheimischen dazu, die Aucklander als arrogant, hektisch und wenig hilfsbereit zu beschreiben. Ob das Vorurteile sind oder nicht, kann ich als Ausländer schwer entscheiden. Vielleicht liegt, wie so oft, die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Zum Glück hat sich das Licht nicht verändert. Es hat noch die gleiche Intensität, als hätte jemand die Sonne etwas heller gestellt als in Mitteleuropa. Und diese Kontraste, diese vielen verschiedenen Grüntöne, die es daheim - wo ist das nur? - nicht gibt, außer vielleicht an manchen klaren Herbsttagen.
Ich blicke nach links durchs Seitenfenster - in Neuseeland gilt Linksverkehr - und sehe unzählige einstöckige Holzhäuser an mir vorbeiziehen, alle freistehend mit weißen Zäunen, Hecken oder Steinmauern, viele auf Pfählen aus der Totara-Steineibe, die nur in Neuseeland wächst. Es gibt sogar spezielle Firmen für ‚Repiling’, welche die morschen Pfähle ersetzen. Hier und da sehe ich ein Trampolin auf dem Rasen, viele Bäume und viele Büsche. Ein Takeaway - mein Magen fängt an zu knurren - dann ein Dairy, die neuseeländische Entsprechung zu unseren Tante-Emma-Läden, welche meist von Indern oder Chinesen geführt werden und an sieben Tagen die Woche geöffnet haben.
Der Taxifahrer rechts neben mir fragt mich, wo ich herkomme.
Als ob ich das weiß!
Ich sage ihm, dass ich aus Deutschland komme. Er selbst stammt von den Fidschi Inseln und lebt schon seit über zwanzig Jahren mit seiner Familie hier. Die meisten seiner Kollegen sind Inder.
Wir machen noch ein bisschen üblichen Smalltalk. Er scheint mir noch weniger Neuseeländer zu sein als ich es sein könnte.
Manukau Road steht auf einem Straßenschild. Die Wolken ziehen schnell dahin und schieben sich immer wieder vor die Sonne. Der Taxifahrer sagt mir, dass ich Glück habe. Nur bis Anfang Januar habe es viel geregnet, ein schlechter Sommerbeginn. Aber seitdem gebe es nur schöne trockene Tage, was bei den Bauern allmählich zu Problemen führe. Die Wetterprognose sei gut. Aber man weiß ja nie. Neuseeländisches Wetter steckt voller Überraschungen. Heute auf jeden Fall ist es mit 25 Grad angenehm warm.
Parnell Road. Fast am Ziel. Rechts die Holy Trinity Cathedral: weiß, ganz aus Holz und mit rotem Dach.
Nach einer Zwanzig-Kilometer-Fahrt hält das Taxi am Backpackers und der Fahrer holt mein Gepäck aus dem Kofferraum. 67 Dollar kostet die Fahrt. Ich gebe ihm siebzig.
„Stimmt so“, sage ich.
Es ist 18:00 Uhr.
Ich habe 35 Stunden Reise hinter mir, davon 23 Stunden reine Flugzeit und zwei Zwischenlandungen, eine in Dubai und eine in Brisbane.
Vor mir sehe ich eine ehemals schöne dreistöckige Holzvilla mit spitzem Dach. Zur Linken auf dem Rasen steht ein leeres großes Meditationszelt und weiter hinten ein paar Zelte und alte Mietwohnwagen. Ich fühle den Jetlag, der Horizont scheint sich im Zeitlupentempo wie bei Dünung auf dem Meer zu bewegen.
Der Mann im Office zu meiner Rechten begrüßt mich freundlich mit ein paar Standardfloskeln. Er dürfte um die fünfzig sein und hat graues gelocktes Haar. Wir wickeln das Geschäftliche ab, ich bezahle für drei Nächte, erfahre kurz, wo sich was befindet und bekomme kurz die Hausordnung erklärt.
„Vielen Dank“, sage ich.
„You’re welcome“, antwortet er.
Als ich diese englische Redewendung vor zwanzig Jahren bei meinem ersten Aufenthalt die ersten Male hörte, glaubte ich zuerst wirklich, dass mich alle Neuseeländer willkommen heißen würden, aber ‚you’re welcome’ bedeutet ‚gern geschehen’ oder ‚keine Ursache’. Ich will damit nicht sagen, dass ich mich nie willkommen gefühlt habe. Nein! Ganz im Gegenteil. Die Freundlichkeit der Einheimischen ist in der Regel nicht gespielt, außer vielleicht dort, wo es viele Touristen gibt, wie zum Beispiel in einem Hotel oder Backpackers, aber wo ist das nicht so auf der Welt? Sucht man nach einen Ort in Neuseeland, wo über Land und Leute vielleicht am wenigsten zu erfahren ist, dann ist man in einem Backpackers an der richtigen Adresse. Die Chancen, hier einem Neuseeländer zu begegnen, tendieren gegen null.
An den Tischen auf der Terrasse sitzen circa ein Dutzend junge Leute. Mit meinen fünfzig Jahren dürfte ich ungefähr doppelt so alt sein wie der Durchschnitt. Ich höre Deutsch, Französisch, Chinesisch? Japanisch?
Ich gehe direkt in mein Zimmer im Erdgeschoss, welches eines der wenigen Einzelzimmer ist. Es ist sauber, einfach und mit Blick nach hinten auf Wäscheleinen, einen Anbau und Hintergärten. Ich öffne meinen Rollkoffer, nehme Kulturbeutel und Handtuch heraus und wasche mir im Gemeinschaftsbad Gesicht und Hände.
Wieder zurück im Zimmer stelle ich mich vor den Spiegel, der neben der Tür hängt.
Wie kann ich mich beschreiben?, frage ich mich.
Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, wie ich mich sehen würde, wenn ich mich selbst auf der Straße treffen würde.
Wirkt dieser Mann sympathisch? Wirkt er auf Frauen? Oder auf Männer? Wirkt er selbstbewusst? Wirkt er vertrauenswürdig? Wirkt er überhaupt?
Da ich keine einzige Antwort finde, versuche ich es mit einer möglichst sachlichen Beschreibung:
dunkles leicht lockiges halblanges Haar mit angegrauten Schläfen - dichte Augenbrauen - blaugraue Augen - Gesichtsform? Eckiges Kinn. Sonst eher rund - breiter Mund - noch alle Zähne im Original - schmale Nase - im Augenblick Dreitagebart ...
Ich trete zwei Schritte zurück.
... knapp 1.80 Meter groß - mesomorph? (Wenn ich den Ansatz von Bauch sehe, muss ich eher sagen: das war vielleicht einmal) - keine Arbeiterhände - (noch) hellhäutig vom deutschen Winter (Das heißt: ich treibe keinen Wintersport) - Jeans und rotes T-Shirt.
Das ist mein äußeres Escheinungsbild. Je länger ich mich anschaue, umso schwieriger wird es für mich, ihm meine Psyche zuzuordnen.
Mein. Mich. Meine. Was bedeuten diese Worte?, frage ich mich.
Ich wende mich wieder vom Spiegel ab.
In einem Takeaway in der Parnell Road besorge ich mir Fisch und Chips. Kaum etwas ist billiger, um sich satt zu essen. Leider macht es auch fett. Vielleicht ein Grund für die Übergewichtigkeit der Neuseeländer, vor allem der Maori. Allerdings scheinen Polynesier von ihrer Veranlagung her gute Futterverwerter zu sein - das Wort ‚Futterverwerter’ habe ich kürzlich irgendwo gelesen.
Das klingt diskriminierend, denke ich. Ich sollte besser sagen, dass sie relativ leicht Fett ansetzen.
Aber mal davon abgesehen ist Körperfülle durchaus eine Art Statussymbol.
Ich esse draußen an einem der Tische. Neben mir planen gerade eine dunkelhaarige Pariserin und eine blonde Norddeutsche, die sich offensichtlich hier kennengelernt haben, gemeinsam mit einem Sleepervan durchs Land zu reisen. Es sind zwei Schönheiten, jede auf ihre eigene Art. Sie werden sicher Bekanntschaften machen.
Es ist keineswegs ungewöhnlich, dass sich Leute, die alleine unterwegs sind, in Auckland zusammentun, um gemeinsam Neuseeland zu bereisen. Aus diesem Grund gibt es hier einen viel regeren Kontaktaustausch an den Tischen als in den Backpackers anderer Städte.
Mir gegenüber sitzt ein junger Japaner mit Irokesenschnitt.
Wir kommen spontan ins Gespräch und reden über unsere Reisen. Er ist vorher alleine in Indien und Thailand unterwegs gewesen.
„Fällt dir etwas an mir auf?“, fragt er mich.
„Nein“, sage ich nach kurzer Überlegung.
Er breitet seine Arme aus und sagt lachend: „Ich habe keinen Fotoapparat dabei.“
Ich lache auch.
Kurz darauf holt er seine Gitarre aus dem Zimmer und spielt ein paar alte Sachen von den Doors, den Rolling Stones und den Beatles. Es beginnt zu dämmern und um die zwanzig Leute sitzen an den Tischen herum. Ich höre Englisch, Österreichisch, Schweizerdeutsch und Russisch?
Ich werde müde, gehe in mein Zimmer, hole dort meinen Laptop aus dem Koffer und tippe die Ereignisse dieses Tages ein. Ich überlege kurz, ob ich einen Blog erstellen soll.
Blödsinn, denke ich. Dann hätte ich wahrscheinlich tausende Schaulustige und selbsternannte Helfer am Hals.
Ich habe vor, in den nächsten sechs Wochen bis nach Queenstown im Süden der Südinsel zu reisen. Von dort will ich auf den 1748 Meter hohen Ben Lomond wandern, eine Tour, die zwar Kondition, aber keine bergsteigerische Erfahrung voraussetzt. Mein einziges Gepäck wird eine Flasche Schnaps sein, die ich auf dem Gipfel trinken werde. Ich werde am späten Nachmittag aufbrechen, um in der Dämmerung oben zu sein. Unten in meinem Auto in Queenstown wird man irgendwann meinen Laptop finden, auf dem ein Zettel mit einem Hinweis auf dieses Tagebuch geklebt sein wird. So wird es zu meinem Vermächtnis für die Nachwelt und ich kann vermeiden, dass mein Fall mit dem Vermerk ‚Tod unter mysteriösen Umständen’ zu den Akten gelegt wird.
Natürlich wird dann die Öffentlichkeit über die Medien erfahren, welcher Name sich hinter Michael D. verbirgt, aber ich will zumindest nicht derjenige sein, der ihn preisgegeben hat.
Je länger ich warte, umso kälter wird es auf dem Gipfel sein, zumindest rein statistisch. Letzte Nacht waren es zwei Grad unter null auf dem Ben Lomond.
Ich habe keine wirklich eindeutigen Aussagen darüber gefunden, ob der Tod durch Erfrieren schmerzhaft ist oder nicht. Der Alkohol wird den Schmerz aber sicher minimieren und betäuben. Es wird eine Reise ohne Rückfahrschein.
Und was passiert dann mit meiner Leiche? Vermutlich wird man sie nach Deutschland überführen wollen. Darauf lege ich keinen Wert. Wenn ich hiermit verfügen kann, dass dies nicht geschehen soll, dann tue ich das. Wenn nicht, ist es auch egal.
Allerdings sind dies alles Überlegungen, die am Computer entstanden sind. Vielleicht muss ich vor Ort aus irgendwelchen Gründen meine Pläne variieren. Vielleicht kommt mir auf der Reise dorthin eine ganz andere Idee, aus dem Leben zu scheiden, eine, die sich völlig spontan ergibt. Ich kann auch früher Schluss machen. Der Tag in sechs Wochen, der Tag 42, hat eigentlich nur symbolische Bedeutung, weil an diesem meine Maschine von Auckland abfliegen wird - mit einem unerwartet leeren Sitzplatz.
Es kann also durchaus sein, dass dieses Tagebuch nur wenige Seiten lang wird und dann wird es sowieso niemand lesen. Also hangle ich mich lieber von Tag zu Tag und entscheide die Dinge im Hier und Jetzt. Und letzten Endes ist da natürlich noch die Frage nach dem ,Warum?’.
Ja. Warum also?
Ich könnte sagen, dass ich unheilbar krank bin und in einigen Monaten unter schrecklichen Qualen sterben werde. Aber so ist es nicht.
Ich könnte auch sagen, dass ich aus enttäuschter Liebe aus dem Leben scheiden will. Das ist das klassische Motiv. Die Literatur ist voll davon. Die Leiden des jungen Werthers war in der Schule eine meiner ‚Lieblingsbücher’. Aber ist das der Grund? Enttäuschte Liebe? Oder unerfüllte Liebe? Ein Schicksalsschlag ... ?
Oder ich könnte sagen, dass ich seit Jahren hochgradig depressiv und in psychiatrischer Behandlung bin. Das bin ich aber nicht.
Nein. Es geht vor allem darum, dass ich den Bezug zu meiner inneren und äußeren Welt verloren habe. Es geht darum, dass das Wort Heimat für mich nicht mehr existiert und all die damit verbundenen Sinnbezüge. Sogar eine Wohnung habe ich nicht mehr. Es geht darum, dass ich das Gefühl habe, in einer zunehmend materiellen Welt alles erledigt zu haben, was ich mit meinen mir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten privat und innerhalb meiner Jobs erledigen konnte.
Viele werden jetzt vielleicht denken: ‚Ist das alles? Deswegen will der Mann sich umbringen!’
So etwas passiert tatsächlich. Tut mir leid, wenn ich kein Motiv bieten kann, mit dem man sich besser identifizieren und entsprechend mitleiden kann. Natürlich stecken hinter meinen angegebenen Gründen jede Menge Erlebnisse, die sie begreifbar machen könnten, aber es ginge zu weit, sie alle schildern zu wollen. Das wäre eine Geschichte für sich.
So kann ich einfach nur sagen:
‚Game over!’
Und warum ausgerechnet in Neuseeland?
Weil das Land am ehesten all das repräsentiert, was ich immer wieder in meinem Leben ersehnt und vermisst habe:
Das bereits erwähnte Licht und die Kontraste.
Die Zahl der hier lebenden Menschen. Es sind nicht zu viele und (bei Bedarf) nicht zu wenige. (Schon immer war ich leicht agoraphobisch.)
Die Relaxtheit und das Tempo, welches im Vergleich zu Europa einen Gang heruntergeschaltet ist.
Das gemäßigte ganzjährig milde Klima. (Nur die Winter können wegen der schlechten Isolierung der meisten Häuser unangenehm sein.)
Die Natur, vor allem die Vegetation und die Meeresküsten.
Die Outdoor-Mentalität.
Und die (zumindest noch) weniger materialistische Einstellung der Menschen.
Und warum bleibe ich dann nicht einfach hier?
Ich habe bereits erfolglos alle Möglichkeiten ausprobiert, in Neuseeland bleiben zu können. Und selbst, wenn es irgendwie gehen würde, frage ich mich, ob ich mich nach einem halben Jahrhundert deutscher Kultur hier wirklich integrieren könnte? Ich würde nur ein Fremder im ‚Paradies’ bleiben.
Ich tippe die letzten Zeilen in meinen Laptop ein und werde gleich schlafen gehen.
TAG 2
Nach achtstündigem traumlosem Schlaf, der eher einem Koma ähnelte, wache ich auf und brauche eine Minute, um mich zu orientieren. Dann stehe ich auf, dusche mich und mache einen morgendlichen Spaziergang die Saint Stephens Avenue runter Richtung Judges Bay. Vereinzelte Jogger sind unterwegs. Ich verspüre fast den gleichen Kick wie damals vor zwanzig Jahren. Rechts und links wird der Weg von knorrigen Bäumen gesäumt, deren Äste mit ihrem grünen Laub zum Teil bis über die Straße reichen. Holzhäuser hinter weißen Zäunen und Hecken, die meisten zweistöckig, gehobener Mittelstand. In manchen Gärten erheben sich Pappeln, Baumfarne oder Palmen. Ich sehe Gärten mit gepflegten Rasen und verschiedensten Sträuchern. Die meisten Autos stehen in Garagen. Und alles ist in dieses Licht getaucht, welches bei uns im Sommer nie zu sehen ist: satte kontrastreiche Farben und hier und da kleine Wölkchen am strahlend blauen Himmel.
Lichttherapie!
Der Gedanke an den Tod erscheint im Augenblick absurd, genauso wie der Gedanke an das Leben. Ich weiß, dass ich diese Eindrücke nicht ewig halten kann, sie wieder loslassen muss. Sie sind nur Illusion. Ich bin nur Illusion. Alles ist nur Illusion. Es ist angenehm warm, aber auch das ist nur Illusion.
Was ist so schlimm daran?
Nichts. Es ist einfach so, wie es ist.
Am Ende der Straße steige ich die Stufen hinab, blicke auf die Bay links Richtung Hafen. Dann laufe ich langsam zurück, um mir in der Parnell Road Sachen fürs Frühstück zu kaufen: Orangensaft, Schinken, Orangenmarmelade, Butter, Schinken, Eier, löslichen Kaffe, Milch, Zucker, ‚richtiges’ Brot aus einer italienischen Bäckerei. (Toast werde ich noch genug essen.)
Die Sonne scheint. In der Gemeinschaftsküche koche ich ein Ei, nehme mir Besteck und Teller, lasse am Boiler heißes Wasser in die Kaffeetasse laufen und esse wieder draußen.
Die beiden schönen Frauen vom Vorabend packen gerade ihren Sleepervan, in welchem man im Gegensatz zum Campervan nicht aufrecht stehen kann.
Es sitzen noch ein paar andere Reisende an den Tischen und eine Katze schleicht um meine Füße. Mehr Kontakt brauche und will ich im Augenblick nicht.
Nach dem Frühstück mache ich mich zu Fuß auf den Weg in die City. Zuerst gehe ich die Parnell Road hinab. Sie ist eine der Szene- und Restaurantstraßen Aucklands. Vor mir sehe ich einen Teil des Hafens. Nach einer halben Stunde erreiche ich die Queen St. Hier gibt es die einzige wirkliche Skyline Neuseelands, mit bis zu vierzigstöckigen Hochhäusern.
Mein Ziel ist das Intercity-Büro in der Hobson Street, wo ich mir für übermorgen ein Busticket nach Gisborne kaufen will. Doch vorher spaziere ich zum ganz in der Nähe gelegenen Skytower, mit 328 Metern das höchste Gebäude, gleichzeitig Fernsehturm, der südlichen Hemisphäre. Es ist ziemlich touristisch hier. Die Hauptattraktion sind der Blick aus dem sich drehenden Restaurant in fast 200 Metern Höhe und der ‚Skyjump’, eine Art Bungee-Jumping in der Mitte von zwei Brems- und Positionshalteseilen. Ich habe kein Interesse an einem Sprung. Beim bloßen Gedanken daran verspüre ich ein Ziehen von meinem Steißbein bis in den Hinterkopf.
Ich brauche kein Adrenalin, ich brauche keinen Kick. Nur eine Inspiration. Springen. Ist das eine Möglichkeit?
In Chad Taylors Roman Shirker stürzt nur fünf Minuten entfernt von hier auf mysteriöse Weise ein Mann aus dem fünften Stock in den Tod.
Ich löse ein Ticket und fahre mit dem Lift nach oben. Die Aussicht aus den Panoramafenstern, es gibt sogar in den Boden eingebaute Glasfenster, ist grandios. Selbst die Hochhäuser drum herum wirken wie Zwerge. Die ganze Stadt liegt mir zu Füßen, in der Ferne sehe ich Hügel mit Wohnhäusern und dahinter die Bergketten. Im Norden liegt der Hafen und nordöstlich sind Rangitoto Island und andere Inseln im Hauraki Gulf zu erkennen.
Vor mir schwebt an einem Seil ein Mensch mit angespanntem Gesichtsausdruck in der Luft und sinkt plötzlich in die Tiefe, wird nach wenigen Sekunden zu einem ... Punkt ... Menschenpunkt.
Ich inspiziere die Fenster und stelle fest, dass alles hermetisch abgeschlossen ist. Ein Suizid ist so gut wie ausgeschlossen. Vielleicht wäre es möglich, dort hängend, mit einer Zange das Seil zu durchtrennen.
Und dann?
Nur ein paar Sekunden bis zum Aufschlag.
Nimmt man diese Sekunden noch bewusst wahr, ziehen sie sich subjektiv in die Länge, wird es der häufig beschriebene Flug durch einen Lichttunnel? Wird man schon während des Sturzes ohnmächtig, blendet also alles aus? Wird es zum ultimativen Adrenalin-Kick? Oder bereut man es augenblicklich und will zurück? Und was ist mit dem Schmerz beim Aufprall? Wird er für Bruchteile einer Sekunde wahrgenommen? Oder wird auch er in die Länge gezogen?
Vor einigen Jahren beging eine manisch depressive Bekannte von mir Selbstmord. Was für ein hässlicher Ausdruck! Denn er beinhaltet das Wort ‚Mord’. Ich werde im weiteren Verlauf des Tagebuchs andere Begriffe wählen. Aber zurück zu der Bekannten. Sie fuhr mit dem Lift in den zehnten Stock einer Klinik und sprang über die Brüstung. Einige Tage nach ihrem Suizid schaute ich mir die Stelle an. Sie lag fast abgeschieden und in zehn Minuten begegnete mir kein Mensch. Unten war kein Strauch, kein Baum, kein Rasen, kein Mensch und nicht einmal ein Parkplatz zu sehen. Nur purer Asphalt oder Beton - todsicher.
Ja, sie war vermutlich sofort tot.
Unten im Cafe saß eine Freundin von ihr, der sie vor dem Sprung ihre Handtasche mit den Abschiedsbriefen, die sie vorher zu Hause geschrieben hatte, anvertraute. Von ihrem beabsichtigten Suizid sagte sie ihrer Freundin natürlich nichts. Sie sagte lediglich, dass sie mal kurz auf die Toilette müsste.
Nein! Springen ist nicht mein Ding. Nicht vom Dach eines Hochhauses. Vielleicht in den Schlund eines Vulkans, von denen es in Neuseeland einige gibt.
Ich löse mein Busticket in der Hobson Street und laufe noch eine Weile durch die Straßen der City, verlasse diese, gehe an der Art Gallery vorbei, und erreiche nach zehn Minuten die Auckland Domain, Aucklands ältesten und größten öffentlichen Park, eine grüne Lunge auf einem sanften Hügel, einem der ältesten fünfzig Vulkane des Aucklandfeldes.
Mein Ziel ist das War Memorial Museum, Neuseeland ältestes Museum, erbaut in neoklassizistischen Stil, eröffnet 1929. Ein prächtiger Bau mit großem Eingangsportal.
Ich schaue mit zuerst die Kriegsgedenkstätte an. In zwei Gedächtnishallen sind an den Wänden die Namen aller neuseeländischen Soldaten aufgelistet, die in Kriegen und Konflikten des 20. Jahrhunderts ums Leben kamen.
In der Ausstellung sind alte Kampfflieger aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen und sogar ein Schützengraben, den man von Gefechtslärm begleitet durchschreiten kann, ist nachgebaut. An einer Wand hängt eine Fahne mit einem spiegelverkehrten Hakenkreuz?! Absicht? Oder Fehler?, frage ich mich.
Aber das Museum bietet nicht nur Kriegserinnerungen, sondern auch über siebenhundert Jahre Maorikultur in Form von Kunstgegenständen, alten Fotos, Kanus und kompletten Holzgebäuden, darunter ein traditionelles Versammlungshaus mit Holzschnitzereien. Ich lese, dass das Wort Maori ‚natürlich’ bedeutet. Sie kamen ursprünglich aus Ost-Polynesien, führten untereinander Kriege und sogar Kannibalismus soll es gegeben haben. Lange plünderten sie die Natur, brannten ganze Wälder nieder, nur um die letzten Moas, die bis zu 270 kg schweren ausgestorbenen Laufvögel, hinauszutreiben. Und 1769 landete schließlich James Cook und löste die Besiedlungswelle aus. Immer mehr Pakeha, so nennen die Maori die europäischen Einwanderer, kamen, vor allem von den Britischen Inseln. Zwischen 1843 und 1872 kam es zu den Neuseelandkriegen zwischen den Maori und den neuen Siedlern, die immer mehr von britischen Soldaten unterstützt wurden. Die Maori wurden weitgehend enteignet. Erst 2008 wurden sie vertraglich entschädigt und die Stämme wurden wieder zu den größten Waldbesitzern Neuseelands, welches insgesamt noch 24 % Waldfläche hat. Dennoch geht es den Maori in Bezug auf Arbeitslosigkeit und Ausbildung auch heute noch schlechter als den Pakeha.
Immerhin sind sie sehr viel besser in die Gesellschaft integriert als zum Beispiel die Aborigines in Australien. 2008 entschuldigte sich dort Premierminister Kevin Rudd für das Unrecht, welches die Weißen ihnen in der Vergangenheit angetan hatten. Die neuseeländische Regierung entschuldigte sich bereits 1999 bei den Maori.
Zwei Maori veranstalten mit heraushängenden Zungen einen lauten Kriegstanz und Touristen stellen sich anschließend zwischen die beiden, um sich fotografieren zu lassen. Über die Authentizität dieser ‚Show’ lässt sich streiten.
Mein persönlicher Museumsfavorit ist der 1:1 Nachbau einer Straße in Auckland aus dem Jahre 1866. Ein Pub, eine Apotheke, ein Sattler, ein Buchladen, ein Tabakladen, eine Wohnstube und mehr sind bis ins Detail nachgebaut und mit unzähligen Gegenständigen aus der damaligen Zeit ausgestattet.
Ich gehe zu Fuß zum Backpackers zurück. Unterwegs lasse ich Geld an einem ATM-Automaten heraus, besorge mir in der Parnell Road etwas beim Thai Takeaway (meinem Lieblings-Takeaway) und kaufe eine Flasche australischen Rotwein. Der neuseeländische ist zwar sehr gut, aber teurer.
Ich esse wieder draußen an den Tischen, an denen ich ein paar neue Gesichter sehe, aber auch bereits bekannte. Ein Mann Mitte vierzig, mittelgroß, breitschultrig, unrasiert mit zwei Narben, eine an der linken Schläfe und eine am Hals, kommt leicht humpelnd an meinen Tisch und fragt auf Englisch, ob ein Platz frei sei. Ich sage widerwillig ja und esse weiter. Er fragt mich, wo ich herkomme. Ich beantworte seine Frage und stelle ihm die gleiche. Er entpuppt sich als Deutscher aus Frankfurt.
Das passt irgendwie, denke ich.
Ich ordne ihn spontan irgendeinem dunklen Frankfurter Milieu zu und bleibe kurz angebunden. Er erzählt, dass er bereits seit fünf Wochen unterwegs ist und übermorgen wieder zurückfliegen muss.
„Ich will nicht zurück“, sagt er und seine Augen werden feucht.
Feuchte Augen passen nicht zu dem Typ, denke ich.
Ich schaue ihn nur fragend an.
„Mit Neuseeland hatte ich mir einen Traum erfüllt und der endet jetzt. Ich will nächste Woche nicht wieder anfangen zu arbeiten.“
Ich traue mich nicht, ihm darauf zu sagen, dass mein Urlaub gerade erst beginnt und ich traue mich noch viel weniger, ihm zu sagen, dass mein Leben bald enden wird.
„Ist deine Arbeit so schlimm?“, frage ich ihn stattdessen.
„Ich bin Elektroingenieur. Ist eigentlich okay, aber immer häufiger ödet mich der Job trotzdem an, und jetzt natürlich erst recht.“
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das mit dem Anöden verstehe ich ganz gut. Ich werfe ihm nur einen verständnisvollen Blick zu, der bei ihm anzukommen scheint.
„Tut mir leid. Das war jetzt kurz, aber ich muss noch ein paar Dinge für den Rückflug erledigen“, sagt er mit gequältem Lächeln und erhebt sich. „Wie heißt du übrigens?“
„Michael“, sage ich.
„Rudi, hat mich gefreut. Vielleicht sieht man sich morgen noch einmal.“
„Ja, wer weiß.“
Er gibt mir die Hand, dreht sich um und geht ins Haus.
Viele der Leute im Backpackers sind für ein Jahr mit einem ‚Working Holiday Visum’ unterwegs. Für die meisten ist Auckland der Ausgangspunkt, für einen kleineren Teil Christchurch auf der Südinsel, weil es auch dort einen internationalen Flughafen gibt. Einige arbeiten direkt erst einmal hier vor Ort, zum Beispiel in einem Backpackers oder Cafe. Andere reisen nach einigen Tagen in die verschiedensten Regionen des Landes, um Kiwis, Äpfel und/oder Trauben zu ernten/pflücken.
Die wenigsten hier sind auf Sauftour, wie zum Beispiel auf dem Ballermann in Mallorca. Kaum einer ist nur für ein paar Wochen hier. Viele sind inspiriert von der neuseeländischen Outdoor-Mentalität.
Die richtigen Adrenalinfreaks zieht es vor allem auf die Südinsel nach Queenstown. Geboten werden dort Para- und Hanggliding, Jetboat, Bungee-Jumping, Mountainbike, Skifahren im Winter und einiges mehr.
Und für die zahlreichen Surfer gibt es jede Menge Spots, der bekannteste ist wahrscheinlich Raglan.
Mittlerweile haben sich ein Schweizer um die dreißig mit dunklen kurzen Haaren und Brille, ein junger etwas schüchtern wirkender Bayer mit Wuschelkopf und ein junger achtzehnjähriger Deutscher an meinen Tisch gesetzt.
Abgesehen von mir trinkt niemand Alkohol.
Der Schweizer, Urs, empfiehlt mir eine Maori-Massage in Ngongotaha nahe Rotorua. Er bewegt sich mental irgendwo zwischen Spiritualität und Intellektualität.
Der Bayer mit Namen Tobias kommt gerade aus dem Nordland und erzählt, dass der dortige Ninety Mile Beach gar nicht neunzig Meilen, sondern nur neunzig Kilometer lang ist und jemand bei der Namensgebung vermutlich die Maßeinheiten vertauscht hat. Darüber hinaus gilt er als offizielle Straße, sogar für Busse. Beeindruckt haben ihn die Mangroven und der Wald mit den Kauribäumen. Das älteste Exemplar, der T?ne Mahuta, soll 2.000 Jahre alt sein.
Ein Österreicher mit Namen Jörg, Mitte vierzig, barfuß und mit Pferdeschwanz, stößt hinzu und setzt sich neben mich. Ich habe ihn bei meiner Ankunft im Garten jonglieren sehen. Er sagt, dass er Lehrer ist und sich eine einjährige Auszeit genommen hat. Ein lockerer Typ, der mit seinem Leben zufrieden zu sein scheint.
Warum habe ich nie so einen Lehrer gehabt, frage ich mich?
Der Deutsche, der sich als Simon vorstellt hat, erzählt, dass er Ski- und Surflehrer sei und dass er sich beim Basketballspielen schon sämtliche Finger gebrochen habe, zum Teil sogar mehrmals. Bei allen Gesprächsthemen wirkt er fast beängstigend allwissend, aber gleichzeitig sehr unemotional. Er behauptet, auch jonglieren zu können. Der Österreicher gibt ihm seine drei Bälle, doch Simons Versuche scheitern kläglich.
Was ist Bluff bei ihm, was nicht?, frage ich mich.
Jörg kommt aus der Nähe von Dornbirn, der einzigen Gegend Österreichs, die ich ein wenig kenne. Ich gestehe ihm, dass ich durch den Kontakt mit den Menschen dort meine Vorurteile gegen sein Land stark reduziert habe.
„Reduziert? Das heißt, ein paar hast du schon noch“, sagt er.
„Na ja, vielleicht, aber ich arbeite dran.“
„Du musst nicht alle Österreicher mögen. Ich denke da zum Beispiel an Peter Alexander oder ... Adolf Hitler.“
„Da kann ich nicht widersprechen.“
Die anderen tragen ihre Erfahrungen zum Thema Vorurteile bei. Zwei Deutsche, ein Bayer, ein Österreicher und ein Schweizer: die ideale Kombination für die Erörterung von Klischees im deutschsprachigen Raum.
Nachdem sich das Thema erschöpft hat, rede ich noch eine Weile mit Jörg. Ich erfahre von ihm, dass er in der Mittelschule die 10 - 14-jährigen in Sport und Englisch unterrichtet, seit drei Monaten auf der Nordinsel herumreist und erst wieder im September ins neue Schuljahr einsteigen wird.
Um 22:00 Uhr steht Jörg auf, um sich zu verabschieden.
„Tut mir leid, aber ich muss ins Bett. Ich muss morgen früh raus, um meine Schwester vom Flughafen abzuholen. Ich fahre mit ihr zusammen noch für ein paar Wochen auf die Südinsel, bevor es wieder nach Hause geht.“
TAG 3
Ich sitze bereits um 8:00 Uhr beim Frühstück und überlege, was ich mit diesem letzten Tag in Auckland anfangen soll. Nur ein schwedisches Paar hockt am Nebentisch. Einige liegen wahrscheinlich noch im Bett, ein paar Leute sehe ich in der Küche.
Rudi kommt mit einem Becher Kaffee und einem Teller mit Toast, Marmelade und Schinken auf mich zu und fragt, ob er sich setzen darf. Diesmal spüre ich keinen Widerstand und sage:
„Sicher.“
Rudi setzt sich, schaut kurz ins Leere und blickt mich dann an.
„Mein letzter Tag“, seufzt er. „Wie schnell fünf Wochen vorbeigehen können. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich heute noch möglichst viel sehen muss.“
„Das kenne ich. Aber wie heißt es so schön. Weniger ist oft mehr. Sonst artet es in Stress aus.“
„Ja, ich weiß, aber das ist leicht gesagt. Ich habe heute noch meinen Mietwagen.“
„Ein großer Ausflug in die Natur lohnt da kaum noch. Auckland ist viel zu weiträumig.“
„Hast du eine Idee für eine kleine Tour? Was zum Relaxen.“
„Vielleicht Devonport.“
„Devonport?“
„Über die große Brücke beim Hafen, die ins Nordland führt. Es ist eine ruhige etwas bessere Wohngegend mit einem kleinen Hügel, von dem man einen guten Ausblick hat.“
„Du kennst dich anscheinend ganz gut aus?“
„Ja, das schon. Ich war vor zwanzig Jahren zum ersten Mal hier. Seitdem alles in allem fast ein Jahr. Ich glaube, ich war mehr oder weniger überall. Im Detail gibt es natürlich noch jede Menge zu sehen, aber diesmal will ich es etwas gemächlicher angehen.“
„Ja, das verstehe ich. Wenn du Zeit und Lust hast, kannst du mich gerne nach Devonport begleiten.“
Ich fühle kaum noch Widerstand gegen ihn.
„Ja, okay. Ich habe heute nichts Konkretes vor.“
Nach dem Frühstück brechen wir mit seinem Nissan Sunny auf. Wir haben unser Programm erweitert und fahren zuerst auf dem Tamaki Drive zu Kelly Tarltons Sea Life Aquarium. Am eindrucksvollsten ist der Gang auf einem langsamen Transportband durch einen durchsichtigen Tunnel, in dem man Haie und Rochen, durch die Lichtbrechung ein Drittel kleiner als normal, über sich hinwegschwimmen sehen kann. Doch das ist kein Ersatz für all das, was Neuseeland ‚live’ zu bieten hat.
Später hält Rudi beim Hafen in der Quay Street im Parkverbot.
„Macht nichts“, sagt er“, ich bin eh morgen fort.“
Wir schlendern um die Hafenbecken herum, bestaunen ein großes Kreuzfahrtschiff und gehen dann in ein Cafe in der Queen Street. Anschließend stoppen wir beim Westhaven, einem der größten Yachthäfen der südlichen Hemisphäre. Dann überqueren wir die achtspurige mehr als einen Kilometer lange Harbour Bridge und biegen rechts ab Richtung Devonport. In der Kerr Street biegen wir zum Mount Victoria Reserve, einem erloschenen Vulkan, ab, fahren hoch und parken.
Mit nur 86 Metern ist der Begriff ‚Mount’ etwas übertrieben.
Nach einem kurzen Spaziergang setzen wir uns aufs Gras und genießen den Ausblick. Vor uns liegt die Skyline Aucklands, links die Harbour Bridge und hinter uns Rangitoto Islands im Hauraki Golf. Und zu unseren Füßen breiten sich die meist freistehenden Häuser von Devonport aus. Hier und da ist die Grünfläche eines Parks zu sehen.
Rudi schaut sehnsüchtig in die Ferne.
„Ein letzter Blick.“
„Das klingt so ultimativ. Du kannst durchaus wiederkommen.“
„Ja, könnte ich. In Frankfurt hält mich nicht viel.“
„Keine Familie oder so?“
„Mit meiner Familie habe ich keinen Kontakt. Und meine Freundin hat mich vor einem Jahr verlassen.“
„Wegen ... einem anderen Mann?“
„Nein.“ Rudi muss abrupt lachen. „Wegen einer ... Frau.“
Einen Augenblick bin ich irritiert.
„Dann seid ihr wahrscheinlich nicht lange zusammen gewesen.“
„Immerhin knapp zehn Jahre.“
„Das heißt, sie hat nach zehn Jahren erst gemerkt, dass sie lesbisch ist?“
„Nein, nein. Sie ist bi. So ist das. Aber damals war eh alles recht chaotisch. Meine Narben stammen von Schlägereien. Ich hatte mal eine echt gewalttätige Phase. Viel zu viel Alkohol, übles Umfeld, eine richtige Scheiße war das.“
„Und was war da mit deiner Freundin.“
„Keine Sorge, die hab ich nicht geschlagen. Sie hat mit zum Umfeld gehört. Eigentlich habe ich sogar gewusst, wie sie gepolt ist, aber das war mir damals eh scheißegal.“
„Und wie bist du aus all dem rausgekommen?“
„Irgendwie auf dem letzten Drücker. Irgendwann hieß es nur noch: entweder das war’s jetzt, oder du unternimmst sofort was. Na ja. Ich hab dann was unternommen. Ich war auf Entzug, zeitweise in der Psychiatrie, Gruppen- und Einzeltherapie, Anti-Gewalt-Training, das volle Programm. Das ist jetzt ... acht Jahre her. Seitdem bin ich trocken und hab meine Aggressionen im Griff.“
„Gut. Das schafft weiß Gott nicht jeder. Mit Psychiatrie kenne ich mich auch ein bisschen aus, allerdings aus der anderen Perspektive. Ich habe jahrelang mit psychisch Kranken als Kunsttherapeut gearbeitet. Vor zwei Jahren ist es meinem Chef nach kräftezehrenden Kämpfen gelungen, mich loszuwerden. Er ist diplomierter Psychologe, ein reiner Kopfmensch, empathisch nach Lehrbuch. Alles streng geregelt und hierarchisch. Und zusätzlich noch Anthroposoph. Weißt du, was da ist?“
„Ja, so ungefähr. Das ist die Lehre von Rudolf Steiner. Hä, der hat meinen Taufnamen.“
„Anthroposophie ist so ein bisschen wie der Rolls Royce in der Esoterikszene. In Dornach bei Basel haben die einen regelrechten Tempel, das Goetheanum. Ein riesiger Betonklotz. Ich kann da drinnen kaum atmen, diese Masse zerdrückt mich schier. Und diese grässliche Ästhetik ...“
„He Mann! Der Typ scheint dich immer noch schwer zu beschäftigen. Komm mal runter. Das ist Vergangenheit. Du wirkst wie aufgedreht.“
„Sorry, du hast recht. Film zurück.“
„Ja, Schnitt. Klappe, die nächste.“
Ich muss mich einen Augenblick neu sammeln und mein Blick fällt auf Rudis Fuß.
„Hat dein Hinken auch mit deiner chaotischen Zeit zu tun?“
„Nein, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich bin viel Mountainbike gefahren. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Sturz die Treppe runter. Das Resultat war ein komplizierter Bruch. Seitdem ist die Ferse in meinem rechten Fuß ohne Gefühl. Ich sollte möglichst nicht barfuß laufen. Wenn ich in einen Nagel trete, merke ich das nicht einmal. Ich hatte einmal eine Scherbe im Fuß. Ich weiß nicht einmal, wann ich reingetreten bin. Hinter mir gab es auf jeden Fall eine längere Blutspur.“
Rudi erzählt dies nicht, wie jemand, der klarstellen will, was für ein verdammt harter Kerl er ist, sondern mit leicht gebrochener Stimme, die Abstand zu den Geschehnissen ausdrückt, aber auch, dass der Abstand noch nicht so groß ist, wie er es gerne hätte.
„Und deine aktuelle Situation?“, frage ich.
„Keine Beziehung im Augenblick. Im Job habe ich über die Jahre wieder Fuß gefasst. Allerdings stelle ich gerade alles in Frage. Kann es das gewesen sein? Es gibt irgendwie nichts Neues. Das nennt man, glaube ich, Midlife-Crisis. Hier in Neuseeland, das war mal was anderes. Und jetzt geht es wieder zurück in den gleichen scheiß Trott.“
„Wenn du ungebunden bist, kannst du dir auch überlegen, ob du hier leben willst. Es könnte sein, dass dein Beruf auf einer Skills List steht. Wenn ja, dann hättest du durchaus Chancen.“
„Ja, vielleicht. Aber erst einmal muss ich zurück.“ Rudi denkt einen Augenblick nach. „Und was läuft bei dir, mit deiner Familie und so?“
„Meine Familie ist praktisch ausgestorben. Ich glaube, es gibt noch eine ältere Schwester, aber da habe ich null Kontakt. Und eine nicht mehr Freundin. Das habe ich gründlich versaut, oder wir beide. Wie auch immer. Eigentlich ist schon seit zwei Jahren Schluss.“
„Und uneigentlich?“
„Uneigentlich definitiv. Es gab hier und da noch Momente, in denen man, in denen ich dachte, dass vielleicht ... ich rede Schwachsinn. Es ist nichts mehr zu retten. Beziehungen sind etwas Kompliziertes.“
„Aber du bist doch Therapeut?“
„Oh ja. Aber ich sage dir eins: wenn es Menschen gibt, die nicht imstande sind, ihre privaten Probleme zu lösen, dann sind es Therapeuten. Auf dem Auge sind die meisten blind.“
„Vielleicht zu studiert, zu theoretisch, zu egozentrisch ... wie dein ehemaliger Chef?“
„Ja, so in der Richtung.“
„Themenwechsel. Wir sollten was essen gehen.“
„Gute Idee.“
Wir bewundern noch still ein paar Minuten die bereits tiefstehende Sonne, deren Bahn, für unsere Augen ungewohnt, von rechts nach links verläuft. Dann fahren wir zurück in die Parnell Road und gehen zum Japaner, um Sushi zu essen.
Zuerst tauschen wir uns über die Orte aus, die wir in Neuseeland besucht haben. Rudis zwei Favoriten auf der Nordinsel sind die Coromandel-Halbinsel mit ihren zahlreichen Buchten, die zum Teil nur über Schotterpisten zu erreichen sind, mit ihren Wanderwegen durch dichten Urwald aus Rimubäumen und Baumfarnen und der Tongariro-Nationalpark, mit seinen eindrucksvollen Vulkantouren zum Mount Ngauruhoe und Mount Ruapehu, dem mit 2672 Metern höchsten Berg der Nordinsel.
Ich erwähne einen anderen Vulkanberg weiter westlich, den 1966 Meter hohen Mount Taranaki, den er aber nicht kennt.
Auf der Südinsel hat Rudi ganz im Süden an der Nordspitze des Fjordlands den viertägigen Milford Track gemacht, eine der schönsten Wandertouren weltweit, die durch üppigen Regenwald mit den höchsten Wasserfällen Neuseelands führt.
„Hast du bei einer solchen Tour kein Problem mit deinem Bein?“, frage ich Rudi.
„Nein. Schmerzen habe ich sowieso keine. Und Wandern war schon immer mein Ding, außer natürlich in den Jahren, wo gar nichts ging. Das Schlimmste beim Milford Track sind die Sandflies, diese gierigen kleinen Blutsauger. Schau mal hier“, er zeigt mir sein rechtes Bein, „die Stelle ist immer noch etwas vereitert. Die Stiche von den Biestern jucken noch nach einer Woche.“
„Am besten ignorieren. Die Neuseeländer bemerken die fast gar nicht mehr. Als ich zum ersten Mal hier gewesen bin, habe ich genauso ausgesehen. Mittlerweile geht’s. Und die Feuchtigkeit hat dir nichts ausgemacht? Die Gegend hat immerhin um die 300 Regentage pro Jahr.“
„Nein, ich mag das. Ich mag auch englisches Wetter. Und die ganze faszinierende Vegetation dort gibt es nur dank Regen.“
„Ich wollte den Track schon mehrer Male machen, aber irgendwie hat das Timing nie gestimmt.“
„Dann hole es nach. Ich kann’s dir nur empfehlen.“
Unser Essen kommt, für Rudi vegetarisches Tempura und gekochte Sojabohnen, für mich gebackenen Oktopus und Teriyaki mit Huhn. Wir genießen und schweigen. Ich trinke mit Rudis Einverständnis ein Bier.
„Und was sind deine Pläne für die nächsten Wochen?“, fragt mich Rudi.
„Morgen fahre ich nach Gisborne und dann ... ich weiß noch nicht genau.“
„Du machst nicht den Eindruck, dass du zurück willst.“
„Ja, zurück ...“ Ich versinke in Gedanken.
„Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen.“
„Hm ....“
„Gibt’s eine Alternative?“
„Die gibt es immer.“
„Ich meine eine realistische und befriedigende.“
„Das ist nicht unbedingt immer miteinander zu vereinbaren.“
„Kannst du das näher erklären.“
„Na ja. Wirklich befriedigend ist es weder hier noch daheim. In meiner eigenen Haut stecke ich überall. Das ist die Realität.“
„Das klingt etwas depressiv, beinahe beängstigend.“
„Ich sehe das eher als nüchterne Erkenntnis.
„Okay. Was heißt das konkret? Hast du irgendeine Dummheit vor?“
„Dummheit?“
„Dummheit. Etwas Unüberlegtes. Etwas in der Art.“
„Ich versau dir noch deinen letzten Abend“, versuche ich abzulenken.
„Ist schon okay. Ich bin hart im nehmen. Ich will dich überhaupt nicht irgendwie belehren. Ich bin nicht deine Mutter.“
„Gott sei dank.“
„Alles was du tust, ist letzten Endes deine Entscheidung.“
„Ja, ich weiß.“
„Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn jemand jammert und das Opfer spielt.“
„Tue ich das?“
„Nein. Na ja, vielleicht ein wenig. Ich erzähle dir mal etwas. Ich kannte mal einen Typ aus der Fremdenlegion. Der hatte noch mehr Narben als ich. Er hat mir mit voller Überzeugung und lachend erzählt, er wolle gar nicht alt werden, einfach kurz und möglichst intensiv leben, dann Abgang. Fertig. Das ist okay, finde ich. Aber was rede ich da für Zeug? Du hast mich ja heute auch schon jammern hören.“
„Ja, aber in erträglichen Ausmaßen. Der letzte Urlaubstag scheißt mich auch meist an. In einer Woche sieht für dich alles bestimmt wieder rosiger aus.“
„Hm.“
Ich will ihm von einem französischen Philosophen namens Jean Améry erzählen, der vor vielen Jahren ein Buch über den Freitod geschrieben hat. Dieser sei als absurde und paradoxe seelische Verfassung weder zu verurteilen noch zu therapieren, ein Privileg des Humanen und ein langer Prozess des sich ‚Hinneigens’. Wer glaube, seine Aufgaben erfüllt zu haben, kann ohne Reue und Seelenschmerz gehen. 1978 nahm sich Jean Améry das Leben.
Ich entscheide mich zu schweigen.
„Lassen wir das Thema. Wir wissen im Augenblick beide sowieso nicht, was morgen sein wird“, sage ich.
„Ja. Schade. Wir hätten uns vor Wochen treffen sollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Entscheidungen treffen wirst, mit denen du am besten leben kannst.“
Oder sterben, denke ich.
„Danke.“, sage ich. „Noch ein Dessert?“
„Nein, ich bin satt. Ich gehe zahlen.“
Ich will meinen Geldbeutel ziehen.
„Lass stecken. Ich lade dich ein.“





























