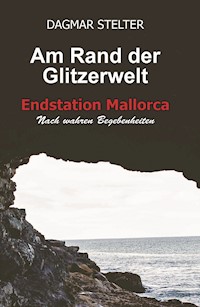
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichte ist eine Mischung aus Story und Liebesgeschichte. Sie zeigt, wie vergänglich Erfolge sind, wie rasant es hoch und dann wieder tief runtergehen kann und wie schnell man zum Bettler wird. Die Ehe des Bauunternehmers Martin Schwarz, alias Blacky, ist gescheitert, seine Firma längst bankrott. Nachdem der Romanheld eine ganze Menge krummer Wege hinter sich hat, kommt er zufällig auf die Insel Mallorca und bleibt, hofft dort einen Neuanfang zu finden, doch es kommt alles anders. Dem anfänglichen Hochgefühl folgt plötzlich Unfassbares. Blacky wird obdachlos und landet in einer Höhle. Es ist die Tiefe des Falls, die Fremdartigkeit der abstrusen Schockmomente, die seinem Leben am Rand der Glitzerwelt so zusetzen, bis er eines Tages ganz unverhofft Anne trifft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Unser größter Ruhm liegt nicht darin,
niemals zu fallen,
sondern jedes Mal wieder aufzustehen,
wenn wir gescheitert sind.
KONFUZIUS
Copyright© 2019 by Dagmar Stelter
Umschlaggestaltung und Satz: Sven Dannenberg
Coverfoto: StockSnap/Pixabay
Lektorat: Medien-Agentur Gaby Hoffmann
Korrektorat: Thomas Thürmann
ISBN: 978-3-7482-6634-1
Paperback
ISBN: 978-3-7482-6959-5
Hardcover
ISBN: 978-3-7482-6636-5
e-book
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.Sie finden dieses Buch im Internet u.a. bei:
www.tredition.de/buchshop, Amazon und diversen anderen Buchshops.
Auch auf der Sonneninsel Mallorca schreibt das Leben nicht immer erfolgreiche Geschichten! Wahre Begebenheiten deutscher Aussteiger, ihre bewegenden Schicksale und außergewöhnlichen Lebensumstände, ihre einzigartigen Erlebnisse und mutigen Entscheidungen sind der Stoff dieses Buches. Sie basieren auf bewegenden Ereignissen, die es so oder ähnlich gibt oder gegeben hat. Die Namen der Protagonisten wurden jedoch geändert, um deren Privatsphäre zu schützen. Rückschlüsse auf einzelne Personen sind deshalb nicht möglich. Auch erhebt der Roman nicht den Anspruch, die Orte und Geschehnisse an sich in jeder Hinsicht authentisch wiederzugeben.
Die Autorin verurteilt jegliche Art von Gewalt, Diskriminierung, Extremismus und Drogenmissbrauch.
DANKSAGUNG
Ich danke allen denjenigen, die mir im Laufe mehrerer Jahre großzügig ihre Lebensgeschichten erzählt haben und bei Recherchen behilflich waren. Dabei lernte ich faszinierende Menschen kennen. Einige turbulente Einzelschicksale haben mich ziemlich nachdenklich werden lassen. Deshalb begann ich sie eines Tages aufzuschreiben und so ist dieser Roman entstanden. Danke für das Vertrauen und die Offenheit der gestrauchelten Frauen und Männer, die dieses Buch überhaupt erst möglich gemacht haben.
Dagmar Stelter
Endstation Mallorca
Am Rand der Glitzerwelt
Nach wahren Begebenheiten
ROMAN
Zwischen Freiheit und Fiasko
„Herr Schwarz, Ihre Entlassungspapiere sind fertig. In zwanzig Minuten hole ich Sie ab“, rief Oberaufseher Baumert, schrill herein und ließ die Zellentür offen.
Schon seit Stunden saß ich fein herausgeputzt am Tisch meiner elf Quadratmeter großen Zelle und wartete angespannt auf diesen Augenblick. Ein verstohlenes Lächeln huschte mir zaghaft über die Lippen, während ich mich selbstprüfend von oben nach unten betrachtete. Der graue Anzug, das rote Oberhemd und die schwarzen Lackschuhe passten mir noch immer. Die Hose jedoch war ein wenig zu kurz und betonte meinen Bauch, mehr als er es verdiente.
Um viertel vor zehn hatte Baumert einen Rollwagen vor der Zellentür abgestellt, auf den ich wortlos meinen Koffer legte, die Tasche obendrauf.
Ein letztes Mal betrat ich die Zelle. Mein Blick blieb nachdenklich auf dem kleinen gelben Sonnensticker kleben, dessen fröhliches Gesicht mir hier drinnen fünf Sommer ersetzt hatte, die ohne Wärme waren. Daran knüpften sich urplötzlich Episoden aus meinem verkorksten Leben. Ein nervöser Muskel, der keine Ruhe geben wollte, zuckte unangenehm in meinem Gesicht. Ich versuchte mich abzulenken. Ein paar Minuten blieben noch, um „Blacky“ in den Wandputz unter dem Waschbecken einzukratzen. Mike, Kevin, Gordon und Marvin hatten sich dort bereits vor mir mit ihrem Namen verewigt. Kaum war das erledigt, dröhnte auch schon diese vertraute blecherne Stimme durch den Lautsprecher der Anstalt: „Herr Schwarz, bitte zum Terminal. Herr Schwarz, bitte zum Terminal.“ Es hallte wie ein Echo über den Gang, fast ein wenig unheimlich sogar. Auf einmal zögerte ich, die Schwelle der Tür zu übertreten.
„Kommen Sie schon, Schwarz!“, donnerte mir Baumerts Anweisung energisch entgegen. „Es ist fast elf, wir sind spät dran.“
Auf dem langen Weg zum Terminal signalisierte dumpfes Geschirrklappern die aktiven Vorbereitungen zum Mittagessen. Irgendwoher blökte jemand ganz schauderhaft im Hintergrund: „In ein paar Wochen komme ich dich besuchen.“
Ich blieb kurz stehen und schaute mich erstaunt um. Erst beim zweiten Mal begriff ich, dass es Alex war. Ich zeigte ihm den Mittelfinger und schnalzte mit der Zunge. Hoffentlich nicht, dachte ich dabei.
Wenngleich das ein ganz normaler Knastalltag war, heute klangen die Stimmen und Geräusche auf dem Gefängnisflur merkwürdig anders als sonst. Obwohl ich mich Schritt für Schritt so sehr sehnte, endlich von hier wegzukommen war da etwas, wovor ich mich fürchtete. Ob ich wieder hineinfinden werde in die Welt, die mir so lange verschlossen war? Oder bleibe ich als „Ex-Knacki“ ausgeschlossen und muss ein ausgegrenztes Leben im Abseits führen?
Überlegungen dieser Art ließen mich gerade keinen klaren Gedanken fassen. Nun erst wurde mir richtig bewusst, dass, wenn ich gleich dieses Gebäude verlassen werde, alle vertrauten Brücken abgebrochen sind.
Die Frage, wohin es da draußen gehen soll, hatte ich schon hundertmal gedanklich skizziert. Immer wieder stand „Sonne tanken“ ganz oben auf meiner Wunschliste.
Vor der Sicherheitsschleuse legte Baumert ganz unerwartet seine Hand auf meine Schulter.
„Sie müssen jetzt stark sein, Schwarz“, war sein letzter gutgemeinter Rat, bevor er seinen birnenförmigen Körper zurück durch die Tür schob.
Wie oft er diesen Satz wohl schon gesagt hatte?
„Ich bin stark“, flüsterte ich mir selbst mutmachend zu, obwohl sich augenblicklich ein ziemlich flaues Gefühl in meinem Bauch breitmachte.
Es ging los. Nun gab es kein Zurück mehr.
Ich holte tief Luft und legte den Schalter in meinem Gehirn einfach um, wollte mich nicht jetzt mit aufkommender Ungewissheit belasten. Meine Aufmerksamkeit war ganz und gar auf diese gewaltige Eisenpforte gerichtet, die sich ohrenbetäubend knarrend und schwerfällig zu öffnen begann.
Es war ein Donnerstag, dieser 21. März 2013, als ich, Martin Schwarz, das Gefängnis als freier Mann verließ.
Keiner war da, der mich erwartet hätte.
Die Tasche umgehängt und den Koffer in der Hand, lief ich unsicher los, visierte die andere Straßenseite an und bemühte mich, einfach nur geradeaus zu schauen.
Der hupende Linienbus erschreckte mich beim Überqueren der Straße. Ein Jogger hechelte kopfschüttelnd mit seinem kläffenden Hund vorbei, ein Radfahrer wich mir mit einem Schimpfwort wütend aus … Mein Gott, war das normal? Irgendwie fürchtete ich mich vor dieser neuen Welt hier draußen, war nervös und verdammt einsam.
Nachdem der Schock nachgelassen hatte, winkte ich ein Taxi heran, das mich durch Berlins überfüllte Straßen zum Flugplatz brachte.
Die freundliche junge Frau hinter dem Lastminute Schalter riet mir, das „Mistral“ auf Mallorca zu buchen, weil sie kürzlich erst selbst in diesem spanischen Hostal war und mir das Eldorado der Deutschen in El Arenal an der Playa de Palma bestens empfehlen könnte. Also entschied ich mich für dieses günstige Urlaub-Sorglos-Paket. Mein Ziel war nun für die nächsten acht Tage präzise definiert.
Die Woche Urlaubsfreude, in der sich mir das Leben endlich wieder von seiner liebenswerten Seite gezeigt hatte, ging viel zu schnell vorbei.
Am Morgen meiner Rückreise öffnete ich das Fenster, wollte noch einmal den Duft des Meeres mit allen Sinnen einfangen und überlegte mit innerer Zerrissenheit: Soll ich bleiben, für immer vielleicht? Einfach den Rückflug verfallen lassen und frei sein? Ob hier ein neues Leben und neue Chancen vor mir liegen könnten? Immerhin hatte ich diesmal die Reise ohne Lasten der Vergangenheit angetreten.
Eine innere Stimme warnte mich zwar zur Vorsicht und doch war ich neugierig.
Mein Kopf sagte nein, aber mein Herz schrie ja. Noch unentschlossen schaute ich in den Spiegel über der kleinen Kommode. Ein wankelmütiger, fünfzigjähriger Mann blickte mir da entgegen, durch dessen dunkles Haar sich erste graue Strähnen zogen.
„Was denn nun, du eitler Gockel“, knurrte ich mir selbst zu. Das Herz hatte dann doch gewonnen, allerdings wird diese unglückliche Entscheidung bald für eine Menge Zündstoff sorgen.
An der Rezeption buchte ich für weitere vier Wochen Sonne, Meer und Strand.
Durch ein Zeitungsinserat, das mir ganz zufällig in die Hände fiel, lernte ich Carlos Moreno, den Chef der Hausbaufirma „LA CASA“, kennen und hatte Glück. Schon ein paar Tage später begann ich bei ihm als Bauarbeiter zu arbeiten.
Trotz meiner Ausbildung als Bauingenieur war ich mir für keine Arbeit zu schade, packte überall mit an, gab alles. Carlos schien das sehr zu schätzen. Im Laufe der letzten Monate war er für mich sogar fast ein Ersatzbruder geworden. Zu ihm konnte ich mit meinen großen und kleinen Problemen kommen. An den Wochenenden verbrachten wir sehr viele mediterrane Sommernachtssausen und hatten einen Heidenspaß dabei. Mit mir und der Welt war ich längst im Reinen, glaubte angekommen zu sein, doch mein Hochgefühl war leider nicht von langer Dauer. Seit ein paar Wochen merkte ich, dass die Auftragslage immer lauer wurde - die Zeiten wurden schlechter. Es war ein sehr heißer Vormittag im Juni, als mich Carlos in sein Büro rief. Obwohl die grünen Klappläden vor den Fenstern geschlossen waren, drang extreme Mittagshitze herein. Die Klimaanlage arbeitete auf Hochtouren, mir kam es vor, als rattere sie heute viel lauter, als sonst.
Während ich eintrat, nahm er langsam die Brille ab und wischte sich, wie in Zeitlupe, über sein verschwitztes Gesicht. Dann nickte er kaum wahrnehmbar und holte tief Luft, bevor er betroffen sagte: „Tut mir wirklich leid, Blacky, aber …“
Ich verstand genau, was er meinte. Nur was ich in diesem Moment nicht verstehen konnte und was mich total fertig machte war, warum er mich in dem guten Glauben gelassen hatte, dass im Herbst alles besser werden würde! Ich habe ihm vertraut. Verhält sich so ein Freund?
„Schon gut. Bist mir keine Rechenschaft schuldig“, schnitt ich ihm das Wort ab, wollte überhaupt nicht mehr hören, was er mir noch zu sagen hatte.
Völlig schockiert drehte ich mich um und schritt zügig durch die offene Tür. Carlos hielt mich nicht einmal auf, sagte nicht: „Warte noch“. Er fand es offenbar ratsamer, jetzt einfach zu schweigen.
Maßlos enttäuscht, konnte ich überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die Gewissheit, jetzt mittellos in einem fremden Land zu sein, machte mir Angst. Ich hatte keine Ahnung, was nun passieren würde. Ich wusste nicht wohin mit mir, lief deshalb einfach ziellos durch den kleinen Küstenort El Arenal, bis dorthin, wo die schachbrettartigen Straßen und die wie Perlen aneinandergereihten Hotels abrupt endeten. Erst an der Steilküste, abseits vom Tourismus, machte ich Halt, setzte mich auf die warmen Steine und wollte nur noch allein sein. Nun hatte mich die Freiheit eingeholt. Ein krasser Gedanke. Alles stürzte gerade über mir zusammen. Existenzängste brannten sich schmerzlich in mein Herz hinein. Noch konnte ich mein bescheidenes Zimmer im Hostal bezahlen, obwohl mir Carlos bereits ein Monatsgehalt schuldete.
Unterdessen war es Abend geworden. Am Horizont ging allmählich die Sonne unter und zog einen pastellfarbenen Dunstsaum am Himmel entlang. Der Wind trug den Geruch von gegrilltem Fisch herüber und lockte eine Menge Möwen an, die so unermüdlich kreischten, als würden sie dafür bezahlt. Während ich grübelte, was nun werden würde, ohne Job, ohne Freunde und fast pleite, ließ sich ein junger Mann, vielleicht Anfang dreißig, neben mir nieder.
Es war Ben, ein deutscher Landsmann, äußerst gutaussehend, mit athletischer Figur, schulterlangem blonden Haar und wasserblauen Augen. Wenn er lächelte, gruben sich tiefe Grübchen in seine Wangen. Außer in Hochglanzmagazinen hatte ich noch nie solch ein Gesicht gesehen.
Wir tauschten zunächst einmal nur ein freundliches Hallo aus, bevor unser Gespräch ganz unerwartet sehr emotional wurde. Ben kehrte sein Innerstes nach außen, er schüttete sein Herz aus und eröffnete mir tiefe Einblicke in seine Seele. Er erzählte mir nicht nur, dass er jeden Abend hier sei, seit er die Miete für seine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte, sondern dass er nun in einer Höhle im Wald lebt, dass er nach einer Lösung für sein Problem sucht, aber keine findet, weil es auf der Insel kaum Arbeit gibt, dass das Elend in voller Wucht über ihn gestolpert ist und dass er nun Mut zur Schwäche braucht, um wieder Stärke zu erlangen.
Die hochtrabende Sprachweise des jungen Mannes überraschte mich. Merkwürdiger Typ, dachte ich und warf einen Kieselstein aufs Meer hinaus.
„Als Draußenmensch wird man gleichgültig, hart, gefühllos und verblödet mit der Zeit“, sprach er unbeirrt weiter. „Zuerst verliert man das Zeitgefühl, dann das Mitgefühl und später den Verstand. Mein Geist fängt langsam an zu verkrüppeln. Ich bin stumpfsinnig, einsam und bedeutungslos geworden. Nur hier oben auf der Klippe, kann ich einen Augenblick meinen Ängsten und Kümmernissen entfliehen.“
„Wird wohl so sein“, murmelte ich nicht besonders interessiert und zuckte dabei unbeholfen mit den Schultern. Schließlich war ich ihm erst vor einer halben Stunde begegnet, empfand seine Offenheit sogar ein wenig peinlich und außerdem hatte ich auch nur mit halbem Ohr hingehört.
Auf einmal huschte ein verträumtes Schmunzeln über sein braungebranntes Gesicht, das allerdings der inneren Anspannung nicht lange standhielt.
„Kennst du die Angst, die Furcht vor dem, was dein Boss von dir erwartet?“ Seine Stimme überschlug sich ziemlich aufgeregt und seine versteinerte Miene erschreckte mich. „Kennst du die Panik, keinen Erfolg zu haben, verachtet und lächerlich gemacht oder schlimmstenfalls sogar entlassen zu werden und dann alles zu verlieren? Als junger Fondsmanager war ich in New York, London und Berlin; habe dort richtig viel Geld verdient, aber mein Job war purer Stress.“
Ich nickte zaghaft. Oh ja, wenn du wüsstest, war mein insgeheimer Gedankengang. Ich fühlte mich jedoch außerstande etwas zu erwidern, weil mein eigener Kummer ähnlich und gerade viel zu präsent war.
Ben sah links an mir vorbei und musste mehrmals tief durchatmen, um sich wieder zu beruhigen.
„Damals suchte ich nach Ausreden, um meine Ängste zu verstecken“, sprach er mit zitternder Stimme weiter, „jagte verbissen zwischen all den Börsendaten hin und her, bis ich fast zusammenbrach, bis ich kurz vor einem Burnout stand und dann, dann kam auch noch der verdammte Crash an der Wall Street. Das Jahr 2008 zählt zu dem traurigsten Kapitel meines Lebens.“ Ben verstummte einen Moment, presste verkniffen seine Lippen aufeinander und wirkte unheimlich ratlos.
Ohne eine Antwort abzuwarten, klopfte er mir kumpelhaft auf die Schulter und stand seufzend auf.
Ich sah ihn ziemlich mitgenommen an. Was sollte ich sagen? Etwa, dass ich, verdammt noch mal, auch gerade entlassen worden war? Dass ich mich selbst auf dem besten Weg befand, obdachlos auf der Straße zu landen?
„Der Funke des Auswanderns will bei mir einfach nicht überspringen“, flüsterte er beim Aufstehen verzweifelt. „Komm doch ruhig mal wieder vorbei, Blacky. Nett, dich kennengelernt zu haben“, und während er das sagte, schaute er flüchtig auf seine Armbanduhr. „Oh, jetzt wird es aber Zeit, mit Leo zum ’Containern’ aufzubrechen. Das ist mein gegenwärtiger Job“, grinste er verbittert.
Bedrückt, von dem, was er mir im Turbogang aus seinem jungen Leben erzählt hatte, schaute ich ihm hinterher. Was mochte es sein, dass ihn antrieb, in einer Höhle zu hausen? Auf der Insel Fuß zu fassen, scheint wahrscheinlich nicht einfach zu sein, weil es tatsächlich zu wenig Arbeit gibt und die Insel ein teures Pflaster ist.
Andere plausible Antworten fand ich darauf nicht.
Im Augenblick erschien mir das auch nicht wichtig.
Wirklich wichtig war, endlich zum „Mistral“ zu gehen, um über mich selbst tiefsinnig nachzudenken.
„Du hast dich entschieden auf Mallorca zu bleiben, nun musst du das auch durchziehen“, sprach ich im Monolog mit mir und trabte los.
Mittlerweile waren meine finanziellen Reserven und die ursprüngliche Zuversicht auf dem Nullpunkt angekommen. Alle Erwartungen und Visionen von einem Neuanfang schmolzen wie Eis unter der mediterranen Augustsonne dahin. An welche Tür ich auch anklopfte, es öffnete sich einfach keine. Kein gutes Omen! Längst hatte ich nach und nach alles, was sich zu Geld machen ließ verkauft, bis nichts mehr zum Verkaufen da war. Schon seit einem Monat konnte ich die Hostal Rechnung nicht mehr bezahlen. Trotz etlicher Mahnungen ließ mich der Chef nur noch aus reinem Mitleid dort wohnen. Nun jedoch verlangte er sein Geld für die Unterbringung. Irgendwie konnte ich mich noch einmal aus der Sache herauswinden, erreichte letztmalig einen Tag Zahlungsaufschub, obwohl ich ganz genau wusste, dass ich auch morgen keinen Cent in der Tasche haben würde. Wie ein Hund bin ich davongeschlichen, um unangenehmen Fragen aus dem Wege zu gehen.
Mit quälenden Gedanken verbrachte ich schlaflos und gedemütigt die darauffolgende sehr lauwarme Nacht im nahegelegenen Park. Genau das war nicht mein Ziel, da wollte ich nie hin. Auf einer Bank wälzte ich mich ruhelos von einer auf die andere Seite und verfluchte mich für die eigene Fehlentscheidung, auf der verdammten Insel geblieben zu sein. Diese zermürbenden Zweifel mochten einfach nicht weichen und machten mir gerade das Leben furchtbar schwer. Irgendwie musste ich zu Zaster kommen.
Der nächste Morgen fing erstaunlich gut an. Irgendjemand hatte mir ein paar Münzen in die Mütze gelegt. Es schien ein positiver Tag zu werden.
Mein knurrender Magen lenkte mich ganz zufällig in die städtische Markthalle „Mercat de Olivar“.
Während mir allerlei köstliche Düfte durch die Nase zogen, wurde ich auf eine etwa sechzigjährige Spanierin aufmerksam.
Sie war beladen mit prallgefüllten Einkaufstaschen. Für einen atemberaubenden Moment sahen wir einander stumm und abwartend an. Sie war ziemlich aufgetakelt, hatte ein wenig hervorquellende Augen, war klein, vollbusig und auffallend geschminkt. Mit Sicherheit wirkte sie mindestens zehn Jahre älter, als sie erscheinen wollte. Doch noch bevor ich mir ein Bild von ihr machen konnte, kullerte alles, was sich noch Sekunden vorher in einer der Tüten befand, wild durcheinander über den schmierigen Boden. Ein Tragegriff war gerissen. Ihr panischer Blick irrte suchend umher und blieb schließlich flehend an mir hängen. Außerordentlich schnell sprang ich zu Hilfe, sammelte mit gentelmanhafter Geste Orangen, Pfirsiche, Zitronen und Mangos ein. Währenddessen überlegte ich, wie es wäre, mit ihr zu gehen? Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los, hämmerte wie verrückt durch meinen Kopf, denn die Señorita machte einen sehr wohlhabenden Eindruck. Vielleicht hätte sie als Wiedergutmachung einen Job für mich?
Indes ich auf dem Boden hin und her kriechend, mich an diesen Unsinn förmlich zu klammern begann, lag plötzlich ihre Geldbörse unter dem Marktstand - direkt neben meinem rechten Fuß. Sehr geistesgegenwärtig täuschte ich einen Hustenanfall vor und beobachtete mit angespanntem Blick, wie sie mit dem Umsortieren ihrer Einkäufe beschäftigt war, bückte mich blitzschnell und hatte sogleich die Beute fest in meiner Hand.
Was denn noch? Geh schon, verschwinde endlich, befahl ich mir selbst und eilte mit langen Schritten aus der Markthalle, bis mich das Menschengewühl in der Altstadt verschlungen hatte. Dicht an dicht schoben sich dort die Leute vor den Geschäften entlang, sodass ich wirklich Mühe hatte, zügig durch das Getümmel zu gelangen. Erst am „Cappuccino“ verlangsamte sich mein Tempo. Herzklopfend betrat ich das spanische Café, begab mich sofort in den Toilettenraum, verriegelte rasch die Tür hinter mir und riss hastig die Geldbörse aus meiner Hosentasche hervor. Ein dickes Bündel Geld kam sogleich zum Vorschein - bunte Euro-Scheine, meistens rote, vier grüne und zwei violette.
„Oh mein Gott ist das viel“, stammelte ich mit weit aufgerissenen Augen, während die Scheine zwischen meinen Fingern knisterten. Zwei-, dreimal musste ich von vorn beginnen, bevor ich ruhig zählen konnte.
Nicht mehr müde und gebeugt, sondern aufrecht und frohgelaunt, spazierte ich nun mit federnden Schritten ausgelassen zum „Mistral“ zurück, bezahlte mit einem lustigen Pfeifen meine Rechnung und checkte erneut für weitere vier Wochen ein.
Noch wusste ich nicht, welch unangenehme Ereignisse meinen Übermut bald dämpfen werden, dass diesem kurzen Glück, bald langes Leid folgen wird.
In meinem Zimmer untersuchte ich den Fund genauer. Etwa 1.300 Euro lagen gerade majestätisch vor mir.
Bist du jetzt ein kleiner mieser Dieb geworden, klopfte plötzlich mein Gewissen an. „Unsinn, entspann dich“, murrte ich leise vor mich hin, „Geld hat keine Moral und überhaupt, es gibt keine Moralbegriffe, wenn man nicht untergehen will. Das Leben hält eben immer wieder Überraschungen für einen bereit, gute und böse. Zu jeder Zeit. Kein Tag ist wie der andere.“
Mit kraus gezogener Stirn sah ich am Fenster stehend auf die Straße hinaus. An diesem späten Nachmittag war es trotz laufender Aircondition, unerträglich heiß in meinem Zimmer. Körperliches Unbehagen machte mich fast bewegungsunfähig. Die Haare waren bereits patschnass und mein T-Shirt klebte unangenehm an mir. Ich fühlte mich ausgebrannt. Diese innerliche Leere machte mich beinahe verrückt. Auf einmal war ich mir nicht mehr so sicher, ob man so einen, wie mich, auf der Insel überhaupt braucht, ob ich aus der Abwärtsspirale je wieder herauskäme.
Ganz unerwartet polterte es heftig an der Tür und im selben Augenblick stand Alex im Halbdunkeln des Flures. Ich war regelrecht verblüfft.
„Mich hattest du wohl nicht erwartet, was? Wie wäre es denn mit einem Lächeln, nach all den Monaten, die wir voneinander getrennt waren?“, grölte er gehässig und viel zu laut.
„Äh, ach, ein Besuch macht immer Freude. Entweder beim Kommen oder beim Gehen“, stotterte ich erschrocken, ohne auf seine Fragen einzugehen.
Meine Gedanken, die ohnehin von den Ereignissen des Tages völlig überlastet waren, überschlugen sich förmlich. Was wollte Alex von mir? Wie konnte der mich überhaupt hier finden? Über Kolja etwa? Den hatte ich nämlich ein paar Mal im Knast angerufen.
Irgendwie war mir nicht wohl in meiner Haut.
Alex schaute sich indes verhalten um und grinste herablassend. „Setz dich, setz dich doch dort hin, wenn du nun schon mal hier bist“, bot ich ihm, bemüht gefasst, meinen einzigen Stuhl an und versuchte distanziert eine zwanglose Unterhaltung zu beginnen.
Alex war nie mein Freund gewesen und würde es auch nie werden. Sein halbes Leben lang hat er geraubt, geschlagen, gedealt, betrogen und vergewaltigt. In der Gangsterszene ist er ein Heiliger und unantastbar die rechte Hand von Oleg, dem Boss der Russenmafia, der als „Lebenslänglicher“ die verschiedenartigsten Verbrechen aus dem Knast heraus managt.
Im Laufe unseres Gespräches kam er schnell zum Punkt. Es ging um Drogen, um einen Hightech Dealer Ring sogar. Wirklich perfekt, wie der Kerl schamlos seine Chance nutzte, um mich für seine miesen Geschäfte zu gewinnen.
„Kolja wird nächste Woche aus dem Knast entlassen. Der kommt dann auch auf die Insel. Er übt schon fleißig mit dem Joystick umzugehen“, erklärte er mir äußerst lauthals und unmissverständlich auf seine derbe Art.
Ich zögerte, antwortete zunächst nicht, betrachtete ihn nur erstaunt von der Seite.
„Du bist heute nicht gerade ein Quell der Freude“, fuhr er mich herausfordernd an.
„Ach ja? Mit dem Joystick? Heißt das, du kommst hierher, um mir das zu erzählen?“, hinterfragte ich mit einem künstlichen Lächeln und brach gleich darauf in schallendes Lachen aus.
„Bist du jetzt völlig bekloppt?“, brüllte er so laut, dass ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte. „Richtig, kleiner Scheißer. Irgendwann begreifst auch du das alles. Muss jetzt gehen, mich um mein Business kümmern. Hab` noch `nen Arsch voll zu tun, aber ich werde wiederkommen. Bah, viel geredet und nichts geklärt! Überleg`s dir bis dahin. Du hörst in den nächsten Tagen von mir.“
Schon war der Bursche verschwunden. Er kam kurz vor drei und war halb vier wieder weg.
„Idiot“, maulte ich irritiert, nachdem er die Zimmertür mit lautem Knall hinter sich zugeschlagen hatte und es sollte nicht das letzte Mal sein, dass er mich kopfschüttelnd zurückließ.
Eine Woche später hatte mir Alex eine schäbige Wohnung besorgt und holte mich eines Nachmittags vom Hostal ab.
In seinem protzigen Mercedes bogen wir in die Carrer Santa Florentina, eine kleine Straße inmitten Palmas Problemviertel Son Gotleu, ein. Auf der Suche nach einem Parkplatz raste der Kerl dreimal um den Block, bevor er den Wagen schließlich wutschnaubend im absoluten Halteverbot abstellte.
„Sind spät dran. Toni wartet schon eine gute Stunde auf uns. Scheiß drauf“, murmelte er gehetzt und eilte mit mir im Schlepptau, die paar Schritte zum Hauseingang hinüber.
Der, den er Toni nannte, stand bereits vor der Wohnungstür, als wir atemlos die Treppen hinauf gestürzt kamen. Er hatte einen Joint hinters Ohr geklemmt und einen weiteren in der Hand, an dem er genüsslich zog.
„Das ist Anton, kannst ihn Toni nennen“, rief mir Alex nun etwas wohl gestimmter zu. „Er ist hier im Kiez der Pate. Die Polizei frisst ihm quasi aus der Hand.“
„Die Bullen sind meine Freunde, fragen selbst nach Marihuana. Wer Dealer jagt, muss wissen, was er tut“, prahlte der Ganove in gutem Deutsch, während wir eintraten.
Auf einmal blieben Alex` Augen an meinen Schuhen haften.
„Was hast du eigentlich für schäbige Botten an! Geh` mal shoppen, vielleicht findest du was Passendes“, grölte er Sekunden später amüsiert mit verschränkten Armen. „Sehe dich morgen um elf in der Passate Picos de Urbio, Alte Bäckerei.“
Er richtete seinen Blick nochmals auf meine Schuhe, tippte sich dann hämisch kichernd an die Mütze und verschwand.
Wie angewurzelt stand ich da und starrte sprachlos, mit offenem Mund, auf meine Füße. Selbst Toni schielte kurzzeitig hin und kratzte sich dabei verlegen mit dem kleinen Finger auf dem Kopf herum.
Toni war ein wuchtiger Typ, eher klein, vielleicht ein Meter fünfundsechzig. Das kräftige Gesicht passte zu seinem Körperbau, es wirkte besonders breit, mit der fleischigen Nase, die mindestens einmal gebrochen war. Die gut gegelten schwarzen Locken hatte er glatt nach hinten gekämmt und wenn er sprach, strahlten mir zwei Reihen perfekte Zähne entgegen. Einige Falten, von Erfahrung und Leid gezogen, prägten seine harten Gesichtszüge. Ich schätzte ihn Anfang bis Mitte fünfzig. Meine Gedanken schweiften von ihm ab, als sein Handy keine Ruhe gab. Es klingelte zwei, dreimal, ohne dass er ran ging. Mit einem unwilligen Brummen griff er schließlich doch in die Hosentasche und drückte es mit dem Daumen aus. Daraufhin hatte er es plötzlich verdammt eilig. Noch im Gehen rief er mir zu: „Sehen uns um acht im ’Nico’. Ist gleich um die Ecke von hier!“
Als auch er weg war, blieb mir noch eine Stunde Zeit, um durchzuatmen. Tief seufzend lehnte ich mich an die vom Zigarettenrauch vergilbte Zimmerwand und ließ verhalten meine Augen durch den Raum wandern. Mit Grauen beobachtete ich, wie eine große Kakerlake, vielleicht acht Zentimeter lang, mit kupferfarbener Silhouette, gerade gemütlich den Küchenschrank hinauf spazierte und schließlich, ohne Eile zu haben, in einer Ritze verschwand. Wie eklig! Den aufkommenden Brechreiz konnte ich gerade noch mit einem ablenkenden Blick aus dem Fenster unterdrücken. Der elende Hof da draußen verbreitete jedoch auch nur eine bedrückende Atmosphäre. Mir blieb keine Zeit, weiter darüber nachzugrübeln, denn es war höchste Zeit, um zum „Nico“ loszugehen.
Während ich die Treppe hinabstieg, drang aus der unteren Wohnung das Kichern einer Frau, dann jauchzende Laute eines Mannes in einer Sprache, die ich nicht verstand und für Arabisch hielt, wenngleich der Tonfall mir genug verriet. Manche Dinge klingen eben in jeder Sprache gleich.
Schmunzelnd trat ich auf die Carrer Santa Florentina hinaus und stand schon nach wenigen Schritten direkt vor der Pinte, in der Toni bereits wartete.
Ich musste allerhand Geduld aufbringen, um durch die von zwielichtigen Gestalten dicht umlagerte Kneipentür zu gelangen. Toni beobachtete mich argwöhnisch dabei - wie ein Mafioso-Pate eben.
„Du bist also dieser unglückselige Knastbruder, der dringend Kohle braucht?“, begrüßte er mich zynisch grinsend.
Ich nickte, mehr zu mir selbst, als zu ihm und dachte über seine Worte nach.
„Alex meistert hier seine Bühne“, sprach er nach kurzem Zögern weiter, „obwohl er nichts Gutes zu bieten hat.“
„Das ist Alex. Ich kenne ihn ganz genau. Wenn der Ernst macht, dann …“
Neugierig lächelnd schob Toni seinen Stuhl näher an mich heran, in der Hoffnung mehr zu erfahren, ich fand es jedoch angebrachter, besser die Klappe zu halten und augenblicklich lag in seinem Gesicht eine Spur von merkwürdigem Misstrauen. Die Welt dreht sich auch ohne dich - bleib oder geh, signalisierte mir seine abfällige Mimik. Dann senkte er die Augen, als ob er sich auf eine schwierige Aufgabe vorbereiten würde, die ihm unverhofft zugefallen war. Das neugierige Lächeln von vorhin war schlagartig verschwunden, zeigte auf einmal nicht mehr die Spur von Begeisterung.
„Machst du nun mit oder nicht?“, war seine darauffolgende, beinahe rhetorische Frage gewesen. „Sag ja, das verkürzt die Diskussionen.“
Ich blickte ihn skeptisch an.
Schweißtreibende Angst und Selbstmitleid kämpften gerade in meinem Innersten um den ersten Platz. Daher schlug ich mir schwer atmend die Hände vors Gesicht, verstummte sogar kurzzeitig und glaubte, alle Energie wäre schlagartig aus mir gewichen. Als ich vorsichtig wieder aufsah, musterte mich Toni verdammt nachdenklich, noch nicht überzeugt, dass ich für meine zugedachte Aufgabe geeignet wäre.
Beidseitiges Nicken reichte dann schließlich doch aus, um den Packt mit der Unterwelt zu besiegeln. Eine Riesendummheit, wie sich später noch herausstellen wird, doch ich hatte einfach keine Alternative, wollte ich nicht bettelarm auf der Straße landen.
Im „Nico“ wurde es immer lauter. Die Stimmung eskalierte von einer Minute zur anderen bedrohlich. Es kam sogar zu einer handfesten Massenschlägerei. Stühle flogen quer durch die Pinte und ich hatte Mühe, nicht verletzt zu werden.
„Was für eine Keilerei. Wie im Kino!“, rief mir Toni triumphierend zu und grinste zufrieden dabei. „Hier bist du mittendrin, im sozialen Brennpunkt, im Armenviertel am Rand der Glitzerwelt. Das ist die grausame Fratze von Son Gotleu, unser Geschäft, Blacky. Morgen wird dich der Boss in unser Projekt einweisen. Die Alte Bäckerei, also das neue ’Little Harlem’, liegt nur zwei Straßen weit entfernt von hier“, erklärte er mir gutgelaunt und zündete sich seelenruhig eine Zigarette an. Erst als die brannte, stand der Kerl auf, verabschiedete sich von mir und verschwand im Kneipendunst.
Nun fühlte ich mich absolut verloren unter der aufgebrachten Meute. Deshalb verließ auch ich eine Viertelstunde später diese unheimliche Pinte.
Obwohl bereits grelles Licht durch die Fenster fiel, hatte ich das Gefühl, es wäre noch mitten in der Nacht. Aus der Nachbarwohnung tönte entsetzliches Kindergeschrei. An Schlaf war nun nicht mehr zu denken. So begann um Viertel nach acht mein erster Tag in Son Gotleu.
Mühsam wälzte ich mich hoch und betrachtete, von der Couchkante aus, mein neues Zuhause, das irgendwie noch dürftiger aussah, als ich es gestern empfand. Von fürchterlichen Rückenschmerzen geplagt, schleppte ich mich leidlich lahm unter die Dusche und schärfte dort meinen Überlebenswillen. Erst nach ausgiebiger Morgentoilette fühlte ich mich besser und ging erwartungsvoll los , um mich im Kiez etwas umzusehen.
Meine besondere Aufmerksamkeit richtete sich auf eine gegenüberliegende Pasteleria, aus der verführerischer Kuchenduft herausströmte. Ich musste einfach stehenbleiben, weil mir förmlich das Wasser im Mund zusammenlief. Mein Entschluss war soeben gefasst, mich in dieser spanischen Bäckerei mit Café con Leche und köstlichen Churros für Schlafmangel und Rückenschmerzen selbst zu entschädigen.
Der Vormittag war windstill und schwül. Von meinem Platz aus beobachtete ich Afrikanerinnen, mal in langen, farbenfrohen Kleidern, mal in viel zu enge Hot Pans gezwängt. Sie liefen geschäftig die Straße entlang oder saßen tratschend auf bunten Stühlen vor den Häusern. Das Milieu war unkonventionell gemixt mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen.
Wenngleich ich noch genügend Zeit zum Bleiben gehabt hätte, kam ich nach quasi dreißig Minuten nicht umhin zu gehen. Grund dafür war ein beißender Gestank, von faulen Eiern oder Jauche, der fürchterlich die Luft verpestete.
Gezwungenermaßen bummelte ich nun durch das verwahrloste Viertel und stand schließlich in einer stillen Seitengasse direkt vor dem „Little Harlem“.
Die kleine Sicherheitskamera über dem Eingang musste mich bereits entdeckt haben. Die Tür öffnete sich nämlich lautlos ganz von selbst, ohne dass ich den Klingelknopf gedrückt hatte. Ein hinterlistig grinsender Schönling, knapp eins fünfundneunzig groß, mit äußerst beeindruckenden Muskelbergen und etwa fünfundzwanzig Kilo schwerer als ich, stand vor mir. Sein Gesicht war auffallend kantig und hart. Er wirkte verdammt einschüchternd auf mich. „Hi, bin Ivan. Alex erwartet dich schon. Komm rein. Ich bringe dich zu ihm ins Büro“, empfing mich der Riese schroff. Die Kälte seiner Stimme und dieser schneidende Blick drangen wie Blitze durch meinen Körper.
Der Typ schien maximalen Wert auf stilvolles Aussehen und Charisma zu legen. Sein Sixpack Bauch schimmerte gut geformt durch das weiße Cotton Hemd und auch die dunkelblaue Baumwollhose saß tadellos. Eigentlich ein fast perfektes Männermodel, war meine Überlegung, indes der arrogante Affe schnippisch vor mir her tänzelte, als ginge es zu „Mallorca sucht den Super Arsch“.
Warme Luft strömte mir entgegen. Sie schien den gesamten Flur auszufüllen. Darin lag ein Geruch von Cannabis, der mich ein wenig zu beunruhigen begann.
Nachdem ich die „Höhle des Löwen“ betreten hatte, steckte ich lässig die linke Hand in meine Hosentasche, um meinen Herzschlag wieder auf eine halbwegs normale Frequenz herunterzuzwingen. Gleichzeitig fiel mein Blick auf die Ohrläppchen des glatzköpfigen Gorillas, die mindestens drei Karat in Form von mehreren kleinen Brillies schmückten. Sein rundes Gesicht wirkte allerdings heute ein wenig gelangweilt. „Willkommen in der Unterwelt“, begrüßte er mich arrogant und baute sich dabei wie ein Sumo Ringer vor mir auf. Das schwarze Versace Shirt betonte dabei elegant die breiten Schultern und schmiegte sich leger über die maßgeschneiderte Hose. Mich hätte es nicht gewundert, wenn „Toller Typ“ auf dem Shirt gestanden hätte.
„Du stehst gerade vor dem Boss des neuen ’Little Harlem’, einer der großen Clubkneipen des ’NDE’, also des ’New Dream Empire’“, fuhr er überheblich fort, zog genüsslich an seiner fast aufgerauchten Zigarre und blies mir den beißenden Rauch direkt ins Gesicht.
Obwohl mir das ziemlich unangenehm war, lächelte ich diese unglaubliche Unverschämtheit einfach weg und ließ meine zusammengekniffenen Augen in aller Ruhe durch sein Büro gleiten. Es war nicht besonders groß, aber elegant und sehr maskulin eingerichtet. Das Poster hinter ihm zeigte einen dynamischen, feurigen und prallen Stier. Ein echter Hingucker. An der Wand lehnte sein Rennrad, wahrscheinlich eine französische Edelmarke.
„Wenn ich mir das viele Leder und die edlen Hölzer betrachte, ein großartiges Ambiente, das du hier hast. Nicht mit deiner Zelle im Knast zu vergleichen“, lachte ich verhalten.
Seine Augen hatten jetzt die hellblaue Farbe von glänzenden Glasperlen angenommen. Er versuchte, entspannt zu wirken, bot mir lässig den Platz ihm gegenüber an, und doch bemerkte ich ein nervöses Zittern seiner rechten Hand, während er Wasser in die Gläser füllte.
„Übrigens Oleg, der Big Boss, will dich mit im Team haben. Er schätzt noch immer deine angebliche ’Durchsetzungsstärke’“, feixte er mich abfällig an. „Das respektiere ich natürlich. Meine erste Wahl bist du zwar nicht, aber wir müssen uns schließlich nicht mögen, um hier das Zombie Projekt durchzuziehen.“ „Worauf willst du hinaus, Alex?“
„Na ja, wenn man die Tour mit dem Teufel antritt, muss man wissen, wo sie schlimmstenfalls enden könnte“, war seine sarkastische Antwort auf meine naive Frage und für einen winzigen Augenblick huschte ein abscheulich eiskalter Ausdruck über das rosafarbene, fast faltenlose Gesicht dieses Bastards, so widerlich, wie ich es noch nie bei einem Menschen gesehen hatte - in den schwarzen Pupillen loderte förmlich der Wahnsinn.
Es dauerte ein paar Sekunden, bis er seine Selbstbeherrschung zurückgewonnen hatte.
„Auf den Balearen will ich der mächtigste Drogenboss werden“, grölte er kurz darauf unheimlich laut und schnippte nervös an seinem Feuerzeug herum.
Eine beängstigende Bemerkung. Geistig Beschränkte haben ja manchmal die geniale Begabung, aus Scheiße ein Vermögen zusammenzuraffen, überlegte ich angestrengt, ließ mir jedoch diese Gedanken nicht anmerken.
„Blacky, ich versuche, ganz ohne Umschweife zur Sache zu kommen“, begann er geheimnisvoll. „Wir produzieren eine neue Designer-Droge. Unsere ’Cloud Nine’ kann bei zu hoher Dosierung durchaus auf den menschlichen Organismus zerstörerische Nebenwirkungen zeigen. Man könnte sie auch als Kannibalen-Droge bezeichnen.“
Nun wusste ich wieder, wen ich vor mir hatte und ging davon aus, dass es sich bei dem sogenannten „Zombie Projekt“ um ein außergewöhnliches Geschäft handeln musste, doch ganz bestimmt keins, dass Hoffnung macht. Drogenboss! Ein Nichts, ein brutaler Haufen Dreck bist du zwielichtige Gestalt, dachte ich angewidert, während er sich auf die Kante seines Schreibtisches setzte und selbstverliebt das Stierposter betrachtete.
„Wir haben diese Psychodroge in verschiedenen Diskotheken getestet. Ein Bombengeschäft, verstehst du. Die Leute lieben den verbotenen Kick.“
Selbst, als der Kerl großkotzig beide Beine auf den Tisch legte, sich wichtigtuend eine Lakritzstange zwischen die Zähne schob und exzentrisch: „Willkommen im Club“, brüllte, hatte ich den Ernst der Lage noch immer nicht begriffen.
„Unsere Schaltzentrale für die Balearischen Inseln ist hier, im ’Little Harlem’. Spanische Drogen sind recht günstig geworden, vor allem Kokain und Heroin. Hiesige Drogenclans machen die Preise kaputt. Deren Drogen-Supermärkte gefallen uns gar nicht.“
„Drogen-Supermärkte?“, fragte ich entsetzt. „Wo sind die denn?“
„Auf Mallorca gibt es drei Bezirke, in denen die Clans ihre Drogen verkaufen: La Soledat, Son Banya und Son Gotleu. Son Banya, eine Barackensiedlung, ganz in der Nähe des Flughafens, ein Bezirk der Abtrünnigen, ist uns ein ganz besonderer Dorn im Auge. Es ist eins der ärmsten Viertel der Stadt, Palmas Favela, sozusagen und Drogenumschlagplatz Nummer eins.“
Zwei, drei entsetzliche Knasterinnerungen liefen gerade wie ein Film, durch meinen Kopf. Schockiert war ich mir auf einmal nicht mehr so sicher, ob ich den Vorstellungen von Oleg gerecht werden könnte. Diese Mischung aus Humor und menschlichen Abgründen bedrückte mich mehr, als ich eigentlich zulassen wollte. Sie trieb mir kalten Schweiß auf die Stirn.
„Wie viel Kilo Koks hast du für uns eigentlich damals im Knast vertickt?“, unterbrach Alex meine Gedanken.
„Deine Frage überrascht mich. Du und Kolja, ihr wart doch meine Drogenbosse. Viel zu viel, vermutlich.“
„He? Willst du mit uns wieder richtig Kohle machen oder was willst du hier? Als Team holt uns nicht mal der Teufel ein. Vertrau mir einfach!“
„Wieso sollte ich dir vertrauen?“
Sein Blick verfinsterte sich nach dieser Frage zunehmend. Sein Mund wirkte urplötzlich bedrohlich schmal und klein. Hatte ich mich jetzt etwa zu weit vorgewagt?
„Weil du keine andere Wahl hast!“, kreischte er übertrieben lachend mit einer Stimmenfrequenz los, die schon schmerzte und tippte dabei mit einer schwungvollen Handbewegung auf sein iPad.
Oleg, der Big Boss, erschien augenblicklich mit einer Videobotschaft aus dem Knast an mich: „Guten Tag, Blacky. Ich habe Alex beauftragt, auch dich für eines unsere Projekte zu gewinnen. Wir drehen schon jetzt das Rad satt im Plus. Um uns von primitiven Dealer Clans abzuheben und den gigantischen Markt absolut zu beherrschen, arbeiten wir mit modernen Frachtdrohnen. Dich und Kolja brauche ich, um die Fracht von Highspeed Booten, die die Ware auf die Insel bringen abzuholen und zu unseren mallorquinischen Druggates der Großhändler zu steuern. Das ist für den Drogenhandel eine neue Dimension. In Alex’ Büro befindet sich ein Drohnen-Simulator. Wenn du dich jetzt an die Arbeit machst, bleibt mir nur noch, dir Erfolg zu wünschen.“
Plötzlich war er vom Bildschirm verschwunden. Verblüfft sah ich zu Alex hinüber, der abwartend mit zusammengekniffenen Augen immer noch auf seiner Lakritzstange herumkaute.
Mir war auf einmal verdammt mulmig zumute. „Speed Boote? Drohnen? Druggates? Was habt ihr mit mir vor? Das geht doch nicht lange gut. Steht da nicht zu viel auf dem Spiel?“, fragte ich empört nickend, als wollte ich meinen eigenen Bedenken zustimmen.
„Was sollen wir schon mit dir vorhaben? Du kennst dich doch aus, mit dem Verticken von weißem Schnee. Ist jetzt nur ein bisschen moderner geworden.“
„Bring hier bloß nichts durcheinander! Ich habe noch nie Kannibalen-Drogen verkauft“, versuchte ich mich heftig schluckend zu verteidigen.
„Welches Risiko hättest du denn gerne? Glaube nicht, dass ich dir irgendetwas erklären muss. Mein Geschäft geht dich einen Dreck an“, keifte er ziemlich grantig über den Tisch und sprang wütend auf, um mir diesen Simulator zu zeigen.
Zunächst starrte ich wie ein gelähmtes Kaninchen auf den Monitor. Nach und nach blendete jedoch Faszination all meine Zweifel aus. Mit kindlicher Freude versuchte ich diese gewaltigen Drohnen zu steuern. Meine Bedenken lösten sich plötzlich wie in Luft auf. Ich fühlte mich gerade, wie mittendrin in einem Actionfilm und hatte sogar die naive Hoffnung, irgendwie lässig alles selbst regeln zu können.
„Mit dem roten Knopf löst du eine brutale Schusswaffe aus, die nur auf meinen Befehl zum Einsatz kommt“, erklärte mir Alex Minuten später in strengem Ton. „Nun daddele mal ein bisschen herum. Morgen wirst du mit unserem Coach spezielle Übungen und Situationen trainieren. Falls der anschließende Test positiv ausgeht, bist du ein Operator des NDE.“
Obwohl das die grausamsten Lehrpläne der Welt waren, gab ich mir große Mühe, alles genau zu verstehen, bestand tatsächlich und war fortan einer von Alex` Druggate Operatoren. Ein paar Tage später kam tatsächlich Kolja in unser Team und das Projekt „Cloud Nine“ nahm seinen tragischen Lauf.
Immer abends, an sieben Tagen in der Woche, brachte uns ein schwarzer Kleintransporter zu dem äußerlich unauffälligen Frachtcontainer. Dieser Blechkasten, unser Arbeitsplatz, der das Innenleben eines Düsenjet-Cockpits, hatte, war sehr funktional eingerichtet: Drehsessel, Konsolen mit Joysticks, moderne Videotechnik, Außenkameras und jede Menge Monitore - Hightech auf engstem Raum.
Seit Wochen nahmen wir von Speed Booten tausende Drogenlieferungen auf, hatten es gelernt, die Ware mit großer Präzision an vorgegebene Ziele zu bringen. Kolja und mich verband inzwischen sogar eine lockere Männerfreundschaft.
Heute war es besonders hektisch. Seit Stunden gab es zig Aufträge. Das nächste Ziel sollte eine alte Finca in unmittelbarer Nähe sein. Alex meldete sich plötzlich fürchterlich aufgeregt. Irgendetwas schien nicht in Ordnung zu sein.
„Vermutlich eine Falle, eine Falle“, blökte er durch die Lautsprecher unserer Computer und genau in dem Moment sahen wir auch schon eine männliche Gestalt zu Fuß in Richtung des Containers eilen, dann noch eine und noch eine. Die Bilder waren so fantastisch klar, dass wir sogar die angespannte Mimik der Männer erkennen konnten.
„Alle beweglichen Objekte zerstören“, war kurz darauf sein hektischer Befehl an uns beide.
Ich hielt die Luft an, war völlig panisch, während Kolja, ohne nochmals nachzudenken, den roten Knopf drückte.
Entsetzliche Schreie machten mich völlig bewegungslos. Kolja jedoch erklärte Alex wie ein Roboter: „Befehl ausgeführt“. Danach war es einen Moment lang, mucks Mäuschen still. Welch trügerische Ruhe!
Alex` nächste Anweisungen vernahm ich nur noch wie aus weiter Ferne. Augenblicklich zeichneten sich grausame Bilder auf meinem Screen ab. Die Kameras der Drohnen hatten hochaufgelöste Aufnahmen gesendet. Ekelerregende Überreste der Leichen lagen halbkreisförmig verteilt auf dem steinigen Boden umher. Überall war Blut zu sehen - auch Gehirnpartikel und Fleischfetzen. Die Männer waren in tausend Stücke zerrissen worden.
„Du bist ein Mörder, Kolja! Tod nach Checkliste“, schrie ich Haare raufend mit weit aufgerissenen Augen durch den Container.
„Mach dich doch nicht lächerlich. Die Jungs haben eben Pech gehabt“, versuchte mich der Kerl mit einer beschwichtigenden Handbewegung zu beruhigen und lachte auch noch schallend auf dabei.
Ich war so verstört, dass mir regelrecht die Luft wegblieb, doch das berührte ihn überhaupt nicht.
„Wir töten sie und sie töten uns. Ein Spiel zwischen den Clans auf Leben und Tod. Das ist der Teufelskreis in unserem Job“, rief er mir stolz, wie ein Sieger zu und stocherte nochmals in den Aufnahmen herum, zoomte sich binnen Sekunden jede einzelne dreihundertsechzig Grad Zeitlupenaufnahme heran. „Das Hochgeschwindigkeitsgeschoss durchschlug direkt die Schädel und zerstörte durch die Rotation der Projektile deren Gehirne. Bah, selbst ihre Augäpfel und die Zähne sind förmlich explodiert“, murmelte er grinsend, mit einer Art Galgenhumor, vor sich hin.
„Verdammt, warum meldet ihr euch nicht mehr“, fauchte Alex plötzlich durch die Leitung. „Wie lange könnt ihr noch in der Luft bleiben?“
„Eine knappe halbe Stunde“, antwortete Kolja lässig zurückgelehnt.
„Beide Drohnen zu den Ausgangskoordinaten zurückleiten. Schluss für heute“, war Alex` missgelaunte Anweisung. „Kolja, das war ein hinterhältiges Abschlachten!“, brüllte ich ihn kurz darauf völlig außer mir an und wollte hektisch die Containertür aufreißen, um kopflos hinauszustürzen.
„Bleib hier und reg dich ab. Den Schweinkram da draußen räumen andere weg, ist nicht unser Job.“
Kolja legte den Kopf leicht nach hinten, nachdem er das gelangweilt genuschelt hatte und mir entging nicht, wie mich dabei argwöhnisch seine Augen taxierten.
„Wenn wir den roten Knopf drücken, fällt der Tod vom Himmel. Ich mache das nicht mit, verstehst du! Das war ein regelrechtes Massaker!“, heulte ich wie ein Irrer los, rüttelte wütend seinen Oberkörper und war im Begriff, zuzuschlagen, doch er wehrte mich herablassend ab, stand empört auf und ging beleidigt zur Tür, denn inzwischen wartete schon der Transporter, um uns zurück zum „Little Harlem“ zu bringen.
Während wir schweigend durch die Nacht fuhren, dachte ich über Gewalt, Misstrauen und Hass nach. Drohnen töten sogar Menschen. Das sind jetzt die modernen Kalaschnikows.
Unregelmäßigkeiten klären sich blitzschnell aus der Luft. Wie absurd! Und doch ist sie schon beinahe fast genial, diese künstliche Intelligenz.
Unterdessen waren wir am „Little Harlem“ angekommen. Ob der mich bei Alex verpfeift, war noch mein letzter Gedanke, nachdem sich Kolja nur mit einem stummen Kopfnicken von mir verabschiedet hatte.
Ich musste mich unbedingt abreagieren.
In mir tickte gerade eine Art Zeitbombe und so beschloss ich noch kurz in die Spelunke hineinzugehen, um mir einen Schlaftrunk zu holen.
Dumpfe Technomusik hämmerte da drinnen aus allen Boxen - ein elektrisierender, metallischer Höllenlärm, nach dem dunkle Gestalten beharrlich ihre Köpfe wogen oder ausgelassen, in dem immer gleichbleibenden Rhythmus der Beats hüpften. Alle waren exzentrisch und überdreht in Bewegung. Menschen, die auf diese Weise heiter sind, waren eigentlich unerträglich. Plötzlich bemerkte ich hinter mir Streit zwischen einer Gruppe junger Männer, der entsetzlich ausuferte. Messer blitzten und Blut spritzte an die Kneipenwand. Die Drogenwelt entrollte hier ihren eigenen Krimi. Für den Bruchteil eines Augenblicks erlebte ich letzte Klarheit über die Wirkung der Psychodroge „Cloud Nine“. Während sich diese Menschen, die sich gerade in wilde Bestien verwandelt hatten, tobend gegenüberstanden, erkaltete meine Sympathie für die Aussicht des schnellen Geldverdienens. Mein schlechtes Gewissen nagte wie ein Wurm an meinen Nerven. Ich konnte das nicht mehr aushalten, zahlte und ging.
Todmüde stieg ich die knarrenden Stufen zu meiner Wohnung hinauf und war einfach froh, endlich Ruhe zu finden. Doch ich lag hellwach im Bett, blickte ins Dunkle und überlegte, was für eine Null ich geworden bin, ein Nichts, ein schäbiger, feiger, kleiner Dealer Rebell.
In solch ausweglosen Momenten musste ich oft an meine Mutter denken. Jetzt bräuchte ich ihren Trost, ihre Arme, und ihr Lächeln. Und Vater, der Bäcker war, den sie liebevoll Hänschen nannte? Von ihm sind nur noch dunkle Abrisse in meinem Gedächtnis hängengeblieben. Als ich die Augen schloss, sah ich jenes rote Muttermal auf seiner rechten Gesichtshälfte. Er verließ uns, noch vor meinem sechsten Geburtstag, ging nach Spanien, ohne sich je wieder zu melden. Sein Verschwinden hat für uns fatale Folgen gehabt. Mutter wäre daran fast zerbrochen.
Die schweren Jahre haben uns beide zusammengeschweißt. Ich mochte ihre sanfte Stimme, wenn sie mir Geschichten vorlas oder abends Lieder am Bett sang. Sie war da, wenn ich sie brauchte, verstand mich auch in schwierigen Situationen. Bei ihr fand ich immer eine tröstende Auszeit, solange, bis ich weiter machen konnte. „Mach dir nichts vor, Junge, stell dich den Tatsachen, es gibt keine Abkürzungen im Leben. Sehe der Wahrheit ins Auge und lerne aus deinen Fehlern, sonst wirst du eines Tages ein Niemand sein“, waren ihre Lieblingssätze.
All diese Gedanken rasten in meinem Kopf hin und her, als ob sie ein Wettrennen gewinnen wollten, bis mich Viertel nach neun, das Schnarren des Handys aus den Erinnerungen längst vergangener Tage riss.
„ALEX“, las ich auf dem Display.
„Sehe dich um elf“, sagte er kurz angebunden und noch bevor ich das bestätigten konnte, war unser Gespräch beendet.
Pünktlich auf die Minute betrat ich mit einem freundlichen Hallo sein Büro.





























