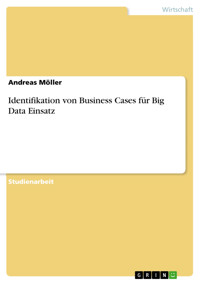Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Als sich der Werbegrafiker Andreas Nießen (1906–1996) in die bereits bei UFA-Größen wie Heinz Rühmann und später führenden »Kulturschaffenden« wie Christa Wolf beliebte Künstlersiedlung zurückzog, hatte er bewegte Jahre hinter sich. Ab 1927 leitete er die Eigenwerbung des einflussreichen Berliner Zeitungsverlags Mosse, erhielt 1937 Berufsverbot wegen der Ehe mit der Jüdin Ella Mayer, die nach der Scheidung mit der gemeinsamen Tochter nach Amsterdam floh und nur knapp der Deportation entging. Er überstand den Einsatz in der Propagandakompanie an der Ostfront und zog 1954 mit seiner zweiten Familie an den Rand Berlins, wo er sich neu erfand als Gestalter von Auftragswerbung für volkseigene Betriebe und DDR-Ministerien. Als seine Arbeiten als »unsozialistisch« verworfen wurden, geriet er in die Fänge der Staatssicherheit, die ihn als Kopf eines oppositionellen Kreises von Künstlern und Intellektuellen überwachte. Kleinmachnow als zeitentrücktem Ort kam dabei eine vergleichbare Rolle für die sozialen Interaktionen im Künstlermilieu zu wie etwa dem Weißen Hirsch in Dresden für das dortige Akademikermilieu, das sich vom Sozialismus abkapselte – und durch seine Inselbildung zugleich gut für diesen sichtbar war. Am Rande Berlins lebt die Intelligenz erzählt die Geschichte eines tief in das 20. Jahrhundert verwickelten Künstlerdaseins. Es ist die Geschichte eines Überlebens und der politischen Kompromisse in der Kultur- und Medienszene von der Weimarer Republik bis zur Wiedervereinigung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Juliane, Johannes, Kati und Thomas.
Für Ulrike und Stefan.
Und für Markus.
»Kleinmachnow ist kein Ort. Kleinmachnow ist eine Weltanschauung.«
Harald Kretzschmar
Inhalt
Einleitung
Vom Kaiserreich nach Weimar: Wandervogel und Lebensreform
Erste Arbeiten in Köln: Ideale des Werkbunds
Metropolis: Im Bann der Leuchtreklamen und Extrablätter
Siemensstadt: Gebrauchsgrafiker in Nazi-Deutschland
Grunewald: Kunst und Staat
Potsdam: Goethes Farbenlehre und die Diktatur
Auf dem Rücken der Pferde: In den Krieg
Riga 1944: In der Propagandakompanie
Wintzingerode: Aus dem Osten ins Eichsfeld
»Am Rande Berlins«: Neustart als Grafiker in der DDR
Oranienburg: Scheitern des Deutschen Ärzte-Kalenders
Erlenweg: Jahr der Stasi-Überwachung
Sonnenhag: Resignation und Rückzug
»Zu lange die alten Männer verehrt«: Vorwende und Mauerfall
Nikolskoe: Spazieren an der Pfaueninsel
Nicht mehr bei Gott: Letzte Jahre
Schweigen und Parolen: Mein Großvater und ich
Anmerkungen
Danksagung
Andreas Nießen am Strand von Prerow, 1956
Einleitung
Als die Mauer gefallen war, fuhr ich zu meinen Großeltern nach Kleinmachnow, die nahe der ehemaligen Grenze zum Westberliner Stadtteil Zehlendorf unter Kiefern und Birken lebten, bewacht von den Rufen der Eichelhäher.
Es war der Sommer 1990. Das Gefühl des Neuen lag in der Luft und mischte sich mit dem jugendlichen Hunger nach Leben. Wir hörten Bands wie Sandow und Feeling B, die D-Mark war nun auch im Osten Zahlungsmittel, und Deutschland wurde durch ein Tor von Andreas Brehme Weltmeister. Die Wende hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können.
Gleichzeitig schlossen viele Betriebe auch in meiner Heimatstadt Rostock. Der Frust der Erwachsenen über die Entwertung der eigenen Arbeit und die Sprachlosigkeit im SED-Staat übertrug sich auf uns. Die Stimmung war euphorisch und gereizt zugleich. Schlägereien in Diskotheken oder in der S-Bahn nach Warnemünde waren an der Tagesordnung. Mit verstörender Härte brach sich Bahn, was lange unterdrückt geblieben war. Nachrichten über »Bordsteinkicks«, die Angst am Hauptbahnhof mit der E-Gitarre über der Schulter, der Hubschrauberlärm im Unterricht während der Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992: Sie gehören zur Erinnerungsschicht jener Jahre.
Zur selben Zeit kam ein Berufsberater in die Klasse und fragte nach unseren Zukunftsplänen. Da ich die Wende mit Montagsdemonstrationen und einer Jugendkultur, in der es nur »rechts«, »links« oder »stino« für »stinknormal« gab, als Politisierung erlebt hatte und für die neue Schülerzeitschrift schrieb, gab ich vorlaut »Redakteur« an. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete und wie man das wurde. Die lokale Ostsee-Zeitung stand zudem im Ruf, eben noch Parteiorgan gewesen zu sein. Doch da ich jetzt so oft es ging nach Berlin fuhr, lag es nahe, mir ein Herz zu fassen und beim Tagesspiegel anzufragen, der seine Adresse in der Potsdamer Straße hatte.
Die Idee – im Grunde war es eine Ansage – kam von ihm. Mein Großvater war bereits über achtzig und gab mir nur selten Ratschläge. Aber da er ein halbes Jahrhundert mit Werbeanzeigen, Plakaten und Büchern zu tun gehabt und sich schon im Berlin der Zwanzigerjahre einen Namen als Grafiker gemacht hatte, willigte ich ein.
Ich hatte in der DDR nicht gelernt, Türen ins Unbekannte aufzustoßen und selbstbewusst einen Anspruch zu artikulieren, wie ich es im Unterschied zu manchem West-Kommilitonen noch Jahre später nicht ohne Scham spüren sollte. Entsprechend groß war meine Nervosität. An jenem Morgen sagte mein Großvater etwas zu mir, das ich nicht vergessen habe. Vielmehr ist es, als hörte ich seine Stimme ganz nah, den im Osten seltenen rheinischen Akzent, der in diesem Moment etwas umso Fremderes hatte, als wollte er andeuten: Wie kannst du nur?
Als er mich im T-Shirt im Flur stehen sah, sprach er vorwurfsvoll, ich solle umkehren und mir ein gebügeltes Hemd anziehen. »Die Journalisten sind doch alles konservative Leute!« Es klang wie eine Warnung. Aber es war nur Ausdruck einer Sozialisation, die er so tief verinnerlicht hatte, dass auch die Arbeiter- und Bauerndoktrin seinen inneren Kern nicht berühren konnte, wie es später im Bericht der Staatssicherheit hieß. In seiner ganzen Traditionsversessenheit, die ihm in künstlerischen Dingen zu eigen war, hatte er die Jahrzehnte in der DDR einfach überwintert. Er knüpfte nun 1990 noch einmal an das an, was er sich auf seinem langen Schaffensweg als Kompass angeeignet hatte. Er war sich seines Urteils so sicher, dass ich es nicht wagte, dagegen aufzubegehren.
Trotz des gestärkten Hemdes, das er mir borgte, kam ich nicht weiter als bis zum Pförtner, der mir eine Telefonnummer in die Hand drückte. Vom Tagesspiegel habe ich nie wieder etwas gehört. Dafür machte ich im Sommer darauf mein erstes Lokalpraktikum bei den Norddeutschen Neuesten Nachrichten, dem Konkurrenzblatt der Ostsee-Zeitung. Niemand sah hier so aus, wie ich es nach seinen Schilderungen vermutet hatte. Die Aschenbecher quollen über, an den Wänden hingen notdürftig drapierte Wochenplaner mit dem Symbol des Rostocker Zoos. Glamourös fühlte sich der Journalismus nicht an. Konservativ und erhaben wie auf Schwarzweißfotos von Barbara Klemm, auf denen Joachim Fest am Schreibtisch sitzt, auch nicht. Wie alles andere war auch die Redaktion im Umbruch. Redakteure gingen, und die, die blieben, suchten einen neuen Ton, ohne ihr bisheriges Leben zu verleugnen. »Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen«, dichtete Volker Braun in dieser Zeit: »Und unverständlich wird mein ganzer Text.«1
Heute, dreißig Jahre nach dem Tod meines Großvaters, sehe ich ihn wieder vor mir, so wie er in meiner Erinnerung immer aussah. Helle Hose, Hemd mit Binder, gestrickter Pullunder, Rasierwunde am Kinn, das weiße Haar nach hinten gekämmt, die Augenbrauen buschig, seine abgeschlagene goldene Glashütte am Handgelenk. Er sitzt in seinem Sessel und blickt wortlos in den Raum. Hinter ihm ein volles, fast chaotisches Bücherregal, in dem ich Namen wie Hieronymus Bosch, George Grosz, John Heartfield, Otto Dix, Kuhns Allgemeine Kunstgeschichte und Die Geschichte der Menschheit von Hendrik van Loon entziffern kann. Als wären es eigens zu diesem Zweck aufgestellte Werbeschilder, die ihren Besitzer bei Fremden einführen sollen, damit er selbst keine Anstalten dazu machen muss.
Wir haben oft nur so dagesessen, ohne zu sprechen, während meine Großmutter stets leidenschaftlich mit mir diskutierte und dabei vergnügt an ihrer Ernte 23 zog. Oder sie rührte sekundenlang in ihrer Teetasse, dass man verrückt werden konnte. Sie hatte schöne Sommersprossen im Gesicht und so viele Altersflecken auf den Händen, als wären sie tätowiert. Werktags wie sonntags trug sie eine helle Bluse, die ihr etwas Vornehmes gab. Sie sah der Schauspielerin Ilse Werner nicht unähnlich, die ihre großen Erfolge im Nationalsozialismus feierte und in zweiter Ehe seltsamerweise ebenfalls mit einem Herrn Nießen, nämlich dem Komponisten Josef Nießen, verheiratet war.
Oft reichte »Oma Ruth« Waffelröllchen, die sie in einer runden Quality-Street-Dose aufbewahrte. Das machte es einfacher, sie zu lieben, wenn sie die Dinge in der ihr eigenen Schärfe kommentierte. Oder mit einer mahnenden Grimasse zum Ausdruck brachte, dass man beim Abtragen des Geschirrs in die Küche helfen solle. Dazu klatschte sie in die Hände wie eine Sportlehrerin: »Alle Mann, alle Mann!«
Er hingegen redete kaum, ereiferte sich nur selten, war für mich unerreichbar, auch wenn wir uns gegenübersaßen. Er war da und war doch nicht da. Mein Großvater schwieg und rauchte, meist Sumatra, deren feuchte Mundstücke ich musterte, um sie dann mit dem Finger im Aschenbecher zu berühren, wenn er nicht hinsah. Er saß wie hinter einer Glaswand, was auch mit seinem regungslosen Blick zu tun hatte, weil die Augen ihn zunehmend im Stich ließen. Und wenn er etwas sagte, dann war es ein »Setz dich mal her, Sohnemann« oder ein gepresstes »Maline«, mit dem er meine Großmutter rief, wenn er das Gefühl hatte, sie sei nun schon zu lange weg, in der Küche oder im Keller (ich weiß nicht, warum er sie so nannte, ihre Vornamen waren Ruth Dorothea Luise). Und wenn sie schließlich zur Tür hereinkam und »Andres?« sagte, entgegnete er nichts, sondern nickte nur und zog an seiner Zigarre.
Er sprach dafür durch seine Bilder, die überall im Haus hingen, es einnahmen, ja fast erdrückten. Es waren Skizzen und Zeichnungen, eine Ansicht des wiederaufgebauten Potsdams, Aquarelle aus der Nachkriegszeit im Dorf Wintzingerode im Eichsfeld, wo meine Mutter und ihre beiden Geschwister wegen der Bombardements auf Berlin aufwuchsen. Porträts von Schauspielern und Ärzten aus den umliegenden Städten Duderstadt, Worbis und Heiligenstadt. Und das Ölgemälde des Grafen von Wintzingerode, den alle im Dorf nur »Onkel Major« genannt hatten, datiert auf das Jahr 1948. Es waren Bilder, die gelebtes, zum Teil erlittenes Leben spiegelten, das mir damals noch nicht vor Augen stand, nicht vor Augen stehen konnte.
Ich wusste lange nichts von seinen Geldsorgen in der Weltwirtschaftskrise und seinem Berufsverbot 1937. Nichts von der Ehe mit einer jüdischen Frau namens Ella Mayer und der gemeinsamen Tochter Eva vor meiner Mutter. Von ihrer Flucht nach Holland kurz vor Kriegsbeginn. Und von den möglichen Schuldgefühlen, die er nach den Erlebnissen in der Propagandaeinheit an der Ostfront mit sich herumtrug. Nichts von dem, was er im Krieg hatte mitansehen müssen. Nichts vom Neustart als Grafiker in der DDR. Ich wusste auch nichts von den Repressalien, die nun folgten, der Stasi-Überwachung und dem Rückzug in eine Welt, die wie ein Versteck war, in dem er nach all den Orts- und Wohnungswechseln angekommen war. Hier war er zu Hause, im geheimen Kleinmachnow, hatte die letzte und entscheidende Ausfahrt seines Lebens genommen.
Der auch außerhalb Berlins bekannte Ort spielt für seine Biografie eine wichtige Rolle. In Kleinmachnow fanden die sozialen Interaktionen von Künstlern und Intellektuellen in seinem Umfeld statt, vergleichbar mit dem Klischee des Viertels Weißer Hirsch in Dresden für das dortige akademische Milieu, das sich vom Sozialismus abkapselte – und gerade dadurch gut lokalisierbar war. Christa Wolf, die bis zu ihrem Umzug nach Pankow in Kleinmachnow lebte, steht exemplarisch für diese Ambivalenz. Ein Subkosmos »abgeschnitten vom Strom der Zeit«, wie man über Peter Huchels Wohnhaus in Wilhelmshorst bei Potsdam schrieb.2 Und zugleich ein drastisches Sinnbild der Teilung und des geduldeten Ungehorsams, dessen Symbol auch mein Großvater war.
Wolf Biermann hat nach dem Mauerfall nicht ohne Selbstgerechtigkeit das Wort vom »Schrebergarten der Stasi« geprägt, den er hinter der alternativen Subkultur des Prenzlauer Bergs ausmachte. Ein Ort, der dadurch charakterisiert gewesen sei, dass er im Wunsch, anders zu sein und ein bestimmtes Publikum anzuziehen, Züge eines Biotops trug, das sich infiltrieren ließ.
Eine solche Analogie wäre in dieser Schärfe und Bitterkeit abwegig. Ich habe Kleinmachnow seit den späten Siebzigerjahren unzählige Male mit meinen Eltern besucht. Vor allem die Gartenfeste mit Hausmusik waren Höhepunkte im Familienleben, nicht zuletzt angesichts der Persönlichkeiten, die zum Freundeskreis meiner Großeltern zählten. Sie versprühten den Geist eines bestimmten, der DDR abgewandten Künstlermilieus, das wir von daheim so nicht kannten.
Im Vergleich zu meiner Heimatstadt Rostock mit ihren Werften, dem Hafen und dem mit Hilfe schwedischer Architekten errichteten Hotel »Neptun«, die ein Höchstmaß an maritimer Weltoffenheit im Spätsozialismus versprühte, erschien mir Kleinmachnow dennoch als ein im emotionalen Sinne selbstbeherrschter Ort, obwohl die Grenze zu Westberlin nur einen Steinwurf entfernt lag. Viel näher als das Signallicht vom dänischen Gedser, das wir bei gutem Wetter von Warnemünde aus sehen konnten und uns vom Westen träumen ließ. Möglicherweise gerade deshalb.
Etwas Weltabgewandtes und Ernstes beschwerte diesen waldigen Flecken Erde, das ich nie zu ergründen vermochte. Selbst ein Kind konnte es aber spüren, wenn es mit einem Einkaufsnetz leerer Bier- und Brauseflaschen zum Getränkehändler Kruschke geschickt wurde. Die Stille kam mir nicht echt vor, die Straßen waren bei Sonnenschein leer, niemand tobte auf dem Trottoir, man sprach gedämpft, alle zogen sich in ihre Häuser und Gärten zurück, von denen viele in direkter Nähe zum Grenzwall standen.
Als mich mein Vater einmal begleitete, blieben wir auf dem Rückweg vor einem Haus im Wolfswerder stehen, das im Schatten der Mauer stand, keine zehn Meter von ihr entfernt. Man konnte fast in die Fenster der dahinterliegenden Wohnungen in Westberlin blicken. Der Besitzer, der gerade im Garten beschäftigt war, ließ Tomaten und Ziergewächse mit der gleichen Unbekümmertheit an dem Beton emporranken wie die von Sandra Hüller verkörperte Hedwig Höss in Jonathan Glazers Drama The Zone of Interest. Als er uns bemerkte, bellte er uns an: »Was starren Sie so? Haben Sie noch nie eine Mauer gesehen?« Ich war wie versteinert. Dann brach es aus mir mit dem wackeligen Selbstbewusstsein eines Teenagers heraus: »Doch, aber nicht die Mauer!«
Zurück im Haus im Sonnenhag erzählte ich von meinem Erlebnis. Mein Großvater zeigte keine erkennbare Reaktion. Wahrscheinlich, weil er all das aus eigenem Erleben kannte. Doch er sagte nichts, auch wenn ich es mir wünschte. Er blieb wie auch sonst der Mann, zu dem ich gefühlsmäßig nicht vordrang. Nicht als Enkel, der gerne beherzt in die Arme genommen worden wäre oder mit ihm über einen dummen Spruch gelacht hätte. Nicht als Gesprächspartner, der Jahre später auch seinetwegen Geschichte zu studieren begann und Interesse an seinen Grafiken zeigte.
Auch darin, im Herunterregeln von Gefühlen, war er vor allem ein Vertreter seiner Generation, weniger ein Sinnbild der DDR, die »Schuld« genauso wenig wie der Westen thematisiert hatte, wenn es um den Einzelnen und nicht um den Staat ging. Sein Schweigen kam nicht aus der Einsicht, dass erst das Aussparen der Wahrheit eine glückliche Ehe und die unbeschwerte Kindheit meiner Mutter und ihrer Geschwister ermöglicht hatte. Ich glaube heute, er tat es vielmehr aus Selbstschutz.
Hätte ich ihn im hohen Alter ausfragen sollen, den missbilligenden Blick meiner Großmutter riskierend? Ich brachte es nicht fertig. Also bewunderte ich ihn für das, was er preisgab, verehrte ihn für seine Kunst, für sein Haus, in dem es nach Tabak und Kölnisch Wasser roch. Er konnte ohne Lineal eine gerade Linie mit dem Bleistift zeichnen. Oder ein »A«, das er für mich mit Tusche schwärzte. Der Anfangsbuchstabe unseres gemeinsamen Namens, den meine Mutter für ihren einzigen Sohn aus Liebe zu ihrem Vater ausgesucht hatte.
Andreas Nießen starb 1996 als Zeuge von fünf Deutschland. Seine Lebensgeschichte, die man in Anlehnung an Fritz Sterns Memoiren Fünf Deutschland und ein Leben (2006) als »Fünf Deutschland und ein Künstlerleben« zwischen Kaiserreich und Wiedervereinigung bezeichnen könnte, wird in diesem Buch erzählt. Sie handelt von einem außerhalb der Fachwelt wenig bekannten Schriftkünstler, der in der Zeit der aufkommenden Massenmedien zum Gebrauchsgrafiker und Werbefachmann wurde und darin Talent bewies. Er lebte ein Leben, zu unbedeutend für das Buch der Geschichte, und doch eng verflochten mit den Geschehen jener bewegten Jahre, wie es 1987 im Vorspann des letzten großen DEFA-Films über die Bekanntschaft eines vom Sozialismus überzeugten Volkspolizisten mit einem jungen Pfarrer heißt: Einer trage des anderen Last von Lothar Warneke, der ebenfalls in Kleinmachnow lebte.
Dieses Buch geht der Frage nach, wie mein Großvater unter den ungeheuren Bedingungen, in die er hineingeboren wurde, leben und arbeiten konnte. Und es erzählt vom Spagat zwischen Kunst und Broterwerb. Davon, wie man zwischen den Systemen »elastisch« bleibt, ohne sich selbst zu verlieren. Aber es handelt auch von der schweren Mitgift, seine geschiedene jüdische Frau und sein damals einziges Kind emigrieren zu sehen und deren Deportation in Kauf zu nehmen.
Sein Fall liegt dabei nicht wesentlich anders als der von Größen des NS-Kulturbetriebs wie Heinz Rühmann, der sich um seiner Karriere willen von seiner jüdischen Frau Maria Bernheim scheiden ließ, und zwar nur wenige Tage nach der Reichskristallnacht im November 1938. Rühmann heiratete daraufhin die »Vierteljüdin« Herta Feiler, während Bernheim eine eilig arrangierte Ehe mit dem schwedischen Schauspieler Rolf von Nauckhoff einging, die ihr die schwedische Staatsbürgerschaft und Reisefreiheit sicherte. 1943 ging sie ins Exil. Daniel Kehlmann hat Rühmanns Entscheidung in seinem Roman Lichtspiel in eine Lakonie gekleidet, die, wie sich zeigen wird, nur zu gut auch auf meinen Großvater passt: »Ganz ohne Kompromisse gehe es natürlich nicht, sagte Rühmann. Er habe sich von Maria scheiden lassen müssen, sonst habe er nicht mehr arbeiten können.«3
Hat auch mein Großvater sein Gewissen für die Möglichkeit geopfert, seine 1937 entzogene Berufserlaubnis wiederzuerlangen? Oder schützte er im Gegenteil Frau und Kind nach den Rassegesetzen von 1935 durch die formale Aufrechterhaltung einer Ehe, die in Wahrheit seit Jahren brüchig war, wie er behauptete?
Auch nach dem Krieg machte er Konzessionen an den Staat, um Aufträge des neuen DDR-Landwirtschaftsministeriums oder der volkseigenen Pharmabetriebe an Land zu ziehen. Aber er wurde nie zum Parteigänger, sondern zog sich ernüchtert von der Zensur und später der Observierung durch die Staatssicherheit zurück, wofür Kleinmachnow als bukolischer Ort besser geeignet war als Berlin. Vielmehr scheint es, dass er in der DDR jenen Kotau, den er nach 1933 aus wirtschaftlichen Gründen und wohl auch aus Angst machen musste, nicht wiederholen wollte. So war er zwar Mitglied der berufsständischen Vereinigungen, Kammern und Kulturbünde, ohne die er nicht hätte arbeiten können. Aber er war nie Mitglied der SED. Auch der NSDAP war er nie beigetreten, selbst wenn ihn das Standesamt Berlin-Tiergarten im Gegensatz zu meiner evangelischen Großmutter als »gottgläubig« führte – ein Codewort für den Austritt aus der Kirche bei zumindest passiver Unterstützung des NS-Systems. Und auch wenn die Kreisleitung der NSDAP einen Monat später in einer Auskunft für die Wehrmacht zum Zwecke der Beförderung festhielt, dass »über den Obengenannten in politischer Hinsicht keine Bedenken« bestünden.4
Die Mühen der Unfreiheit und der mehrfach vereitelte Wunsch, seiner Kunst nachgehen zu können, weil sie nicht »nationalsozialistisch genug« oder nicht »sozialistisch genug« war: Sie sind das eigentliche Thema seiner Biografie, das sich bis in die letzten Selbstzeugnisse hindurchzieht. Wo endet der legitime Broterwerb? Lässt sich ein Leben, zumal unter den Bedingungen einer Diktatur, aus der Rückschau angemessen beurteilen? Man könnte auch fragen: Wer war er, aber wer wäre man selbst in diesen Zeiten geworden? Auch davon handelt dieses Buch. Das Dechiffrieren der Vergangenheit ist hierbei ein zweischneidiges Schwert. Und das nicht nur, weil die Quellen Lücken aufweisen und die Imagination ersetzen muss, was Akten und Zeitzeugen nicht mehr leisten können. Man ist auch beseelt vom Glauben, durch die Beschäftigung mit einem Angehörigen etwas zu finden, das auch für andere von Interesse sein könnte.
Tatsächlich kann die Suche einen anderen Menschen durch das Aufdecken alltäglicher Details entzaubern. Am meisten auf der Hut muss man jedoch davor sein, die Quellen auszuschlachten und das Leben eines anderen umzukrempeln. Auch einem Toten ist Intimität zuzugestehen. Darum gilt es abzuwägen, was von historischem Interesse ist und was in den Archivkästen belassen werde sollte. Selbst wenn die Quellen bis auf wenige Ausnahmen öffentlich zugänglich sind. Genau wie es die heutigen E-Mail- und WhatsApp-Verkehre vielleicht eines Tages sein werden, aus denen nachfolgende Generationen ein dichtes Bild der Gegenwart zu zeichnen vermögen. Und dafür Privates öffentlich machen, das nie für die Veröffentlichung bestimmt war.
Insofern ist dieses Buch ein Wagnis. Und doch ist es geschrieben aus dem Wunsch heraus, die Biografie eines Künstlers dem Vergessen zu entreißen und zu bewahren, was seine Generation in den beiden Weltkriegen und danach erlebt, aber auch verdrängt hat. Ich kann dabei nicht für ihn sprechen, ihn weder erklären noch entschuldigen. Aber ich kann über die Zeiten schreiben. Und jene Fragen stellen, die ich zu Lebzeiten nicht gestellt habe. Denn die Lebenden mögen den Toten die Augen schließen, wie es in einem Sprichwort heißt. Aber es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen.
Diese Geschichte speist sich darum aus vielen Originaldokumenten, die hier erstmals veröffentlicht werden, das bin ich nicht zuletzt den anderen Familienangehörigen im Sinne größtmöglicher Objektivität und Faktentreue schuldig. Sie ist fußnotenreich. Ihr fehlt dadurch bisweilen der – in der Sprache des Grafikers – grobe Pinselstrich. Und die Leichtigkeit, ein Leben aus der Zeit zu heben, wie es historische Biografien oft tun.
Dieses Buch ist im Gegenteil in der Überzeugung geschrieben, dass Andreas seine Zeit nicht überstrahlte. Vielmehr war er in seinem Aufstieg wie in seinen Überlebensversuchen ein typischer Vertreter der Zeit. Neben Archivmaterialien werden darum auch Zeitungsartikel, Einladungen, Anzeigen und anderes mehr herangezogen, die insbesondere die Jahre ab 1949 umfassen. Die Quellenlage ist hier merklich dichter als in den Jahrzehnten zuvor. So setzen die Tagebücher meiner Großmutter erst 1949 ein. Zur Tagebuchschreiberin wird man aber nicht mit sechsunddreißig. Ich weiß heute: Sie verbrannte ihre Aufzeichnungen, die mutmaßlich bis in die frühen Dreißigerjahre zurückreichen, vor der Einnahme des Dorfes 1945 im Eichsfeld erst durch die Amerikaner und schließlich durch die Rote Armee. Diktaturen wie Kriege formen Menschen, nicht selten machen sie sie kaputt oder berechnend. So einfach ist es wohl.
Mein Großvater hingegen hat umfangreiche Briefe aus dieser Zeit hinterlassen, allerdings nicht aus freien Stücken. Sie wurden nach dem Krieg von staatlichen Stellen einbehalten und werden heute im Landesarchiv Berlin und im Bundesarchiv aufbewahrt. Umso genauer muss man überdies sein grafisches Werk lesen. Und hier fällt im Schatten der Auftragsarbeiten etwas Interessantes auf: Ohne explizit zu werden, schuf sich Andreas durch die Auswahl von Bildmotiven und Zitaten eine Art »Sprache«, die seinen Standpunkt im Spiegel der Zeiten recht gut erkennen lässt.
Die Quellen in Form von Postkarten an Verwandte und Freunde zum Jahreswechsel ab 1939 sind grafisch gestaltete Kommentare zur Zeit. Sie geben Aufschluss über sein Denken auch in Fragen der geschichtlichen Entwicklung Deutschlands vom Kriegsbeginn bis zum Mauerfall. Darüber hinaus zeichnen sie ein Panorama des Lebensortes Kleinmachnow, der entscheidend zur inneren Emigration des Grafikers und der ihm nahestehenden Künstler nach dem Mauerbau beigetragen hat. Einigen von ihnen bin ich noch persönlich begegnet.
Dieses Buch geht über Kleinmachnow und die Grafikkunst meines Großvaters hinaus und berührt eine deutsche Lebensgeschichte zwischen Mitläufertum und Widerstand – eine Geschichte von vielen. Diese war, so wird sich zeigen, maßgeblich nicht von aktiver Unterstützung der Systeme, sondern von Gefügigkeit und opportunistischer Anpassung aus persönlicher Angst vor Repressionen gekennzeichnet. Und vielleicht ist es die Enkelgeneration, die einen solchen Blick aufbringen kann, ohne einseitig anzuklagen oder zu entlasten.5
Lange erstreckte sich die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg auf eine nicht verhandelbare Schuld der Beteiligten, wenn diese nicht aktiv im Widerstand gewesen waren. Mit Unverständnis und diskursivem Ausschluss wurden gerade nach Achtundsechzig Zwischentöne wie jene belegt, ob es auch ambivalente, sich überlagernde Perspektiven derer gab, die wie mein Großvater im Krieg bei der »Propaganda« waren oder ihre jüdischen Partner zuvor nachweislich im Stich gelassen hatten.
Die geschichtspolitische Erzählung der Bundesrepublik kannte nur eine Richtung, diese aus Gründen der Distanzierung von den Vätern dafür umso demonstrativer, vielleicht auch hochmütiger. Waren es nach dem Krieg vereinfacht gesagt »die anderen« gewesen, war es später ein ganzes Volk, das mitgetan hatte im Sinne von Daniel Goldhagens Hitlers willige Vollstrecker. Und vermutlich hat ein Teil des Geschichtsrevisionismus der letzten Jahrzehnte, wie er im Historikerstreit und der anschließenden Kritik von Habermas 1986 erstmals zur Sprache kam, auch damit zu tun, nicht beizeiten Ventile für parallele Täter- und Opferperspektiven geschaffen zu haben, ohne das Geschehene zu relativieren.
Insofern kann die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte heilsam sein, indem sie die Dinge neu verortet und Schuld auch Schuld nennt, gleichzeitig aber auf den äußeren Druck, den Schmerz und die unterlassenen Gespräche blickt, die für viele Nachkriegsfamilien typisch waren. Und die sich in der zögerlichen Auseinandersetzung mit dem DDR-Staat nach 1990 in gewisser Weise fortschrieben.
Das vorliegende Buch stößt genau in diesen Zwischenraum, gerade weil es keine Heldengeschichte ist und seinen Protagonisten nicht schont, aber auch die Zwänge und Drangsalierungen nicht verschweigt. Keiner der gesellschaftlich gut verankerten Spitzel, die Berichte über den Kleinmachnower Grafiker Andreas Nießen und dessen Familie an die Stasi lieferten, hat nach der Wende den Versuch unternommen, sich bei ihm oder meiner Großmutter zu entschuldigen. Nie gab es wenigstens anonyme Briefe. So wie es seitens meiner Staatsbürgerkundelehrerin, die bis November 1989 Direktorin unserer Rostocker Schule war, bei zufälligen Begegnungen im neuen SPAR-Supermarkt nie ein Wort der Entschuldigung mir und anderen gegenüber für zahlreiche politische Indoktrinationen und Abmahnungen gab, für die unsere Eltern heranzitiert wurden. Ein ganzes Land verdrängte und schwieg. Man ging als Einzelner zur Tagesordnung über, versuchte sich im neuen System angesichts unbestreitbarer Brüche in vielen Erwerbsbiografien zurechtzufinden, während man gleichzeitig von der staatlichen und gesellschaftlichen Aufarbeitung des DDR-Unrechts hörte. Bis heute gibt es eine solche im Privaten nicht im selben Maße.
Vom Kaiserreich nach Weimar: Wandervogel und Lebensreform
In der Idylle des Schwarzwaldes wächst Hans Giebenrath auf, der tragische Held in Hermann Hesses 1906 erschienener Erzählung Unterm Rad. In dem durchsichtigen Bemühen der Erwachsenen, alles Schlechte von ihm fernzuhalten, wird Hans von seinen Mitschülern getrennt. Die Natur spielt in dieser Heilungsfantasie eine zentrale Rolle ganz im Sinne der erstarkenden Lebensreformbewegung, für die Hesse auch persönlich stand und sich nackt vor einem Felsen in Amden am Schweizer Walensee ablichten ließ. Bereits in seinem Roman Peter Camenzind, dessen Titelfigur als Widergänger des Autors verstanden werden kann, heißt es, dass die »Fische ins Wasser und die Bauern aufs Land« gehörten »und dass aus einem Nimikoner Camenzind trotz aller Künste kein Stadt- und Weltmensch zu machen ist«.6
Hesses Rekurs auf Einfachheit und Einsamkeit als Gegenentwurf zu Moderne und Pädagogik war hierbei exemplarisch. Frische Luft und die Bewegung im Freien wurden seit der Jahrhundertwende überhöht zu Lebenselixieren gegen die Strenge der wilhelminischen Schule, die »Erziehung« auf Unterricht und Wissensvermittlung reduzierte, aber auch gegen die vermeintliche moralische Verkommenheit der industriellen Gegenwart. Diese Gedankenwelt sollte auch meinen Großvater nachhaltig prägen. Bis an sein Lebensende würde er in Kleinmachnow täglich, auch im Winter, in ein kleines Schwimmbecken springen, um anschließend nackt einige Runden durch den Garten zu laufen. Wir Kinder haben ihn dabei mit einer Mischung aus Bewunderung und Unverständnis vom Küchenfenster aus beobachtet, wenn er mit verklebtem weißen Brusthaar im notdürftig geschlossenen Bademantel an uns vorbei ins Bad ging, leise wimmernd vor Kälte.
Den Stahlwerken und Schornsteinen den Rücken zu kehren, auf dem Land zu leben, sich zwanglos zu kleiden, auf Alkohol, Tabak und Fleisch zu verzichten, Völkerball zu spielen – all das lag bereits seit der Jahrhundertwende voll im Trend und bildete eine Art frühe ökologische Jugendrevolte. Frauen und Männer spielten Gitarre, sangen Lieder am Lagerfeuer und versicherten sich gegenseitig ihrer Naturverbundenheit. Als sich 1913 mehrere Tausend Jugendliche auf dem Hohen Meißner bei Kassel zu einer Kundgebung versammelten, nahmen sie allerdings auch die Bilder der euphorisierten Jugend vorweg, die 1914 in den Krieg zog. Aus dem freien Wandern wurde ein Marschieren, das Elias Canetti in seinem Werk Masse und Macht zu seinem berühmten Vergleich mit dem deutschen Wald anregte: Das Massensymbol der Deutschen sei das Heer gewesen, das Heer wiederum sei nichts anderes als der marschierende Wald.
In dieser Epoche der Euphorie und des gleichzeitigen Unbehagens über den technischen Fortschritt wird Andreas Nießen kurz vor dem Jahreswechsel 1906/07 in eine streng katholische Familie in Bonn geboren. Deren Stammbaum lässt sich bis zu seinem Urgroßvater Peter Nießen und dessen Ehefrau Elisabeth im Jahr 1815 zurückverfolgen, als auf dem Wiener Kongress die Neuordnung Europas nach der Niederlage Napoleons beschlossen wurde.
Andreas' Vater Adam Nießen, geboren im Jahr der Bismarck'schen Reichseinigung 1871, stammte aus dem Kreis Schleiden in der Eifel. Seine Mutter Anna Maria Klinkenberg kam aus Eschweiler bei Aachen und wuchs als Halbwaise auf. Auch die Großeltern väterlicherseits, Peter Arnold Nießen und Elisabeth Nießen (sie trugen in der Tat dieselben Vornamen wie die Urgroßeltern), geborene Frings, waren in der Gegend um Schleiden beheimatet in Wollseifen und Blankenheimerdorf. Mütterlicherseits hießen sie Franz Joseph Klinkenberg und Gertrud Mödersheim und lebten in Eschweiler und Birkendorf bei Düren in der Eifel – Namen, die wie Fixsterne am Firmament einer beginnenden Biografie auftauchen und sogleich dem Vergessen anheimfallen, weil sie in keiner weiteren Beziehung zur vorliegenden Erzählung stehen.
Das ursprüngliche Haus Adam Nießens in der Vorgebirgstraße 179 in Köln-Zollstock war ein sehr einfaches gewesen. Mein Urgroßvater arbeitete als Schriftsetzer, war überzeugter Sozialdemokrat und Mitbegründer der SPD in Zollstock, seit 1891 Mitglied der Partei, zudem aktives Mitglied der freien Gewerkschaften des Rheinlands. Er heiratete meine Urgroßmutter 1898 in Köln. Meine Urgroßeltern wurden nie geschieden, sondern lebten bis an ihr Ende beisammen in großer Frömmigkeit, zunächst in Köln, dann in Bad Godesberg. Diese Welt der Klarheit und Obhut: Sie spiegelt sich auch in den Fotos von Besuchen des jungen Andreas bei den Großeltern mütterlicherseits, am Kaffeetisch oder im Garten. Der Knabe trägt kurze Lederhosen, die erwachsenen Männer tragen Anzüge und die typischen, gänz-
Porträts der Eltern Anna und Adam Nießen (Bleistift, Holzschnitt)
lich unwilhelminischen Vollbärte ohne gezwirbelten Schnauzer.
Andreas wuchs mit sieben Geschwistern auf, meinen Großonkeln und Großtanten. Die anderen Buben hießen Adam, Joseph und Peter, die Mädchen Mia, Elisabeth, Katharina und Theresa. Adam Junior fiel im Ersten Weltkrieg, als Andreas noch ein Kind war. Von Elisabeth, Jahrgang 1900, hieß es, auch sie sei nach Berlin gezogen, ihres Mannes wegen, eines dort ansässigen Buchhändlers. Mehr weiß ich nicht.
Hesse, die Kraft der Natur, die Kultivierung der Einsamkeit: Sie trafen auch deshalb auf Resonanz, weil die technische Entwicklung mit großer Geschwindigkeit voranschritt. Fast überall in Deutschland, auch in abgelegenen Regionen wie der Eifel, gab es elektrisches Licht, Straßen, Telegrafenmasten und Eisenbahnschienen. Der Konjunkturverlauf im Verbund mit einer gezielten staatlichen Förderung des Industriesektors hatte seit der Jahrhundertwende dazu geführt, dass sich die Zahl der steuerpflichtigen Einkommen binnen zweier Jahrzehnte verdoppelte.
Die Zeit war wie trunken vom Wunsch nach ökonomischem Fortschritt. Zunehmend stellte sich aber auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer modernen Welt, die in den Großstädten mit ihren Fabriken, Spitälern, Leichenhäusern ihr abstoßendes Gesicht zeigte. Denn was zu mehr Komfort führte, warf zugleich einen Schatten auf die Kultur des Massenhaften, in der der Einzelne ununterscheidbar zu werden drohte. Das Wort von der »transzendentalen Obdachlosigkeit« war noch nicht geboren. Aber die Technik und die Säkularisierung verstärkten sich zu einem modernen Grundgefühl.
In jenen letzten Jahren des so bezeichneten »langen 19. Jahrhunderts« wurde der technische Fortschritt folgerichtig erstmals breit mit Zuschreibungen assoziiert, die sich im Ersten Weltkrieg zum Eindruck verfestigten, die Technik habe sich das namenlose Subjekt vollständig unterworfen, ja, sogar seinen millionenfachen Tod verursacht. Von Ernst Jüngers Stahlgewittern bis hin zu Robert Musils schaurig-schönem Zitat im Mann ohne Eigenschaften, die Mathematik sei die »Mutter der exakten Naturwissenschaft, Großmutter der Technik, auch Erzmutter jenes Geistes, aus dem schließlich Giftgase und Kampfflieger aufgestiegen sind«, thematisierten Kunst, Literatur und Philosophie die Heimatlosigkeit des Ich.7
In einer beispiellosen Überlagerung von Kultur- und Ereignisgeschichte im 20. Jahrhundert wurde die Erfahrung der technischen Anonymität auf den Schlachtfeldern und in den Fabriken durch den Verlust der alten Ordnung nach 1918 verschärft. Auch in Bonn, wo der damals zwölfjährige Andreas Nießen die Schulbank drückte, war das Kaiserreich plötzlich Geschichte, selbst wenn die emotionale Wirkung ungleich geringer gewesen sein dürfte. Denn im Hause Adam Nießens wehte ein anderer Geist als jener der Kaisertreue. Plötzlich strömten die heimkehrenden Reichswehrtruppen als Kriegsverlierer über den großen Fluss zurück, und es begann die Besetzung des Rheinlandes durch französische Truppen. Mein Großvater wurde als Kind Zeuge eines Verlustes an nationaler Souveränität, den er in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen oder Posen nie so unmittelbar erlebt hätte wie im Rheinland. 1914, beim »Weihnachtsfrieden«, hatten Deutsche und Franzosen noch gemeinsam »Douce nuit, sainte nuit« gesungen. Kurz vor Weihnachten 1918 marschierten nun kanadische und französische Soldaten in Bonn ein und sangen am ersten Weihnachtstag »Entre le bœuf et l‘âne gris«, »Zwischen Ochs und Esel«. Sieben Jahre lang, bis 1926, sollte Andreas' Heimatstadt besetzt bleiben, vor allem von französischen Truppen. Bis zu 10.000 Soldaten belagerten die Stadt.
Die Erfahrung des kollektiven Sterbens an der Somme und der Marne oder die Schlacht um Verdun hatten der Weltöffentlichkeit nicht nur die zerstörerischen Möglichkeiten der Technik vor Augen geführt, sondern auch die Frage aufgeworfen, wohin eine weitere Technisierung führen würde. Denn nicht nur das Töten war maschinell geworden: Auch die Innovationen in der Alltagstechnik sowie die Popularisierung der modernen Naturwissenschaften erreichten ein nie gekanntes Ausmaß, das in seiner Wirkung selbst heutige Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz oder der Genetik übertraf.
Ein gutes Beispiel für diese Ambivalenz von Phantasma und Krisenstimmung ist das Jahr 1923. Am 29. Oktober sprach Friedrich Georg Knöpfke die berühmt gewordenen Worte »Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin«. Der Rundfunk ging auf Sendung, doch gleichzeitig war die Armut in der Bevölkerung groß. Der erst kurz zuvor ins Amt gekommene Reichskanzler Wilhelm Marx konstatierte mit drastischen Worten, dass die Zahl derer, die sich ihr tägliches Brot nicht mehr verdienen könnten, nie zuvor größer gewesen sei. Hatte ein Kilogramm Roggenbrot im Januar 1922 noch knapp 4 Mark gekostet, so waren es im Januar 1923 schon 250 Mark. Zum Jahresende waren es schließlich 400 Milliarden. Und auch die Ausgaben für eine Tageszeitung, womit Andreas wenig später sein Brot verdienen sollte, erhöhten sich im gleichen Zeitraum von 30 Mark auf 100 Milliarden Mark. Harald Jähner hat seine Monografie über das Jahr 1923 nicht zufällig Höhenrausch getauft.8 Schließlich zählte zu den Ereignissen in diesem Schicksalsjahr der Weimarer Republik nicht allein, dass infolge ausbleibender deutscher Reparationszahlungen französische Truppen das Ruhrgebiet besetzten: Viele politische Morde, besonders prominent der an dem jüdischen Industriellen und Außenminister Walther Rathenau, kennzeichnen dieses Scharnierjahr der ersten deutschen Demokratie.
Am 9. November 1923 betrat schließlich Adolf Hitler mit einem Putsch in München die politische Bühne. Nur vier Tage zuvor war es zu einem antijüdischen Pogrom im Berliner Scheunenviertel gekommen. Anlass war eine Demonstration Tausender Arbeitsloser gewesen, die mit dem Vorwurf aufgestachelt worden waren, die Kassen für Unterstützungszahlungen seien leer, weil Juden das dafür vorgesehene Notgeld aufgekauft hätten, um damit zu spekulieren.
1923 hatte aber auch eine andere Seite, die Ausdruck einer historischen Bipolarität war: Es erschienen Rainer Maria Rilkes Duineser Elegien, der Flughafen Berlin-Tempelhof wurde eröffnet und die erste Automatik-Armbanduhr der Welt kam auf den Markt. Es war ein Jahr, das die Sollbruchstelle zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und den später so genannten Goldenen Zwanzigern markierte – jene Jahre zwischen 1924 und 1929, die wie ein kurzes Hochgefühl und Rendezvous mit Utopien in Wissenschaft, Technik, Musik, Film und Architektur wirken, bevor die größte Wirtschaftskrise folgte und der Niedergang der Weimarer Republik begann. Politisch war die Zeit charakterisiert durch den Tod Friedrich Eberts, der von 1919 bis 1925 Reichspräsident war, sowie die Übernahme seines Amtes durch Paul von Hindenburg, der bis 1934 an der Spitze des Landes stehen sollte.
Erste Arbeiten in Köln: Ideale des Werkbunds
Die Welt des Druckes und der Typografie war meinem Großvater durch den Beruf seines Vaters in die Wiege gelegt worden. Nach der Volksschule besuchte er nicht das Gymnasium, sondern absolvierte eine Schriftsetzerlehre im benachbarten Köln, wo es, wie gesehen, Verwandtschaft gab. Dort entstand auch die erste Gouache, die ich von ihm besitze, Schwarz und leuchtendes Hellgrün auf Naturpapier. Zu sehen ist der mächtige Dom von der gegenüberliegenden Rheinseite aus, am Ufer liegen Fahrgastschiffe, vergleichsweise skizzenhaft und noch sehr ungewöhnlich für seinen späteren ausnehmend präzisen grafischen Stil geradezu oberflächlich »dahingetuscht«.
Köln hatte zu dieser Zeit rund 600.000 Einwohner, war somit deutlich kleiner als Berlin mit 4 Millionen. Mit seinen Leuchtreklamen und dem Verkehr dürfte die Stadt am Rhein dennoch wie ein Vorgeschmack gewirkt haben. So hatte sie sich seit dem 19. Jahrhundert nicht nur zum Eisenbahnknotenpunkt mit grenzüberschreitenden Verbindungen entwickelt: Auch der Motorenbau, etwa die Deutz AG, die Chemie, viele Versicherungen und der Warenhauskonzern Kaufhof, aus dem später der Einzelhandelskonzern Rewe werden sollte, besaßen ihre Firmensitze am Rhein.
Mit der industriellen Entwicklung wuchs auch der Bedarf an Werbung und Grafik – eine zeittypische Entwicklung, die für Andreas Optionen bieten sollte, sowohl durch seine Arbeiten für die Industrie, etwa die Berliner Maschinenbaufirma Orenstein & Koppel, kurz O&K, die bis in die 1990er-Jahre existierte, als auch für die 1919 von Marie Juchacz gegründete Arbeiterwohlfahrt, deren herzförmiges Logo mit den verschlungenen Großbuchstaben in den Zwanzigerjahren durch seine Vorarbeiten entstand und bis heute durch den »Awo«-Schriftzug ausstrahlt. Zudem entwarf er Prospekte für die Skandinavien-Fahrten des Norddeutschen Lloyds.
Von Anfang an fühlte sich mein Großvater dabei den Gedanken des Deutschen Werkbundes nahe, der 1907 als Vereinigung von Künstlern, Architekten, Kunsthandwerkern mit dem Ziel gegründet worden war, den ästhetischen Wert der gewerblichen Arbeit durch ein Zusammenwirken von Kunst, Handwerk und Pädagogik zu stärken. Hintergrund dieser Bewegung war der Protest gegen einen so empfundenen »Kulturverfall«, den man in einer Gleichgültigkeit in der Architektur oder auch Städteplanung, bei Industrie- und Wohnbauten, Arbeitsstätten, aber auch bei Geräten und Interieurs für Wohnräume ausmachte. Material und Zweckmäßigkeit der Produkte, etwa von Möbeln, sollten fortan genauso im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen wie das Design. Mit dem neuen Gedanken des form follows function ging nicht weniger als der Versuch einer künstlerischen wie sozialen Reform der Arbeitswelt einher. In ihr sollte es nicht länger zu einer »Entfremdung« der Arbeiter von den Produkten infolge der zunehmenden Automatisierung kommen; Begrifflichkeiten, die den heutigen Debatten rund um Automatisierung und Digitalisierung gar nicht so unähnlich sind. Diese Dimension der modernen Welt elektrisierte Andreas Nießen, der nicht nur über seine familiäre Herkunft mit der Sozialdemokratie sympathisierte, sondern mit vierzehn Jahren in die Sozialistische Arbeiterjugend eingetreten war. Schon früh verstand er seine Aufgabe in der Schriftkunst dergestalt, dass diese formschön, aber möglichst lebensnah sein sollte, und nicht elitär im Sinne eines L'art pour l'art, wie es in vielen symbolistischen Entwürfen der Zeit seit der Jahrhundertwende zum Ausdruck kam, etwa den von Melchior Lechter für den Verlag Georg Bondi gestalteten Gedichtbänden Stefan Georges.
Über seine ersten Berufsjahre, also die Zeit ab 1921, gibt ein vierseitiger Lebenslauf Auskunft, den er 1977 maschinenschriftlich für den Kulturfonds der DDR verfasste. Zwischen 1921 und 1925 absolvierte er zunächst seine Lehre als Schriftsetzer in einer Kölner Druckerei, was dem Selbstverständnis seines Vaters entsprach. Nach seiner Lehre wurde er Vollstudent und Assistent von Jakob Erbar an den Kölner Werkschulen, einer gerade erst gegründeten Einrichtung für Bildende Künste, Architektur und Formgebung. Sie war die Vorläuferin der heutigen Köln International School of Design und der Kunsthochschule für Medien. In dieser Zeit studierte er Schriftlehre, vor allem bei Erbar selbst, der die nach ihm benannte Schrifttype Erbar-Grotesk entwarf, aus der später die serifenlose Schrift Futura entstand. Er war eine Koryphäe, einer der bedeutendsten Gestalter und Schriftkünstler seiner Zeit.
In seinem Lebenslauf erwähnt meint Großvater sehr selbstbewusst bereits in den jungen Jahren »Auszeichnungen und Wettbewerbserfolge auch in größerem Rahmen. Meine Arbeiten wurden in vielen Ausstellungen des In- und Auslandes gezeigt und in vielen Fachzeitschriften veröffentlicht. Die alte Preußische Kunstbibliothek in Berlin besaß eine größere Sammlung meiner typographischen Arbeiten.«9 So wenig bescheiden er hier auf sein Leben zurückblickt: Die Resonanz war in der Tat groß. So machte er durch eine Arbeit im sächsischen Görlitz unter der Anleitung seines Lehrers Martin Elsaesser auf sich aufmerksam. Er gestaltete das Epitaph der Nikolaikirche, die schon vor dem Ersten Weltkrieg als Bauwerk gefährdet gewesen war. Die Kirche wurde ab 1926/27 daraufhin in eine Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs umgewandelt und der Innenraum im Stil des Expressionismus angelegt.
Gemalte Bänder trugen die Namen der gefallenen Reichswehrsoldaten, ihre Dienstränge, Regimenter und Todesdaten. Die von Andreas entworfenen und mit großem Aufwand ausgeführten Schriftbänder bildeten ein riesiges Epitaph und korrespondierten mit der Farbfassung der Pfeiler, wie ein Kritiker 1935 im Fachblatt Die zeitgemäße Schrift unter Verwendung von Bildmaterial ausführte.10 Die Fachpresse berichtete nicht ohne Euphorie über diese Arbeit des jungen Schriftkünstlers, und zwar durch die später noch zu würdigende Zeitschrift Gebrauchsgraphik