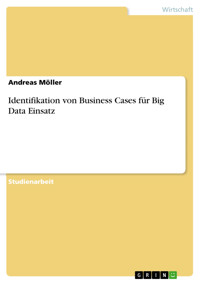5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Ich glaube, es ist Zeit für einen ›dritten Weg‹ zwischen Hardcore-Landwirtschaft und Bullerbü-Idylle.« (Andreas Möller)
Nirgendwo prallen urbanes Lebensgefühl und ländliche Wirklichkeit so hart aufeinander wie beim Thema Landwirtschaft. Während Stadtmenschen das Ursprüngliche suchen und erschrocken auf Bilder der »Agrarindustrie« reagieren, erfahren sich Bauern als Getriebene von Verbrauchern und Weltmarkt. Die Folge ist eine zunehmende Entfremdung zwischen Stadt und Land, die weit über die Landwirtschaft hinausgeht.
Dieses Buch überbrückt den kommunikativen Graben zwischen Kritikern und Kritisierten. Einem breiten Publikum erklärt es, wie Landwirte heute arbeiten, welchen Zwängen sie unterliegen und auf welche Zukunft sie zusteuern. Aber auch, wo sie Wünsche und Ängste der Bevölkerung ernster nehmen müssen als bisher. Ein Plädoyer für einen neuen Gesellschaftsvertrag mit dem Land und der Landwirtschaft jenseits von »konventionell« und »bio«.
- Landwirtschaft zwischen Landlust-Romantik und Massenproduktion
- Für einen besseren Dialog - Analysen eines Kommunikationsexperten
- Endlich ein nüchterner Blick auf Wirklichkeit und Zukunft im Stall und auf dem Acker
- Für einen neuen Gesellschaftsvertrag zwischen Bauern und Konsumenten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Möller
Zwischen Bullerbüund Tierfabrik
Warum wir einen anderen Blick
auf die Landwirtschaft brauchen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2018 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotive: pixabay.com
ISBN 978-3-641-23281-8V002
www.gtvh.de
Für Silke, die am liebsten bio kauft
»Bauer sein ist ein hartes, oft undankbares Geschäft. Kaum eine Arbeit hängt derart von den Launen der Natur ab, kaum irgendwo liegen die Freude über üppige Felder und der Frust über eine vernichtete Ernte so nah beieinander. Ein kräftiges Gewitter, ein heftiger Frost kann Existenzen vernichten. Mit diesem Risiko leben Menschen, die selten nach acht Stunden Feierabend haben und notfalls sonntags auf dem Traktor sitzen, bevor das Wetter umschlägt. Die meisten von ihnen machen das sogar gerne.
Und Bauern kriegen einiges ab. Denn wohin sich die deutsche Landwirtschaft entwickelt, passt nicht recht in das romantische Bild, das viele von ihr haben. Die Höfe werden größer und mit ihnen die Maschinen; die Pflanzenschutzmittel werden raffinierter und mit ihnen das Saatgut. Die Kundschaft schüttelt den Kopf, trägt ihr Geld aber unverdrossen zum Discounter. Bäuerliche regionale Landwirtschaft hat so kaum eine Chance. In der Kritik an einer industriellen, naturabgewandten Landwirtschaft sind sich die meisten Verbraucher trotzdem einig.«
(Michael Bauchmüller: Erntedank, Süddeutsche Zeitung, 23. August 2017)
Inhalt
WARUM ICH DIESES BUCH SCHREIBE
1. DIE LANDWIRTSCHAFT UND WIR
2. DAS LAND
3. DIE SUBVENTIONEN
4. DIE TIERE
5. DIE PFLANZEN
6. DIE ÖFFENTLICHKEIT
7. ZEHN VORSCHLÄGE FÜR EINE BESSERE KOMMUNIKATION ZWISCHEN LANDWIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT
8. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
9. DANKSAGUNG
ANMERKUNGEN
WARUM ICH DIESES BUCH SCHREIBE
Dieses Buch ist ein Abenteuer, vielleicht ein Wagnis. Denn ich bin kein Landwirt oder sonst wie mit der Landwirtschaft verbunden. Ich gehöre zu den 98,6 Prozent der Bevölkerung, die beruflich etwas anderes tun. Ich bin einer von denen, die in den Supermarkt gehen und abgepacktes Gemüse kaufen. Und die Tiere nur dann töten und ausnehmen, wenn ich Glück beim Angeln hatte. Das ist dann eine große Sache, die meine Kinder in helle Aufregung versetzt. Und uns fast andächtig auf das gebratene Stück Fisch blicken lässt, das vor uns auf den Tellern liegt!
Aber ich beschäftige mich von Berufs wegen mit der Akzeptanz von Wissenschaft, Technik und Industrie. Heute leite ich den Kommunikationsbereich eines Familienunternehmens im Maschinenbau, in dem Fragen von Nachhaltigkeit im Umgang mit Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaft einen besonderen Stellenwert einnehmen. Die Werte-Debatte in Wirtschaft und Öffentlichkeit ist mir darum vertraut. Ebenso die Forderung nach einem ökologischen Richtungswechsel, die seit einiger Zeit mit dem Zusatz »Wende« bekräftigt wird, was für mich jedes Mal wie »1989« klingt: Energiewende, Verkehrswende, Klimawende, Textilwende, Ernährungswende – Agrarwende.
Glaubt man diesen Schlagworten, müssen wir an immer mehr Stellen unseres Lebens einen falschen Weg korrigieren. Ich bin da skeptisch. Und das nicht nur, weil ich alles in allem ein positives Bild von der Gegenwart habe. Sondern weil es bei der Suche nach Alternativen der Verbraucher bedarf. Nur wenn möglichst viele Verbraucher mitmachen, können gute Ideen in der Praxis ihre Wirkung entfalten.
Aber: Tun wir dies auch, zumindest der übergroße Teil von uns? Die Rekordumsätze von Volkswagen trotz der Debatte um Abgasmanipulationen oder der Datenskandal bei Facebook im Frühjahr 2018, dem kein nennenswerter Einbruch bei den User-Zahlen folgte, zeigen eher das Gegenteil. Mit der Landwirtschaft ist das nicht anders: Ihre Produkte werden massenweise gekauft, obwohl man öffentlich mehr hart als herzlich mit den Bauern ins Gericht geht.
Der Volksmund sagt, dass wir immer dann viele Worte machen, wenn wir uns einer Sache nicht sicher sind. Ein Grund dafür, warum derzeit so viel von »Wende« die Rede ist, könnte darin liegen, dass wir alle diese innere Zerrissenheit spüren: Einerseits wünschen wir uns mehr Verantwortung für Klima, Pflanzen und Tiere. Andererseits möchten wir auf nichts verzichten. Eine Wende ist leicht gefordert. Wer aber ist wirklich bereit und dazu in der Lage, entscheidend mehr für Lebensmittel zu zahlen? Sich von saisonalem Obst und Gemüse statt von günstigem Fleisch und Südfrüchten zu ernähren? Einschränkungen bei Mobilität, Rohstoffen und vielen anderen Dingen zu akzeptieren?
Landwirtschaft und Erinnerung
Ungeachtet meiner städtischen Biografie habe ich mich immer für das Land begeistert. Bereits als Kind verspürte ich ein Kribbeln, wenn wir raus aus der Stadt und vorbei an endlosen Feldern fuhren. Wenn ich später auf dem Steg saß und angelte, war auch dort Landwirtschaft – und keine unberührte Natur. Mochten die Barsche in einem Meter Wassertiefe auch seelenruhig um den Angelhaken kreisen: Über dem Wasser waren die Mähdrescher zu hören, die bis spätnachts auf den Feldern arbeiteten. Und deren Dröhnen man mit in den Schlaf nahm. Genau wie das Schlagen der alten Kirchturmuhr.
Das Bullerbü meiner Kindheit lag an einem Mecklenburger See, der über einen schmalen Kanal mit einem anderen, noch größeren verbunden war. Wollte man dorthin, musste man mit dem Ruderboot durch Schwärme von Insekten. Neben fadenbeinigen Schnaken und handgroßen Libellen gab es dort Unmengen von Kuhbremsen. Und ich muss wieder an sie denken, wenn wir darüber diskutieren, welchen Einfluss die Landwirtschaft auf das Verschwinden einiger Insektenarten haben könnte und dazu »Windschutzscheiben-Tests« bemühen. Werden die »Flies on the windscreen« einmal der Erinnerung angehören, wie es in einem Song meiner damaligen Lieblingsband Depeche Mode heißt?
Wir haben uns als Kinder nie für solche Dinge interessiert, den Zusammenhang von Lebensräumen und Insekten. Wir hassten die Bremsen, deren Stiche dicke Schwellungen am Hals und auf den Armen hinterließen. Wir wollten möglichst schnell auf den großen See und waren froh, wenn wir ihrem Blutdurst entkommen waren. Heute befällt mich jedoch ein eigenartiges Gefühl, wenn ein Stück der eigenen Biografie im Lichte aktueller Themen neu erscheint. Hätte man die Welt, wie sie war, anders wertschätzen müssen? Ist etwas durch uns unwiederbringlich verloren, wie viele Medienberichte dieser Tage behaupten?
Zu den Erinnerungen an diese Zeit gehört auch ein riesiger schwarzer Bulle, der angepflockt am Ufer stand. Mein Kumpel Gunnar und ich bewarfen ihn vom Boot aus mit Kletten und hofften, dass er sich nicht losriss. Und mir kommen die überdüngten Böden in den Sinn, die unseren See in etlichen Sommern »umkippen« ließen. Ich verstand als Zehnjähriger noch nichts von Ökologie, wer tut das in dem Alter schon. Aber ich begriff als Angler so viel, dass an den nach Luft schnappenden Plötzen und Brachsen die nahegelegene LPG schuld war. Sie ging – wir schreiben das Jahr 1984, als die DDR die Olympischen Spiele von Los Angeles boykottierte – nicht gerade zimperlich mit unserem See um. Weil sie einen Plan zu erfüllen hatte, der keine Rücksichtnahme gegenüber der Natur kannte. Und weil an diesem Plan Prämien und Präsentkörbe mit Wurst und Radeberger Bier hingen.
An den modernen Lagerfeuern
Mehr als dreißig Jahre später hat sich im Vergleich zu damals zumindest eines nicht geändert: Das Land ist noch immer eine von uns Städtern hoffnungslos romantisierte Sache. Sobald wir die Stadtgrenze überqueren, unterstellen wir eine Art Gegenwelt zu den Zwängen der Zivilisation – zu Algorithmen, Abgasen, Lärm, dem Bedrängenden städtischer Enge. Auch dem Streben nach Gewinnen.
Stattdessen soll das Land ein wenig aussehen wie Ostpreußen um 1900 und ein Versprechen von etwas einlösen, das uns angesichts von Globalisierung, Migration und technischer Beschleunigung wieder wichtiger ist: das Gefühl von Heimat und Herkunft. Zwei anderen Worten für Sicherheit und Beständigkeit.
Die Wirklichkeit ist weniger idyllisch – und schon gar nicht idealistisch. Landwirte produzieren Nahrungsmittel oder Energiepflanzen. Sie stellen sich dabei auf die Bedingungen ein, die das komplexe Geflecht aus Erzeugung und Handel vorgeben. Sie machen, was sich für sie rechnet, und unterlassen alles, was keine Margen verheißt.Dünger und Pflanzenschutz, Futter, Treibstoff für Landmaschinen, Lohnkosten, Kredite für Ställe, Versicherungspolicen gegen Hagelschäden, Frost, Starkregen und vieles andere sind für sie Kosten, die sie exakt kalkulieren müssen. Denn wer falsch kalkuliert oder Kostensteigerungen nicht ausgleichen kann, läuft auch auf dem Land Gefahr, wirtschaftlich zu scheitern!
Landwirte sind also keine Altruisten – und beileibe nicht die Unschuld vom Lande. Dennoch sind sie zunehmend Forderungen ausgesetzt, die so gar nicht zumnüchternen Betriebskalkül eines Unternehmers passen wollen. So fordern Verbraucher heute einen nachhaltigeren Umgang mit der Natur. Weniger Pestizide. Mehr Rücksichtnahmen auf das Tierwohl. Wollen Landwirte darum nicht nur Bad News produzieren und im Fernsehen beschimpft werden, dann werden sie auf diese Wünsche im Eigeninteresse nicht mit Ignoranz reagieren können. Genau das ist, etwas holzschnittartig, aber der Vorwurf an die Branche.
Warum dabei diese Härte der Kritik? Zum einen zeigen sich die Folgen der intensiven Landwirtschaft heute möglicherweise deutlicher, kumulieren sich wie bei den Insekten oder manchen bodenbrütenden Vogelarten Effekte, die ihre Ursachen vor zehn oder zwanzig Jahren haben. Auch bewegen Großprojekte wie die geplante Schweinemastanlage für 37.000 Tiere, die ein niederländischer Investor im brandenburgischen Haßleben errichten will, schon zu lange die Gemüter.
Bei den Recherchen für dieses Buch wurde mir zum anderen aber klar, dass es noch einen Grund gibt. Er hat weniger mit der Landwirtschaft zu tun als damit, was die Wissenschaftler Hans von Storch und Werner Krauß mit Blick auf die Klima-Debatte einmal als die modernen »Lagerfeuer« der Menschheit bezeichnet haben, um die wir alle gern sitzen.1 Und uns dort Geschichten von Blitz und Donner erzählen, die uns kollektiv verbinden – eine Art Public Viewing zu drängenden Gesellschaftsfragen. Angst ist dabei oft ein starkes Motiv.
Die Landwirtschaft ist nach meiner Beobachtung der nächste Kampfplatz in der Reihe großer gesellschaftlicher Konflikte, welche die deutsche Nachkriegsgeschichte durchziehen. Nach den Debatten um das Waldsterben und die Verschmutzung der Luft durch Sauren Regen und Smog, die Vergiftung der Flüsse durch die Chemie, vor allem aber die Atomkraft und die mittlerweile leiser werdende Klima-Debatte, ist sie jetzt sozusagen »an der Reihe«. Nicht zuletzt deshalb, weil Themen wie die Kernkraft durch den Ausstiegsbeschluss des Jahres 2011 politisch abgeräumt sind und ein Stück unserer medialen Aufmerksamkeit »freigeworden« ist, was manche Nichtregierungsorganisation konsequent im Eigeninteresse nutzt.
Es ist deshalb nicht übertrieben zu sagen, dass die Landwirtschaft zu dem Schauplatz öffentlicher Kontroversen an der Schnittstelle von Mensch, Natur und Technik geworden ist. Obwohl sie im Grunde dasselbe tut wie all die Jahre zuvor und vieles auf Druck einer veränderten Umweltpolitik im Vergleich zu den Achtziger- oder Neunzigerjahren sogar nachweislich zum Besseren steht. Das kann ich als Angler mit einer stoischen Liebe zu einigen Gewässern, die ich seit meiner Kindheit aufsuche, aus eigener Erfahrung sagen. Ich fange dort zwar nicht besser als früher. Aber ich sehe wieder öfter Eisvögel, Bachstelzen und Ringelnattern. Und keine an der Oberfläche treibenden Fische wie 1984.
Schöne neue Welt
Die genannten Schlaglichter führen zu einer Zangenbewegung, die vielen Landwirten weit mehr zu schaffen macht, als wir es wahrnehmen. Auf der einen Seite müssen sie sich Forderungen nach einem naturnäheren und tiergerechteren Wirtschaften stellen. Auf der anderen Seite sind sie Getriebene der ökonomischen, technischen und kulturellen Umbrüche unserer Zeit. Denn die globalen Verflechtungen des Geschäfts, das System Landwirtschaft – Mineralphosphate aus Marokko zum Düngen brasilianischer Sojafelder, auf denen das Kraftfutter für Schweine in Niedersachsen wächst, die anschließend in den Export nach Russland und anderswo gehen – zwingen sie zu Opportunismus. Und lassen sie nervös auf kleinste Ausschläge des Marktes reagieren.
Hinzu kommen Entwicklungen, den mit Maßnahmen vom grünen Tisch nicht einfach so beizukommen ist. Dazu zählt die Energiewende, die viele Deutsche nach wie vor für eine ökologisch sinnvolle Sache halten. Oder das Thema Digitalisierung, die in der Landwirtschaft ganz neue Geschäftsmodelle möglich macht.
Auch Trends in der Biotechnologie wie CRISPR/Cas werden in der Öffentlichkeit nicht als Herausforderung für die Landwirtschaft wahrgenommen. Nach dieser in unaussprechlichen Worten Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats genannten Methode können Gene mit bestimmten Eigenschaften gezielt in DNA-Stränge eingefügt oder andere herausgeschnitten werden. Die sogenannte Genchirurgie könnte eines Tages nicht nur dazu führen, dass es Menschen mit »nachteiligen« körperlichen Dispositionen nicht mehr geben muss, weil man die menschliche DNA entsprechend umbauen kann. Solche Vorstöße in das Innerste der Natur werden auch für die Pflanzenzüchtung entscheidende Bedeutung haben.
Gemessen daran nehmen sich Themenfelder wie das Autonome Fahren oder stimmgesteuerte Computer wie Alexa wie ein Experimentierkasten für Schüler zum professionellen Elektronenrastermikroskop aus. Dennoch reden wir öffentlich weit häufiger über sie, wird von Delegationsreisen ins Silicon Valley eine ähnliche Wirkung erhofft wie vom Durchwaten des Jungbrunnens auf dem berühmten Gemälde Lucas Cranachs d. Ä. aus dem Jahr 1546. Denn sie machen das Neue im Alltag erfahrbar, darin liegt ihr großer Vorteil. Die großen Fragen der Zukunft, wenn es um Mensch und Natur geht, werden hier jedoch nicht verhandelt.
Der Wissenschaftsjournalist Joachim Müller-Jung fand für diese ungleiche Beachtung technischer Entwicklungen einmal die Überschrift »Schizophrenie der Zukunft«. Im Schatten des öffentlichen Interesses an Künstlicher Intelligenz und smarten Kühlschränken spielen sich in der Biotechnologie Dinge ab, die »sehr viel tiefer als die digitalen Umwälzungen in unser Wertesystem« eingreifen.2 Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ethisch. Und letztlich: anthropologisch. Denn sie berühren unser Bild des Lebens in einem ganz elementaren Sinne.
So müssen wir darüber diskutieren, welche Eigenschaften Nutztiere und Pflanzen in Zukunft haben werden, weil wir sie ihnen geben. Züchtung gibt es schon lange, wir alle kennen den Namen Mendel seit der Schule. Muss man Pflanzen in Zukunft daher zwangsläufig biologisch schützen? Oder darf man sie auch angesichts des Klimawandels genetisch so verändern, dass sie mehr Erträge versprechen, obwohl sie weniger Wasser brauchen und steigende Temperaturen aushalten? Stellt es nicht geradezu eine Verpflichtung dar, dass wir sie auf diese Weise unempfindlich machen für Krankheitserreger, die man heute mit der »Chemie-Keule« bekämpft? Auch wenn es außerhalb der Forschung noch nicht so weit ist: Diese Fragen werden kommen. Wir müssen deshalb Antworten auf sie finden.
Vergessenes Land
Wer sich mit der Landwirtschaft beschäftigt, stößt nicht nur auf solche wissenschaftlichen und technologischen Aspekte, sondern auch auf eine zunehmende kulturelle Entfremdung zwischen Stadt und Land. Und vielleicht ist gerade sie das Thema der Stunde – zumal für jemanden, der sich der Landwirtschaft aus einer gesellschaftlichen Perspektive nähert!
Es geht hierbei nicht nur um die Schließung von Kinderstationen in Krankenhäusern oder Schulen in ländlichen Regionen, um verwaiste Bushaltestellen, Läden, Gemeindezentren, Gaststätten, Tanzsäle. Es geht um den Unmut, den viele Menschen verspüren, wenn sie allabendlich Talkshowdebatten verfolgen. Wenn dort Themen aufgerufen werden, die an ihrer Lebenswirklichkeit vorbeigehen.
Wie stark Lebensrealitäten auseinanderdriften, ist auf beängstigende Weise am Wahlerfolg Donald Trumps in den USA sichtbar geworden. Dies galt auch für die Städte, keine Frage. Sein Polemisieren gegen das »Establishment« an der Ostküste kam in den vergessenen Regionen Amerikas, im Rustbelt und in den Farmlands, aber besonders gut an.
Eine solche Spaltung lässt sich ungeachtet aller Unterschiede auch in Deutschland beobachten. So ist es kein Zufall, und zugleich eine positive Ausnahme, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Zukunft der ländlichen Räume zu einer zentralen Aufgabe seiner Amtszeit erklärt hat. Ich habe ihn dieses Thema auf Veranstaltungen mehrfach nennen hören. Ohne jedoch, und das ist symptomatisch für die öffentliche Wahrnehmung von »Land«, dass es ein vergleichbares Interesse der Nachfragenden wie zur Digitalisierung oder Zuwanderung gegeben hätte.
Wir sprechen heute eben über vieles, das mit der Landwirtschaft zu tun hat und besser werden muss. Über volle Ställe. Den Tod auf dem Acker durch zu viel Chemie. Das ist ein Erfolg. Aber wir müssen uns auch fragen, warum »Heimat« und »Land« als Hoffnungssymbole in Sonntagsreden, Wahlkämpfen, Bundestagsaussprachen und am Kiosk hoch im Kurs stehen, warum Städter vom Urban Gardening träumen – gleichzeitig aber in vielen ländlichen Regionen die Lichter in Kuhställen, Kneipen und Kirchen ausgehen.
It’s the economy, stupid!
Zu selten wird im Zusammenhang mit der Landwirtschaft zudem über die Unterschiede debattiert, die dieser Zweig zum großen Rest der Wirtschaft aufweist. Diese befindet sich derzeit in einem Konjunkturhoch, ich erlebe das mit Blick auf die Metall- und Elektroindustrie aus nächster Nähe. Schlagworte wie Handelsbilanzüberschüsse, Rekordwerte bei Auftragseingang und Umsatz, Fachkräftemangel und anderes mehr bestimmen dort die Tagesordnung.
Die deutsche Landwirtschaft, die gerade einmal 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, aber Millionen von Menschen ernährt und über die Hälfte der deutschen Böden bearbeitet, steht für einen gegenteiligen Trend.3 Das Konjunkturbarometer des Deutschen Bauernverbands vom Herbst 2017 spricht in geradezu düsterer Rhetorik von der »deutlichen Verschlechterung« der wirtschaftlichen Stimmung und raunt von »besonders schlechten Zukunftserwartungen« – »und zwar in allen Betriebsformen«.4
Ist das nur Jammern auf hohem Niveau? Die sprichwörtliche Klage, die beim Bauern und beim Kaufmann zum Geschäft gehört? Weit gefehlt! Im besagten Konjunkturbarometer kann man nämlich auch einiges zur Agrarpreisentwicklung nachlesen, also darüber, was wir Verbraucher für die Produkte der Landwirte zu zahlen bereit sind. Von einem Milchpreis von durchschnittlich 26 Cent pro Liter für den Produzenten ist da die Rede, der Erzeugerpreis für Schweinefleisch liege bei 1,50 Euro für das Kilogramm. Zugleich stiegen die Kosten für Düngemittel und Energie. Ein »besonders belastender Einfluss« – so das Barometer – gehe überdies von den hohen Pachtpreisen aus.
Gerade dieser Aspekt erscheint mir besonders wichtig, er wird dieses Buch darum immer wieder begleiten. Begehrt waren Flächen bereits nach der Wiedervereinigung, vor allem in den hektarstarken Regionen der ehemaligen DDR. Seit der Lehman-Krise und der anschließenden Flutung der Finanzmärkte mit billigem Geld sind Agrarflächen aber als Objekte für spekulative Renditen erkannt worden, was zu einem regelrechten Run von Investoren aller Couleur geführt hat.
Nicht anders als bei der Verteuerung von Wohnraum in den Städten fördert der Preisanstieg der Böden auf dem Land deshalb eine Entwicklung hin zu größeren, weil leistungsfähigeren Einheiten, die noch dazu oftmals keine Nahrungsmittel, sondern Strom erzeugen. Doch: Sind uns solche Einflüsse bewusst, wenn wir im Supermarkt stehen und uns zu Recht mehr Nachhaltigkeit auf dem Acker wünschen, mehr Tierwohl und gerechtere Löhne für Spargelstecher aus Osteuropa?
Es scheint mir manchmal, als wären wir, bildlich gesprochen, ständig damit beschäftigt, über die Verschönerung der Fassaden eines Hauses zu debattieren, während das im Erdreich liegende Fundament von anderen stillschweigend ausgetauscht wird.
Wandel der Lebensentwürfe
Und dann sind da noch der »Faktor Mensch« und der Wandel der Lebensentwürfe. Wenn Landwirte ihre Nachfolge auf dem Hof heute nicht mehr so reibungslos wie früher regeln können, liegt das nicht allein an der Höhe des Verdienstes. Vielfach wünschen sich deren Kinder ein ganz anderes Leben. Eine eigenverantwortliche Gestaltung von Beruf und Freizeit, die Möglichkeit von Urlauben, Eltern- und anderen Auszeiten, die in vielen Industriebranchen längst Standard sind.
Wer als Jungbauer einen Milchviehbetrieb übernimmt, weiß, dass er die nächsten 40 Jahre um 3 oder 4 Uhr aufsteht – und zwar an jedem Tag der Woche, auch am Wochenende. Statt einer 28-Stunden-Woche, wie sie die IG Metall in der letzten Tarifrunde für Arbeitnehmer in die Diskussion einbrachte, hat ein Landwirt eher eine 60- oder gar 90-Stunden-Woche. Eine Kuh ist kein Tamagotchi, das die Älteren unter Ihnen noch kennen werden. Und kein Facebook-Account, bei dem man mal pausieren kann.
Junge Landwirte wissen das. Hinzu kommt, dass sie in beruflicher Hinsicht eine absolute Minderheit in ihrer Alterskohorte darstellen und darum einen gewissen sozialen Zwang aushalten müssen. Sie entscheiden sich für einen harten Beruf, der öffentlich angefeindet wird und auf Abi-Bällen sicher weniger hoch im Kurs steht als ein Freiwilliges Soziales Jahr bei einem Umwelt-Projekt oder ein »Schnupper-Praktikum« im Ausland. Nichts ist für die eigene Berufswahl aber so wichtig wie Vorbilder und die Bestätigung durch Andere.
Zunahme gesetzlicher Vorgaben
Der viel beklagte zahlenmäßige Rückgang der Höfe in Deutschland hat zuletzt auch mit einer Politik zu tun, die zwar großzügige Subventionszahlungen aus den Töpfen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU ermöglicht. Die durch zunehmende Dokumentationspflichten, Umwelt- und Brandschutzauflagen, Zertifizierungsanforderungen, Qualitätsprüfungen, Veterinärordnungen und sonstigen Verwaltungsaufwand aber gerade kleinen Familienbetrieben das Leben schwermacht.
Es ist paradox: Das, was politisch gewollt scheint, nämlich nachhaltig wirtschaftende Klein- und Kleinstbetriebe, wird regulatorisch behindert. »Wir wollen weniger Bürokratie und mehr Effizienz für eine marktfähige Landwirtschaft«, heißt es in Zeile 3895 des Koalitionsvertrags von CDU/CSU und SPD aus dem Februar 2018.5 Die Worte hört man wohl – allein es fehlt der Glaube, spricht man mit Praktikern, dass aus der Absicht auch Wirklichkeit wird.
Wer die steigenden Betriebsausgaben eines Hofes einspielen will, muss Umsatz und Rentabilität darum notwendigerweise steigern, am besten durch Wachstum und Produktivität. Auch deshalb, nicht weil Landwirte es schön fänden, gibt es in Deutschland immer weniger, aber immer größere Höfe. Existierten 1990 noch rund 630.000 landwirtschaftliche Betriebe mit einer Durchschnittsfläche von 17 Hektar, so sind es heute 274.000 Betriebe mit einer Größe von rund 62 Hektar. 2013 waren es noch 59 Hektar, 56 im Jahr 2010, und so weiter.6
All das hat gravierende Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Landwirtschaft. In einer Branche, die so alt ist wie die Menschheit, ist etwas gehörig durcheinandergekommen – mancher meint auch: aus den Fugen geraten. Die den Bauern bisweilen nachgesagte Renitenz wird daher auch als eine Verteidigung historischen Ausmaßes erkennbar: In einigen Fällen haben Höfe eine Geschichte, die bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges oder der Bauernkriege Thomas Müntzers, dem verordneten Helden meiner Schulzeit, zurückgeht. Solche Traditionsstärke prägt das Selbstbild der Landwirtschaft bis heute. Markiert zugleich aber ihre empfindlichste Stelle, wenn es um die Bereitschaft zum Wandel geht.
Die Kühe auf den Kopf stellen
Die Marke Opel warb nach einem Image-Tief vor einiger Zeit mit einer Kampagne unter dem Slogan »Umparken im Kopf« – und schaffte eine Wende. Genau solch ein Perspektivenwechsel scheint mir ebenfalls nötig, wenn es um die Zukunft der Landwirtschaft geht!
Wer eine neue Zeit mit einer besseren Landwirtschaft will, das ist die zentrale Aussage dieses Buches, kommt mit Pauschalkritik an den Bauern nicht weiter. Auch nicht mit Alarmismus oder effektreichen politischen Aktionen wie unlängst dem Verbot sogenannter Neonicotinoide, um die Bauern anschließend bei der Suche nach wirtschaftlich tragfähigen Alternativen im Regen stehen zu lassen.
Wir gewinnen auch nichts mit der Forderung nach einem Umstieg aus bestehenden Produktionsweisen über Nacht. Denn die ökonomischen Spielräume sind so eng gesetzt, dass die Landwirtschaft Zeit braucht – so wie gegenwärtig andere Industrien Zeit für ihre Transformation etwa bei der Umstellung auf die Digitalisierung brauchen. Stattdessen sollten wir gemeinsam darüber nachdenken, wie statt Einzelmaßnahmen ein schlüssiges Gesamtkonzept für eine bessere Landwirtschaft aussehen könnte!
Dieses Gesamtkonzept – auch das werde ich in diesem Buch ansprechen – verlangt nicht nur von den Landwirten Beweglichkeit und Verhaltensänderungen. Sondern auch von uns, dem Handel, den öffentlichen Stellen. Wenn es sich eine Gesellschaft erlauben kann, ein Drittel der Kartoffelernten in Biogasanlagen zu werfen, weil die Kartoffeln nicht den optischen Wünschen der Verbraucher nach ebenmäßigem Gemüse entsprechen, oder Nutztiere im Krankheitsfall sterben zu lassen, um nicht durch erhöhte Kennzahlen bei den Ämtern aufzufallen, dann ist nicht nur die wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit aus dem Lot geraten.
Ähnlich absurd stellt sich die Praxis dar, Futtermittel zu importieren und mithilfe staatlicher Anreize Energiepflanzen statt Getreide auf unseren Äckern anzubauen. Könnten die von den Bio-Betrieben weniger erbrachten Mengen nicht zumindest teilweise kompensiert werden, wenn Deutschland Maß und Mitte wiederentdeckte, statt zwei Extreme zu fahren, den Hochleistungsackerbau auf der einen und die Energiepflanzenproduktion auf der anderen Seite? Wenn es akzeptierte, dass Nahrungsmittel nicht »instagrammable« sein müssen – makellos, um sie auf Instagram posten zu können? Die Debatte um »Teller und Tank« ist mittlerweile leiser geworden. Dennoch bleibt sie richtig und wichtig.
Dabei muss uns klar sein: Nur wenn es uns gelingt, zu einem anderen Verständnis der Landwirtschaft und zu einem neuen Verhältnis zu ihr zu kommen, haben wir eine Chance, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten, für Umwelt und Betriebe gleichermaßen. Wenn die Entfremdung hingegen zunimmt und wir weiter auf die Bauern »draufhauen«, werden wir in einigen Jahren möglicherweise mehr ökologische Flächen vor unserer Haustür haben und eine präsentable Umweltbilanz – aber auch immer weniger Menschen, die im ländlichen Raum arbeiten und leben wollen. Und noch mehr von dem, was wir täglich konsumieren, importieren. Und zwar aus Regionen der Welt, in denen Tierwohl, Boden- und Gewässerschutz kleingeschrieben werden und die Arbeitsschutzstandards meilenweit von den unseren entfernt sind.
Im Bereich der CO2-intensiven Produktion von Rohstoffen, in der ich einige Jahre tätig war, nennt man diese fragwürdige Verlagerung von Verantwortung durch das Abwandern von Unternehmen »Carbon Leakage«. Sie passt in die Formel: Saubere Bilanzen daheim, unerfreuliche woanders. Fangen wir also damit an, uns die Dinge einmal anders anzusehen, und stellen die Kühe von den Beinen auf den Kopf! Der Zeitpunkt dafür könnte nicht besser sein, aber auch nicht drängender.
1. DIE LANDWIRTSCHAFT UND WIR
Ich möchte dieses Buch beginnen mit einem Blick auf jene Themen, die unser Bild der Landwirtschaft heute prägen. Und solchen, die schon in naher Zukunft prägend für sie sein werden. Wenn Sie dieses Kapitel gelesen haben, sollten Sie nicht nur darüber, sondern über den weiteren Inhalt des Buches einen groben Überblick haben.
Das Land und die Landwirtschaft, so meine Eingangsthese, sind als Alltagsbegleiter nicht allein aus der deutschen Öffentlichkeit verschwunden, sondern auch aus der aller anderen westlichen Gesellschaften. Die Bilder, Geräusche und Gerüche, die mit der Landwirtschaft zusammenhängen, sind darum weitgehend verlorengegangen. Der französische Philosoph und Hochschullehrer Michel Serres formulierte das 2013 so: »Der neue Schüler und die junge Studentinhaben im Leben keine Kuh gesehen, kein Kalb, kein Schwein, kein Vogelnest. Um 1900 arbeiteten die meisten Menschen auf unserem Planeten in der Land- und Ernährungswirtschaft; heute machen in Frankreich wie in vergleichbaren Ländern die Bauern gerade noch ein Prozent der Bevölkerung aus. Zweifellos wird man darin einen der tiefsten historischen Brüche seit dem Neolithikum erkennen müssen.«1Ich musste offen gestanden noch einmal nachschlagen, was es mit dem Neolithikum auf sich hat. Gemeint ist damit die Jungsteinzeit vor rund 12.000 Jahren. Sie markiert insofern einen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte, als Jäger und Sammler erstmals sesshaft wurden und neben der Jagd auch Ackerbau betrieben. Diese ersten Ackerbauern schufen somit die Grundlagen dessen, was wir heute Landwirtschaft nennen.
Man wird deshalb kaum eine andere Branche finden, die es hinsichtlich ihrer geschichtlichen Tragweite mit der Landwirtschaft aufnehmen kann. Dies wahrzunehmen ist für das Verständnis öffentlicher Diskussionen insofern hilfreich, als Bauern mit einigem Recht behaupten können, auf eine Tradition zurückzublicken, die jedes Berliner Startup in den Schatten stellt. Und dennoch löst die Landwirtschaft in der Regel keine Neugier oder gar Begeisterung aus. Kühlschränke zu füllen, Menschen satt zu machen sind heute eben keine News mehr.
Die Macht der Bilder
Seit dem Neolithikum ist nicht nur eine ziemlich lange Zeit vergangen, sondern man kann sagen, dass die Landwirtschaft seit jenen frühen Tages des Ackerbaus aus dem Mittelpunkt der Gemeinschaft an deren Rand gewandert ist.
Dies lässt sich mit einigen Zahlen belegen. Heute sind noch 1,4 Prozent der deutschen Erwerbstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt, nach dem Zweiten Weltkrieg waren es 25 Prozent, im 19. Jahrhundert sogar 50 Prozent – einer von zwei Deutschen im berufstätigen Alter!2
Viele der gegenwärtigen Akzeptanzprobleme, so eine zweite These, stellen sich darum gerade in einer von Bildern geprägten Zeit, weil die Landwirtschaft, abgesehen von Skandalbildern, im Grunde ein visuelles Schattendasein führt. Denn wir kaufen zwar landwirtschaftliche Produkte oder durchstöbern »Food Blogs« mit allerlei bunten Fotos. Aber wir sehen die Prozesse, mit denen Nahrung gemacht wird, und die Akteure, die sie machen, heute im Alltag nicht mehr. Wir sehen nicht die Knochenarbeit und den körperlichen Verschleiß, den Landwirtschaft früher bedeutete. Nicht die soziale Enge der Höfe. Aber auch nicht die Unmengen an Nahrungsmitteln, die täglich in die Städte gefahren werden. Nicht Aufzucht und Tötungen von Tieren. Nicht Abfälle und Gülle.
Die konkrete Wahrnehmung des Zusammenhangs zwischen Bedarf und Erzeugung, den uns die Ökostromproduktion mit Hunderttausenden kleiner Anlagen direkt vor unseren Nasen im Vergleich zu wenigen Großkraftwerken im Grunde sehr gut vor Augen führt, ist uns im Bereich der Landwirtschaft komplett verloren gegangen. Früher sagte man: Der Strom kommt aus der Steckdose. Heute könnte man sagen: Das Essen kommt aus dem Discounter.
Nicht zuletzt infolge dieser visuellen Entfremdung tun wir uns schwer mit einem Verständnis von »Land«, das nicht Raum für Freizeit ist wie bei meinen Angelausflügen, sondern der Raum, in dem täglich Lebensgrundlagen geschaffen werden. Kein mir bekannter Land- oder Forstwirt wird im Alltag bei allem Respekt vor der Natur in Wald und Flur einem »geheimen Leben der Bäume« nachspüren können, oder einem internetgleichen »geheimen Netzwerk der Natur«, wie es in den Bestsellern von Peter Wohlleben beschrieben wird.
Den Wald nicht nur als »Produktionsort« anzusehen, in dem tonnenschwere Harvester den Boden verdichten, sondern in ihm den Lebensort vieler Tiere und Mikroorganismen zu erkennen, hat etwas für sich. Auch ich sehe ihn so. Die Zunahme hoffnungsvoller Naturbücher zu vielen Tier- und Pflanzenarten in einer hochtechnischen Zeit ist dennoch kein Zufall, sondern ein Hinweis darauf, wonach sich viele Menschen offenkundig sehnen.
Ob sie dabei mit dem Förster Wohlleben den »Wald als Widerstand« entdecken (Der SPIEGEL) oder die »Geschichte der Bienen« der norwegischen Autorin Maja Lunde lesen, macht keinen Unterschied. Denn beides geht auf denselben emotionalen Kern zurück: das Gefühl des Verlusts einer Natur, wie wir sie kannten. Aber auch das Unbehagen an einer modernen Welt, zu der die Einkehr in die Natur als bessere Alternative erscheint.
»Feldkontrollen und chemische Bekämpfung«
Jeder Geschichtsinteressierte wird nun gleich zu Beginn einwenden, dass die Diskrepanz zwischen ländlicher Wirklichkeit und der Romantisierung des Landes durch die, die nicht dort arbeiten, kein Kennzeichen unserer Zeit sei. Das kennen wir in Deutschland bereits seit dem 19. Jahrhundert. Die Natur kam immer dann groß raus, wenn die Zivilisation brüchig erschien. Und moderne Naturgedichte wurden dann auffallend oft geschrieben, wenn im Dickicht der Städte elektrische Straßenbahnen und Lichtspielhäuser den Zeitgeist bestimmten.
Gerade deshalb erscheint es mir nicht trivial, darauf hinzuweisen, dass die Landwirtschaft zu jeder Zeit »unnatürlich« war, legt man einen strengen Begriff von Natürlichkeit zugrunde. Denn sie arbeitete immer schon mit Methoden und stofflichen Kombinationen, die von der Natur nie beabsichtigt waren. Auch die momentan fast kultisch verehrten »alten Sorten« bei Getreide oder Äpfeln waren einmal »neue Sorten«, die aus Gründen der Optimierung weiter verändert wurden. Insofern ist das Antlitz der heutigen Landwirtschaft im Grunde nicht mehr als ein Spiegel der sonstigen technischen Errungenschaften auch. Und doch ist der Grad der Entwöhnung von dem, was früher einmal selbstverständlich war, fraglos größer geworden. Auch bei mir.
Eine solche Landwirtschaft im Wandel der Zeit lernen auch unsere Freunde und Bekannten kennen, statten sie meiner Familie und mir einen Besuch ab. Kommen sie in unsere Küche, starren sie auf ein gerahmtes Poster über dem Geschirrschrank. Es stammt von meinem Großvater, der nach dem Zweiten Weltkrieg vor den Toren Berlins als Gebrauchsgrafiker arbeite und für viele damalige Industriekombinate Werbeplakate entwarf.
»Jeder hilft mit bei Feldkontrollen und chemischer Bekämpfung«, steht auf besagtem Plakat, es mag um 1960 entstanden sein. Zu sehen sind ein Traktor, der durch ein Kartoffelfeld fährt, und ein riesiger gelbschwarzer Kartoffelkäfer. Wie ein Heiligenschein ragt in die Mitte des Bildes eine übergroße Hand hinein, die zu einer Kralle geformt ist und nach dem Kartoffelkäfer greift.
Anders als in einem Museum mit Alten Meistern benötigt man kein Begleitheft, um dieses Bild zu dechiffrieren: Neben dem für diese Jahre typischen Fortschrittsbegriff, der Penicillin, die Kernspaltung oder die bemannte Raumfahrt einschloss, wohnte der technischen Umwälzung der Landwirtschaft nach dem Krieg der Zauber des Neuen inne. Wissenschaft und Technik, so war man überzeugt, würden den Menschen in eine bessere Zukunft führen. Als fortschrittlich galt, was schnell Mehrertrag schuf, Schädlinge mithilfe der Chemie eindämmte, die Anwendung von Mineraldünger propagierte – eine Wahrnehmung der Landwirtschaft, die Lichtjahre von der heutigen entfernt ist.
Als er ein Schüler war, erzählte mir mein Vater mit Blick auf dieses Plakat oft, war er selbst diese Hand. Denn die Wandertage hatten damals noch etwas von Jugendarbeit. Man fuhr nicht wie heute in eine andere Stadt oder zu einem Natur-Denkmal: Meistens ging es zu einer der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, in denen bereits Halbwüchsige mitanpacken und Kartoffelkäfer sammeln mussten, um sie anschließend in Hühner- und Gänseställe zu bringen.