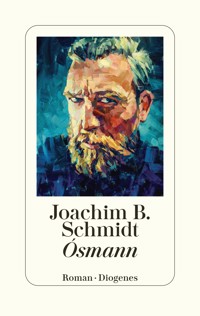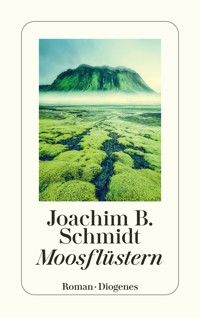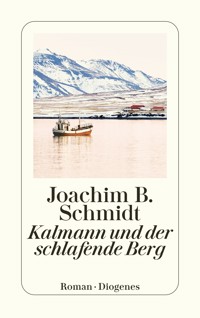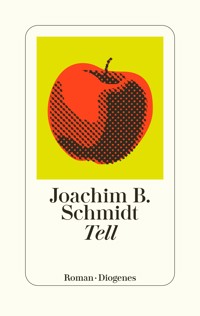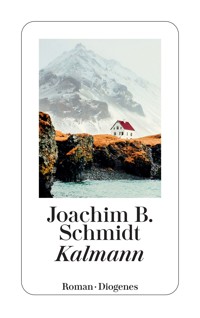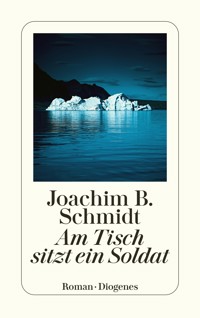
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jón hat genug von seiner komplizierten Familie, der Last der alten Tragödien, dem isländischen Landleben. Er will weg und flüchtet sich in ein Medizinstudium im fernen Hamburg. Als seine Mutter im Sterben liegt, kehrt er nach Island zurück, nur um festzustellen, dass die Vergangenheit dort auf ihn gewartet hat. Auf dem abgeschiedenen elterlichen Hof im Hinterland der Mývatnssveit erstehen die Geister seiner Kindheit vor ihm, und es kostet ihn allen Mut, sich ihnen endlich zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Joachim B. Schmidt
Am Tisch sitzt ein Soldat
Roman
Diogenes
Für Rögnvaldur Jónsson.
Undir Dalanna sól hef ég lifað mín ljóð.
(Hallgrímur Jónsson frá Ljárskógum)
TEILEINS
»Die Isländer haben dicke, plumpe Körper, offenbar zu lang und zu schwer für die Beine, während die Füße groß und flach sind. Das vielleicht charakteristischste Merkmal sind die Augen, die fast immer hart, kalt und ausdruckslos sind. Isländer sind von den meisten Lastern befreit, mit Ausnahme einer nationalen Untugend – Trinken.«
Aus dem Sammelband »The Living Races of Mankind: A popular illustrated Account of the Customs, Habits, Pursuits, Feasts & Ceremonies of the Races of Mankind throughout the World«, erschienen 1902
1
Kaum schlägt das letzte Stündlein, werden sie redselig, sind fast nicht zum Schweigen zu bringen, diese Sünder im Hinterland der Mückenseegegend. Als hätten sie während all den Jahren vor lauter Schuften nicht genug Zeit gehabt, Ungereimtheiten ins Reine zu bringen, Ungesagtes zu sagen.
Rósa, eine robuste Bäuerin, an der die arbeitsreichen Jahre nicht spurlos vorbeigegangen waren, saß mit versteinertem Gesicht am Sterbebett ihrer Schwester. Die Kammer war schmal, nur eine kleine Schirmlampe warf braunes Licht an die Tapeten.
Draußen herrschte Schwärze. Es war eine zahme Winternacht – selbst der Wind blieb für einmal still, als wollte er kein Wort überhören, das drinnen gesprochen wurde. Dieser neugierige Halunke. Wie lange hatte sie noch zu leben? Stunden? Tage, vielleicht.
Rósa hatte ihr ganzes Leben an der Seite ihrer Schwester verbracht, als wäre es ihre fromme Pflicht gewesen, eine Anweisung von ganz oben, sie durch all die Jahre der Entbehrung zu geleiten. Doch die plötzliche Redseligkeit ihrer Schwester machte sie nervös.
»Großer Gott, Rósa! Wir müssen ihm helfen! Wir müssen dem armen Mann doch helfen!«, klagte die Kranke und blickte verwirrt umher, als sei sie von einer Schar Leute umringt.
»Schh! Sei ruhig«, sagte Rósa und strich ihr flüchtig übers schweißnasse Haar. »Ruh dich aus. Keine Sorge, wir werden uns gleich um ihn kümmern.«
»Wo bleibt denn Vater? Wo bleibt er denn!«
»In Jesu Namen!«, entfuhr es Rósa.
Beinahe hätte sie ihrer Schwester die Hand auf den Mund gedrückt, wie sie so plötzlich den Vater erwähnte, als wäre er noch am Leben.
»Er kommt bestimmt gleich«, presste Rósa hervor. »Er kommt gleich.«
»Aber sieh doch, er kann nicht mehr atmen! Luft. Er braucht Luft! Er stirbt noch. Er stirbt!«
Es klopfte. Dr. Baltasar Gunnarsson, der eigentlich direkt und gesellig, dazu korpulent und ungelenk war, trat so behutsam ins Zimmer, als ginge er auf dünnem Eis. Bemerkenswert. Sogleich richtete sich Rósa vom Bett ihrer Schwester auf und stellte sich ihm in den Weg.
»Sie ist schon ganz wirr. Du brauchst dir diese Geistergeschichten nicht anzuhören. Geh ruhig nach Hause!«
»Aber Rósa, meine Gute …«
Der Arzt neigte sich zur Seite und erhaschte einen Blick auf die sterbenskranke Frau im schmalen Bett. Rósa wich keinen Zentimeter.
»Du hast für sie getan, was du tun konntest. Du kannst ihr nicht mehr helfen. Bist ja schließlich kein Pfaff!«
Nein, ein Pfaff war Baltasar wirklich nicht, auch wenn er sich durchaus zu den regelmäßigen Kirchgängern zählte und daran glaubte, dass Gott Himmel und Erde und alle Menschengeschöpfe erschaffen hatte, selbst solch sture, trollhafte Exemplare wie Rósa eines war. Mit ihr war nicht zu verhandeln. Er kannte die Familie gut, wie alle Menschen hier in der Mývatnsveit. Und er war sich wohl bewusst, dass hier gestorben wurde, wenn gestorben werden musste. Er hatte es schon lange aufgegeben, die Bewohner dieser kargen Gegend von wunderwirkenden Medikamenten und unerhörten Therapien zu überzeugen. Viel eher vertraute man auf Kräutertee und Branntwein. Damit wurden – nicht ohne Erfolg – Lebensgeister geweckt und Hexenzauber aufgehoben. Und wenn es denn Zeit war zu sterben, dann war es eben Zeit, dann brauchte man keinen Herrn Doktor, der in Kopenhagen studiert hatte.
Manche wünschten sich den Pastor ans Sterbebett. Andere waren mit einem guten Stück Harðfiskur oder einer Flasche Brennivín zufrieden. Auf den Arzt verzichtete man gern.
Doch einen Versuch wollte Baltasar Gunnarsson noch wagen. Die Frau litt, denn noch war nicht alles Leben aus ihr gewichen.
»Wenn du willst«, sagte er so sanft er nur konnte, »wenn du willst, kann ich …«
Weiter kam er nicht, denn das Kurbeltelefon, das an der Wand neben der Haustür aufgehängt war, schrillte. Zweimal lang und einmal kurz.
»Wer ruft denn um diese Zeit noch an!«, entfuhr es Rósa. »So spät!«
Sie stieß den Arzt zur Seite, eilte aus dem Zimmer und riss den Hörer vom Apparat.
»Hallo!«, brüllte sie.
Sie hatten auf Steinholt erst seit wenigen Jahren einen Anschluss an die Telefonleitung, und Rósa glaubte noch immer, in die Muschel brüllen zu müssen, um am anderen Ende der Leitung gehört zu werden. Offenbar rief man von einem benachbarten Hof an, um sich über das Befinden der Kranken zu informieren. Alle Höfe südlich des Mückensees hingen an ein und derselben Leitung. Jeder, der den Hörer abnahm, konnte mithören. Zum Donnerwetter. Der Mensch ist ein neugieriges Wesen. Und so blieb natürlich nicht unbemerkt, dass Rósas Schwester so dermaßen krank war, dass der Landarzt höchstselbst bestellt werden musste.
Der zog die Zimmertür zu, um nicht gestört zu werden. Er kauerte sich ans Sterbebett seiner Patientin, nahm ihr den Puls, hörte ihre Herz- und Lungengeräusche ab und maß ihre Temperatur. Er verabreichte ihr eine Dosis Morphium, worauf sie sich schnell beruhigte. Mehr konnte er nicht für sie tun.
Sie schloss erschöpft die Augen und hauchte:
»Er muss es erfahren …«
Baltasar betrachtete sie nachdenklich und murmelte, als er seine Werkzeuge in die Arzttasche steckte:
»Meine Liebe. Es gibt einige, die gern erfahren würden, was du weißt.«
Es machte ihn traurig, sie sterben zu sehen, denn im Gegensatz zu ihrer Schwester hatte sie ein warmes Wesen, wenn sie auch still und verschlossen war. Eine höfliche, ja hübsche Witwe, der man gern begegnete, bei der man jedoch beim Versuch, sie in ein nettes Gespräch zu verwickeln, scheiterte. Und so blieb der Landarzt nicht lange stehen, schüttelte die Melancholie ab, ging behutsam aus dem Zimmer und schlich sich durch die Stube. Die Zeiger der Pendeluhr gingen schon auf Mitternacht zu, und er wünschte sich nichts mehr als einen Tropfen Cognac und dann sein federweiches Bett, das seine Frau schon vorwärmte. Rósa hatte das Telefongespräch abgebrochen und saß erschöpft auf einem Stuhl.
»Sie wird bald einschlafen«, sagte Baltasar und zog sich die Jacke über.
Rósa entgegnete nichts. Starrte nur vor sich auf den Boden und nickte unmerklich.
»Du kannst mich jederzeit anrufen … Gute Nacht.«
Er zog die Haustür vorsichtig hinter sich zu, atmete die erdige Nachtluft ein und verharrte einen Augenblick. Ein schwaches Außenlicht brannte über dem Hauseingang, zu schwach, um seinen Lichtkegel bis auf den Hofplatz zu werfen, doch stark genug, um den Atem des Doktors aufleuchten zu lassen.
2
Die Bauern in der Mývatnsveit, hoch oben im Norden Islands, sind kauzige Menschen. Da gibt es ziemlich missratene Geschöpfe, die wohl nur am äußersten Rand der Welt geduldet werden. Solche, die jeden Sonntag gescheitelt und rasiert zum Gottesdienst erscheinen, die Zähne schwarz und faulig vom Kautabak – oder von den Flüchen, die sie beim Schwatz vor der Kirche von sich geben, sodass der Pastor verzweifelt die Glocken läutet. Es gibt andere, denen man keinen vollständigen Satz entlocken kann, die ihren Kühen im Stall indes hochphilosophische Referate halten, sodass die Tiere ein Universitätsdiplom verdient hätten.
In einer Großstadt wie Hamburg, zweitausend Kilometer von der Mývatnsveit entfernt, gibt es Gestalten, die den eigentümlichen Island-Bauern in nichts nachstehen. Wahrlich. Dem Schöpfer gehen die Ideen nicht aus.
Jón war in der überheizten Ticketkabine des Kino Royal eingeschlafen, den Kopf schwer auf die Hände gebettet, als plötzlich ein älterer, verwahrloster Mann an die Scheibe klopfte und ihn von weit her in die Kabine zurückholte. Der Penner steckte in einem gelben Herrenanzug, der so schmutzig war, als hätte er damit eine Frittierpfanne geputzt. Langes Haar fiel dem massigen Mann bis auf die schuppenübersäten Schultern herab. Er glotzte Jón auf den Bauch, während er noch immer an die Scheibe klopfte. Jón räusperte sich, wischte sich den Speichel von den Lippen und legte dem Mann ein Ticket in die Messingschale.
»Für zwei Personen!«, entfuhr es dem Mann mit seltsam melodiöser Stimme, und endlich hörte er mit der Klopferei auf.
Erst jetzt bemerkte Jón, dass hinter ihm eine kleine, runde Dame stand. Im Gegensatz zu ihrem Begleiter war ihre Erscheinung makellos, wenn auch etwas angestaubt. Sie steckte in einem jägergrünen Kleid mit roten Knöpfen und einem eng geschnallten Gürtel. Die Haare waren aufwändig toupiert. Sie rümpfte immerzu die Nase, als hätte sich ein unangenehmer Geruch darin verfangen, dabei versuchte sie lediglich zu verhindern, dass ihr die Schmetterlingsbrille von der Nase rutschte. Sie zog eine Knipsbörse mit vergoldetem Bügel und Blumenmuster aus ihrer Handtasche und drängte sich neben ihren Begleiter – war es ihr Sohn? Tatsächlich sah sie bei näherem Betrachten bedeutend älter aus als der Penner.
Ihr Sohn, oder wie er auch immer mit ihr liiert war, trat nur ein ganz klein wenig zur Seite, um ihr Platz zu machen. So standen sie, Mutter und Sohn, dicht vor Jón. Dieser hielt den Atem an und faltete intuitiv die Hände.
Die Alte begann mit spitzen Fingern Pfennig um Pfennig aus ihrer Knipsbörse zu klauben und behutsam in die Messingschale zu legen. Jón atmete gepresst aus und nahm die ihm zugeschobenen Geldstücke entgegen, stapelte sie auf, um den Überblick nicht zu verlieren. Er zählte flüchtig, legte eine weitere Kinokarte in die Schale, murmelte etwas, das er selbst nicht verstand, dann verschwanden die zwei dicht hintereinander im leeren Kinosaal, der Penner gehetzt voraus, die Alte hinterher.
Jón gähnte und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Merkwürdige Menschen gibt es in dieser Stadt, dachte er – als plötzlich die Tür aufgestoßen wurde und der verwahrloste Mann aus dem Kinosaal herausgelaufen kam, als wäre ein Feuer ausgebrochen. Er stellte sich wieder vor die Kabine, schnappte nach Atem, bückte sich und rief: »Dürfen wir sitzen, wo immer wir wollen!?«
3
Am frühen Nachmittag klopfte ein Postbote an Jóns Wohnungstür, wartete, drehte ein Fernschreiben in den Fingern und klopfte erneut. Jón saß zu dem Zeitpunkt im Julian-Reich-Hörsaal der Universität Hamburg und versuchte verzweifelt, den Ausführungen Professor Röders zu folgen, der über den Euler-Liljestrand-Mechanismus referierte. Mal verhedderte sich sein Blick an den Deckenleuchten, mal in den blonden Haaren einer Mitstudentin, die genau vor ihm saß.
Der Postbote ließ den Umschlag durch den Türschlitz gleiten und ging.
Das Klopfen der Studenten auf die Pulte riss Jón aus den Gedanken. Er blieb noch eine Weile im Hörsaal sitzen und schrieb die Stichworte von der Wandtafel ab, bevor sie von einem eifrigen Studenten mit einem Schwamm weggewischt werden konnten. Dabei hatte er gar nicht bemerkt, dass Benno neben ihm stehen geblieben war.
»Hochgradig inadäquat, was sich in Berlin abgespielt hat!«
Benno war ein schmächtiger Bursche und hatte das Gesicht eines Knaben, der sehnlichst auf die Pubertät wartet. Nicht selten wurde er für einen Gymnasiasten gehalten, weshalb er seinen Studentenausweis immer bei sich trug. Wie üblich stand er viel zu nahe bei Jón, sodass er sich im Stuhl zurücklehnen musste, um Bennos Atem auszuweichen.
»Meinst du die Demo gegen den Schah?«
»Was denn sonst! Diese Faschisten haben unseren Kommilitonen regelrecht exekutiert! Es gab über fünfzig Verletzte!«
»Exekutiert?«
»Ein Kriminalpolizist hat ihm in den Rücken geschossen. Da. Lies das!«
Er legte Jón einen Artikel aufs Pult. Der Schah von Persien gibt reichlich.
»Du, Benno. Ich muss mir die Sachen von der Tafel notieren …«
»Hast du nicht mitgeschrieben? Du bist wohl wieder weggetreten!«, lachte Benno und klopfte ihm auf die Schulter. »Junger Mann, Sie müssen früher schlafen gehen!«
Jón biss sich auf die Lippen und schaute sich verstohlen um. Glücklicherweise beachtete sie niemand.
»Wir sehen uns später, ja?«, sagte Jón und betete, dass ihn Benno endlich in Ruhe lassen würde.
Aber der ließ nicht locker.
»Kommst du denn zum Info-Abend?«
»Nein, ich kann nicht. Ich habe Abendschicht im Royal.«
Benno erwiderte nichts, blieb einfach nur dicht vor ihm stehen und schaute ihn an, machte keinerlei Anstalten, sich zu verziehen. Also sagte Jón:
»Heb mir ein Infoblatt auf, ja?«
»Aber sicher!«, sagte Benno, hob die Faust zum Gruß, machte ein Gesicht, als gälte es, die Welt zu retten, und verzog sich.
Jón atmete erleichtert auf und richtete seine Aufmerksamkeit wieder der Wandtafel zu, die man inzwischen saubergewischt hatte.
Den Rest des Nachmittags verbrachte er im Lesesaal der Universitätsbibliothek, doch es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren.
Vor zwei Tagen war er im Kühlraum umgefallen. Zwei Dutzend Studenten, ein Pathologe, ein Professor und ein Toter waren Zeugen geworden, wie Jón die Beine eingeknickt waren, einem bleichen Messdiener gleich, der den Weihrauch nicht verträgt.
Jón schlug die Bücher zu und schlich sich aus dem Lesesaal. Er schlenderte durch St. Pauli, genehmigte sich ein Fischbrötchen, ging hinunter an die Elbe und setzte sich eine Weile auf eine Bank. Als ihm der Hintern kalt wurde, ging er auf Umwegen ins Kino Royal, wo ihn in der Ticketkabine schon bald der Schlaf übermannte.
Nachdem er die Alte und ihren verwahrlosten Sohn bedient hatte, blieb er noch eine Weile in seiner Kabine sitzen, für den Fall, dass verspätete Kinobesucher aufkreuzten. Doch außer einem Fahrrad fahrenden Schulmädchen, das ihn erst um Feuer und dann um eine Zigarette bat, kam niemand. Er hätte die Kinotüren schon um zehn Uhr verriegeln können; außer dem kuriosen Pärchen wollte sich niemand die Spätvorstellung von El Dorado anschauen.
Jón brachte seine langen Beine unter dem Tischchen in eine neue Position, was gar nicht so einfach war. Er war ein hagerer Typ mit stelzenhaften Beinen, die nur knapp unter das niedrige Tischchen passten. Er musste höllisch aufpassen, sich nicht die Knie am Balken zu stoßen. Seine Hände berührten fast den Boden, wenn er krumm auf dem Stuhl saß und die Arme baumeln ließ.
Zehn Minuten nach Vorführungsbeginn verließ Jón die Ticketkabine, riegelte ab, begab sich in den dunklen Kinosaal und ließ sich auf einen Sitz in der hintersten Reihe plumpsen. Der Penner und seine Mutter saßen in der vordersten Reihe, fünf Sitze zwischen sich, die Köpfe gebannt auf die Leinwand gerichtet. Jón legte die Füße hoch und bettete den Kopf auf die Sitzlehne. Er hatte den Film schon ein Dutzend Mal gesehen, also schloss er die Augen, sank in einen losen Schlaf, schrak aber immer wieder auf, wenn auf der Leinwand eine Schießerei losbrach, doch in der zweiten Hälfte fiel er in einen Tiefschlaf, der nicht länger als der Flügelschlag eines Vogels dauerte – so kam es ihm jedenfalls vor. Der Filmvorführer, ein Typ mit langem, glattem Haar und John-Lennon-Brille, weckte ihn.
»Ich mach mal einen Abgang«, sagte er, zog sich seinen Poncho über, gab Jón das Peace-Zeichen und ging.
»Peace«, räusperte sich Jón.
Mutter und Sohn waren längst verschwunden. Jón stolperte schlaftrunken zwischen den Sitzreihen hindurch und steckte den wenigen Abfall, der auf dem Boden lag, in eine Tüte.
War es Zufall, dass er von seiner Heimat geträumt hatte, der Mývatnsveit, dem See, den geduckten, kahlen Hügeln und den sich verlierenden Rinnsalen zwischen den Steinen? Konnte es sein, dass er spürte, dass zu Hause etwas nicht in Ordnung war? Vielleicht hatte ihn die runde Dame an seine Mutter erinnert. Er hatte gar von ihr geträumt. Sie war im Haus auf Steinholt hin- und hergehuscht, doch ihm war es nicht gelungen, sie aufzuhalten und ihr mitzuteilen, dass er nach Hause gekommen war.
Am frühen Abend fand Niki das Fernschreiben auf dem Boden hinter der Wohnungstür. Sie betrachtete es von beiden Seiten und legte es, da es an Jón adressiert war, auf sein Bett.
Danach nahm sie ein langes Bad und machte sich hübsch. Sie drehte sich vor dem Spiegel einmal um die eigene Achse und deutete ein paar Tanzschritte an. Das tat sie immer, bevor sie ausging. Sie summte eine Melodie, als sie die Tür schwungvoll hinter sich ins Schloss warf. In der Wohnung wurde es wieder still. Nur der Wasserhahn der Badewanne tropfte.
Als Jón um Mitternacht nach Hause kam, ging er geradewegs ins Badezimmer und drehte den Wasserhahn ganz zu, was er oft tat, denn Niki war meist so sehr in ihre Gedanken vertieft, dass sie ihn nur flüchtig zudrehte, die Gasflamme am Herd brennen ließ oder die Wohnungstür abzuschließen vergaß. Achtlos war sie, wenn es um alltägliche Pflichten ging, aufmerksam, wenn es um Angelegenheiten oder das Wohlbefinden ihrer Nächsten ging. Auch diesmal war die Wohnungstür nicht abgeschlossen gewesen. Jón hatte ihr die Zerstreutheit nie zum Vorwurf gemacht, doch an diesem Abend ärgerte es ihn.
Wie kann man denn nur so kopflos sein! Er vermutete, dass Niki mit ein paar Freunden vom Kunststudium wie jeden Donnerstag in den Studentenkeller gegangen war, wo auch er nun erwartet wurde.
Doch Jón blieb zu Hause. Er war müde und nicht in Stimmung. Er warf seine Jacke aufs Bett und bemerkte das Fernschreiben darunter nicht. Er setzte sich eine Weile aufs Klo, blätterte im Studentenblatt und blieb an einem Artikel über »Radikalisierung der Studenten« hängen.
Was ist nun hier eine radikale Gruppe? Offenbar eine, die ein im Ganzen ziemlich konsistentes, zumindest teilweise theoretisch begründetes Programm vertritt, das von dem der Mehrheit der Bevölkerung, vor allem aber vom offiziellen Regierungsprogramm in entscheidenden Punkten abweicht und auf Änderung der politischen und sozialen Struktur der Bundesrepublik gerichtet …
Jón ließ das Blatt zu Boden fallen. Zwar beherrschte er die deutsche Sprache, doch dieser Satz bereitete ihm selbst beim zweiten Durchlesen Kopfschmerzen.
In der Küche öffnete er eine Flasche Bier und trank sie leer. Er hörte dem surrenden Kühlschrank zu, der manchmal aus unerklärlichen Gründen zu rattern begann. Dann brauchte man ihm bloß einen Tritt zu verpassen, damit das Rattern erstarb. Komisch, aber der Kühlschrank – ein Luxuskasten, den Jón in Island nie gehabt hatte – war für ihn der perfekte Trinkbruder. Von ihm fühlte er sich verstanden.
Als hätte der Kühlschrank seine Gedanken gelesen, begann er eifrig zu rattern. Jón ließ ihn eine Weile. Man muss ja schließlich auch zuhören können.
Wieder dachte er an seine Heimat, die ihm nach drei Jahren im Ausland wie ein anderer Planet vorkam. Jón hatte sich schon in Island wie ein Außerirdischer gefühlt und hätte mit seiner Körpergröße durchaus einer sein können. Oder waren es das feuchtkalte Wetter und die dunklen Winter, die ihm auf die Seele schlugen? Seine Landsleute, die er verabscheute? Diese armseligen Stümper. Auf der Welt drehte sich nicht alles nur um den Hering und die Klauenseuche. Sie hatten noch nicht gemerkt, dass eine Revolution im Gange war! Die Welt war gespalten, die Gräben zwischen den Kulturen wurden immer tiefer. Es galt zu handeln, den Mächtigen die Stirn zu bieten. Doch die Isländer schauten nur teilnahmslos zu, als wären sie nicht genauso Erdenbewohner wie jeder andere Furz in Persien oder Bolivien. Zudem war Bier in Island verboten, was überhaupt keinen Sinn ergab, wo doch Schnaps inzwischen legalisiert worden war.
Jón führte die Flasche erneut zum Mund, doch sie war leer, also stand er ächzend auf, verpasste dem Kühlschrank einen Tritt und fischte nach einer weiteren Flasche. Er öffnete sie an der Tischkante, und einen Moment war Jón richtig zufrieden. Er beschloss, nicht mehr an seine Heimat zu denken.
4
Nach der dritten Flasche war der Vorrat alle. Eine Weile noch kauerte Jón vor der offenen Kühlschranktür in der Hoffnung, wenigstens etwas Essbares vorzufinden, doch eigentlich starrte er bloß durch den Kühlschrank hindurch und hinein in den Kühlraum der Universität, wo die Leiche eines alten Mannes aufgebahrt war, graubraun, die Haut seltsam pigmentiert. Sie hatte alle Sanftheit verloren. Die Studenten standen ausgerüstet mit Notizblock und Skalpell im Kreis um den leblosen Körper. Professor Röder erklärte, dass sie in einem ersten Schritt die Haut auf der Brust aufschneiden und wegklappen würden, um dann die Fettschicht abzutragen. Jón versuchte, nicht hinzuhören, versuchte, die zittrigen Finger zu verbergen, den Frosch im Hals hinunterzuschlucken. Der süßliche Formalingeruch kroch ihm in die Nase und schnürte ihm die Kehle zu, Jón versuchte, flach durch den Mund zu atmen. Er schloss die Augen. Professor Röder setzte das Skalpell auf der Brust an und drückte es ins wächserne Gewebe. Und Jón musste hinsehen.
Er wankte wie ein Baum im Wind, dann fiel er, langsam nur, fast wie in Zeitlupe. Notizblock und Skalpell flogen durch die Luft, Holger, der hinter dem langen Isländer stand, fing ihn geistesgegenwärtig auf, nicht aber den Notizblock, und schon gar nicht das Skalpell, doch Jón fiel durch Holger hindurch, durch den Boden der Universität, hinein ins Dunkel, in die Schwärze der Unterwelt, wo ihn tausend Hände in die Tiefe zerrten.
Mit einem Seufzer richtete sich Jón auf und schlug die Kühlschranktür zu. Er brauchte mehr Bier, sofort, um den Formalingeruch hinunterzuspülen. Er griff sich seine Jacke und eilte aus der Wohnung. Das Fernschreiben fiel unbemerkt zu Boden.
5
Jón hastete durch die schwach beleuchteten Straßen zum Studentenkeller, als würde er wie in einem Agentenfilm von einem russischen Spion auf Schritt und Tritt verfolgt. Dabei waren es seine Gedanken, die ihn wie böse Geister bedrängten. Sie flüsterten ihm zu, dass es wohl das Beste wäre, das Medizinstudium abzubrechen. Zum Arzt tauge er nicht. Er sei eben doch nur ein Bauer.
Dicke, revolutionäre Luft wallte ihm entgegen, als er die schwere Pendeltür zum Studentenkeller aufstieß. Der Raum war schlicht, roh und laut, die Wände fingerdick mit Plakaten tapeziert, leere Biergläser und überquellende Aschenbecher schmückten die Tische. Die Studenten taten, als könnten sie sich Bier und Zigaretten leisten. Dabei fehlte es den meisten an Flüssigem, und sie rauchten die Zigaretten bis auf die Filter oder stopften die Pfeifen mit getrockneten Birkenblättern. Manche nippten den ganzen Abend am selben Bier, trugen es mit sich herum, bis es warm und abgestanden war.
Niki saß mit ihren besten Freundinnen Ulla und Trudi sowie einigen anderen Kunststudenten an einem Holztisch. Jón blieb im Eingang stehen und betrachtete sie. Sie war klein und hübsch, hatte kurzes, braunes Haar, eine jungenhafte Frisur, die ihr eine kecke Ausstrahlung verlieh. Niki genoss die Gesellschaft ihrer Freunde, diskutierte mit ihnen über alles Mögliche. Es gab indes eins, das sie noch lieber tat, als mit ihren Freunden an einem Tisch zu sitzen und über Gott und die Welt zu plaudern: Tanzen. Schon wippte sie mit den Beinen und schielte immer wieder ungeduldig zur Tanzfläche hinüber.
Jón war ein denkbar schlechter Tänzer. Dafür war er zu lang und zu schlaksig. Ein Hampelmann mit Schnur und festgefrorenem Grinsen hätte ihn locker ausbooten können.
Niki hatte ihn nur ein einziges Mal dazu überreden können, mit ihr zu tanzen; als sie sich genau hier im Studentenkeller kennengelernt hatten. Jón war erst seit ein paar Monaten in Hamburg gewesen und hatte die deutsche Sprache noch nicht beherrscht.
Wie groß er denn sei, fragte sie ihn, nachdem sie sich ihm in den Weg gestellt und neugierig zu ihm aufgeschaut hatte.
Sie war ein wenig betrunken und überrumpelte ihn mit dieser forschen Frage prompt.
»Keine Ahnung«, antwortete er. »Als sie mir das letzte Mal, ähm, gemessen haben, bin ich eine Meter und achtundneunzig gewesen.«
Jón gab sich große Mühe, einen einfachen Satz zu bilden, um nicht wie ein spanischer Hafenarbeiter zu klingen. Doch die Kleine schien es nicht im Geringsten zu stören, dass er ein Ausländer war.
»Und wann haben sie dich das letzte Mal gemessen?«
»Vor etwa einem Jahr, als ich nach Deutschland gekommen.«
»Man hat dich gemessen, als du nach Deutschland gekommen bist?«
»Als ich nach Deutschland gekommen bin«, korrigierte sich Jón. »Wir sind alle untersucht und gemessen worden. Vom Arzt.«
»Wer, ihr?«
»Wir Einwanderer. Vom Schiff.«
»Ich wusste gar nicht, dass Einwanderer ärztlich untersucht werden.«
Jón freute sich, dass ihm eine interessante Antwort gelungen war.
»Und wie groß bist du?«, fragte er, und fand seine Frage nun doch etwas ungelenk.
Niki lächelte.
»Dreißig Zentimeter kleiner als du, würde ich sagen.«
»Oder fünfzig, würde ich sagen!«, antwortete Jón und wollte sich ohrfeigen.
Doch Niki nahm es ihm überhaupt nicht übel. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen.
»Groß genug für dich«, sagte sie. »Willst du tanzen?«
Jón schluckte, doch er ließ sich von Niki auf die Tanzfläche führen. Zum Glück tanzten sie kaum, hielten sich nur in den Armen und lächelten sich von Zeit zu Zeit an. Seither waren sie ein Paar. Es war Niki indes nie wieder gelungen, ihn zum Tanzen zu überreden. Jón fragte sich, wieso sie nicht mit jemandem zusammen sein wollte, der tanzen konnte wie Tom Jones.
Ihr Gesicht hellte sich auf, als sie Jón beim Eingang erblickte. Sie winkte ihn wild zu sich und schob einen Kunststudenten, der neben ihr auf der Wandbank saß, mit beiden Händen von sich, um Platz für ihren Isländer zu schaffen. Jón zeigte hinüber zum Tresen und kippte sich ein imaginäres Bier hinter die Binde. Sie nickte und warf ihm eine Kusshand zu, war wohl schon ein wenig betrunken, denn sie warf für gewöhnlich nicht so schnell mit Kusshänden um sich. Jón bahnte sich einen Weg durch die plappernde Studentenmasse zum Tresen, an dem die Durstigen dicht gedrängt standen. Jedes Mal, wenn der Barmann an Jón vorbeilief, hob Jón den Finger, doch der Barmann war zu beschäftigt, als dass er ihn hätte bemerken wollen, und so stand Jón eine ganze Weile einfach nur da, als gehörte er zum Inventar.
»Moin, moin, der Isländer! Ich hab dir das Info-Blatt mitgebracht!«
Jón schloss einen Moment die Augen, als sich Benno neben ihn an den Tresen zwängte.
»Es war ein echt hitziger Abend, sag ich dir!« Sie standen Schulter an Schulter. »Wir halten morgen eine Trauerkundgebung vor dem Audimax ab. Es soll aber auch ein Protest …«
Benno zückte das Info-Blatt aus seiner Jackentasche und las feierlich:
»… ein Protest gegen die brutalen Übergriffe der Polizisten und die zynischen Äußerungen ihrer politisch Verantwortlichen sein …«
Jón hob den Finger, als der Barmann an ihm vorbeilief. Benno fuhr fort:
»Die zuständigen Politiker, der Bürgermeister und Innensenator sowie der Polizeipräsident müssen zur Rechenschaft gezogen werden –«
»Benno!«, rief Jón. »Gib mir schon das Blatt. Ich kanns ja selbst lesen.«
Benno überreichte es ihm.
»Morgen, um 11:30. Die Vorlesungen werden ausfallen.«
»Ich muss was trinken«, erwiderte Jón. »Du auch?«
»Klar! Ich suche uns zwei Stühle, damit wir uns da drüben bei deiner Herzallerliebsten hinsetzen können.«
»Nein!«, wollte Jón rufen, doch schon bahnte sich Benno einen Weg durch die Studenten.
Der Barmann ignorierte den Isländer weiterhin.
»Til helvítis!«, fluchte Jón nach weiteren, zermürbenden Minuten.
In der Strandperle gab es nicht nur die besten Fischbrötchen, sondern auch billiges Flaschenbier. Dort würde er sich eindecken und zu Hause am Küchentisch die Überreste des Abends hinunterspülen können. Also gab Jón seinen Posten am Tresen auf und zwängte sich wieder durch die Studentenmasse. Er winkte Niki zu, doch sie war inzwischen in ein Gespräch mit dem Kunststudenten vertieft, den sie zuvor von sich geschoben hatte. Sie saßen dicht, um sich im Lärm verständigen zu können. Benno war nirgends zu sehen, war wohl noch immer damit beschäftigt, zwei Stühle aufzutreiben. Wieder winkte Jón seiner Freundin zu, wieder sah sie ihn nicht, Jón rief ihren Namen, sie hörte ihn nicht. Jón ging, sie bemerkte es nicht.
Auf dem Weg zum Elbstrand holte sie ihn ein, kam ihm flatternd hinterhergerannt. Er hatte die Hände in den Jackentaschen vergraben und den Kopf gesenkt.
»Jón! Jetzt bleib doch stehen!«, schrie sie, sodass sich Leute nach ihr umdrehten.
Jón blieb stehen. Einige Burschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite lachten. »Jón!«
Sie landete unsanft an seiner Schulter und hielt sich daran fest. »Was ist denn nur mit dir los?«
»Nichts ist los«, brummte Jón, ohne die Hände aus den Jackentaschen zu nehmen und Niki an sich zu drücken. »Ich will doch nur ein Bier.«
Er riss sich los und marschierte weiter. Niki hielt ihn energisch am Arm fest.
»Nein, jetzt stehst du still, Bürschchen! Noch einmal läufst du mir nicht davon!« Jón ließ sich zurückhalten. »So. Red mit mir!«, befahl sie.
Jón redete nicht. Beinahe hätte er geheult, doch er unterdrückte die Tränen mit der angeborenen Willenskraft eines jeden Burschen des isländischen Hinterlandes.
Du hast einen Besseren verdient, dachte er, hätte es auch sagen wollen, doch ein Frosch steckte ihm im Hals.
»Ist es wegen dem Zwischenfall im Präpsaal?«
Wieder riss er sich los und marschierte davon. Niki blieb resigniert stehen.
»Was zum Kuckuck hast du denn? Ist in Island etwas passiert?«
Jón blieb stehen.
»Was sollte denn passiert sein?«, fragte er mürrisch.
»Hast du den Brief nicht gelesen?«
»Welchen Brief?«
»Ein Fernschreiben. Ich habs dir aufs Bett gelegt!«
»Ein Fernschreiben? Von meiner Mutter?«
Niki hielt sich erschrocken die Hand vor den Mund. Sie sagte leise: »Ich glaube, es ist von deiner Tante.«
»Von Tante Rósa?«
Sie nickte ängstlich. Er rannte.
6
»Was steht denn im Brief?«, flüsterte Niki.
»Ich gehe nach Hause«, sagte Jón tonlos, zerknüllte das Fernschreiben und ließ es auf den Boden fallen.
»Ich verstehe nicht.«
»Ich gehe nach Island, sobald als möglich.«
»Island? Wieso denn?«
Tränen schossen Niki in die Augen. Sie hatte das Gefühl, dass Jón ihr entglitt.
»Meine Mutter liegt im Sterben«, sagte Jón und war schon weit weg.
7
Niki schlief noch, als sich Jón am nächsten Morgen aus der Wohnung schlich. Mit der Straßenbahn fuhr er zum Bahnhof Altona, löste einen Fahrschein nach Kopenhagen und kontaktierte eine isländische Reederei. Er hatte Glück. Ein Frachter würde am Abend ablegen. Sein Geld – ein Notgroschen, den er im Kühlschrank gebunkert hatte – reichte zwar nicht für die Überfahrt, doch der Kapitän drückte ein Auge zu, sagte, dass sich Jón auf dem Schiff nützlich machen könne.
Als er zurückkam, um seinen Rucksack zu packen, war Niki nicht mehr da. Jón war enttäuscht, dass er ihr nicht würde auf Wiedersehen sagen können. Sie wusste ja gar nicht, dass er sich schon heute davonmachen würde. Bestimmt rechnete sie damit, ihn an der Trauerfeier für den bei einem Protest getöteten Studenten zu sehen. Und doch war er froh, sich nicht von ihr verabschieden zu müssen. Bestimmt hätte es Tränen gegeben. Manchmal war ihm die Zuneigung, die er von ihr erfuhr, fast zu viel, wenn sie sich tröstend um ihn schlang und ihn stolz »mein stummer Schachmeister« nannte und sich ausmalte, wie gescheit ihre Kinder einst sein würden. Sie täuschte sich. Er war kein Schachmeister. Zwar hatte er als Jugendlicher einige lokale Turniere gewonnen und sogar gegen Islands damalige Nummer eins ein Remis gespielt. Er galt wenigstens für kurze Zeit als überraschendes Schachtalent, wie er Niki zu Beginn ihrer Beziehung erzählt hatte, um ihr zu imponieren. Doch dass sein Ritt auf der Erfolgswelle nicht lang angedauert hatte, verschwieg er ihr. Mit knappen achtzehn Jahren war er beim Landesturnier in Reykjavík sang- und klanglos ausgeschieden und weigerte sich seither, an Wettkämpfen teilzunehmen und Schachfiguren überhaupt anzurühren. Jetzt fühlte er sich gegenüber Niki wie ein Falschmünzer. Sie hatte einen Besseren verdient, davon war er überzeugt, auch davon, dass sie diesen Besseren bald finden würde.
Jón seufzte und blieb eine ganze Weile auf Nikis Betthälfte liegen, den Rucksack reisefertig neben sich. Er konnte sich nicht rühren, seine Knochen fühlten sich wie Blei an. Er hätte nach dieser durchwachten Nacht gern schlafen wollen – ein Luxus, den er sich nicht leisten konnte.
So vergingen die Minuten. Draußen vor dem Fenster brummte die Stadt, und sie würde damit nicht aufhören. Sie würde den Isländer nicht vermissen, würde nicht einmal bemerken, dass er weg war. Jón wischte sich die Tränen aus den Augen und richtete sich ächzend auf.
Das Leben geht immer vorwärts, dachte er dumpf. Immer vorwärts. Unaufhaltsam, wie ein Stein, der den Berg hinunterrollt, und wer nicht schnell genug rennt, wird vom Stein überrollt und bleibt liegen. Wie die Bettler am Bahnhof.
Er hinterließ Niki eine Abschiedsnotiz, doch der schwere Rucksack auf der Schulter behinderte ihn beim Schreiben. Ich fahre heute Nachmittag mit dem Schiff nach Island. Rückkehr unbestimmt.
Er fügte der kaum leserlichen Notiz noch ein paar wenige Worte bei, die er sogleich wieder durchstrich, doch wenn man lange genug hinsah, konnte man sie entziffern. Da stand: In Liebe, dein Schachmeister.
8
Weit kam Jón nicht, wurde flugs auf der Flucht ertappt. Herr Paul, seit einem knappen Jahr Besitzer des Hauses, fing ihn auf der Treppe ab. Beinahe begann Jón zu knurren, denn Paul war nicht leicht abzuwimmeln. Er war ein etwas älterer, irgendwie vornehmer Herr, stets elegant gekleidet, als wäre er ein Baron in seiner Villa und nicht bloß Vermieter in einem schäbigen Mehrstockgebäude, wo außer ein paar Studenten einzig Eigenbrötler wohnten, die ihre Wohnungen nur dann verließen, wenn sie Essen oder Katzenfutter heranschaffen mussten. Ein sonderbar fürsorglicher Typ, irgendwie deplatziert, wenn auch harmlos. Er hatte Jón, schon als sie sich zum ersten Mal im Treppenhaus begegnet waren, Privatunterricht in Deutsch angeboten und darauf bestanden, nichts dafür zu verlangen. Er mache das gern, hatte er sich gerechtfertigt. Er sei gut situiert und habe sonst kaum Verpflichtungen, da er frühpensioniert und alleinstehend sei, die Kinder aus seiner geschiedenen Ehe ausgewandert und so weiter.
Während den einschläfernden Abenden in der Stube des Barons hatte Jón nicht übersehen, dass an den Wänden viel Kunst hing: Dix, Modigliani, Tuke und ein Ivanov-Gemälde, wenn auch nur eine Kopie, wie ihn Niki nach einem Abendessen beim Baron aufgeklärt hatte.
Nach einem halben Jahr war Jón so weit, den Privatunterricht zu beenden – ganz zur Enttäuschung des Barons. Doch der wusste ihn fortan in ein Gespräch zu verwickeln, wenn sie sich im Treppenhaus, im Innenhof oder gar im Tante-Emma-Laden um die Ecke begegneten. So sagte er nun:
»Gehst du auf Reisen?«
»Ja«, antwortete Jón knapp und blieb einige Treppentritte über Herrn Paul stehen.
Dieser wich nicht.
»Osterferien?«
»Nein, ich gehe nach Hause.«
»Nach Island? So plötzlich?«
»Mhm.«
»Das habe ich ja gar nicht gewusst! Mitten im Semester? Wie lange bleibst du denn fort?«
Jón zuckte mit den Schultern.
»Das wird sich zeigen«, sagte er.
Sein Vermieter legte die Stirn in Falten.
»Ist etwas passiert?«
Jón zögerte.
»Meine Mutter … Sie liegt im Sterben.« Er presste die Lippen zusammen.
»Du meine Güte. Du meine Güte!«, sagte der Baron und hielt sich die Hand vor den Mund. An fast all seinen Fingern steckten Ringe.
»Das tut mir von Herzen, von Herzen leid, mein Junge. Von Herzen!«
Er trat bis auf eine Stufe an Jón heran, griff nach dessen Hand und verbarg sie in seinen. Der Baron roch nach edlem Parfüm. Seltsam, wie Jón die übertrieben sentimentale Anteilnahme tröstete. Vielleicht war das Mitgefühl seines Vermieters gar nicht so übertrieben und sentimental, wie er sich dachte. Der Alte lebte schließlich allein. Bestimmt hatte auch er seine Portion Kummer verabreicht bekommen. Er musste wissen, was Verlust wirklich bedeutete, einsam, wie er war.
Plötzlich wurde sich Jón bewusst, dass er Herrn Paul geradezu anglotzte und dass der Händedruck lange dauerte – sehr lange.
»Danke«, sagte Jón und riss seine Hand aus der Umklammerung.
Herr Paul nahm Abstand und schüttelte gedankenverloren den Kopf.
»Wann fliegst du?«, fragte er mit Grabesstimme.
»Fliegen?«
Jón verlagerte das Gewicht des Rucksackes von einer Schulter auf die andere. Das sei doch viel zu teuer, erklärte er. Ein Frachtschiff fahre ihn von Kopenhagen nach Reykjavík, es lege am Abend ab. Er müsse dann wohl los, auf Wiedersehen …
Doch ganz so einfach ließ ihn der Baron nicht entwischen. Er versperrte ihm den Weg, indem er mit der einen Hand das Treppengeländer festhielt und sich mit der anderen an die Wand stützte.
»Ich wäre nur zu gern bereit, dir Geld für einen Flugschein zu geben. Ein Darlehen natürlich.«
Jón wusste nicht, was er darauf hätte antworten sollen.
»Du brauchst es nur zu sagen, Jón«, fuhr der Alte fort. »Ich würde dir sehr gern helfen. Weißt du, man ist froh, wenn man anständige Mieter hat. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.«
Jón lehnte höflich, aber bestimmt ab. Der Alte sah sich als eine Art Mentor, sprach sich gar eine gewisse Vaterrolle zu. Möglich, dass er in Jón einen Sohn sah, den er verloren oder nie gehabt hatte, und nun versuchte, sich seine Zuneigung zu erkaufen. Dieser sentimentale Tropf.
Niki hatte indes eine andere Theorie: Herr Paul habe es möglicherweise auf junge Buben abgesehen, hochgewachsene, gutbestückte Burschen, wie Jón einer war. Er solle also bitte vorsichtig sein, wie sie ihm augenzwinkernd geraten hatte. Der Alte werde ihn bestimmt noch vernaschen wollen!
»Ich komme schon über die Runden«, sagte Jón kurz angebunden. »Ich habe die Fahrt nach Island doch schon bezahlt. Danke trotzdem.«
Ungeduldig trat er eine Stufe tiefer, und sein Vermieter gab ihm den Weg frei.
»Wann kommst du wieder nach Hamburg?«, rief ihm dieser noch hinterher.
»Ich weiß es nicht, vielleicht in einem Monat«, antwortete Jón, während er die Stufen hinunterrannte.
»Auf Wiedersehen, Jón!«, rief Herr Paul.
»Vielleicht«, brummte Jón, und endlich war er im Freien.
9
Auf dem Schiff hütete Jón meist sein Kajütenbett. Seine Hilfe war nur beim Beladen des Frachters gebraucht worden. Er hatte dem Koch helfen müssen, einige Kisten mit Nahrungsmitteln in die Kombüse zu tragen.
Müdigkeit drückte ihn ins muffige Kissen, er schlief tief und traumlos, als sauge das Meer alle Gedanken und Träume in sich auf.
Als er aufwachte, wusste er weder wie lange er geschlafen hatte noch wie weit draußen sie waren. Das Schiff schraubte sich unaufhaltsam vorwärts, und immer vorwärts. Das dumpfe Wummern des Schiffsmotors und die trockene Luft in der fensterlosen Mehrbettkajüte, einige Meter unter der Wasseroberfläche, wirkten betäubend, sodass Jón bald wieder wegdriftete.
Es musste in der zweiten Hälfte der Nacht gewesen sein, kurz vor der Morgendämmerung, als Jón aus dem Schlaf aufschreckte und sich den Kopf am oberen Kajütenbett stieß. Er rieb sich die surrende Stelle, fluchte leise und hoffte, dass er niemanden in der Kajüte geweckt hatte. Er tastete sich auf die Bordtoilette, erleichterte sich und kletterte sodann über den steilen Niedergang an Deck. Die salzige Meeresluft strömte wohltuend in seine Lungen. Jón stand eine ganze Weile frierend an der Reling und starrte hinaus in die Dunkelheit. Rings um ihn war nur Tintenschwärze. Er lauschte dem Rauschen des Schiffes, das sich durchs Wasser pflügte, immer weiter weg von Europa, weg von Niki, dem einzigen Mädchen, dass er jemals geliebt hatte – Island entgegen, seinem Heimatland. Dahin, wo sich einst Menschen niedergelassen hatten, die eigentlich gar nicht in Island sein wollten, die dennoch anderswo ein neues Leben aufbauen mussten. Steuerflüchtlinge, Mönche, Verbrecher. Wenn seine Mutter gestorben war, würde er seiner Heimat für immer den Rücken kehren, no loose ends, wie die Amerikaner sagen. So long! Er würde wieder an der Reling stehen, die letzten Überreste der Küste im Rücken, ein neues, großes Leben vor sich. Er freute sich auf diesen Moment.
Schon einmal hatte er Island auf einem Frachtschiff verlassen, dabei hätte er doch zu Hause den Hof übernehmen sollen. Doch er hatte nicht gewollt. Er war kein Bauer. Früh hatte er Steinholt den Rücken gekehrt, war knapp vierzehn Jahre alt gewesen, als er aufs Gymnasium nach Akureyri gegangen war. Darauf hatte er die Hochschule in Reykjavík besucht und sein Brot am Hafen verdient, hatte die Fracht der Trawler entladen, bis er schließlich ein Stipendium bekommen hatte, um in Hamburg Medizin studieren zu können.
Jetzt steuerte er wieder auf Island zu, diesen schwarzen Felsen auf dem mittelatlantischen Rücken, der irgendwo vor ihm im Dunkeln lag. Diese Insel machte es ihren Bewohnern schwer, als zivilisierte Menschen im 20. Jahrhundert zu leben. Wie im Mittelalter musste man immer auf der Hut sein, musste die Berge und Flüsse kennen, die Sprache der Wolken und des Windes beherrschen und musste wissen, wo sich die Trolle herumtrieben. Denn war man einen Augenblick unachtsam, geriet man leicht in einen Wintersturm, wurde von den Trollen hinterrücks überfallen, in einen Fluss geschleudert und ins Meer gespült.
Jón spuckte über die Reling. Hatten sie die Färöer-Inseln schon hinter sich? Das Wasser war wilder geworden, und das Schiff hob und senkte sich.
Auf dem Weg zurück in die Kajüte schubste ihn das Schiff im schmalen Korridor von einer Seite zur anderen. Ein betrunkener Mann kam ihm torkelnd entgegen, sagte etwas auf Färöisch und lachte, doch Jón verstand ihn nicht und tat so, als hätte er ihn gar nicht bemerkt.
Nach ein paar Metern roch Jón Erbrochenes, und bald sah er eine braune Lache Halbverdautes auf dem Boden im Korridor. Jetzt dämmerte Jón, was ihm der Betrunkene eben hatte sagen wollen. Er versuchte, einen Bogen um das Erbrochene zu machen, so gut es der schmale Korridor zuließ, doch das Schiff neigte sich erneut und schubste Jón direkt auf den Fladen, sodass er sich nur mit einem akrobatischen Sprung retten konnte. Die Beine fast zu einem Spagat gespreizt, fing er sich über dem Erbrochenen auf und stützte sich dabei an der Wand ab, als würde er von der Polizei gefilzt.
Das war knapp, dachte er noch, als ein Matrose um die Ecke gebogen kam und sogleich einen wütenden Knurrlaut von sich gab.
»Das ist nicht von mir!«, rief Jón und sprang vom Erbrochenen weg, als hätte er Sprungfedern an den Füßen. Er zwängte sich am Matrosen vorbei, der stehen geblieben war und die Hände zu Fäusten geballt auf seine Hüften stützte.
»Penner«, grollte er und schaute Jón kopfschüttelnd hinterher.
In der Kajüte blieb Jón eine Weile zitternd auf dem Kojenrand sitzen. Er befürchtete, dass man an die Tür pochen und ihn zurück auf den Korridor zerren würde, um ihn das Erbrochene aufwischen zu lassen. Doch niemand kam.