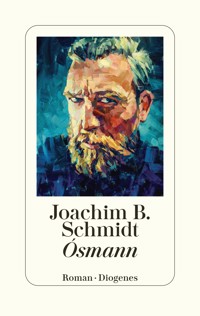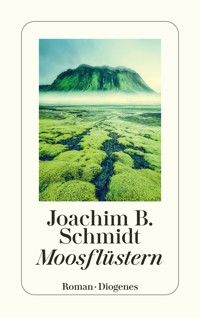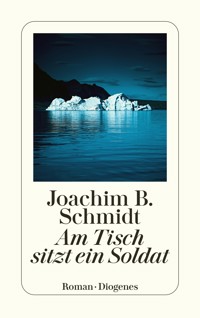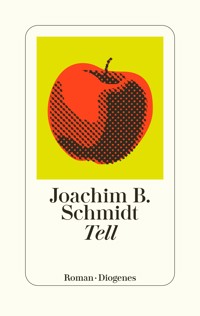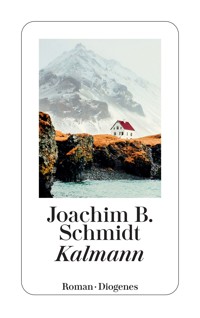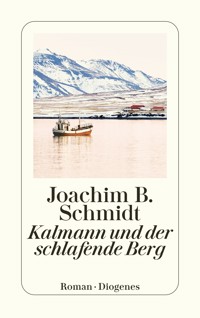
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kalmann
- Sprache: Deutsch
Kalmann sitzt in der Tinte. Besser gesagt, er sitzt im FBI-Hauptquartier in Washington. Dabei wollte er eigentlich nur seinen amerikanischen Vater besuchen. Doch der lässt ihn hängen, und ehe Kalmann sichs versieht, sitzt er wieder im Flugzeug zurück nach Island. Im hohen Norden hat er aber auch keine Ruhe. Ein Mord ist geschehen, und die Spuren reichen zurück bis nach Amerika und in den Kalten Krieg. Und wer muss diesen explosiven Fall aufklären? Korrektomundo: Kalmann, der berühmte Sheriff von Raufarhöfn.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Joachim B. Schmidt
Kalmann und der schlafende Berg
roman
Diogenes
Für meine größten Schätze
Heiðdís Elisabeth und Rögnvald Anton
Das Land getunkt in schwarze Schatten
Dunklen Nächten geweiht bist du
Der Weg
der Weg
wohin führt er? Voran immerzu.
Landið sokkið í svartan skugga
Sorta nætur þú vígður ert
Leiðin
leiðin
liggur áfram en hvert?
Jónas Friðrik Guðnason
Lyriker, 1945–2023
⌘
1Sarg
Ich wünschte, mein Vater hätte mir diesen Brief nie geschrieben. Ich wünschte, er hätte mich und meine Mutter in Frieden gelassen, damit wir in Ruhe hätten Filme gucken und Pizza essen können, nur sie und ich. Wir schlugen uns gut durch die regnerischen Sommertage und die stürmischen Herbstabende hier oben im Nordland und unsere Trauer, die gehörte nur uns. Wenn mein Vater diesen Brief nie geschrieben hätte, dann hätten mir die FBI-Beamten nicht den Arm verdreht und mein Gesicht auf die Motorhaube des schwarzen Cherokee-Jeeps geknallt. Und das Silvesterfeuerwerk in Raufarhöfn hätte ich auch nicht verpasst. Das habe ich nämlich noch nie verpasst, das ist hier Tradition, und Traditionen sind wichtig, auch wenn man manchmal gar nicht mehr weiß, wie sie angefangen haben.
So wie diese Geschichte. Sie fängt vielleicht mit dem Brief meines Vaters an, eine E-Mail bloß, die meine Mutter auf der Arbeit ausgedruckt und mit nach Hause gebracht hatte, was letztendlich dazu führte, dass ich vom FBI verhaftet wurde.
Hatte ich geschrien? Oder war ich stumm geblieben? Ich hasse es, wenn mein Verstand einen Taucher macht wie ein Schiff hinter einer Monsterwelle. Es hat nie etwas Gutes zu bedeuten. Wenn wenigstens meine Mutter da gewesen wäre. Sie hätte den Beamten die Sache erklären können, ganz bestimmt. Aber jetzt war ich hier, mutterseelenallein, viertausendsiebenhundert Kilometer von Island entfernt, in einem winzigen Raum, der außer drei unbequemen Stühlen und einem kleinen Tisch nichts hatte, kein Fenster, keinen Fernseher, keine Bilder – ein Sarg, und ich war eingesperrt, Deckel zu. Peng. Tief vergraben und bald vergessen.
Wie Großvater.
Es war natürlich kein Sarg, sondern ein Verhörraum in einem riesigen Gebäude vom FBI, ein richtiger Klotz. Ich hatte ganz schön gestaunt, als wir im Cherokee-Jeep darauf zugerast waren. Klar hatte ich schon Häuser gesehen, die sogar noch größer sind, zum Beispiel die Kirche in Reykjavík oder das Hotel in Kevin, allein in New York – den Film kenne ich auswendig. Aber bei diesem Klotz hier hatte ich das Gefühl, dass er im Boden versinken würde. Er war braun und schwer wie die Basaltsteine der Melrakkaslétta und so groß, dass man alle Bewohner von Raufarhöfn in Einzelzimmern darin hätte unterbringen können. Das muss man sich einmal vorstellen: sämtliche Einwohner in einem einzigen Haus, mit Schule und Laden und Gemeindesaal und Tankstelle und allem! Aber hier war niemand aus Raufarhöfn, und darum fühlte ich mich so einsam wie nie zuvor.
Früher habe ich geglaubt, dass der einsamste Ort der Welt im Schulzimmer ist, in der hintersten Reihe, da, wo man ganz allein am Tisch sitzt und nicht begreift, was der Lehrer vorne der Klasse erklärt. Alle hören aufmerksam zu oder schreiben etwas auf, werfen dir manchmal Blicke nach hinten, froh darüber, dass es jemanden gibt, der blöder ist als man selbst. Niemand möchte der Dümmste sein. Aber jemand muss der Dümmste sein, und wenn man so ist wie ich, ist es das Klügste, es nicht abzustreiten.
Ein Lehrer sagte einmal, dass man das Wissen selbst mit einem Hammer nicht in meinen Schädel hämmern könne. Sigfús war das, eigentlich war er der Rektor in unserer Schule. Aber an dem Tag war unsere Lehrerin krank, und Sigfús musste einspringen.
Jetzt ist er schon alt, aber nicht so einfach totzukriegen, geht langsam und mit kleinen Schritten durchs Dorf. Er stützt sich auf Skistöcken ab, sogar im Hochsommer, denn damit kann er Küstenseeschwalben und Touristen vertreiben. Heute ist er nicht mehr so gemein zu mir, sondern ganz nett eigentlich, als habe er völlig vergessen, dass ich ihn damals mit meiner Dummheit fast zur Verzweiflung gebracht habe. Einmal warf er ein dickes dänisches Wörterbuch über die Köpfe meiner Mitschüler hinweg nach mir. Aber weil ich mich im letzten Moment duckte, prallte das Buch an die Weltkarte hinter mir an der Wand. Zurück blieb ein Loch im Atlantischen Ozean. Weil ich der Einzige war, der das lustig fand, schickte mich Sigfús vor die Tür, und da machte ich wohl etwas kaputt, schlug die Glasvitrine mit den ausgestopften Vögeln ein und ließ sie fliegen, die Brandeule, den Goldregenpfeifer, den Papageitaucher, die Bekassine, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber den Raben fasste ich nicht an, ganz bestimmt nicht. Diese Räuber machen mir nämlich Angst, weil sie hinterlistig und gerissen sind, wahrscheinlich klüger als Sigfús, auch wenn sie nicht Dänisch können. Raben mögen den Tod, fressen gern Aas. Wie Grönlandhaie oder Polarfüchse oder Seewölfe. Dabei sind Seewölfe gar keine richtigen Wölfe, sondern Fische. Sie sind gestreift oder gefleckt und eigentlich zu dick geratene Aale. Der Seewolf ist wahrscheinlich das hässlichste Tier im großen weiten Nordmeer. Seine Fresse ist so scheußlich, dass selbst der beste Zahnchirurg einen Schrecken bekäme. Aber alles hat seinen Sinn, vor allem in der Natur, und darum braucht es im Meer keine Zahnchirurgen, die gibt es nur bei uns, denn der Mensch ist das einzige Tier, das die Zähne dazu benutzt, um freundlich zu lächeln.
Glücklicherweise musste ich nach der Sache mit den ausgestopften Vögeln erst einmal nicht mehr in die Schule. Großvater nahm mich aufs Meer mit, damit ich ihm helfen konnte, Haie zu fangen, Köderstücke an die Haken zu spießen und am Steuer zu stehen, wenn er unten in der engen Kajüte oder ausgestreckt auf dem Deck ein Nickerchen machte. Dabei hätte ich wie jedes andere Kind in die Schule gemusst. Das ist nämlich das Gesetz. Aber das war mir damals noch nicht klar. Großvater sagte, dass ich hier draußen viel mehr lerne als im Schulzimmer, denn Buchstaben könne man nicht essen.
Als ich dann doch wieder die Schulbank drückte, musste ich gleich am ersten Tag nachsitzen, bis es dunkel wurde. Bis Großvater plötzlich im Türrahmen stand, geduckt, bebend. Daran erinnere ich mich gut, weil ich ihn noch nie zuvor im Schulzimmer gesehen hatte. Er wollte von Sigfús wissen, ob er eigentlich einen Schaden habe, und Sigfús, der von seinem Lehrerstuhl aufgesprungen war, erklärte, er habe nur helfen wollen, Privatunterricht eben, damit ich das Schuljahr nicht noch einmal wiederholen müsse. Aber Großvater entgegnete, man könne ein Jahr gar nicht wiederholen, niemand könne das, ein Jahr könne nur einmal gelebt werden, danach sei es vorbei. Punkt. Und damit war meine Karriere als Schüler beendet.
Jetzt gerade wäre es mir völlig egal gewesen, wenn ich im Schulzimmer in Raufarhöfn hätte nachsitzen müssen, denn überall anders war es besser als in diesem Sarg beim FBI. In der Schule hätte ich wenigstens zum Fenster hinausschauen und Halldór dabei beobachten können, wie er auf dem Parkplatz Schnee schaufelte oder sich auf der Schaufel abstützte, weil er sich mit jemandem über den Schnee unterhielt. Und nach dem Nachsitzen hätte ich mit den anderen Kindern in der Pallabrekka Schlitten fahren oder eine Schneeballschlacht machen können. Ich gegen alle, bis einer geheult hätte, das war nämlich immer so. Man hätte mich nach Hause geschickt, aber ich wäre durchs Dorf gestreunt, bis ich Großvater irgendwo aufgespürt hätte, unten am Hafen vielleicht oder beim Trocknungshäuschen. Großvater war es meistens egal, dass die Leute über mich schimpften. Und außerdem wäre er noch am Leben gewesen.
⌘
2Dakota Leen
Der groß gewachsene FBI-Agent, der mich festgenommen, in die Zentrale gefahren und hier sitzen gelassen hatte, steckte seinen Kopf zur Tür herein und fragte mich, ob ich Durst oder Hunger habe, und ich bestellte eine Cola.
Ich kenne das. Wenn man verhört wird, darf man ein Getränk bestellen. Das ist das Gesetz.
Eine halbe Ewigkeit später ging die Tür wieder auf, aber diesmal erschien eine junge FBI-Agentin, die ich noch nie gesehen hatte, weder bei der Festnahme noch als wir durch das riesige Gebäude gegangen sind. Ich hätte sie ganz bestimmt nicht übersehen, obwohl sie eher klein war. Aber sie war sehr hübsch und jünger als ich, und ihre Haut war schwarz, aber nicht so schwarz wie ihr Haar, das zu eintausend kleinen Zöpfen geflochten und am Hinterkopf eng verknotet und hochgesteckt war. Sie trug auch keine kugelsichere Weste wie ihre Kollegen im Cherokee-Jeep, war nicht mal bewaffnet, ihr Pistolenholster war leer. Unter ihren linken Arm hatte sie einen Laptop geklemmt und unter ihren rechten ein Notizbuch, in den Händen hielt sie einen bis zum Rand mit Kaffee gefüllten Pappbecher und eine Cola-Dose. Sie blieb in der Tür stehen und starrte mich einen Moment an, presste den Laptop fest an sich.
»Hello Kalmann«, sagte sie und nickte mir flüchtig zu. »Can I call you Kalmann?« Mit dem Fuß gab sie der Tür einen Stoß, ohne auch nur einen Tropfen aus ihrem Pappbecher zu verschütten. Dann blieb sie unschlüssig stehen. »Brauchst du einen Dolmetscher, jemanden, der das Gespräch übersetzt?«, fragte sie mich auf Englisch.
Ich schüttelte den Kopf und sagte, um ihr klarzumachen, dass ich sie gut verstand: »No need to worry.«
»No need to worry«, echote sie und lächelte erleichtert. »Hat dir dein Vater Englisch beigebracht? Er ist Amerikaner, nicht wahr?«
»Nein«, sagte ich. »Dr. Phil.«
»Dr. Phil, die Talkshow?«
»Und The Bachelor, Top Gear, Gilmore Girls –« Ich verstummte abrupt, denn das mit den Gilmore Girls hätte ich eigentlich nicht verraten wollen. Ich schaute diesen Frauenkram schon lange nicht mehr.
»I love Gilmore Girls!«, sagte die FBI-Agentin und beugte sich über den Tisch, um all ihre Sachen abzulegen, was wohl gar nicht so einfach war. »I’m agent Dakota Leen, but you can call me Dakota or Cody.«
Ich beschloss, dass ich sie Dakota Leen nennen würde, schließlich war sie eine richtige FBI-Agentin.
»Und der andere?«, fragte ich.
Sie warf einen Blick zur Tür.
»Mr. García? Was soll mit ihm sein?«
»Er hat gesagt, er werde sich noch um mich kümmern.«
»Willst du, dass er dich befragt?«
»Lieber nicht.«
»Gut.« Sie klappte ihren Laptop auf und legte das Notizbuch sowie einen Kugelschreiber daneben, alles ganz ordentlich. Ihr Hemd war bis oben zugeknöpft.
Das Licht des Laptops warf einen blauen Schimmer auf ihr Gesicht, das ständig neugierig zu sein schien. Dakota Leen tippte etwas ein.
»Just a minute«, sagte sie, stand abrupt auf und ging Mr. García holen, der sich über den Laptop beugte und ihr erklärte, wo das Programm zu finden sei, wo sie den Code eingeben, Kamera und Mikrofon anklicken müsse, hier und hier, aber zuerst müsse sie noch den Raum auswählen – wir waren in der Vier – er werde es ihr nicht wieder zeigen.
»Got it.« Dakota Leen räusperte sich, und jetzt weiß ich, dass auch Menschen mit schwarzer Haut ein rotes Gesicht bekommen können, man muss aber schon genau hinschauen.
»You can do it!« Mr. García legte seine Hand auf ihre Schulter, schaute dabei aber mich an, starrte richtiggehend, als habe er mich eben erst bemerkt, und wie durch Zauberei spürte ich seine Hand auch auf meiner Schulter liegen. »Es gibt für alles ein erstes Mal, nicht wahr?« Er zwinkerte mir abschließend zu und verließ den Raum, warf die Tür hinter sich ins Schloss, und Dakota Leen strich mit der Hand über ihre Schulter und atmete gepresst aus. Ich gönnte mir ein paar Schlucke aus der Cola-Dose.
»Januar, der sechste, zwanzig-zwanzig, nein, Unsinn, wir haben schon zwanzig-einundzwanzig! Ich bin Agentin Dakota Sage Leen, zwölf, null, zwei, elf. Ich spreche mit –«, sie schaute mich plötzlich ganz direkt an, und weil ich wie ausgeknipst zurückstarrte, die Cola-Dose auf halber Höhe haltend, ergänzte sie: »Please state your name!«
»Kalmann«, beeilte ich mich zu sagen und unterdrückte einen Rülpser. »Óðinsson.«
Wieder tippte sie auf der Tastatur herum und ich fasste Mut.
»Kann ich dich etwas fragen?«
Sie nickte.
»Natürlich.«
»Bin ich verhaftet?«
Dakota Leen lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und wippte ein wenig mit der Rückenlehne, dabei spannte sich ihr Hemd über der Brust. Ich tat mein Bestes, nicht hinzugucken.
»Denkst du, dass du verhaftet bist?«
Eine Frage beantwortet man nur dann mit einer Frage, wenn man die Antwort selbst nicht weiß. Also zuckte ich mit den Schultern und widmete mich der Cola-Dose. Sie war größer als die in Island, ansonsten identisch. Ich führte sie an die Lippen und trank sie bis auf den letzten Tropfen leer.
»Kalmann.« Dakota Leen beugte sich vor. »Du musst mir bloß ein paar Fragen beantworten, in Ordnung?« Ich nickte. »Fangen wir gleich an. Was hattest du da draußen zu suchen?«
Ich dachte an meinen Vater und bekam einen Kloß im Hals, als würde ich durch einen Strohhalm atmen. Meine Hände versteiften sich und die Cola-Dose bekam eine Delle.
»Ich habe sie gesucht.«
»Wen hast du gesucht?«
Ich presste die Dose noch fester zusammen.
»Sie waren plötzlich alle weg. Mein Vater, Onkel Bucky, sogar Sharon, da waren so viele Leute, und ich wurde rumgeschubst, und meinen Cowboyhut habe ich auch verloren.«
»Und wo sind sie jetzt, dein Vater, Onkel Bucky und Sharon?«
Ich machte die Dose mit beiden Händen so platt, als wäre ein Lastwagen über sie hinweggefahren. Dakota Leen rutschte mitsamt ihrem Stuhl ein wenig vom Tisch weg und ließ mich dabei nicht aus den Augen.
»Bin ich verhaftet?« Ich wiederholte die Frage leise, und die FBI-Agentin seufzte.
»Nein, Kalmann, du bist nicht verhaftet. Du kannst jederzeit gehen. Da ist die Tür. Sie ist nicht abgesperrt. Aber ich bin die Einzige, die dir jetzt helfen kann. Darum musst du mir ein paar Fragen beantworten, verstehst du? Es gibt nämlich ganz viele Dinge, die ich nicht weiß. Die nur du weißt. Und danach helfe ich dir, deine Leute zu finden. Deal?«
Ich willigte ein, und damit begann das Verhör. Es war aber nur der Anfang eines stundenlangen Gesprächs, ich hatte also einen miserablen Deal gemacht. Doch das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich erzählte der FBI-Agentin, dass wir den Präsidenten hatten besuchen wollen, um danach mit ihm einen Spaziergang zu machen. Aber der Präsident sei gar nicht mitgekommen, obwohl er es versprochen habe.
»Versprechen darf man nicht brechen«, erklärte ich ihr und musste an die wütende Menschenmenge denken, die vielleicht deswegen enttäuscht war, weil so viele Versprechen nicht eingehalten worden waren.
Es gibt fast nichts Schlimmeres als die Enttäuschung, denn sie macht so vieles kaputt, das Vertrauen und die Vorfreude, den Frohmut und die Hoffnung. Und wo sich Enttäuschung ausbreitet wie Dürre, flammt die Wut auf. Das versuchte ich der FBI-Agentin zu erklären, aber sie schaute mich nur nachdenklich an und sagte kein Wort.
⌘
3Großvater
»Nimmst du das Gespräch eigentlich auf?«
»Der Raum ist mit allem ausgestattet. Mikrofon und Kamera.« Dakota Leen machte eine ausschweifende Armbewegung. »Zurück zu meiner Frage. Was hattet ihr eigentlich vor? Wolltet ihr wirklich reingehen?«
»Ich nicht, die anderen schon. Zur Sicherheit könntest du das Gespräch mit einem iPhone aufnehmen. In Island macht man das immer so.« Ich musste an Birna denken, die wahrscheinlich die beste Polizeikommissarin der Welt ist, und schaute mich verstohlen um. Links oben unter der Decke war ein rundes Glas angebracht, das so groß wie das Ei der Eiderente war, aber ganz schwarz.
»Ja, da ist eine Kamera. Kalmann, was ist dann passiert?«
»Und das Mikrofon?«
»Überall im Raum. Mach dir darüber keine Sorgen. Kalmann, bitte erzähl mir, was passiert ist. Hast du deine Leute im Park verloren, schon vor den Treppen?«
»Korrektomundo.«
»Waren sie bewaffnet?
»Onkel Bucky –« Ich zögerte.
»War Onkel Bucky bewaffnet?«
»Ich bin gar nicht sicher, ob er überhaupt mein Onkel ist«, sagte ich.
»Das spielt jetzt keine Rolle. Beantworte bitte meine Frage. Ist der Mann bewaffnet?«
»Immer.«
»Womit denn?«, wollte Dakota Leen wissen, aber weil ich zögerte, erklärte sie mir, es sei wichtig, dass sie wüssten, ob er eine Gefahr für andere darstelle. Gut möglich, dass ich heute Leben rette! »Vielleicht ist dein Onkel wütend.«
»Er ist wahrscheinlich nicht mein Onkel.«
»Das hast du schon gesagt.«
»Ist es eigentlich verboten, Waffen zu tragen?«
»Manchmal schon, ja.«
Ich fühlte mich elend, schuldig, obwohl ich doch gar nichts falsch gemacht hatte.
»Er trägt immer eine Glock am Knöchel, manchmal auch eine Walther und eine HK unterm Arm. Das sieht man aber gar nicht.«
»HK? Heckler und Koch?« Sie tippte es in den Laptop ein.
»Und ein Messer.«
»Ein Taschenmesser?«
»Nein, ein Jagdmesser. Ziemlich groß.« Ich zeigte ihr die Größe.
»Auf wen will er denn Jagd machen?«
»Normalerweise auf Hirsche, aber heute auf Echsen und Schweine.«
Dakota Leens Gesicht wurde blasser. Sie sah konzentriert auf den Laptop, und darum bemerkte sie nicht, dass ich mich verstohlen nach weiteren Kameras umschaute. Ich fand noch ein schwarzes Ei hinter mir. Und in den Wänden waren kleine runde Stellen mit Löchern, da waren wahrscheinlich die Mikrofone angebracht.
»Wieso bist du nicht mit ihnen reingegangen?«
Ich zuckte mit den Schultern. Wieso hatte mein Vater mich einfach in der Menschenmenge stehen gelassen und nicht nach mir gesucht?
»Ich bin plötzlich ganz allein gewesen. Darum. Und wenn man verloren geht, muss man an Ort und Stelle stehen bleiben und darf sich nicht vom Fleck rühren. Das weiß doch jeder.«
Dakota Leen musterte mich und biss sich auf die Unterlippe. Sie ist vielleicht die schönste Frau, die mir in den Vereinigten Staaten begegnet ist.
»Kalmann«, sagte sie. »Hast du einen Vormund? Weißt du, was ich damit meine?«
Ich nickte und starrte auf die Tischplatte.
»Meine Mutter.«
»Und wo ist deine Mutter?«
»Sie ist viertausendsiebenhundert Kilometer entfernt. In Akureyri. Das ist die größte Stadt im Nordland, aber ziemlich klein.«
Dakota Leen stand auf, wollte das Zimmer verlassen, aber als sie die Tür öffnete, stand Mr. García genau davor.
»Leen!«, hörte ich ihn überrascht sagen. »Schon fertig?«
Sie zog die Tür ein wenig zu, weshalb ich nur Wortfetzen aufschnappen konnte. Sie sprachen von einem Protokoll, einem korrekten Weg, Regeln und dass jemand zu informieren sei, wenigstens die Botschaft. Aber Mr. García klang ärgerlich. Ich hörte deutlich, wie er sagte, Dakota Leen sei nun nicht mehr an der Akademie und auch nicht bei einem Beauty Contest. Sie sei jetzt im Feld, und da draußen sei Krieg. »Welcome to the real world, honey.«
Als sich Dakota Leen wieder zu mir setzte, starrte sie eine ganze Weile ziemlich wütend in den Laptop, ihre Brust hob und senkte sich schnell, ihre Hände zitterten unmerklich, aber sie schloss die Augen und atmete ganz langsam aus.
»Kalmann, spulen wir noch mal zurück. Wieso warst du heute da draußen? Wieso bist du hier?«
Tja. Wieso war ich, wo ich war? Wieso ist man überhaupt irgendwo? Es war eine Frage so groß wie das Meer, und Dakota Leen schickte mich in einem kleinen Boot da hinaus. Aber sie schien es um jeden Preis wissen zu wollen. Also dachte ich angestrengt nach. Wir saßen nämlich zusammen in dem Boot, sie und ich. Das verstand ich jetzt.
Großvater. Ich sah ihn vor mir in seinem löchrigen Wollpullover und den ausländischen Militärhosen, die Tabakpfeife, die er sich zwischen die Zähne geklemmt hatte. Er saß mit uns in diesem Boot und schaute aufs Meer, paffte. Die Melrakkaslétta in weiter Ferne. Ich erinnerte mich an die vielen Wanderungen, die wir auf der Slétta gemacht haben. Manchmal ließ ich mich einfach aufs Moos plumpsen, weil ich so erschöpft war, und Großvater sagte dann, wenn man eine lange Strecke zurücklege, mache man nicht gleich die ganze Strecke, sondern nur einen Schritt. Und dann noch einen und dann noch einen. Immer nur einen einzigen Schritt auf einmal, mehr nicht.
»Schritt für Schritt«, murmelte ich, und nun wusste ich plötzlich, wo ich anfangen musste, damit die ganze Geschichte Sinn ergab. Nämlich am Anfang.
»Mein Vater hat mir einen Brief geschrieben, weil mein Großvater Óðinn ermordet worden ist. Darum bin ich hier«, erklärte ich.
»Das tut mir leid«, sagte Dakota Leen, schien aber irgendwie erleichtert. »Erzähl weiter.«
Also erzählte ich ihr alles. Und zwar wirklich von Anfang an. Ich erzählte ihr, dass ich meinen amerikanischen Vater bis vor wenigen Wochen gar nicht richtig gekannt hatte, dass er in den Achtzigerjahren auf der Militärbasis in Keflavík stationiert gewesen war und meiner Mutter die Samen für meine Zeugung gespendet hatte, obwohl er das gar nicht gedurft hätte, weil er schon eine Frau und zwei Kinder hatte und darum aus Island abgezogen wurde, als ich neun Monate später zur Welt kam. Dass meine Mutter mit mir zu Großvater in sein Haus gezogen und ich bei ihm aufgewachsen war, der mir alles beigebracht hatte, etwa, wie man einen Grönlandhai verarbeitet oder sich beim Pinkeln auf der Melrakkaslétta mit dem Rücken gegen den Wind stellt.
Dakota Leen lächelte und schaute mich wieder mit ihren neugierigen Augen an, und weil ich deswegen den Faden verlor, sagte sie, ich solle einfach weitererzählen, ich mache das gut.
Also erzählte ich ihr, dass ich einem Eisbären begegnet war, und hätte ich die Mauser meines amerikanischen Großvaters nicht dabeigehabt, würde ich heute nicht hier sitzen. Vielleicht fing die Geschichte also beim Eisbären an oder bei meinem amerikanischen Großvater, der im Korea-Krieg gekämpft und einem Koreaner diese Nazi-Pistole abgenommen hatte. Und ein Sheriff wie ich trage schließlich die Verantwortung –
»Sheriff?« Dakota Leen wandte sich verwirrt ihrem Laptop zu.
Ich überlegte kurz, fragte mich, wie ich es ihr erklären sollte, denn ein Sheriff in Raufarhöfn ist vermutlich nicht dasselbe wie ein Sheriff in Washington D.C. Aber sie winkte ab und sagte, es spiele eigentlich keine Rolle. Sie wolle viel eher wissen, ob mich mein Großvater gelehrt habe, mit Schusswaffen umzugehen.
»Korrektomundo!«, sagte ich stolz, und dann wurde ich traurig, weil ich an ihn denken musste.
Ich wünschte, Großvater wäre nicht ermordet worden. Als ich Dakota Leen alles erzählte, Wort für Wort, fühlte es sich an, als sitze er neben mir auf dem gefrorenen Moos und blicke auf den schnurgeraden Horizont, und irgendwo dahinter war das Meer, das nie gleich aussieht, fast jeden Tag seine Farben wechselt, für die es wahrscheinlich gar keine Namen gibt, denn es sind so viele. Wie Gefühle. Auch die Trauer hat eine Farbe, eine dunkle, wie das Meer bei Sturm, tief und unergründlich. Die Trauer zieht sich zurück und schwillt an wie Ebbe und Flut. Und sie rauscht, nicht in den Ohren, sondern in der Brust.
»Erzähl mir von deinem Großvater«, forderte mich Dakota Leen auf, lehnte sich im Stuhl zurück und trank aus ihrem Pappbecher. »Und nimm dir bitte Zeit.«
Zeit.
Ich schniefte und nickte, dachte an Großvater.
Wenn man jemanden zum letzten Mal sieht, ist es besser, man weiß es nicht. Man geht davon aus, dass man noch Zeit hat, sich bald wieder begegnet, man sagt einfach nur »bless«, und diese Abschiede sind die besten, weil sie nicht wehtun.
Großvater konnte schon eine Weile nicht mehr gehen, er wollte nicht mehr essen, und er konnte nicht mehr selbst aufs Klo, brauchte sogar Windeln. Und er wusste nicht mehr, wie man einen Löffel oder eine Gabel hält, obwohl ich es ihm noch ein paarmal gezeigt hatte. Darum vermutete ich, dass er auch nichts mehr sah, oder nur noch verschwommen, denn seine Augen sahen aus wie tote Quallen am Strand. Und unter den Quallen liegen die grauen Steine, die einst Teil eines Felsens gewesen sind. Auch mich erkannte Großvater nicht mehr. Jemand hatte mir mal erklärt, dass altersschwache Menschen fast wie neugeborene Babys seien, aber Großvater war längst nicht so süß und neugierig, und manchmal roch er wie verfaulter Lappentang, dass man sich die Nase zuhalten musste.
Dass Babys neugierig sind und zudem viel besser riechen als mein Großvater, das kann ich bestätigen. Ich durfte nämlich mal eins in den Armen halten, ein echtes, keine Puppe. Wirklich wahr! Perla, meine Ex-Freundin, hat eine Schwester, die Lilja heißt und keine Behinderung hat. Lilja hat so ein Baby bekommen, als ich noch mit Perla zusammen war. Und als wir sie einmal besuchten, wurde mir das Baby einfach in die Arme gedrückt, da konnte ich gar nichts machen, keine Chance, denn so ein kleines Ding kann man nicht einfach zurückgeben, das wäre viel zu gefährlich. Man muss warten, bis einem das Baby wieder abgenommen wird. Also machte ich mich ganz steif und wurde zu einer Statue, vergaß sogar fast zu atmen. Das Baby roch wie Vanillecrème. Es öffnete die Augen, blinzelte mich an, denn es wollte wahrscheinlich sehen, wer ich bin. Und ich blinzelte zurück, als ob wir uns mit Morsezeichen verständigten, was alle total entzückend fanden, auch wenn ich leider kein einziges Wort verstand.
Manchmal kniete ich mich ganz dicht vor Großvater auf den Boden und schaute ihn einfach nur an oder machte Morsezeichen mit den Augen. Unsere Nasenspitzen berührten sich fast, und manchmal ging dann ein Ruck durch ihn und er richtete sich auf, nickte mir zu, machte »Hm« oder räusperte sich, und gelegentlich quetschte er ein paar Worte zwischen den Lippen hervor, die sich tatsächlich ein wenig wie Babysprache anhörten, aber rauer. Seine Stimme war schon verbraucht, ich verstand kein Wort. Manchmal musste ich dann lachen, obwohl ich gar nicht lachen wollte.
Meine Mutter hatte mir erklärt, dass mich Großvater noch immer verstehen könne, auch wenn er nicht reagiere. Sein Herz höre mit, garantiert.
Darum erzählte ich ihm alles Mögliche. Manchmal lachte er dann, und manchmal weinte er, ganz egal, was ich gerade gesagt hatte, und ich hätte zu gern gewusst, was es zu lachen gab oder wie ich ihn hätte trösten können, doch meine Mutter sagte, dass nur noch er allein wisse, was in seinem Kopf vorgehe. Er sei tief in sich hineingerutscht, und er komme da auch nicht mehr raus, und das Einzige, das wir noch für ihn tun können, sei, bei ihm zu sein, weil er dann nicht so allein sei, und alles sei besser, wenn man nicht allein ist, fernsehen zum Beispiel, oder essen, oder Auto fahren, oder lesen, oder tanzen, oder kochen, oder schlafen –
Meine Mutter wollte gar nicht mehr aufhören, Dinge aufzuzählen, die zu zweit mehr Spaß machen. Darum unterbrach ich sie, denn es gab durchaus Dinge, die viel besser sind, wenn man allein ist. Zum Beispiel auf dem Klo sitzen oder sich mit einem Polarfuchs unterhalten oder beleidigt sein. Und manchmal ist es auch schön, wenn man allein auf dem Meer ist, weil man sich dann ausdenken kann, wen man gern dabeihätte, und das kann dann jede x-beliebige Person sein, zum Beispiel Lady Gaga oder Rihanna.
Etwa so erklärte ich es ihr, worauf mich meine Mutter komisch anschaute und sich dann zu mir beugte, um mich zu umarmen, was ihr aber nicht recht gelang. Wir hatten uns nämlich ganz nah zu Großvater gesetzt, und der musterte uns verstohlen, verstand nicht die Bohne.
»Kalli minn, du bist ein Weiser«, sagte meine Mutter und hatte plötzlich feuchte Augen. Wieso, weiß ich bis heute nicht. Ein Weiser zu sein ist im Grunde nichts Trauriges, aber vielleicht war meine Mutter traurig, weil nicht ich, sondern Großvater der Weise in unserer kleinen Familie hätte sein sollen, das war nämlich immer so gewesen, obwohl sich meine Mutter oft über seine Weisheiten beschwert hatte.
»Schade, dass du keinen Gammelhai dabeihast«, seufzte sie und schniefte. »Vielleicht könnten wir ihn noch einmal zurückholen, um uns richtig von ihm zu verabschieden. Bevor es zu spät ist. Das wäre schön.«
Und jetzt ärgerte ich mich, denn ich hatte just an dem Tag keinen Gammelhai dabei. Es war das zweitletzte Mal, dass ich Großvater lebend sah.
Einmal kniete ich mich vor ihn auf den Boden und legte meinen Kopf in seinen Schoß, und er streichelte mein Haar als wäre ich eine Katze.
⌘
4Kaliber
Seit der Sache mit dem Eisbären wurde ich von Albträumen geplagt, ich war nicht mehr der Kalmann, der ich mal war. Die Welt um mich herum war es auch nicht mehr. Cocoa Puffs wurden verboten, weil jemand herausgefunden hatte, dass sie ungesund waren, was allen den Appetit verdarb. Ich hatte auf Honey Nut Cheerios umstellen müssen und mich schon fast daran gewöhnt – als es plötzlich wieder Cocoa Puffs gab! Es war total verwirrend. Mein bester Freund Nói hatte sich noch immer nicht gemeldet, und Island war um einen Gletscher ärmer geworden.
Auch in Raufarhöfn hatte sich einiges verändert. Dagbjört hatte, nachdem ihr Vater verschwunden und für tot erklärt worden war, das Hotel Arctica verkauft und war schweren Herzens nach Akranes gezogen, fünfhundertfünfundsiebzig Kilometer von Raufarhöfn entfernt. Die Schulbehörden suchten daraufhin verzweifelt einen Ersatz, sogar auf Facebook wurde das Inserat geteilt, bis sich eine Polin namens Valeska bereit erklärte, die wenigen Kinder zu unterrichten. Es gab aber keinen Grund zur Sorge: Valeska kann so gut Isländisch, dass man glaubt, sie sei eine Isländerin mit komischem Namen.
Etwa zur selben Zeit kaufte ein Mann namens Hörður das Hotel. Er war nur selten im Dorf anzutreffen, weil er sich meistens in seiner Villa in einem Außenquartier Reykjavíks oder in Teneriffa aufhielt. Óttar kümmerte sich um das Hotel, unterstützt von seiner Frau Lin, die aufpasste, dass er sich nicht an der Hotelbar vergriff und niemanden verprügelte. Hörður hatte nicht nur das Hotel gekauft, sondern auch einen Teil der Fischereiquote zurückgebracht, die er und seine Geschwister vor vielen Jahren aus Raufarhöfn abgezogen hatten. Er muss den Ruf der alten Heimat gehört haben, das sagte zumindest der Hafenmeister Sæmundur, und darum gab es vorerst keinen Grund zur Sorge. Siggi und Jújú landeten weiterhin tonnenweise Fisch, das Gefrierhaus wurde nach kurzer Pause wieder in Betrieb genommen; Raufarhöfn hatte den Tod des Königs verkraftet.
Manchmal nannten mich die Leute Kalli Kaliber. Ich mochte diesen Spitznamen nicht, weil ich nun keine Waffen mehr besitzen durfte. Die Behörden hatte mir nämlich die Waffenlizenz entzogen, die ich, wenn man es genau nimmt, gar nie besessen hatte. Weil ich schon als Kind bewaffnet durchs Dorf patrouilliert war, war es niemandem eingefallen, mich nach einer Lizenz zu fragen, denn die Mauser gehörte an meine Hüfte wie schlechte Laune zu Halldór.
Aber nach der Sache mit dem Eisbären änderte sich das. Es wurden Fragen gestellt. Viele Fragen. Um sich die Antworten zu sparen, verkaufte meine Mutter die Büchse und die Flinte, womit ich Füchse und Schneehühner gejagt und den Haien das Licht ausgeknipst hatte, peng. Die Mauser hatte ich inzwischen auf Birnas Wunsch ins Meer geworfen. Darum konnte ich jetzt keine Haie mehr fangen, denn dazu braucht man eine Schrotflinte, damit betäubt man die Tiere, das ist das Gesetz. Kalli Kaliber hörte sich also wie ein Witz an, als würden die Leute jemanden rufen, den es gar nicht mehr gab, nur, um ihn zu ärgern.
Vielleicht mochte ich nicht, wer ich geworden war. Vielleicht war ich unter dem Eisbären eine Weile tot gewesen, das kann man nicht ausschließen, und darum war ich wie neugeboren. Lange Zeit wollte ich es nicht wahrhaben, denn Großvater hatte immer gesagt, Kalmann Óðinsson ist, wie er ist! Aber wenn ich noch immer derselbe Kalmann gewesen wäre, hätte ich an jenem zweitletzten Besuch im Heim ein Stück Gammelhai dabeigehabt. Der neugeborene Kalmann war ein vergesslicher Griesgram, fast wie Großvater einer gewesen war, wurde oft wütend, scheinbar ganz ohne Grund. Etwas in mir war wohl zerquetscht worden, als ich unter dem Eisbären gelegen hatte. Nach dem Besuch bei Perlas Schwester bekam ich sogar einen Wutanfall, denn nun wollte Perla plötzlich auch so ein Baby, und ich hätte natürlich der Vater sein sollen, aber das geht nicht, das dürfen wir nicht, zumindest hatte ich das mal in einer Dr.-Phil-Sendung gehört. Zudem kann man mit Küssen allein keine Babys machen. Möglicherweise wusste Perla das nicht. Und darum wurde ich immer wütender und machte schließlich eine Puppe kaputt, die sie so gern mochte, drehte ihr den Kopf ab, riss ihr Arme und Beine aus, und Perla übernachtete bei ihren Eltern. Einmal, als ich einen Albtraum hatte, zerriss ich mein Hulk-Nachthemd, und ich verpasste Perla versehentlich einen blauen Fleck, weil sie mich beruhigen wollte und mir dabei zu nahe kam. Darum durfte ich sie für eine Weile nicht mehr sehen, und wenn ich ganz ehrlich bin, war mir das egal. Es war besser für alle, wenn man mich mit meinen Albträumen allein ließ.
Nach dem Drama mit Perla zog ich zu meiner Mutter in Akureyri. Das war ganz in Ordnung, auch wenn damit meine Chancen, jemals wieder eine Frau wie Perla zu finden, minimal waren. Meine Mutter und ich hatten uns in einem kleinen alten Wellblechhaus einquartiert, mitten im Hafenquartier dieser Kleinstadt. Die Schlafzimmer waren etwas größer als bei uns in Raufarhöfn, und ich mochte, dass jeder Schritt auf den Dielen und jede Drehung im Bett ein Quietschen und Knarren verursachte oder dass man bei schlechtem Wetter das Plätschern des Regenwassers hören konnte, weil das Ablaufrohr der Dachrinne durchgerostet und an manchen Stellen abgefallen war. Der Keller stand ständig unter Wasser, den konnten wir also nicht benutzen.
Ich bekam Arbeit in der Shoppingmall Glerártorg, da konnte ich zu Fuß hin. Ich war für die Einkaufswagen zuständig, die die Leute kreuz und quer draußen auf dem Parkplatz zurückließen. Ich musste sie einsammeln und ins Trockene bringen, manchmal auch putzen oder die Räder ölen. Diese Arbeit gefiel mir gut, und die Leute waren meistens nett, obwohl ich sie böse anguckte, wenn sie ihre Einkaufswagen nicht zurückbrachten. Aber das durften die wohl, denn mein Boss, der Nanouk hieß und eigentlich Grönländer ist, bestellte mich in sein Büro und sagte, ich solle den Leuten nicht bis zu ihren Autos folgen, sondern einfach warten, bis sie weggefahren waren, um dann die Wagen einzusammeln. Isländer seien faul, das sei einfach so, da könne man nichts machen. Er wusste wahrscheinlich nicht, dass es gegen das Gesetz war, etwas mitten auf einem öffentlichen Parkplatz stehen zu lassen. Wahrscheinlich gibt es dieses Gesetz in Grönland nicht, weil sie da fast keine Autos haben und darum auch keine großen Parkplätze.
Ich hatte also eine Arbeit und ich wurde sogar bezahlt dafür, verdiente mehr Geld, als ich für meinen Gammelhai oder die Polarfuchsschwänze bekommen hatte. Und darum gab es für mich keinen anderen Grund, nach Raufarhöfn zu fahren, als bei Óttar im Hotel Arctica einen Arctic-Cheese-Burger zu essen und unserem Häuschen Hallo zu sagen, damit es nicht vereinsamte.
Im Sommer blieb ich einmal einen ganzen Monat. Es gab nämlich viel zu tun, am Hafen war wegen der sommerlichen Regionalquote einiges los, und ich half, die Schüttgutcontainer mit dem Wasserschlauch zu reinigen und die Möwen zu verscheuchen. An einem Wochenende wurden die Gehsteige im Dorf repariert. Die Bewohner von Raufarhöfn trafen sich und schlugen die kaputten Stellen weg, betonierten kleinere Flächen und besserten die Ränder mit Zement aus. Die Gemeindebehörde in Húsavík, die seit einigen Jahren über Raufarhöfn bestimmte, wollte kein Geld für Gehsteige ausgeben, obwohl man es versprochen hatte. Halldór behauptete es zumindest. Aber wer jetzt denkt, dass sich die Bewohner von Raufarhöfn darüber ärgerten oder sogar wütend waren, weil sie sich selbst um die Gehsteige kümmern mussten, irrt sich. Die Stimmung war ausgezeichnet, fröhlich sogar, obwohl der Sommer bisher feucht und kalt gewesen war und die Leute noch im Juli Wollmützen trugen. Es gab Kaffee und süßes Gebäck, und Schafbauer Magnús Magnússon hatte sein Akkordeon dabei und spielte uns während einer Kaffeepause ein Ständchen. Alle waren ganz still und zufrieden, schlürften Kaffee und schauten gedankenverloren aufs Meer.
Die Albträume aber – die blieben. Kamen immer wieder. Hartnäckig. Meine Mutter wusste zum Glück, was man mit ihnen machen muss: ausatmen. Wegblasen wie Gestank, das Fenster einen Spalt öffnen, tief Luft holen und dann alles aus sich in die schwarze Nacht hinauspusten, bis man keine Luft mehr im Körper hat, weder im Oberstübchen noch in den Knoblauchzehen, um dann die frische Nachtluft einzuatmen, damit sich keine neuen Albträume im Körper ansammeln können.
Ich war davon ausgegangen, dass die bösen Träume weniger werden würden, aber sie kamen immer wieder, fast regelmäßig: der Eisbär, der hinter jedem Hügel lauerte, manchmal plötzlich vor mir stand, selbst wenn ich im Traum gar nicht draußen in der Natur war, sondern irgendwo in einem Haus oder in der Shoppingmall. Róbert, der mich anstarrte und sich die Mauser an den Kopf hielt.
Abdrückte.
Umkippte.
Die zersägten Körperteile. Das Blut.
In Akureyri gibt es einen Laden für Touristen. Neben dem Eingang steht ein falscher Eisbär in Lebensgröße, der auf den Hinterbeinen steht und den Kopf und die Vorderbeine bewegt. Als ich zum ersten Mal an diesem Eisbären vorbeiging, begann ich zu zittern und musste mich sogar übergeben. Total peinlich. Die Touristen glaubten, ich sei besoffen.
Das Problem war, dass ich mit niemandem darüber reden konnte. Denn das mit McKenzie war ein Geheimnis, und zudem kannte ich niemanden, der wie ich unter einem Eisbären gelegen hatte und meine Albträume nur annähernd hätte verstehen können.
Dann kam dieses blöde Virus. Meine Mutter, die im Spital arbeitete und vom vielen Maskentragen Abdrücke im Gesicht bekam, sagte, ich dürfe nicht mehr in der Shoppingmall arbeiten, wenn ich weiterhin meinen Großvater besuchen wolle. Entweder-oder. Darum entschied ich mich für Großvater, da musste ich gar nicht überlegen. Denn Großvater und ich, wir gehörten zusammen wie Hamburger und Fritten.
Als ich Großvater zum allerletzten Mal besuchte, saß er wie immer im Rollstuhl und starrte mit trüben Augen vor sich auf den Boden. Eine Pflegerin, die mich ins Zimmer geführt hatte, streichelte ihm mit der Hand über den Rücken und sagte laut: »Óðinn minn, Kalmann ist da. Er kommt dich besuchen!«
Großvater schreckte aus seinen Gedanken und gab einen Laut von sich, der sich beinahe wie ein richtiges Wort anhörte, es war also einer der guten Tage, die immer seltener geworden waren.
»Wer?«
»Kalmann, dein Enkel!«
»Ah.« Er sank enttäuscht zurück in den Stuhl.
Die Pflegerin lächelte mich aufmunternd an und ließ mich mit Großvater allein. Ich blieb eine Weile stehen, dann kniete ich mich wie gewöhnlich vor ihn auf den Boden.
»Hallo, Großvater«, murmelte ich, aber er schaute mich nur flüchtig an und dann wieder durch mich hindurch. Ich glaube nicht, dass er mich erkannte. Doch diesmal hatte ich Gammelhai dabei! Es waren ein paar ziemlich schleimige Würfelchen von meinem allerletzten Vorrat, wahrscheinlich längst nicht mehr genießbar, aber das machte nichts, denn Großvater durfte sowieso keinen Gammelhai mehr essen. Er hätte daran ersticken können. Bekanntlich isst man nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Augen und der Nase, darum hielt ich ihm das offene Döschen unter den Riecher, damit er wenigstens den Duft der Delikatesse genießen konnte.
Es dauerte einen kleinen Moment, dann fuhr es wie ein Erdstoß durch ihn hindurch. Er riss überrascht die Augen auf, stützte sich auf seine zittrigen Arme, richtete sich ein wenig auf und begann, sich hin- und herzuwiegen, als tanze er zu einer Musik, die nur in seinem Kopf dudelte, denn ich hörte rein gar nichts. Er hob eine Hand und bewegte die Finger in der Luft, als zähle er Sterne, erstarrte, und dann brach es wie Buchstabensuppe aus seinem Mund. Die Worte waren völlig unverständlich, es waren bloß komische Laute, die dennoch irgendwie vertraut schienen. Also versuchte ich, auf den Klang der Stimme zu hören, und so konnte ich tatsächlich ein Wort mit Bestimmtheit ausmachen: »Kalmann«, sagte er immer wieder – ich vermutete es zumindest, es klang nämlich viel mehr nach »Kallakallakalla!« Und dann beugte er sich plötzlich nach vorn, packte mich an den Schultern und schaute mich ganz erschrocken an. Ich war mächtig erstaunt, Großvater hatte noch immer Kraft, fast wäre mir das Döschen aus der Hand gefallen, aber ich umklammerte es fest, und Großvater rief: »Gora vzletit! Opasno. Gora letit!«
»Was?«
»Vnutri gory! Der Berg. Vzletit v vozdukh. Gora! Gora letit!«
Mein Atem stockte.
»Berg?«
»Suka amerikanets, suka, suka amerikanets! Opasno. Vnutri gory!«