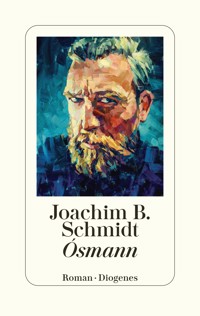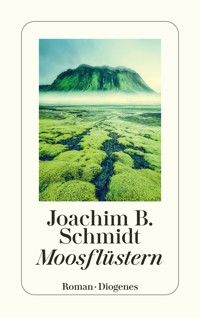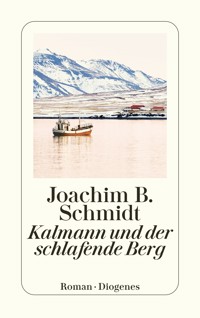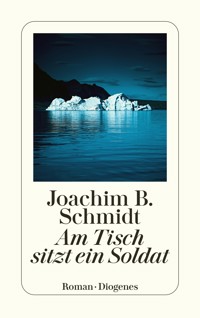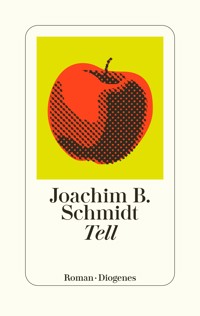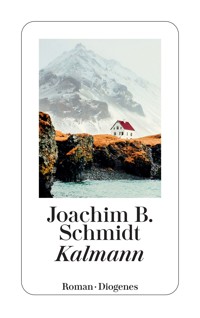
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kalmann
- Sprache: Deutsch
Er ist der selbsternannte Sheriff von Raufarhöfn. Er hat alles im Griff. Doch in Kalmanns Kopf laufen die Räder manchmal rückwärts. Als er eines Winters eine Blutlache im Schnee entdeckt, überrollen ihn die Ereignisse. Mit seiner naiven Weisheit und dem Mut des reinen Herzens wendet er alles zum Guten. Kein Grund zur Sorge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Joachim B. Schmidt
Kalmann
Roman
Diogenes
Für Kristín Elva
Lange Nächte
strahlend kalte Tage
habe ich gesucht
es ist der Menschen Saga
Jónas Friðrik Guðnason, ljóðskáld
⌘
1Schnee
Ich wünschte, Großvater wäre bei mir gewesen. Er wusste immer, was zu tun war. Ich stolperte über die endlose Ebene Melrakkaslétta, hungrig, erschöpft, blutverschmiert, und fragte mich, was Großvater getan hätte. Vielleicht hätte er sich eine Pfeife gestopft und die Blutlache einfach zuschneien lassen, hätte seelenruhig zugeschaut, einfach um sicherzugehen, dass sie sonst niemand finden würde.
Immer wenn ein Problem anstand, stopfte er sich eine Pfeife, und sobald uns der süße Rauch benebelte, war alles gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht hätte Großvater beschlossen, niemandem davon zu erzählen. Er wäre nach Hause gegangen und hätte sich keine Gedanken mehr darüber gemacht. Denn Schnee ist Schnee, und Blut ist Blut. Und wenn einer spurlos verschwindet, ist das vor allem sein Problem. Neben dem Eingang unseres Häuschens hätte Großvater sich die Pfeife an der Schuhsohle ausgeklopft, die Glut wäre im Schnee erloschen, und damit wäre die Sache erledigt gewesen.
Aber ich war ganz alleine da oben, Großvater war hunderteinunddreißig Kilometer entfernt, und durchs verschneite Hinterland der Melrakkaslétta wandern konnte er schon lange nicht mehr. Also gab es auch keinen Pfeifenrauch, und weil es schneite und einfach alles, mal abgesehen von der roten Blutlache, weiß war und man keinen einzigen Laut hörte, fühlte ich mich, als wäre ich der letzte Mensch auf der ganzen Welt. Und wenn man der letzte Mensch auf der ganzen Welt ist, ist man froh, wenn man es jemandem erzählen kann. Darum erzählte ich es dann doch, und damit fingen die Probleme an.
Großvater war Jäger und Haifischfänger. Jetzt war er es nicht mehr. Er saß meistens auf einem gepolsterten Stuhl im Pflegeheim in Húsavík und schaute den ganzen Tag aus dem Fenster – und schaute doch nicht, denn wenn ich ihn fragte, ob er etwas Bestimmtes sehe, gab er meistens keine Antwort oder brummte und guckte mich komisch an, als störte ich ihn bei irgendwas. Sein Gesicht war nun die meiste Zeit verdrossen, die Mundwinkel zeigten nach unten, die Lippen zusammengepresst, so dass man gar nicht sah, dass ihm vier Zähne fehlten, oben, die ganz vorne. Er konnte niemanden mehr beißen. Manchmal fragte er mich, was ich hier zu suchen habe, ziemlich barsch fragte er das, worauf ich ihm erklärte, ich heiße Kalmann und sei sein Enkel und besuche ihn einfach nur, wie jede Woche. Also kein Grund zur Sorge. Doch Großvater warf mir misstrauische Blicke zu und schaute wieder aus dem Fenster, total mürrisch. Er glaubte mir nicht. Ich sagte dann nichts mehr, denn Großvater guckte wie jemand, dem man die Pfeife weggenommen hatte, und darum war es besser, ich sagte nichts.
Eine Pflegefrau hatte mir geraten, Geduld mit Großvater zu haben, so, als wäre er ein kleines beleidigtes Kind. Ich müsse ihm immer wieder alles erklären, das sei ganz normal, und so sei das Leben nun mal, denn manche, die das Glück hätten, ein hohes Alter zu erreichen, würden in gewissem Sinne wieder Kleinkinder, denen man beim Essen helfen müsse, beim Anziehen, Schnürsenkel binden und so weiter. Einige bräuchten sogar wieder Windeln! Alles gehe rückwärts. Wie ein Bumerang. Was das ist, weiß ich. Das ist eine Waffe aus Holz, die man in die Luft schleudert, ein Bumerang eben, der dann in einem Bogen wieder zurückfliegt und einem den Kopf abschneidet, wenn man nicht mordsmäßig aufpasst.
Ich fragte mich, wie das mit mir sein wird, wenn ich mal so alt bin wie Großvater. Denn es war noch nie richtig vorwärtsgegangen mit mir. Man vermutete, dass die Räder in meinem Kopf rückwärtslaufen. Kam vor. Oder dass ich auf der Stufe eines Erstklässlers stehengeblieben sei. Ist doch mir egal. Oder dass in meinem Kopf bloß Fischsuppe sei. Oder dass mein Kopf hohl wie eine Boje sei. Oder dass meine Leitungen falsch verbunden seien. Oder dass ich den IQ eines Schafes habe. Dabei können Schafe gar keinen IQ-Test machen. »Run, Forrest, run!«, riefen sie früher im Sportunterricht und lachten sich krumm. Das ist aus einem Film, in dem der Held behindert ist, aber schnell laufen und gut Pingpong spielen kann.
Ich kann nicht schnell laufen und auch nicht Pingpong spielen und früher wusste ich nicht mal, was ein IQ ist. Großvater wusste es zwar, aber er sagte, das sei nichts als eine Zahl, um Menschen in Schwarz und Weiß einzuteilen, eine Messmethode wie Zeit oder Geld, eine Erfindung der Kapitalisten, dabei seien wir alle gleich, und dann verstand ich überhaupt nichts mehr, und Großvater erklärte mir, dass nur das Heute zähle, das Hier, das Jetzt, das Ich, hier mit ihm. Fertig. Das verstand ich. Er fragte mich, was ich machen würde, wenn ich draußen auf dem Meer wäre und Sturmwolken aufzögen. Die Antwort war einfach: So schnell wie möglich in den Hafen zurückfahren. Er fragte mich, was ich anziehen würde, wenn es draußen regnete. Einfach: Regenkleider. Wenn jemand vom Pferd gefallen wäre und sich nicht mehr bewegte. Kinderspiel: Hilfe holen. Großvater war zufrieden mit meinen Antworten und sagte, ich sei geistig völlig auf der Höhe.
Das sah ich ein.
Aber manchmal kapierte ich einfach nicht, was gemeint war. Kam vor. Dann sagte ich lieber nichts. Das brachte es dann einfach nicht. Denn niemand konnte die Sachen so gut erklären wie Großvater.
Zum Glück bekam ich dann einen Computer mit Internetanschluss, und damit wusste ich schlagartig viel mehr als früher. Denn das Internet weiß alles. Es weiß, wann du Geburtstag hast und ob du den Geburtstag deiner Mutter vergessen hast. Es weiß sogar, wann du das letzte Mal auf dem Klo gewesen bist oder dir einen runtergeholt hast. Das sagte zumindest Nói, der mein bester Freund war, als sich die Sache mit dem König zutrug. Aber was genau in meinem Kopf los war, konnte mir niemand erklären. Ärztepfusch, sagte meine Mutter einmal, als sie noch in Raufarhöfn lebte und ihr das so rausrutschte, wahrscheinlich als ich Elínborgs Katze abknallte und zerlegte, weil ich von Großvater gelernt hatte, wie man das machte, und üben wollte. Meine Mutter wurde sehr wütend, denn Elínborg hatte sich bei ihr beschwert und gedroht, zur Polizei zu gehen, und wenn meine Mutter wütend war, sagte sie nichts mehr, sondern machte was. Den Müll rausbringen zum Beispiel. Den Mülltonnendeckel aufklappen, den Müllsack hineinwuchten und den Deckel zuschlagen – und wieder öffnen und wieder zuschlagen. Peng!
Aber wer nun glaubt, dass ich eine schwierige Kindheit hatte, weil in meinem Kopf Fischsuppe ist, liegt falsch. Großvater übernahm das Denken für mich. Er passte auf mich auf. Aber eben, das war einmal.
Jetzt guckt mich Großvater mit farblosen, wässrigen Augen an und erinnert sich an nichts. Und vielleicht werde ich auch verschwinden, wenn Großvater nicht mehr ist, werde mit ihm begraben, ganz so wie das beste Pferd eines Wikingerhäuptlings. Das haben sie früher nämlich gemacht, die Wikinger; das Pferd einfach mit dem Häuptling beerdigt. Die gehörten einfach zusammen. So würde der Wikingerhäuptling über Bifröst nach Walhall reiten können. Das machte dann Eindruck.
Aber der Gedanke machte mich nervös. Begrabensein, meine ich. Zugedeckt unterm Sargdeckel. Da bekommt man Platzangst, und dann ist es besser, man ist tot. Darum blieb ich meistens nicht lange im Pflegeheim. In Húsavík bekam ich wenigstens etwas Anständiges zu futtern. Im Tankstellenimbiss bei Salvör gab es nämlich die besten Hamburger für eintausendachthundertfünfundvierzig Kronen. Den Betrag hatte ich immer passend, immer, und das wusste auch Salvör, der das Münzgeld gar nicht mehr zählte. Aber manchmal schmeckte mir der Hamburger dann doch nicht, weil ich traurig war, weil Großvater nicht mehr wusste, wer ich war. Und wenn er es nicht mehr wusste, wie bitte sollte ich es dann wissen?
Großvater hatte ich alles zu verdanken. Mein Leben. Wenn es ihn nicht gegeben hätte, hätte mich meine Mutter in ein Behindertenheim gesteckt, wo ich missbraucht und vergewaltigt worden wäre. Jetzt würde ich in Reykjavík leben, einsam und verwahrlost. In Reykjavík herrscht Verkehrschaos, und die Luft ist schmutzig, und die Menschen sind gestresst. Pfui Teufel, das ist nichts für mich. Großvater hatte ich zu verdanken, dass ich wer war, hier, in Raufarhöfn. Er hatte mir alles gezeigt, mich alles gelehrt, was man eben braucht, um zu überleben. Er hatte mich auf die Jagd und aufs Meer mitgenommen, obwohl ich anfangs noch keine große Hilfe war. Vor allem auf der Jagd benahm ich mich wie der hinterletzte Trottel, stolperte und keuchte, und Großvater sagte, ich fiele über meine eigenen Füße, ich müsse sie heben, wenn das Gelände uneben sei, was ich dann auch machte, die Füße heben, wohlgemerkt, aber immer nur für ein paar Schritte, dann vergaß ich es schon wieder und stolperte über den nächsten Grashöcker, und manchmal fiel ich der Länge nach hin und machte dabei einen solchen Krach, weil ich doch so dick war, dass die Schneehühner aufgeschreckt davonflatterten und die Polarfüchse das Weite suchten, bevor wir sie überhaupt erspäht hatten. Aber wer jetzt denkt, Großvater sei deswegen wütend geworden, irrt sich mordsmäßig. Denn Großvater wurde nicht wütend. Im Gegenteil. Er lachte nur und half mir auf die Beine, klopfte mir den Schmutz von den Kleidern und sprach mir Mut zu. »Nur Mut, Genosse!«, sagte er. Und bald gewöhnte ich mich an das unebene Gelände, und ich war dann auch nicht mehr so dick. Selbst auf dem kleinen Kutter konnte ich dann aufrecht stehen, ohne hinzufallen, auch wenn das Boot schaukelte. Es machte mir plötzlich Spaß, die Wellen in den Knien abzufedern, und ich musste mich dazu gar nicht mehr konzentrieren, machte es automatisch, programmierte den Wellengang in meinen Knien, und auf der Jagd hob ich meine Füße und verscheuchte die Beute nicht mehr, so dass wir manchmal mit zwei Schneehühnern oder einem Nerz am Gürtel zurück ins Dorf marschierten. Manchmal mit einem Polarfuchs. Ich war so stolz! Und damit uns auch sicher alle bemerkten, machten wir jeweils ein paar Runden durch Raufarhöfn. Ehrenrunden. Und die Leute winkten uns zu und lobten uns. Daran kann man sich gewöhnen. Lob.
Das sei eine Droge, sagte Nói, mein bester Freund, als er noch mein bester Freund war. Ich müsse vorsichtig mit Lob umgehen und mich bloß nicht daran gewöhnen. Nói war ein Computergenie, aber sein Körper machte ihm Probleme. Er sagte, er sei mein Gegenteil, mein Gegenstück, mein Gegenspieler, und ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte. Er sagte, wenn wir beide eine Person wären, wären wir unschlagbar. Schade, dass er in Reykjavík wohnte.
Aber dann passierte die Sache mit Róbert McKenzie, der war bei uns der Quotenkönig, und das war dann der Anfang vom Ende, und niemand hat gerne, wenn etwas zu Ende geht. Darum will man lieber an früher denken, wo etwas seinen Anfang genommen hat und das Ende in weiter Ferne ist.
Die Tage mit Großvater auf dem Meer und auf der Melrakkaslétta waren die schönsten meines Lebens. Manchmal durfte ich auch mit Großvaters Flinte schießen, die jetzt mir gehört. Er zeigte mir, wie man ein guter Schütze wird, wie man zielt, wie man ganz sachte am Abzug zieht, ohne dabei zu wackeln. Wenn ich während der Trockenübungen mein Ziel anvisierte, legte er ein Steinchen oben auf den Lauf, und ich musste abdrücken, ohne dass das Steinchen vom Lauf fiel. Das ist nämlich schwieriger, als man denkt, denn man muss ziehen, nicht drücken! Erst, als mir das gelang, durfte ich auch mal richtig schießen. Meine Mutter hätte aber auf keinen Fall davon erfahren sollen, das hatten wir so abgemacht, ich und Großvater, denn meine Mutter glaubte, Schusswaffen seien zu gefährlich für mich. Es kam ihr dann aber trotzdem zu Ohren, als ich Elínborgs Katze abknallte, direkt hinterm Haus. Das war dumm von mir. Jemand hatte den Schuss gehört und meine Mutter im Gefrierhaus verständigt. Sie kam also direkt von der Arbeit und war sauer, obwohl sie sich ein paarmal über die Katze aufgeregt hatte, die uns gelegentlich ins Kartoffelbeet schiss. Sie wurde sogar richtig wütend, meine Mutter, und vielleicht war sie auch beleidigt, denn sie sagte, es sei Zeit, Klartext mit mir zu reden, was sie dann auch tat. Ich sei anders als die anderen, und sie tippte an ihre Schläfe. Ich sei langsamer da oben, und darum wolle sie nicht, dass ich mitten in Raufarhöfn mit dem Gewehr auf die Jagd gehe und Tiere abknalle, das werde Probleme im Dorf geben – was dann tatsächlich so war, denn mit Elínborg war nicht zu spaßen, sie verständigte sofort die Polizei.
Aber meine Mutter hätte es so nicht sagen sollen. Denn wenn mich jemand anbrüllte, selbst wenn dieser Jemand meine eigene Mutter war, verlor ich die Beherrschung. Dann stellte mein Kopf ab. Und wenn ich die Beherrschung verlor, flogen die Fäuste. Meine Fäuste. Meistens gegen mich. Das war dann nicht so schlimm. Manchmal gegen andere, wenn andere da standen, wo meine Fäuste gegen mich flogen. Das war dann schlimmer, aber ich machte es gar nicht mit Absicht, und ich konnte mich danach auch fast nicht erinnern. Als hätte die Nadel auf der Schallplatte einen Sprung nach vorne gemacht. Und darum versuchte meine Mutter, mich zu beruhigen, versicherte mir, dass sie mir durchaus zutraue, mit einem Gewehr umgehen zu können, dass ich bestimmt ein guter Schütze sei, was Großvater übrigens bestätigen konnte, der über die ganze Streiterei nur den Kopf schüttelte und die Polizisten wieder wegschickte. Er war auch gar nicht wütend, dass ich Elínborgs Katze abgeknallt hatte. Er fand, meine Mutter übertrieb, denn so verteufelt anders sei ich gar nicht, eigentlich kaum nennenswert, es gäbe weitaus größere Idioten da draußen, es komme eben nicht auf Schulleistungen, sondern darauf an, wie man sich anderen gegenüber benehme, was man für ein Mensch sei und so weiter. Und er machte ein Beispiel, er konnte das gut, denn es ist wichtig, Beispiele zu machen, damit alle verstehen, was gemeint ist. Er erzählte uns von diesem Sportler, der in Amerika lebte und gut aussah und nett war und sogar Schauspieler wurde, dann aber seine Frau umbrachte, weil er eifersüchtig war und nichts weiter als das. Eifersucht. Peng! Ende der Geschichte. Darum sei ich ein besserer Mensch als dieser berühmte Sportler. Aber meine Mutter sagte, er könne sich seinen Sportler sonst wohin stecken, denn Elínborgs Katze sei das wahrscheinlich schnuppe, aber Elínborg sei es nicht schnuppe, dass ich ihre Katze abgeknallt habe, und der Polizei auch nicht und der Schulbehörde auch nicht. Es sei nun mal so, ein gewisses Verhalten, eine gewisse Leistung werde von uns erwartet, er solle endlich im zwanzigsten Jahrhundert ankommen, bevor es zu Ende sei, und er solle aufhören, sich einzumischen, schließlich sei sie meine Mutter und sie habe das letzte Wort, wenn es um meine Erziehung gehe. Aber Großvater war da knallhart. Er konnte nämlich auch ziemlich wütend werden, wenn er wollte, und er erinnerte sie lautstark daran, dass er ihr Vater ist, dass wir in seinem Haus wohnten, seine vier Wände, seine Regeln, und deshalb habe er verdammt noch mal das allerletzte Wort. Zudem verbringe er mehr Zeit mit mir als sie, worauf meiner Mutter die Worte im Hals steckenblieben. Sie stürmte dann raus, um etwas zu machen. Den Müll rausbringen oder so. Und ich machte dann auch etwas kaputt, ich erinnere mich aber überhaupt nicht mehr, was es war. Etwas ging aber ganz bestimmt in die Brüche. Ich habe ein ganz klares Bild vor mir, einen Erinnerungsfetzen: Großvater, der mit hochrotem Kopf rittlings auf mir drauf sitzt, meine Arme auf den Boden drückt, verzweifelt nach meiner Mutter ruft und mir ins Gesicht brüllt, ich solle mich verdammt noch mal beruhigen.
Ich erlegte meinen ersten Polarfuchs mit elf. Füchse sind eine Plage, auch wenn sie schon hier waren, bevor die Wikinger kamen. Die darf man schießen, die Füchse. Es ging eigentlich ganz schnell, und ich war so überrascht, dass ich gar keine Zeit hatte, aufgeregt zu sein. Wir spazierten querfeldein, als plötzlich einer vor uns auftauchte, seinen Kopf hinter einem Grashöcker hervorstreckte, uns also bemerkte, aber auf die Schnelle kein Versteck fand. Großvater drückte mir die Flinte in die Hand, sagte nichts, guckte nur mit zusammengekniffenen Augen den Fuchs an, der ganz erschrocken zurückguckte, und ich verstand. Ich legte an, der Fuchs suchte das Weite, doch ich folgte ihm mit dem Lauf, Fingerkuppe am Abzug, zog sachte daran, bis es knallte. Den Schlag des Gewehrkolbens bemerkte ich gar nicht. Mein Herz schlug härter. Der Fuchs fiel auf die Seite, überschlug sich sogar einmal und zuckte mit den Beinen, als würde er noch immer davonlaufen wollen. Konnte er aber nicht mehr.
Ich fühlte mich seltsam. Großvater sagte noch immer kein Wort, klopfte mir aber zufrieden auf die Schulter, und dann schauten wir dem Tier beim Sterben zu. Es hatte nämlich bald ausgezuckt und lag mit dem Fell im dickflüssigen Blut, das aus seiner Schnauze quoll. Anfangs hob und senkte sich sein Brustkorb schnell, aber sein Atmen wurde dann immer langsamer, ruckartiger, bis der Fuchs schließlich ganz starr dalag. Er tat mir eigentlich leid, aber als ich auf dem Gemeindebüro die fünftausend Kronen entgegennahm, wusste ich, was Berufung war. Berufung ist, wenn man wie gerufen für etwas kommt.
Großvater hatte nicht mehr lange zu leben. Jedes Mal, wenn ich mich von ihm verabschiedete, sah ich ihn vielleicht zum letzten Mal. Das hatte mir eine Pflegefrau mitgeteilt. Und sie hatte auch gesagt, dass ich dann sehr traurig sein werde, was aber ganz normal sei, weinen auch, also kein Grund zur Sorge. Nói erklärte mir einmal, dass mein Großvater für mich die Vaterrolle übernommen habe, was meine Mutter bestimmt abgestritten hätte. Aber Nói hatte recht, schließlich hieß ich Kalmann Óðinsson, nach Großvater, der Óðinn hieß, und nicht nach meinem eigentlichen Vater, den meine Mutter manchmal Samenspender nannte.
Quentin Boatwright. So hieß er, ihr Samenspender. Und wenn ich seinen Namen bekommen hätte, hätte ich Kalmann Quentinsson geheißen. Das ging aber nicht, weil es diesen Namen und den Buchstaben Q in Island nicht gab. So wie meinen Vater. Den gab es hier auch nicht. Wenn ich in Amerika gelebt hätte, hätte ich Kalmann Boatwright geheißen. Das mit den Namen ist da verkehrt.
Wenn ich einmal Kinder haben würde, würde ich für sie da sein. Ich wollte so sein, wie Großvater für mich war, und ich würde ihnen erzählen, was mir Großvater erzählt hatte. Ich würde meinen Kindern zeigen, wie man jagt, wie man Polarfüchsen auflauert, Schneehühner im Schnee erkennt oder Grönlandhaie fängt. Wie man sich selbst versorgt. Ganz egal, ob ich Jungen oder Mädchen haben würde. Aber wenn man Kinder haben will, braucht man eine Frau. Das geht gar nicht anders. Das ist die Natur.
Ich war jetzt schon dreiunddreißig Jahre alt, es dauerte nur noch ein paar Wochen bis zu meinem vierunddreißigsten Geburtstag. Ich brauchte dringend eine Frau. Aber das konnte ich mir an den Cowboyhut streichen, denn hier in Raufarhöfn gab es keine Frauen, die so einen wie mich wollten. Die Frauenauswahl war hier etwa so üppig wie die Gemüsekiste im Dorfladen. Bis auf Karotten, Kartoffeln, zwei schrumpelige Paprika und braunen Salat gab’s da nichts. Und dass sich meine zukünftige Frau nach Raufarhöfn verirren würde, sechshundertneun Kilometer von Reykjavík entfernt, war eher unwahrscheinlich.
Meine Mutter sagte immer: »Am Ende der Welt links abbiegen!« Ich fand das lustig, aber sie lachte nie. Sie machte auch nie Witze, sondern war sowieso meistens müde von der langen Arbeit im Gefrierhaus. Sie sagte, ich dürfe nicht jeden Tag Cocoa Puffs essen, weil ich sonst noch dicker und nie im Leben eine Frau finden werde. Aber meine Mutter war jetzt nicht mehr da, und Großvater auch nicht, ich konnte also den ganzen Tag Cocoa Puffs essen, wenn ich wollte, und niemand beschwerte sich. Aber ich aß nur zum Frühstück Cocoa Puffs, und manchmal abends, wenn ich The Bachelor guckte. Aber nie zum Mittagessen. Das war meine Regel.
Man braucht Regeln im Leben, das ist wichtig, sonst hätten wir Anarchie, und Anarchie ist, wenn es keine Polizei und keine Gesetze mehr gibt und alle machen, was sie wollen. Ein Haus anzünden zum Beispiel. Einfach so, ohne Grund. Niemand arbeitet mehr, niemand repariert die defekten Maschinen, die Waschmaschinen zum Beispiel, die Schiffsmotore, die Satellitenschüsseln und die Mikrowellen. Und dann sitzt man mit leerem Teller vor dem schwarzen Fernsehbildschirm in einem abgebrannten Haus, und die Leute bringen sich wegen eines Chicken Wings oder Cocoa Puffs gegenseitig um. Aber ich hätte so was überlebt, denn ich konnte mich verteidigen. Ich konnte Grönlandhaie so verarbeiten, dass das Fleisch genießbar wurde. Und ich konnte ein Schneehuhn rupfen. Das Haus meines Großvaters war groß genug, und vielleicht hätte dann eine Frau bei mir leben wollen, denn hier in Raufarhöfn wäre die Anarchie nicht so schlimm gewesen, weil wir einfach zu weit weg gewesen wären. Meine Frau hätte jünger sein müssen als ich, denn wir hätten viele Kinder haben müssen, um das Bestehen der Menschheit zu sichern. Wir hätten praktisch jeden Abend Sex gehabt. Vielleicht sogar zweimal am Tag! Dabei hätten wir von den Straßenschlachten in Reykjavík gar nichts mitbekommen, weil der Fernseher ja nicht mehr funktioniert hätte. Zudem gab es in Raufarhöfn seit der Finanzkrise keine Polizei mehr, und darum hatten wir so gesehen schon jetzt Anarchie. Die Leute hatten es einfach noch nicht bemerkt.
⌘
2Blut
Großvater machte den besten Gammelhai auf der ganzen Insel. Ich machte den zweitbesten. Das haben mir schon mehrere bestätigt, Schafbauer Magnús Magnússon von Hólmaendar zum Beispiel, der seinen Gammelhai direkt von mir bezog und gut Akkordeon spielen konnte. Er sagte es jedes Mal: »Kalmann minn«, sagte er, »dein Großvater hat den besten Gammelhai in ganz Island gemacht. Aber deiner ist fast genauso gut!« Und das war nur logisch, weil ich ja vom Besten gelernt hatte.
Ich wünschte, Großvater wäre bei mir gewesen, als die Sache mit Róbert McKenzie passierte. Großvater hätte Rat gewusst. Und ich war, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen sauer auf ihn, dass er mich in diesem Schlamassel einfach alleinließ. Ich wünschte, ich wäre an jenem Tag gar nicht auf Fuchsjagd gegangen. Ich wünschte, Róbert wäre so spurlos verschwunden wie ein Schiff am Horizont. Auf dem Meer gibt es nämlich keine Spuren. Ein Meer sieht immer so aus, als wäre es noch nie von jemandem berührt worden, ausgenommen dem Wind. Ist es nicht seltsam, dass man nur mit Luft Spuren auf dem Wasser machen kann?
Ausgerechnet ich musste an der Stelle beim Arctic Henge Monument vorbeikommen. Dabei folgte ich bloß der Fährte eines Polarfuchses, dem ich den Namen Schwarzkopf gegeben hatte, wie das Shampoo, aber das hatte mit dem Fuchs nichts zu tun. Ein ungezogener Fuchs war er, ein junges Männchen, einer, der sich bis an die Häuser herangetraute und sich da nach Essbarem umschaute. Vielleicht mochte ich ihn gerade deshalb. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn auch gar nicht abgeknallt. Ich hatte einen heimlichen Pakt mit ihm. Aber Hafdís hatte mich gebeten, dem Fuchs eine Lektion zu erteilen, und jeder weiß, was das bedeutet, und wenn dich die Schulrektorin, die auch zur Gemeindeverwaltung gehört, um einen Gefallen bittet, sagt man nicht einfach nein. Zudem war Hafdís eine sehr schöne Frau, auch wenn sie nicht mehr jung war und drei erwachsene Kinder hatte. Manchmal fragte ich mich, was Hafdís hier in Raufarhöfn eigentlich verloren hatte. Sie sah nämlich aus wie eine Moderatorin im Fernsehen. Sie sagte, der kleine Kerl schleiche sich gefährlich nahe hinterm Gemeindehaus rum, und wenn man ihn verscheuche, mache er sich manchmal Richtung Vogar davon. Ich würde ihn am dunklen Fell und am noch etwas dunkleren Kopf erkennen.
Also einer mit blauem Fell, ging mir durch den Kopf, denn zu diesem Zeitpunkt hätte er noch weiße Flecken im Winterfell gehabt, wenn er die Farbe gewechselt hätte. Hafdís kannte sich mit Tieren nicht so gut aus, obwohl sie die Schulrektorin war. Aber ich sagte nichts, denn eine Schulrektorin darf man nicht belehren. Das würde die auch gar nicht zulassen.
Schwarzkopf war also ein Polarfuchs mit blauem Fell. Das sagt man so, obwohl das Fell gar nicht blau ist. Es ist braun, grau oder dunkelgrau. Die blauen Füchse ändern ihre Fellfarbe zum Saisonwechsel nicht, weil sie sich meistens an der Küste rumtreiben. Zwischen den schwarzen Steinen, Lappentang und Treibholz ist es die beste Tarnung. Da fällst du mit weißem Fell auf, denn am Strand liegt meistens kein Schnee, und darum brauchen die isländischen Füchse gar kein weißes Fell wie die Füchse in Sibirien oder in Grönland, wo alles schön weiß ist.
Das alles hätte ich Hafdís erklären können, machte ich aber nicht. Ich tippte nur mit dem Zeigefinger an die Krempe meines Cowboyhutes – so sagt man in Amerika »Okidoki«, denn von da war mein Cowboyhut – und nahm hinterm Gemeindehaus die Fährte auf, kletterte den Hang hoch und überblickte das ganze langgezogene Dorf, das neuere Holtquartier mit dem Schul- und Sportgebäude zu meiner Rechten, der Hafen und die Kirche zu meiner Linken. Der Hüttenteich war noch immer mit einer matschigen Eisschicht überzogen, aber aufs Eis hinausgewagt hätte ich mich nicht. Ich ging der Kante des Hanges entlang, bis ich auf der Höhe des Schulhauses war, kletterte wieder runter, ging am Schulhaus und am leeren Campingplatz vorbei, weiter zur Küste und von da der Strandlinie entlang bis in die Bucht von Vogar. Außer ein paar Eiderenten, Heringsmöwen und Dreizehenmöwen, die auf dem Wasser saßen und nichts machten, sah ich jedoch keine Tiere. Ich malte mir aus, wie ich Schwarzkopf das Fürchten lehren würde. Insgeheim hoffte ich aber, dass der Fuchs zutraulich war, ich mich mit ihm befreunden und ihn als Haustier würde halten können. Das gibt es nämlich. Zum Beispiel in Russland. Ich glaube, wenn ich einen gezähmten Fuchs als Haustier gehabt hätte, hätte ich bei den Frauen bessere Chancen gehabt.
Schwarzkopf hätte an jenem Tag ein weißes Winterfell gebrauchen können, denn es schneite wie verrückt; dicke, schwere Flocken, weshalb selbst die Steine am Strand schneebedeckt waren. Das Wasser lag matt und grau, bewegte sich kaum, das Wetter war ruhig. Bis auf das Nieseln des Schnees war es so still, dass man einfach ein Liedchen singen musste, denn der Schnee schluckte den Gesang, und niemand konnte mich hören.
Ich sang gerne. Aber das wusste eigentlich niemand. Schwarzkopf wusste es vielleicht, weil er mich gehört und sich darum versteckt haben muss, denn an jenem Tag bekam ich ihn nicht zu Gesicht, obwohl ich stundenlang da draußen herumstolperte, um die ganze Bucht herum, in die Melrakkaslétta hinein, zu den Glápavötn-Seen hoch und im Zickzack zum Arctic Henge rüber, dem halbfertigen arktischen Steinkreis, den Róbert McKenzie vor ein paar Jahren hatte errichten lassen. Ich ging gar nicht mehr davon aus, dass ich überhaupt einem Säuger begegnen würde, denn das Wetter war ungeeignet, die Sicht schlecht. Ich sah nicht einmal Schneehühner. Aber es war nicht mehr so kalt wie im Winter, nur etwa null Grad. Die Märzhelligkeit war angenehm. Und außerdem hatte ich es Hafdís versprochen, und ein Versprechen, das man einer Schulrektorin gibt, hält man.
Die Leute stellen sich die Jagd immer so spannend vor, glauben, dass man Spuren liest, die Nase in den Wind hält, die Sinne anstrengt, die Tiere schließlich aufschreckt und ihnen hinterherjagt. Quatsch. Man sitzt meistens auf dem kalten Boden und hofft, dass einem etwas vor den Lauf gerät. Dazu braucht man eine gute Portion Geduld. »Des Jägers wichtigste Tugend«, wie mein Großvater immer sagte. Er war wie ein Mentor. Ein Mentor ist ein Lehrer, der aber keine Prüfungen macht.
Doch an jenem Tag hatte ich keine Lust, irgendwo auf dem kalten Boden zu sitzen, denn ich vermutete, dass Schwarzkopf in seinem warmen Bau meinem Gesang zuhörte und sich die Ohren zuhielt. Ich frage mich, wieso ich ausgerechnet an jenem Tag zum Arctic Henge hochging. Wieso bog ich nicht einfach ab und ging heim? Es wäre besser gewesen. Denn da oben, ganz in der Nähe des Arctic Henge, stieß ich auf die Stelle mit dem Blut. Und es war viel Blut. Erstaunlich eigentlich, wie viel Blut in einem Menschen drin ist.
Das Blut glänzte rot und dunkel im weißen Schnee. Die Schneeflocken legten sich unaufhörlich darauf und schmolzen in der Blutlache. Mir war ganz heiß vom Gehen, ich schwitzte, aber weil ich jetzt plötzlich stillstand und einfach nur bewegungslos auf die Blutlache starrte, begann ich zu schlottern. Erschöpfung machte sich in mir breit. Meine Glieder waren plötzlich bleischwer, als hätte ich eine anstrengende Arbeit gemacht. Ich dachte an Großvater, während ich zuschaute, wie das Blut die Schneeflocken aufsog, bis die rote Stelle unterm Neuschnee verblasste. Eine ganze Weile muss ich einfach nur dagestanden haben, aber schließlich gab ich mir einen Ruck, steif vor Kälte, und erwachte wie aus einem Traum. Ich schaute mich um und wusste erst gar nicht, wo ich mich befand, bis ich die Steinblöcke des Arctic Henge erkannte und mich an Schwarzkopf erinnerte. Ob er das Blut gerochen hatte? Vielleicht konnte ich ihm hier auflauern.
Natürlich schaute ich mir die ganze Sauerei etwas genauer an. Ich bemerkte Spuren, aber sie waren durch den Neuschnee nur noch undeutlich zu erkennen. Die Vertiefungen führten von der Blutlache weg Richtung Dorf, hinunter an den Hafen, dann verloren sie sich im Schneetreiben. Ich war plötzlich nicht mehr sicher, ob es jetzt meine Fußspuren waren oder die eines anderen. Oder waren es zwei Spuren? Mehrere Leute? Aus welcher Richtung war ich eigentlich gekommen? Wohin hatte ich gewollt? Ich schaute mich nach allen Seiten um. Ich war mutterseelenallein. Die Schneeflocken, die unaufhaltsam auf mich niedernieselten, verwirrten mich. Wenn alles weiß ist, weiß oben, weiß unten und weiß rundherum, geraten die Sinne durcheinander. Vielleicht waren die Spuren gar keine Spuren, sondern bloß Vertiefungen im Boden, zwischen den Grashöckern, und plötzlich dachte ich: Es könnte ja eigentlich auch ein Eisbär sein.
Eisbären sind in Island selten anzutreffen, aber trotzdem gefährlich. Sehr gefährlich. Die sind dann hungrig, wenn sie kommen. Doch ich war zu erschöpft, um mich zu sorgen. Ich hatte genug. Ich wollte heim. Ich wollte mich auf die Couch legen, vielleicht mit Nói quatschen. Die Blutlache war nun fast nicht mehr zu erkennen. Wenn es so weiterschneite, war sie bald weg. Gut so.
Ich stapfte Richtung Dorf, schaute bei Hafdís in der Schule vorbei und teilte ihr mit, dass ich Schwarzkopf nicht hatte aufspüren können.
»Schwarzkopf?«, fragte sie und klappte ihren Laptop zu. Ich wurde rot. Eigentlich hatte ich nicht gewollt, dass sie den Namen erfuhr. Das war eine Sache zwischen mir und dem Fuchs. Darum sagte ich nichts und schaute zu Boden. »Hast du ihm einen Namen gegeben? Wie das Shampoo?« Hafdís schmunzelte. Sie stand von ihrem Tisch auf und trat an mich ran, fasste mich an beiden Händen, hob sie etwas hoch und schaute sie sich an. »Deine Hände sind ja ganz rot!«, sagte sie erschrocken. »Ist das Blut? Hast du dich verletzt?«
Ich entzog ihr meine Hände und bemerkte nun selber, dass sie zwar blutig, aber trocken waren.
»Nicht meins«, sagte ich. Ich erinnerte mich, dass ich in das Blut hineingefasst hatte. War ich gestolpert?
»Nicht deins?«
»Ich habe eine Blutlache gefunden, oben, beim Arctic Henge«, gestand ich rundheraus und fragte mich, ob Großvater gewollt hätte, dass ich davon erzählte. Vielleicht hätte ich lügen sollen, aber lügen darf man nur, wenn man jemanden beschützen will, zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin.
»Blut?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Nur Blut. Sonst nichts. Kein Grund zur Sorge.«
»Hast du dich ganz sicher nicht verletzt?«
»Ganz sicher«, sagte ich.
Wir schauten uns meine Hände genauer an, fanden zwar keine Wunden, aber sie waren etwas geschwollen von der Kälte.
»Blut.« Hafdís war ganz nachdenklich. »Von einem Tier?«
»Möglich«, sagte ich und schob noch ein »bestimmt« nach.
Hafdís legte ihre Stirn in Falten, schüttelte den Kopf und sagte:
»Du bist mir ein Jäger!«
Ich grinste. Ich mochte es, wenn man mich »Jäger« nannte.
Hafdís ließ mich ziehen, und ich ging nach Hause, beschloss, nachdem ich meine Hände gründlich gewaschen hatte, den Rest des Tages mit Fernsehen zu verbringen. Es war erst drei Uhr, aber Dr. Phil schaute ich gern, denn dieser Seelenklempner konnte echt Gedanken lesen! Wenn die Leute einen Lügendetektortest machten, war Dr. Phil nie überrascht von dem Resultat, denn er wusste genau, welche Spielchen da gespielt wurden. Da gab es Männer, die in ihre Schwestern verliebt waren oder nicht von zu Hause ausziehen wollten, sogar älter waren als ich, aber noch immer bei ihren Müttern wohnten, die sich dann bei Dr. Phil beschwerten. Und es gab Frauen, die fremdgingen und mit den anderen Männern auch noch Kinder zeugten und es nicht zugaben, obwohl ein DNA-Test das Gegenteil bewies. Einmal war da eine weiße Frau und ein weißer Mann, und die Frau hatte ein schwarzes Baby, bestritt aber, mit einem schwarzen Mann gevögelt zu haben. Und ihr Mann glaubte ihr sogar, sagte, er vertraue ihr und er liebe sie, gehe mit ihr bis ans Ende der Welt. Aber Dr. Phil durchschaute die Frau und schimpfte mit ihr, bis sie alle weinten und das schwarze Kind dann weder einen schwarzen noch einen weißen Vater hatte. Und dann klatschte und jubelte das Publikum, und Dr. Phils Frau begleitete ihren Mann zum Studio raus und lobte ihn, auch wenn man nicht genau hörte, was sie sagte. Aber sie war immer ganz begeistert von seiner Show. So eine Frau hätte ich auch gerne gehabt. Aber jünger.
Ich machte mir eine Tiefkühlpizza in der Mikrowelle und schaute den ganzen Abend fern, bis ich auf der Couch einschlief. Ich war so müde, dass ich sogar vergaß, Nói auf Messenger anzurufen.
Am nächsten Morgen schaute ich aus dem Fenster, alles weiß, das Meer tiefblau, fast schwarz, alles ganz normal, also kein Grund zur Sorge. Es musste schon in der Nacht aufgehört haben zu schneien, denn es sah nicht danach aus, als käme noch mehr vom Himmel runter.
Ich zog mich warm an und ging an den Hafen. Hier unten standen eine ganze Menge alter Lager- und Fischverarbeitungshallen, Gebäude, die in den Fünfzigern und Sechzigern errichtet worden waren und nun einknickten: die Britenbaracken und Arbeiterunterkünfte, die mächtigen Lebertran- und Öltanks. Alles leer. Ich konnte das Miami-Gebäude gratis benutzen, den hinteren Teil zumindest, obwohl der Rest des Gebäudes von niemandem sonst benutzt wurde. Das Gebäude hieß so, weil sein erster Besitzer Baldur ein paar Palmen auf die Fassade hatte malen lassen, die man jetzt aber fast nicht mehr sah, und die Palmen erinnerten die Leute an Miami, weil es da richtige Palmen gab.
Im Innern des Gebäudes war es dunkel und feucht. Ein großes Haus, das über die Abwesenheit der Menschen traurig war. Durchs Dach tropfte an vielen Stellen das Schmelz- und Regenwasser, darum benutzte ich nur die Stelle, die trocken blieb, ganz hinten.
Früher war hier in Raufarhöfn ein Heringsboom. Die Leute kamen sogar aus Reykjavík, denn es gab viel zu tun für Männer und Frauen. Aber der Platz in den Wohnhäusern reichte kaum, obwohl die Kajütenbetten bis an die Decke gestapelt waren. Das Hotel war früher gar kein Hotel, sondern eine Unterkunft für Arbeiter. Der Schuppen schräg gegenüber dem alten Posthaus war eine Unterkunft für Arbeitermädchen. Die Britenbaracken waren auch Unterkünfte. Es brauchte einfach ganz viele Hände hier oben. Damals hatte das Dorf noch ein Kino, einen Theaterverein und Tanz. Hafenmeister Sæmundur erzählte mir manchmal davon. Bei den Veranstaltungen an den Wochenenden hätten gar nicht alle Seeleute und Hafenarbeiter in den Ballraum gepasst, was dazu führte, dass niemand mehr tanzen konnte, weil die Männer und Frauen dort drin so zusammengepfercht waren wie die Schafe im Stall. 1966 kamen sogar Hljómar nach Raufarhöfn, und damit alle sie zu sehen bekamen, machten sie gleich drei Konzerte an einem Tag!
Aber das war einmal. Heute versammeln sich manchmal alle Bewohner von Raufarhöfn im Gemeindesaal, beispielsweise zum Opferfest Þorrablót, und dann ist der Saal noch immer nur halbvoll.
Die Fischer fischten alle Heringe, die in Islands Küstenmeer zu finden waren, und als alle Heringe in Küstennähe weg waren, versuchte man, die Fischschwärme mit dem Flugzeug aufzuspüren, ganz weit draußen. Die Boote waren dann einen Tag lang unterwegs, um zu den Heringsschwärmen zu gelangen, und als die auch weg waren, waren die Fische eben weg, und die Leute zogen wieder nach Reykjavík und machten etwas anderes. Und es wurde ruhig in Raufarhöfn. Es gab dann zwar genug Platz zum Tanzen, aber die Zurückgebliebenen wollten nur noch saufen. Da merkte man, dass man auch andere Fische fangen und essen konnte, nicht nur Heringe, sondern auch Lumpfische, Schellfische, Köhler, Lengfische, Seewölfe und Makrelen. Und darum gab es hier in Raufarhöfn noch eine ordentliche Industrie, bis dann das Fangquotensystem von den Politikern eingeführt und die Quote fast gänzlich aus Raufarhöfn abgezogen wurde. Nun lagen die Hallen brach, jedes dritte Haus stand leer. Es gab inzwischen nur noch einen Mann, der eine ordentliche Fangquote hatte, wenn auch keine große: Róbert McKenzie. Siggi fing gelegentlich für ihn Kabeljau mit der Handwinde, Einar mit dem Langleinenschiff. Auch Júníus und Flóki, die Vater und Sohn waren und von allen nur Jú-Jú genannt wurden – das ist kurz für Júníus und Junior –, fingen die Fische mit Netzen. Sie waren die fleißigsten von allen, waren meistens auf dem Wasser und im Dorf kaum zu sehen. Manchmal landeten sie sieben Tonnen an einem Tag! Aber das konnte mir egal sein. Ich war der Einzige hier, der Haie fing, war also ganz unabhängig von den Fangquoten. Und darum durfte ich das leere Miami-Gebäude benutzen, in dem früher die Abfälle von der Heringsverarbeitung, Fischköpfe und so, ausgeschmolzen und dann zu Fischmehl verarbeitet wurden. Man roch es noch immer. Ich hatte meine Fässer und Wannen hier, in denen ich meine Haie ein paar Tage in Salzwasser liegen ließ, wenn ich sie nicht gleich am Hafen verarbeitete. Hier lagerte ich die Fässer mit meinen Ködern, hier war mein Arbeitstisch, mein Kühlschrank, der mit dem Wellblech im Wind um die Wette surrte, meine Messer und meine Werkzeuge, die ich für Petra brauchte. Mein Boot. Sie war auch nicht mehr die Jüngste. Großvater hatte mir all das vermacht – bis auf den Kühlschrank; den hatte ich von Magga bekommen.
Ich machte mich an Petra zu schaffen. Sie brauchte einen Ölwechsel. Sæmundur kam rüber, schaute mir eine Weile zu, kletterte zu mir ins Boot und half, auch wenn ich das alleine schaffte. Einmal kam er mir so nahe, dass ich versehentlich mit meinem Gesicht in seine Haare geriet. Das kitzelte. Sæmundur hatte so ziemlich überall Haare, keinen richtigen Bart zwar, aber war immer unrasiert, hatte wuschelige Kopfhaare, sperrige Nasenhaare, buschige Augenbrauen, behaarte Unterarme und Handrücken, und er hatte nur wenige weiße Haare, obwohl er schon sehr alt war.
»Jetzt starr mich nicht so an!« Er lachte plötzlich. »Du machst mich ganz verlegen!«
Ich lachte auch. Doch als ich den Trichter auf den Öltank setzte und Sæmundur behutsam Öl in den Tank glucksen ließ, waren wir ganz konzentriert. Und vielleicht wurde Sæmundur deswegen nachdenklich, vielleicht wollte er einfach etwas loswerden, denn er sagte:
»Róbert, Róbert. Einfach so, puff, verschwunden. Unser hauseigener Hotelbesitzer. Unser Quotenkönig, Herrschaften!« Sæmundur stellte den Ölkanister ab und schüttelte den Kopf. »Das wird einen Tumult geben, wirst sehen. Jetzt ist der Friede endgültig draußen!«
Da hörte ich zum ersten Mal davon, dass Róbert McKenzie vermisst wurde. Und ich hätte über diese Neuigkeit auch gar nicht überrascht sein müssen, schließlich hatte ich tags zuvor eine enorme Blutlache gefunden, ganz in der Nähe des Arctic Henge, und den hatte er immerhin bauen lassen. Aber irgendwie war ich so überrumpelt, dass ich Sæmundur gar nicht davon erzählte. Sæmundur rätselte noch, wo sich Róbert möglicherweise befinden könnte, zum Beispiel in einem Puff in Amsterdam oder in einer Entzugsklinik in Florida. Zu alldem sagte ich überhaupt nichts, und als ich mit meiner Arbeit fertig war, ging ich gleich nach Hause, denn ich fühlte mich, als würde ich etwas verschweigen, als hätte ich eine Dummheit begangen, und sobald ich es den Leuten erzählen würde, hätte ich wirklich etwas mit Róberts Verschwinden zu tun. Aber es war ja eigentlich schon zu spät, Hafdís wusste von der Blutlache, und damit fing der ganze Stress an, weshalb ich versuchte, nicht mehr an die Sache zu denken. Wenn man die Person ist, die eine Leiche oder deren Überreste findet, und sei es auch nur eine Pfütze Blut, hat man etwas mit der Sache zu tun. Man gehört dann einfach in die Geschichte und damit in die Geschichtsbücher. Und das wollte ich verhindern, indem ich einfach nichts sagte. Doch als mich eine Frau von der Polizei auf meinem Mobiltelefon anrief und bat, ins Schulhaus zu kommen, damit sie sich ein wenig mit mir unterhalten könne, wurde ich nervös, fühlte mich schuldig, auch wenn ich überhaupt nichts verbrochen und niemanden umgebracht hatte. Trotzdem. Ich machte mich auf richtigen Zoff gefasst.
⌘
3Birna
Eine knappe Stunde später stand ich also vor dem Schulhaus. In voller Ausrüstung. Nur so fühlte ich mich vollständig. Das war bei mir einfach so. Cowboyhut, Sheriffstern und Mauser. Selbst wenn ich manchmal dafür ausgelacht wurde. Die Ausrüstung gab mir Schutz. Und den brauchte ich ganz besonders, wollte ich das Schulhaus betreten. Ich musste dazu allen Mut zusammennehmen. Nur schon die graue Schulhausfassade und das Polizeiauto davor, ja selbst der Spielplatz und die drei Fahrräder machten mir Angst. Sigfús, der früher Schulrektor gewesen war, hatte einmal zu Schuljahresbeginn vor versammelter Schülerschar gesagt, Wissen sei ein Rucksack, den man das ganze Leben lang mit sich herumtrage. Zwar hatte ich in der Schule nicht viel gelernt, aber meinen Schulrucksack schleppte ich noch immer mit mir rum. Er drückte schwer und wurde sogar noch schwerer, je näher ich dem Schulhaus kam. Dieses Gebäude schluckte mich, bis ich vierzehn war. Danach musste ich zum Glück nicht mehr zur Schule. Aber kein Grund zur Sorge. Alles halb so schlimm. Ich hatte nur keine Freunde, was schade war, denn alle anderen Kinder hatten welche. Ich saß immer in der hintersten Reihe, alleine an einem Zweierpult. Wenn jemand laut war oder die Hausaufgaben nicht gemacht hatte, musste er sich für eine Lektion zu mir setzen. Und es waren immer nur Jungs. Die hielten sich dann die Nase zu, denn ich hatte meist einige Würfelchen Gammelhai in einem kleinen Plastikbehälter in meiner Hosentasche bei mir. Großvaters Gammelhai. Mein Proviant. Alles in guter Ordnung eigentlich, aber der Deckel fiel manchmal ab, was ich erst bemerkte, wenn ich meine Finger in die klebrige Hosentasche steckte, und das rochen dann einige.
Ich dürfe keinen Gammelhai in die Schule mitnehmen, sagte Schulrektor Sigfús dann, beließ es aber dabei, denn er wollte sich nicht mit Großvater anlegen, weil der bewaffnet war. Großvater wusste nämlich ganz genau, dass Sigfús niemandem verbieten konnte, Mundvorrat in die Schule mitzunehmen, denn Großvater kannte die Gesetze. Und überhaupt, die Kinder der Bauern rochen nach Schaf, wie er sagte, und die Kinder der Schiffseigner nach Geld. Ich fand das einleuchtend, aber ich roch es im Schulzimmer nie, weder Schaf noch Geld. Den Gammelhai aber auch nicht. Man gewöhnt sich vielleicht daran. Wieso also der ganze Stress?
Einmal lagerte ich ein Döschen Gammelhai in meinem Pult. Und am nächsten Tag war es nicht mehr da. Jemand hatte es gestohlen! Ich getraute mich nicht, es dem Lehrer zu sagen, erzählte es aber Großvater, und der sagte nur, ich solle in Zukunft keinen Haifisch mehr in meinem Pult lagern. Das fand ich dann doch ein wenig ungerecht. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Großvater auf meiner Seite war. Ich war wütend und enttäuscht, machte mir solche Gedanken, zerbrach mir richtig den Kopf, fragte mich, wer den Haifisch gestohlen haben könnte und wie ich mich rächen würde, wenn ich dem Dieb auf die Schliche käme, so dass ich zwei Tage lang dem Unterricht kaum folgte, einfach nur dasaß und versuchte, den Fall zu lösen. Ich malte mir aus, wie ich den Dieb in den Schwitzkasten nehmen und seinen Kopf unter den Pultdeckel klemmen würde, um ein Geständnis zu erzwingen.
Ich war sowieso nicht gut in der Schule. Ich hatte immer schlechte Noten, selbst als Rómeó neben mir saß. Rómeó war mein einziger und darum bester Freund in der Schulzeit. Er zog aus Seyðisfjörður hierher, sein Vater war aus Italien und arbeitete als Koch in der Kantine der Fischverarbeitung, darum hatte Rómeó einen ausländischen Namen und braune Haut. Er war aber nur für etwa drei Monate in Raufarhöfn, denn die Köche in der Kantine wechselten oft, und darum hatte Rómeó auch keine anderen Freunde. Er bekam den Platz neben mir zugewiesen, was mich richtig freute, und ich gab ihm auch gleich die Hand, denn ich wollte, dass er sich willkommen fühlte, und so wurden wir auf Handschlag beste Freunde. Er war der Einzige, der wirklich nett zu mir war. Als er wegzog, schaute er sogar bei mir vorbei, schenkte mir eine Zeichnung mit Batman, der von einem Hochhaus baumelte, sich nur an seiner Pistole festhielt, Seil und Haken damit verbunden. Das ist so eine Wunderwaffe, die Batman hat. Rómeó konnte sehr gut Muskeln zeichnen, obwohl er selber noch keine hatte, und er reichte mir die Hand wie ich ihm am allerersten Tag, und dann sah ich ihn nie wieder, weiß gar nicht, wo er heute ist oder ob er überhaupt noch lebt, und beim Abschied war ich so traurig wie noch nie in meinem ganzen Leben.
Ich hatte immer die schlechtesten Noten, und zwar in ganz Raufarhöfn, in der Geschichte der Schulnoten, und ich übertreibe nicht, denn ein Wanderlehrer sagte mir einmal, er habe in seiner ganzen Karriere noch nie ein derart schlechtes Zeugnis gesehen. Und er musste es schließlich wissen, wo er doch Lehrer im ganzen Land gewesen war. Er war auch gar nicht wütend, sondern irgendwie positiv überrascht. Meine Mitschüler freuten sich immer auf mein Zeugnis, denn dank mir waren sie nicht die Schlechtesten. Sie lachten dann jedes Mal erleichtert. Ich lachte mit, denn es ist besser, mit anderen zu lachen, als der Einzige zu sein, der nicht lacht. Sonst ist man einsam.
Die Buchstaben purzelten in meinen Heften ständig durcheinander. Rechnen ging gar nicht. Wenigstens war ich in Erdkunde gut, wenn nicht sogar der Beste in ganz Raufarhöfn. Ich kannte alle Namen der Fjorde und der Berge, der Pässe und der Dörfer, ob da nun dreitausend oder zwölf Leute lebten. Ich hatte eine große Landkarte von Island in meinem Zimmer an der Wand hängen, und ich machte manchmal ganze Rundreisen an einem einzigen Nachmittag. Entzifferte alle Namen. Denn lesen konnte ich. Bücher waren mir zu lang, Comic-Hefte zu chaotisch, aber Landkarten waren genau richtig. In den übrigen Fächern hatte ich immer die schlechtesten Noten. Niemand beschwerte sich. Niemand schimpfte mit mir.
»Kein Grund zur Sorge«, befand Großvater. Es gebe Wichtigeres im Leben als Zahlen und Buchstaben.
Meine Mutter war nicht glücklich über meine Schulleistungen, aber sie gab den Lehrern die Schuld. Darum wollte sie mich nach Reykjavík in eine Spezialschule schicken, wo ich hineinpasste, wie sie sagte, aber Großvater wehrte sich, sagte, ich sei viel mehr auf Familie als auf bessere Lehrer angewiesen, und ich stellte mich da ganz hinter Großvater, denn Familie ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Zudem gehörte ich einfach nach Raufarhöfn wie der Eiffelturm nach Paris. Hier war ich aufgewachsen, hier wollte ich mein Leben verbringen. Und hier wollte ich sterben. Meine Mutter sah es schließlich auch ein. Keine zehn Pferde würden mich in die Stadt zerren können. Der Dreck von zweihunderttausend Leuten wird da ungefiltert ins Meer gespült. Am Strand kannst du Frauenbinden, Ohrenstäbchen und Kondome finden. Nein danke! Nicht mit mir! Da würde ich viel eher wieder einen rohen Fisch essen.
Einmal habe ich einen rohen Fisch gegessen. Eigentlich nichts Besonderes, fast wie Sushi, nehme ich mal an, aber damals gab es in Island noch kein Sushi, und die Leute aßen auch keine rohen Fische. Das machten nur die Inuit drüben in Grönland und die Japaner in Japan. Es war eine dumme Mutprobe, und ich bestand sie, nichts weiter, kein Grund zur Sorge. Wir waren da beim Leuchtturm von Hraunhafnartangi, dem nördlichsten Punkt Islands; ich, Palli, Arnór, Kiddi, Steini und Gulli, der schon sechzehn war und das Auto seines Vaters auslieh, wie manchmal, wenn sein Vater auf See war und seine Mutter ein Nickerchen machte. Hraunhafnartangi ist schon über dem Polarkreis. Bis zum Nordpol ist es dann eigentlich nicht mehr so weit, und wenn du auf dem letzten Stein stehst und aufs Wasser schaust, ist nur noch Wasser zwischen dir und dem Nordpol. An dieser Landzunge wird alles Mögliche angespült, viel Treibholz, Seile, Netze, Bojen, eigentlich hauptsächlich Fischereiabfälle, aber manchmal auch Dinge, die nicht ins Meer gehören und meistens aus Plastik sind. Kiddi suchte in den angeschwemmten Plastikflaschen nach einer Flaschenpost, und Arnór fand einen Liegestuhl, klappte ihn auf und setzte sich darauf, als sonne er sich am Strand von Spanien. In der Hand hielt er eine kaputte Boje, und da hinein hatte er einen Roggenhalm gesteckt, was dann aussah, als schlürfe er einen exotischen Cocktail. Das war wirklich lustig, und ich fiel fast hin, so sehr lachte ich, und Gulli sagte, ich lache so idiotisch wie ein behinderter Esel. Steini hatte sich inzwischen in den zerfallenen Fischerhütten umgeschaut und eine völlig verrostete Pfanne gefunden.
»Kinder, Essen ist fertig!«, rief er.