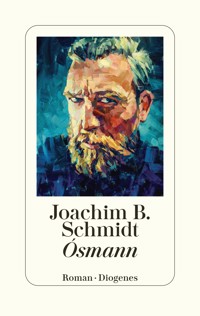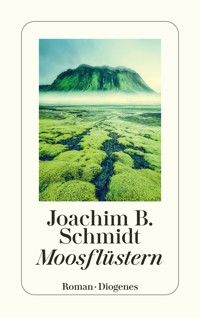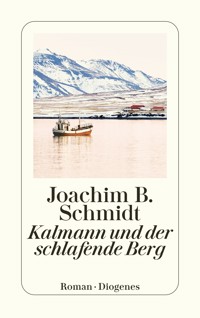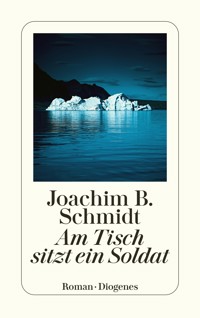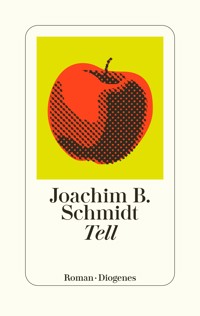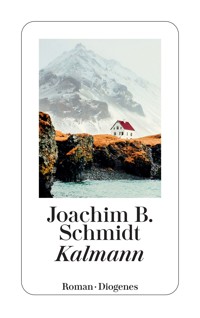11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lárus, Aushilfe im Altenheim und Taugenichts, trifft auf Grímur, einen ehemaligen Fischer. Der eine hat das Leben noch vor sich, beim anderen geht es zu Ende. »Der Schlächter« wird Grímur genannt, man raunt sich zu, er soll einen Mord begangen haben. Und während Lárus seine Drogendealerei immer mehr aus der Hand gleitet, entwickelt sich eine unwahrscheinliche Freundschaft zwischen dem Alten und dem Jungen – die beide ihre Geheimnisse mit sich tragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Joachim B. Schmidt
In Küstennähe
Roman
Diogenes
Dieses Buch ist den Bewohnern von Ísafjarðarbær und Bolungarvík gewidmet, die mich aufgenommen und geduldet haben, als gehörte ich dazu.
»Die See gibt, die See nimmt.«
Prolog
Das Licht der Tranlampe warf tanzende Schatten an die Zimmerwand. Feiner Schneestaub hatte sich im Innern des Hauses bei der Eingangstür und den Fenstern angesetzt, da, wo der eisige Wind durch die Spalten zog. Draussen wütete ein Schneesturm, es war zwecklos, nach dem Arzt in Ísafjörður zu schicken. Bei dem Wetter über den Pass zu reiten, wäre Selbstmord gewesen. Bestimmt tummelten sich die Trolle auf der Passhöhe und versuchten Lawinen loszutreten. Manchmal konnte man sie sogar brüllen hören – oder war es der Wind, der an den Häusern rüttelte? Die Kinder, drei an der Zahl, hielten sich die Ohren zu.
Auch der Tierarzt steckte auf einem Bauernhof etwas abseits des Dorfes fest und musste dort ausharren, bis der Sturm vorbeigezogen war. Das konnte dauern.
Die Kinder beobachteten die gespenstischen Schatten an der Zimmerwand – der Schatten des Vaters, der über dem Bett tanzte, als wäre er auf hoher See, der Schatten des Bettes sein Boot.
Die Geburt war schwer und zog sich über Stunden hin. Die Mutter ertrug die Schmerzen, bis sie schließlich das Bewusstsein verlor. Der Vater fluchte verzweifelt, doch er wusste, was zu tun war. Das Kind musste raus. Die Mutter verlor bei der Geburt viel Blut, das ganze Bettlaken hatte sich vollgesaugt, und als der Wind sich legte, war sie tot.
Das Kind jedoch lebte. Am nächsten Tag machte die Neuigkeit die Runde im Dorf, obwohl der Schnee stellenweise zwei Meter hoch lag.
Der Gemeindeschreiber von Suðureyri trug den Namen des Kindes in diesem frühen Winter 1904 sorgfältig und in geschnörkelter Schrift im Geburtenverzeichnis ein: Gerþrúður Þórsteinsdóttir. Das winzige Fischerdorf war in den Westfjorden Islands zu finden, fernab vom lebhaften Treiben Europas, den Unruhen in den Afrikakolonien, den Kriegen in Asien. Am selben Tag trug er auch den Namen von Gerþrúðurs Mutter im Totenverzeichnis ein. Kristbjörg Harðardóttir; verstorben im Kindbett. Das Kind würde seine Mutter nie kennenlernen.
Der Gemeindeschreiber blieb noch eine Weile an seinem Pult sitzen, er seufzte, dann nahm er die Brille ab und rieb sich die Augen. Es war nicht das erste Mal, dass er Tod und Geburt von Mutter und Kind verzeichnen musste. Ihm schien der kleine Flecken Erde am Rande Europas gottvergessen. Die Menschen waren arm, viele lebten noch in Torfhäusern, die nichts weiter waren als in die Erde gebuddelte Löcher, zugedeckt von Schwemmholz und Grassoden. Das Wohl der Menschen hing vom Wetter und vom Fisch ab. Das Wetter war aber unberechenbar, und die Heringe sollten nur wenige Jahrzehnte später aus den westlichen Gewässern verschwunden sein.
Gerþrúðurs Vater Þórsteinn, ein tüchtiger Schafbauer, verlor in der Unglücksnacht nicht nur seine Ehefrau, sondern auch die Freude am Leben, den Funken, wie man sagt. Der einst so frohgemute Bauer wurde schweigsam und schwermütig. Er kümmerte sich kaum mehr um seine Kinder, doch man konnte ihn manchmal im Schafstall mit sich selbst oder mit den Schafen reden hören. Sprach er zu seinen Kindern, dann meist, um sie zu schelten. Er konnte ganz schön Ohrfeigen austeilen. Sowohl er als auch Gerþrúðurs ältester Bruder Jón starben wenige Jahre später im Lawinenunglück von 1913. Die Lawine überraschte die Dorfbewohner mitten in der Nacht. Die restlichen Geschwister wurden, nachdem man sie lebend aus den Schneemassen gegraben hatte, bei diversen Verwandten untergebracht, Gerþrúður bei ihrem Onkel, der in Bolungarvík lebte, ein Hafenarbeiter. Damals erreichte man Bolungarvík nur über den Seeweg oder über einen gefährlichen Fusspfad. Gerþrúður verlor den Kontakt zu ihren Geschwistern, und nach einigen Jahren vergass sie deren Gesichter und deren Lachen. Sie sah sie nie wieder.
Als sie fünfzehn war, wurde sie unverhofft schwanger und musste auf Geheiß ihres Onkels abtreiben. Der Arzt sagte ihr, dass sie nie mehr Kinder bekommen könne, was vielleicht auch besser so sei. Er war ein guter Freund und Parteigenosse ihres Onkels; derselbe Arzt, der es damals nicht zu ihrer Geburt geschafft hatte, wegen des Unwetters. Gerþrúður gab den Vater des Kindes nie bekannt, hütete das Geheimnis ihr ganzes Leben lang. Es schien auch niemand daran interessiert zu sein. Vier Jahre später starb ihr Onkel und Pflegevater an Tuberkulose; Gerþrúður vergoss bei der Beerdigung keine Träne.
Im einundzwanzigsten Lebensjahr schien sich ihr endlich das Glück zuzuwenden. Sie verliebte sich in Pétur, einen schweigsamen Seemann aus Strandir. Zwar war er elf Jahre älter als sie, und er hatte eine Hasenscharte, die sich bis zum linken Nasenloch hochzog, doch er behandelte sie mit Rücksicht und sie mochte seine freundlichen Augen. Bei den Leuten in den Fjorden war er beliebt, denn er war aufrichtig und tüchtig. Er war jemand, auf den man sich verlassen konnte.
Der Kaufvertrag für ein kleines Häuschen, etwas abseits des Dorfes Bolungarvík, war unterschrieben, die Hochzeit war für Mai geplant, als das Schicksal ein weiteres Mal zuschlug: Pétur fiel bei Sturm im Djúp über Bord und ertrank. Der Kapitän des Schiffes überbrachte Gerþrúður die schlimme Nachricht persönlich. Zwar habe man versucht, das Boot zu wenden, um ihn aus dem Meer zu fischen, habe ihm auch einen Rettungsring zuwerfen können, doch die See sei zu kalt und wild gewesen, sodass sie ihn schon bald in die Tiefe gezogen habe, die See, diese verfluchte See. Sie gebe und sie nehme, brummte der Kapitän noch, doch Gerþrúður verstand ihn nicht, sie verstand nichts mehr. Dann trottete er davon, ohne sich zu verabschieden, der Kapitän, der sich auf dem Wasser wohler fühlte als auf dem Land. Denn es schaukelte das Land. Er ging, ohne sie in die Arme zu nehmen. Gerþrúður stand bleich und zitternd im Türrahmen und sah dem Kapitän hinter. Die Leute im Fjord sprachen noch lange über das Unglück im Djúp, doch Gerþrúður begegnete man mit vorsichtiger Distanz und beschämtem Schweigen. Die Seemänner hatten bei der Rettungsaktion ihr Leben riskiert, ein Wunder, dass sonst niemand umgekommen war.
Gerþrúður blieb in dem Häuschen, obwohl sie und Pétur sich bei der Bank hoch verschuldet hatten und sie das Darlehen nun allein abzahlen musste. Sie fand Arbeit im Hafen, wo die Fische an langen Holztischen verarbeitet wurden. Die Leute im Dorf sammelten für sie Kleider und Haushaltsutensilien, was den Bankdirektor gnädig stimmte; er ließ sie in dem Häuschen gewähren.
Zwei Jahre später stieg ein dänischer Fischermann, der mit seinem Boot im Hafen vor Anker lag, für eine Nacht zu Gerþrúður ins Bett. Torvald Larsen hieß der Kerl, ein Mann ohne Wurzeln, ohne Heimat. Über ihn lässt sich in den Gemeindearchiven kaum etwas finden.
Dem Geschlechtsakt ging ein Ball in der Gemeindehalle voraus. Bei Tanz und Unterhaltung wurde selbstgebrannter Schnaps getrunken, Landi, den man mit Limonade oder Milch mischte, und nach dem sich selbst der Dorfpriester auf der Tanzfläche erbrach. Der Teufel höchstpersönlich müsse anwesend gewesen sein, sagten manche.
Am nächsten Tag verschwand der dänische Seemann auf Nimmerwiedersehen und ließ Gerþrúður mit fürchterlichen Kopfschmerzen zurück. Sie bemerkte viele Wochen lang nicht, dass sie ein Kind in sich trug; man hatte ihr doch gesagt, sie könne nicht mehr schwanger werden.
Das Kind war für sie Glück und Leid in einem. Nun würde sie nicht länger allein sein, doch keinen Vater zum Kinde zu haben bedeutete Ärger. Im Herbst 1926 gebar sie Steingrímur, genannt Grímur, in ihrem Häuschen etwas abseits des Dorfes Bolungarvík.
Dem Bastard winkte ein ähnlich dunkles Leben.
1
Ich bemerkte die plötzliche Ruhe, das leise Klatschen der Wellen an der Bootswand. Eine Unschuld lag über dem Wasser, im kühlen Abendwind, dem Glitzern der letzten Sonnenstrahlen auf den Wellen, als wäre die Welt eben erst erschaffen worden. Niemand hätte erahnen können, dass hier Menschen ertrunken waren. Im tiefen Djúp. Ich blinzelte in die Sonne und spürte, wie sich die Ruhe auch in mir ausbreitete. Die Wärme. Sogar mein Bein hatte zu wippen aufgehört. Endlich ruhte es. Es hatte, soweit ich mich zurückerinnern kann, gewippt oder gezappelt, wenn ich saß, oder zumindest, seit ich als Teenager mit Drogen zu dealen begonnen hatte. Mein Vater nannte es einen nervösen Tick, und meine Mutter legte mir oft ihre Hand auf das Knie und sagte: »Wieso bist du nur immer so nervös?«
Das mochte ich überhaupt nicht. Ich mochte nicht, wenn man mich beruhigen wollte. Mit mir war alles in bester Ordnung!
Von der Dealerei wussten meine Eltern natürlich nichts. Sie wussten nicht einmal, dass ich rauchte, wenn auch nur ein paar wenige Zigaretten am Tag. Überhaupt wussten sie nichts von all den Drogensüchtigen, die in den Westfjorden auf ihren durchgesessenen Sofas hockten. Für sie waren die Fjorde eine heile Welt, frei von jenen Sünden, die man nur in der Stadt finden kann. Vielleicht besuchte ich deshalb meine Eltern so selten, meines nervösen Beines wegen, das mein Doppelleben verriet. Außer meinen Eltern kümmerte sich niemand um meinen Tick – und ich kümmerte mich nicht um anderer Leute Ticks.
Doch als es nun plötzlich zu wippen aufhörte, draußen, auf dem Wasser, bemerkte ich die Ruhe. Und es war angenehm. Dieser stille Frieden. Diese beruhigende Weite. Nichts war hier von Wichtigkeit.
Ich befand mich in Küstennähe, die steilen Fjorde im Rücken, das offene Meer vor mir, der gekrümmte Horizont – für einen Augenblick spielte ich mit dem Gedanken, hinauszufahren, auf den grauen Horizont zuzuhalten, so weit mich der Dieseltank des Bootes bringen würde. Was hatte ich schon zu verlieren. Ich wäre nicht der Erste gewesen, der nie mehr von der See zurückkehrte. Ich stellte mir vor, wie man um mich trauern würde, und wurde fast ein bisschen sentimental dabei. Wie hast du gesagt? Andere Länder haben ihre Kriege, in denen die Männer fallen. In Island fallen sie ins Meer.
Ein Spinner bist du, dachte ich damals, doch da draußen im Djúp, so ganz allein, vermisste ich dich plötzlich. Beinahe hätte ich geweint, doch das tat ich erst im Polizeiauto, und Polizist Þór Senior sagte: »Jetzt tut es dir leid, was?«
Doch ich weinte nicht aus Selbstmitleid. Ich weinte, weil ich einen Freund verloren hatte.
2
Es begann damit, dass der Heizkörper in Zimmer 37-A ausstieg, als mein Bein noch wippte, kaum dass ich mich setzte. Dieser verfluchte Heizkörper. Ich war dreiundzwanzig Jahre alt, knapp nur, blond wie die meisten hier oben, doch nicht so großgewachsen wie etwa die Norweger oder Holländer. Ein Hosenscheißer, wie du mich nanntest. Ich arbeitete damals im Alters- und Pflegeheim Vesöld von Ísafjörður, einem Fischerort in den Westfjorden Islands. Es war der Frühherbst vor der großen Finanzkrise, die halb Island in den Konkurs mitreißen würde. Noch war die Stimmung, besonders in der Hauptstadt, ausgelassen. Die Leute waren zuversichtlich, dass die Wirtschaft einfach so weiterboomen würde. Aber was ging mich das schon an. In den Westfjorden war sowieso nichts los. Hier herrschte schon die Krise, seit die Politiker mit ihrem Quotensystem den Fischern das Leben schwer machten. Ich war Hausmeister im Heim, nicht Pfleger, ein Mann für alles. Na ja, um ehrlich zu sein, ich war bloß der Gehilfe des Hausmeisters. Seine rechte und einzige Hand sozusagen. Helmut Irgendwas – seinen Nachnamen habe ich vergessen – hieß mein Chef, ein Ausländer, ein Deutscher mit Schnurrbart wie aus dem Bilderbuch: lang, humorlos, sarkastisch und verdammt tüchtig. Er kam vor etwa zwanzig Jahren nach Island, weiß der Teufel wieso, vielleicht war er ein politischer Flüchtling des Kalten Krieges. Ich glaube mich zu erinnern, dass er aus Ostberlin kam; er hatte einmal etwas erwähnt, wegen dem Mauerfall. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Es geht hier um den verfluchten Heizkörper in Zimmer 37-A, der seinen Dienst ohne ersichtlichen Grund verweigerte. Das antike Ding wog so viel, dass es nicht wie die neuen Radiatoren in der Wand verankert war, sondern auf vier Füssen stand, die wie Katzenpfoten aussahen. An einem schönen Tag im späten September hörte das Ding auf zu gurgeln. Vielleicht war es auch schon länger still gewesen, doch erst als die Außentemperaturen in der ersten Kälteperiode der Nullgradgrenze nahe kamen, wurde seine Dienstverweigerung vom Pflegepersonal bemerkt. Soffía, eine Auszubildende im Pflegebereich, hatte Gunna, der Leiterin der Pflege, gesagt, dass es in Zimmer 37-A eher kalt sei, worauf Gunna dem Hausmeister Helmut gesagt hatte, dass es in Zimmer 37-A fürchterlich kalt sei, worauf Helmut gefragt hatte, ob der Heizkörper denn überhaupt eingeschaltet sei. Daraufhin hatte Gunna ihn eine ganze Weile angestarrt, den Kopf geschüttelt, ihm den Rücken zugekehrt und war abmarschiert. Gunna war kleinwüchsig, hatte jedoch einen breiten Rücken und einen beachtlichen Nacken. Sie hob die Alten von den Betten auf die Rollstühle, als wären sie aus Pappe. Ich stellte mir manchmal vor, wie Gunna zu Hause Gewichte stemmte. Mich schauderte.
Helmut hatte ihr, als sie abmarschierte, eine ganze Weile auf den Nacken gestarrt. Die beiden, Helmut und Gunna, mochten sich nicht. Schon vom ersten Tag an herrschte Krieg, wie man mir erzählt hatte. Wie Hund und Katz.
Ich selbst arbeitete erst seit wenig mehr als einem Jahr im Heim.
Also kam Helmut zu mir, als ich gerade dabei war, die Außentreppen beim Parkplatz zu fegen – eine Arbeit übrigens, die kaum Sinn hatte, denn der Wind blies immer wieder Sand und Blätter auf die Treppe.
»Der Alten ist mal wieder kalt«, sagte er und ließ sich über die Heizgewohnheiten der Isländer aus, sagte, dass man eher das Fenster öffne, anstatt die Heizung runterzuschrauben, wenn es im Zimmer zu heiß sei, dass niemand auf die Idee komme, sich wärmer anzuziehen, wenn es Winter werde, dass die Mädchen von heute ganzjährig in Miniröcken herumliefen und vor Kälte zitterten, dass man eher die Löhne des Putzpersonals kürze, als Heizkosten zu sparen, dass er sich wundere, weshalb es in dem Gebäude nicht mehr Hitzetote gebe, und dass man den Insassen bloß Wolldecken über den Schoß zu legen brauchte, wenn es draußen kälter wurde, was aber viel zu viel Arbeit für das Pflegepersonal wäre, da sie sonst ihre mehrstündigen Rauch- und Kaffeepausen kürzen müsste, was ja ein Skandal wäre.
»Ha!«, lachte er sarkastisch und sagte, ich solle im Zimmer 37-A nachschauen, ob der Heizkörper überhaupt aufgedreht sei.
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, denn ich fühlte mich in des Meisters Gegenwart immer beobachtet und gehetzt. Seine Predigten schlugen mir so früh am Morgen auf die Seele. Nein danke. Da schlenderte ich lieber allein durchs Heim. Man konnte sich stundenlang durch die Flure und Stockwerke bewegen, von hinten nach vorne, von oben nach unten, denn solange man sich bewegte, sah es aus, als sei man beschäftigt, als müsse man wohin, um da etwas zu erledigen. Niemand schöpfte Verdacht, dass hier einer gar nichts tat.
Im Lift nach oben begegnete mir Soffía, die Auszubildende. Hölle, an manchen Tagen sollte man vorsichtig sein! Ich hätte besser die Treppe genommen oder den Lift verlassen, als Soffía im ersten Stockwerk zustieg. Sie und ich, wir hatten nämlich eine Geschichte. Sexueller Natur. Das Techtelmechtel hatte sich am Wochenende zugetragen, an einer verrückten Party bei Harðar, der selbst auch ein verrückter Kerl ist. Er pflegt in Badewannen zu pinkeln und Glasscherben zu verspeisen. Ja, wirklich, ich übertreibe nicht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen!
Ich hatte also den ganzen Abend lang mit Soffía geflirtet, hatte ihr fleißig Drinks serviert und ihr versucht klarzumachen, was für ein toller Hecht ich sei. Es war schon fast Morgen geworden, als ich sie endlich so weit hatte, dass sie sich mit mir in Harðars Zimmer schlich. Eine Viertelstunde später hatte ich mich angezogen und war gegangen, denn ich hielt nicht viel von Kuscheln. Am nächsten Tag schrieb sie mir natürlich eine SMS, ob wir uns treffen könnten, vielleicht auf einen Kaffee, denn sie fände mich einen interessanten Typen. Die Kleine hatte ja keine Ahnung, wer ich war. Sie war ja auch erst knappe achtzehn, wie sie mir gestanden hatte, als ich ihr die leuchtgrünen Strümpfe runterzog. Sie sah älter aus, und hübsch dazu, sie hatte braunes Haar, das im künstlichen Licht der Altersheimflure golden schimmerte. Ihre Haut war dunkler als die der meisten Isländerinnen, vermutlich waren ihre Mutter oder ihr Vater nicht von hier, vielleicht aus Spanien oder aus Griechenland. Leider habe ich sie nie gefragt. Bestimmt war sie noch naiv und unerfahren, sonst hätte sie sich nicht mit mir eingelassen. Sie war erst Ende des Sommers von Reykjavík in die Westfjorde gezogen, zu ihrem Vater, wie sie mir erzählt hatte. Ich hatte ihr natürlich nicht auf die SMS geantwortet, das war nicht mein Stil, und zudem war ich mir nicht sicher, ob unser Beischlaf überhaupt legal gewesen war. Ich war nicht der Typ für feste Beziehungen. Nur einmal war ich zwei Monate am Stück mit einem Mädchen zusammen gewesen, Heiðrún hatte sie geheißen, dann nahm sie sich einen anderen, ebenfalls bei einer von Harðars Partys, als ich im Nebenzimmer Computerspiele spielte. Das genügte mir, um zu begreifen, dass Beziehungen nur Probleme und Schmerzen bereiten. Die Schmach, ein Verlierer zu sein, tat weh. Liebe ist Pein, und ich mochte die Gleichgültigkeit. Danach war ich nie mehr länger als ein paar Tage mit einem Mädchen zusammen.
Ich war also schon auf dem Weg ins oberste Stockwerk, als der Lift einen Zwischenhalt einlegte und Soffía zögernd zustieg. Sie betrachtete mich verlegen und abwartend, doch ich sagte nichts, blieb cool und stumm, deshalb fragte sie: »Wieso hast du mir nicht geantwortet?«
Ich war ihr während der ganzen Woche erfolgreich ausgewichen, arbeitete sowieso meist im Keller oder kämpfte draußen gegen den Wind, doch nun standen wir uns unausweichlich gegenüber. Im Lift! Man sollte nie mit Frauen von der Arbeit ins Bett, das wurde nun auch mir bewusst.
»Sorry«, sagte ich. »Ich war beschäftigt. Viel zu tun, weißt du?«
Sie runzelte die Stirn, enttäuscht irgendwie, fast traurig. Es stand ihr gut. Sie hatte oft einen etwas traurigen Ausdruck auf ihrem Gesicht.
»Du hättest wenigstens antworten können.«
»Keine Antwort ist auch eine Antwort«, sagte ich cool.
Dann sagte sie: »Du bist ein fieser Typ.«
Zugegeben. Sie stieß mich mit dieser Feststellung ein wenig vor den Kopf, und ich fand so auf die Schnelle keine gescheite Antwort. Erst nachdem Soffía den Lift im zweiten Stockwerk wieder verlassen hatte, fiel mir etwas ein, nämlich, dass ich mir wohl bewusst sei, ein fieser Typ zu sein, da Fies mein Mittelname sei. Darauf hätte sie bestimmt keine Antwort gewusst, und ich hätte das letzte Wort gehabt. Ha! Egal. Es war Freitag, und ich konnte den Feierabend schon riechen. Ich hatte das Bedürfnis, mich zu betrinken. Ich hatte Lust, Biergläser an die Wand zu schmeißen und eine Schlägerei anzuzetteln, mit den Fischern oder einem Touristen, und saufen, saufen.
Dann stand ich vor der Zimmertür 37-A. Ich sammelte mich einen Moment lang, atmete ein und aus, kratzte mich im Schritt und rekapitulierte meinen Auftrag: Feststellen, ob der Heizkörper noch funktionierte. Ich hatte ja keine Ahnung, was mir blühte! Ich klopfte. Keine Antwort. Vorsichtig öffnete ich die schwere Tür und sagte: »Hallo?«
Keine Antwort. Ich trat zögernd ein, Kälte kroch mir unter die Kleider und strich mir mit dürren Fingern über den Nacken.
»Hallo?«, sagte ich erneut und trat ins düstere Zimmer.
Die schweren Gardinen sperrten das Tageslicht aus, die nackte Glühbirne an der Zimmerdecke leuchtete nicht. Auf dem Bett lag – mit dem Rücken zu mir – ein altersschwacher Mann. Man hörte ihn in kurzen Abständen leise keuchen, und ich fürchtete schon, den Herrn beim Sterben erwischt zu haben. Ich war noch nie in diesem Zimmer gewesen, deshalb wusste ich auch nicht, wer der Mann war und ob er Contalgin-Pflaster benutzte. Ich sagte: »Verzeih die Störung, ich kontrolliere nur schnell den Ofen.«
Der Alte regte sich nicht. Also tastete ich mich durchs Zimmer und kontrollierte, ob der Heizkörper eingeschaltet war. Er war auf Höchststufe gestellt, was seltsamerweise eine Vier war, und nicht wie meistens eine Zehn. Ich drehte ihn zu und wieder auf, doch es war weder ein Glucksen zu hören noch kommende Wärme zu spüren. Keine Frage, der Ofen war tot. Ich drehte mich um und erschrak. Der Alte starrte mir geradewegs ins Gesicht. Seine Augen waren wässrig und farblos, das lichte Haar völlig zerzaust, sein Gesicht voller messerklingentiefer Furchen, ein ungepflegter Bart wucherte in seinem Gesicht. Der Bart wies lichte Stellen auf, und es sah aus, als hätte jemand erfolglos versucht, ihn abzurasieren. Sein Mund war eingefallen und lippenlos. Offenbar fehlten ihm die meisten Zähne. Und ich hatte gedacht, er schliefe. Er blinzelte nicht, ich konnte meinen Blick nicht von ihm abwenden, der Alte hypnotisierte mich irgendwie – oder war er etwa tot? Hatte er vielleicht in diesem Augenblick seinen letzten Atemzug getan und war auf den Rücken gerollt, mit dem Gesicht zu mir? Das Blut gefror mir in den Adern. War der Sensenmann etwa im Zimmer und hauchte mir in den Nacken?
Der Tote kam mir nun plötzlich bekannt vor, aber alte, bärtige Greise sehen doch alle gleich aus. Ich sagte mit mir seltsam fremder Stimme: »Deine Heizung ist futsch. Darum ist es so kalt. Ist dir kalt?«
Der Tote reagierte nicht. Er blinzelte noch immer nicht, er atmete nicht, er starrte nur. Kein Zweifel. Der Alte war tot. Ich fasste mich, trat etwas näher zu ihm hin – mein Herz pochte wild – und wedelte mit der flachen Hand vor seinem Gesicht hin und her. Doch wie konnte ich feststellen, ob er wirklich tot war? Sollte ich versuchen, seinen Puls zu fühlen? Die Kälte hatte sich nun bis zu meinen Knochen durchgefressen, und ich begann zu schlottern. Ich hatte noch nie einen Toten gesehen, bis auf die Toten im Internet und im Fernsehen natürlich. Da begann er zu knurren. Wie ein Hund, voller Hass und Angriffslust. Ich hörte mit dem Wedeln auf und ging mit langen Schritten aus dem Zimmer, schaute nach links und nach rechts, ob mich jemand hatte flüchten sehen. Niemand sonst war auf dem Flur, ich atmete auf. Jesus, das war vielleicht gespenstisch gewesen! Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass hinter all diesen Türen altersschwache Menschen in ihren Betten lagen und nichts weiter taten, als auf ihr Ende zu warten. Ein Wartesaal. Ich war froh, dass ich bloß der Gehilfe des Hausmeisters war und kein Pfleger. Ich schüttelte den Schauder ab und machte mich auf den Weg nach unten, um Helmut Bericht zu erstatten. Der alte Nazi würde keine Freude daran haben, dass der Heizkörper tatsächlich futsch war.
Beinahe drückte ich auf den Alarmknopf, als sich die Lifttür im Keller öffnete, denn Soffía und eine ihrer Arbeitskolleginnen warteten auf eine Fahrt nach oben. Man hatte sie wohl mit Bettwäsche zu den Polen in die Wäscherei geschickt. Was sollte das? Das Altersheim war groß genug, dass man sich mehrere Tage nicht begegnen musste. Doch das Schicksal schien heute seinen Schabernack mit mir zu treiben. Um cool zu sein, sagte ich: »An eurer Stelle würde ich mal im Zimmer 37-A nachschauen, ob der Alte noch einen Puls hat.«
»Er ist tatsächlich ein fieser Typ«, stellte Soffías Kollegin erstaunt fest.
Ich kannte sie nicht gut, und ich wollte sie auch gar nicht besser kennenlernen. Sie war korpulent, um es höflich zu formulieren, und hatte eine flachgedrückte Stupsnase, wie sie Schweine haben. Offenbar hatte Soffía über mich getratscht, war sofort zu ihrer Kollegin geeilt und hatte sich bei ihr beschwert. Doch diesmal war ich um eine Antwort nicht verlegen.
»Ganz recht«, sagte ich zu den beiden und hob mein Kinn. »Fies ist mein Mittelname.«
»Du solltest ihn öfters gebrauchen«, schlug Soffía umgehend vor. »Er steht dir gut.«
Darauf fiel mir wieder nichts ein. Ich blieb nur stehen, vor dem Lift, die zwei Weiber gingen rein, die Korpulente kicherte, die Lifttür schloss sich.
Verdammt! Ich schlug mir die Faust in die flache Hand und fluchte ein wenig, merkte aber, dass ich mich dadurch nur noch lächerlicher machte. Offenbar hatte ich die Kleine unterschätzt. Und dann fiel mir eine saftige Antwort ein – zu spät, einmal mehr.
»Baby«, hätte ich gesagt, »du sollst die Einzige sein, die mich beim Mittelnamen nennen darf.«
Eine Mörderantwort! Ich sagte sie beim Weggehen zu Übungszwecken laut, bemerkte dabei nicht, dass die Lifttür wieder aufgegangen war. Die zwei dummen Hühner mussten den falschen oder gar keinen Knopf gedrückt haben. Soffía blickte mir müde hinterher und sagte: »Oh, wie schön. Aber nein danke. Dann nenn ich dich lieber wieder Duda, wie alle anderen.«
Diesmal drückte sie den richtigen Knopf und die Tür schloss sich wieder. Ich hörte die beiden im Lift dumpf lachen. Ich war verwirrt. Hatte ich nun gepunktet oder sie? Zwar hatte sie das letzte Wort gehabt, dafür würde sie mich fortan nicht mehr einen fiesen Typen nennen.
»Aufwachen!«, sagte Helmut, als er um die Ecke bog. Er schnippte mit den Fingern, einmal nur, schnipp!, aber laut. Ich wachte auf. »Hast du geschlafen?«, fragte er, doch es klang eher wie eine Feststellung.
Ich hätte mich an diesem Morgen krank melden sollen. Der Heizkörper in Zimmer 37-A sei kaputt, erklärte ich, worauf Helmut prompt fragte, ob ich den Heizkörper aus- und wieder eingeschaltet hätte.
»Ja«, sagte ich, aber ich dachte, schau doch selbst nach!
»Und der Heizköper hat keine Geräusche gemacht?«
»Nein.«
»Kein Rauschen?«
»Nein.«
»Kein Glucksen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Hm. Komisch«, sagte er mit fachmännischer Miene. »Ist es auch wirklich kalt im Zimmer? Oder bloß kühl?«
»Saukalt. Wie in einem Kühlschrank. Fast kälter als draußen.«
»Dummes Zeug. Wie soll es drinnen kälter sein als draußen?«
Ich sagte ihm nicht, dass ich wegen des Alten gefröstelt hatte.
Helmut blickte ins Weite, studierte angestrengt, suchte nach Problemlösungen, Aufträgen, Arbeitsabläufen. Keine Ahnung, was in dem deutschen Hirn vor sich ging.
Wahrscheinlich sei der Regler kaputt, sagte er schließlich. Wie damals in 4-A. Den verflixten A-Trakt müsste man schon lange renovieren, sagte er, und dass wir das Problem selbst lösen könnten, immer würde man gleich den Heizungsmenschen rufen, der sei teuer, so einer koste mindestens sechstausend Kronen die Stunde und dann sende man sowieso einen Polacken, der nicht einmal Isländisch könne, nein, so etwas könne er selbst machen.
Zu blöd, dachte ich, nun müssen wir wieder zu dem alten Freak in 37-A hoch.
Als hätte Helmut meine Gedanken gelesen, sagte er: »Kennst du ihn eigentlich? Du bist doch in Bolungarvík aufgewachsen.«
Meinte er den Alten?
»Du weißt schon«, sagte Helmut. »Grímur. Grímur der Schlächter. Hat er nicht seine Frau umgebracht?«
Ich erschrak, denn nun wusste ich, wer der Alte in Zimmer 37-A war. Gerade noch war ich bei ihm gewesen, ohne es zu realisieren. Ich hatte den Schlächter schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen und war überzeugt gewesen, dass er längst tot war. Er war ja schon alt gewesen, als ich noch ein Kind war, als wir Kinder noch Angst vor ihm hatten.
»Hallöchen, Lárus!«, riss mich Helmut aus meinen Gedanken. »Du machst ein Gesicht, als hättest du ein Gespenst gesehen.«
»Ich habe ihn überhaupt nicht erkannt«, gestand ich.
Helmut lachte.
»Der muss ja wirklich ein ganz böser Kerl gewesen sein.«
Ich grübelte in meinen Hirnwindungen nach Erinnerungen. Helmut hatte recht: Grímur der Schlächter war tatsächlich ein übler Kerl gewesen.
Björn war gestolpert und lag bäuchlings auf der Straße. Dieser dicke Tollpatsch! Er hatte sich beim Sturz das Kinn blutig geschlagen und die Knie aufgeschürft.
»Björn! Steh auf! Renn weg! Er ist hinter dir!«
Unsere Kinderstimmen überschlugen sich, doch unsere Warnungen kamen zu spät. Der Schlächter war zwar alt, aber noch erstaunlich flink auf den Beinen. Er war bei Björn, bevor der sich aufrappeln und sich mit uns anderen Kindern aus dem Staub machen konnte. Der Alte packte ihn an den Haaren, zerrte ihn hoch, sodass seine Beine in der Luft baumelten. Er war bärenstark. Björn kreischte wie ein Mädchen, gellend, dabei war er schon in der dritten Klasse, wo man Wert darauf legte, nicht mehr wie ein Mädchen zu kreischen. Er schaute uns Kindern hinterher, wie wir davonrannten.
Sein Gesicht war tränen- und blutverschmiert, wir rannten um unser Leben, wahrscheinlich rannten wir schneller als im Sportunterricht, wenn der Lehrer die Zeit nahm. Wir konnten Björn nicht mehr helfen.
Dann löste sich der Haarbüschel, an dem Grímur den Buben hochgezogen hatte, von der Kopfhaut. Das war Björns kleinste Sorge, denn er fürchtete um sein nacktes Leben. Kaum spürte er festen Boden unter den Füßen, rannte er rudernd davon, so schnell er konnte, auch er bedeutend schneller als im Turnunterricht. Grímur verzichtete indes auf eine Verfolgung. Er brüllte uns fürchterliche Flüche hinterher, versprach, dass er uns das nächste Mal erwischen und zermalmen würde. Ich glaube, er sagte tatsächlich zermalmen. Dabei streckte er Björns Haarbüschel in die Luft, als wäre er ein alter Indianer mit einem erbeuteten Skalp. Wir rannten.
3
Mit allerlei Werkzeugen ausgerüstet machten wir uns auf den Weg ins Zimmer 37-A, wie Krieger auf einem Feldzug, auf einer Mission. Ich schleppte Werkzeuge, deren Bezeichnung ich nicht kannte. Typisch Helmut: besser etwas zu viel mitnehmen als zweimal laufen. Er hasste es, wenn man wegen einem Schraubenzieher wieder in die Werkstatt hinuntermusste und dabei fünf Minuten verlor. Wir hatten sogar eine Metallsäge und einen überdimensionierten Gummihammer dabei, und ich fragte mich, ob er damit vielleicht den Schlächter erschlagen und dann zersägen wollte. Auch große Müllsäcke hatten wir dabei, worin wir die Leichenteile unbemerkt in die Abfallcontainer beim Zubringereingang hätten stopfen können. Bei diesen Deutschen wusste man nie.
Diesmal begegneten wir Soffía auf dem Weg nach oben nicht. Dabei wäre ich ihr gerne begegnet, denn mit all den Werkzeugen ausgerüstet kam ich mir wichtig vor. Dafür kreuzten wir auf dem Flur Gunna. Sie hob die Augenbrauen und sagte: »Also nicht bloß zugedreht.«
»Nein«, sagte Helmut. »Ihr habt ihn tatsächlich kaputt bekommen.«
Gunnas Nacken wurde breiter.
»Lass das Haus bitte stehen, Helmut.«
Sie verschwand in einem Zimmer und die schwere Tür sauste hinter ihr zu. Helmut kniff die Augen zusammen und blies ziemlich lange Luft aus den Nasenlöchern. Er blieb stehen, regungslos, als hätte jemand die Zeit eingefroren. Dann hörte man, wie irgendwo weiter hinten in einem Zimmer ein Glas zu Boden fiel und zersprang. Wir gingen weiter.
»Gibt es etwas zu reparieren?«, fragte ein gelangweilter alter Mann im Morgenrock, der auf seinen Rollator gestützt im Weg stand.
Helmut gab keine Antwort, er marschierte einfach nur an ihm vorbei. Ich glaube, er hatte den Alten gar nicht gehört. Niemand konnte Helmut aufhalten. Er zögerte nicht, als wir bei der Zimmertür 37-A ankamen, er klopfte und trat ein, ich, geduckt, hinterher.
»Schönen guten Morgen, Grímur. Wir kommen, um deinen Heizkörper zu reparieren. Dauert nicht lange. Wir sind gleich wieder weg.«
Helmut sagte es langsam und überlaut, so wie man eben meint, mit alten Menschen sprechen zu müssen. Von Grímur kam keine Reaktion. Ich fragte: »Hört der etwa schlecht?«
Helmut schaute mich an, als wäre er nicht sicher, ob ich das ernst gemeint oder bloß einen Scherz gemacht hatte. Er muss gesehen haben, dass ich die Frage ernst gemeint hatte.
Grímur sei über achtzig, sagte Helmut. Niemand höre in dem Alter gut. Zudem sei es fraglich, ob Grímur überhaupt noch höre, denn er habe vor einigen Jahren ganz mit dem Sprechen aufgehört. Wie auch immer, der Mann höre schlecht.
Da hatte er wahrscheinlich recht. Helmut hatte eigentlich immer recht.
Grímur schien zu schlafen. Zumindest hatte er die Augen geschlossen. Doch seine Bettdecke hob und senkte sich nicht.
»Keine Sorge«, sagte Helmut. »Der ist nicht tot.«
Manchmal machte mir Helmut wirklich Angst. Er las mich wie ein offenes Buch, meine Gedanken und so. Doch nun richtete er seine volle Aufmerksamkeit auf den Heizkörper, er drehte den Regler zu und wieder auf, er kniete sich hin und horchte nach fließendem Heizwasser, als hörte er den Heizkörper auf Herzgeräusche ab. Es war still im Zimmer, nur die Wanduhr tickte träge. Ich hörte den Alten ganz flach atmen. Wieder drehte Helmut den Regler zu und auf. Nichts. Er drehte ihn zu. Er stand ächzend auf – Helmut war auch nicht mehr der Jüngste – und starrte den Heizkörper eine Weile an. Wahrscheinlich hatte er den Röntgenblick, womit er auch meine Gedanken lesen konnte.
»Manchmal wäre es gut, einen Röntgenblick zu haben«, sagte er und strich sich mit dem Zeigefinger über den Schnurrbart.
Ich beschloss, mit dem Denken aufzuhören. Es gelang mir nicht.
Wieder drehte Helmut am Regler, diesmal energischer.
»Das Ventil könnte verstopft sein«, murmelte er. Da sei vielleicht ein Fremdkörper im System. Ein Steinchen oder eine Schweißperle. Ich würde nicht glauben, was man da alles finde.
Ich war mir nicht sicher, ob die Worte mir galten oder ob er mit sich selbst sprach.
Vielleicht sei zwischen Dichtungsscheibe und Ventil eine Verunreinigung, aber dann würde man den Heizkörper nicht mehr ausschalten können, nein, das sei es nicht. »Schön und gut«, sagte er dann.
Wenn er »schön und gut« sagte, hatte das zu bedeuten, dass er einen Entschluss gefasst hatte. »Wir drehen den Heizkörper an den Anschlüssen ab.« Er zeigte auf die Stellen: »Vor- und Rücklauf. Hier und hier. Und dann lassen wir Druck über die Entlüftung ab, hier, ganz wichtig. Weißt du, wenn man ein Glucksen in der Heizung hört, dann ist Luft im System, und dazu ist dieses Ventil da.«
Helmut wäre besser Fachlehrer geworden. Ich reagierte nicht. Als ich im Heim zu arbeiten begonnen hatte, vor etwas mehr als einem Jahr, tat ich noch so, als würden mich seine Ausführungen interessieren, was ihn jedoch meist dazu ermunterte, mir die Dinge noch ausführlicher zu erklären. Ich lernte schnell, dass ich Augenkontakt vermeiden, meinen Kopf still halten und flach atmen musste. Die kleinste Bewegung konnte er sonst als Nicken oder Kopfschütteln auffassen, worauf er mit weiteren Ausführungen reagierte. Gähnen half. Ich gähnte, Helmut bemerkte es, und ich hielt mir die Hand vor den Mund. Nun gähnte auch Helmut, doch der Hauch von Müdigkeit verflog schnell. Er suchte nach dem geeigneten Schlüssel in der Werkzeugkiste und fand ihn. Dann nahm er den Engländer und stellte fest, dass er zu klein war. Er stöberte eine Weile in der Werkzeugkiste, dann schaute er mich erschrocken an, als spürte er eine Schneelawine auf uns zukommen.
»Hast du den Rohrschlüssel mitgenommen?«
Als hätte er mich jemals damit beauftragt, den Rohrschlüssel mitzunehmen! Er hatte mir die Werkzeuge in die Hand gedrückt, also hatte er nicht an den Rohrschlüssel gedacht, aber natürlich hatte ich nun den Rohrschlüssel vergessen.
Ich hob die Augenbrauen.
»Hol den Rohrschlüssel«, sagte er. »In der Werkstatt.«
Helmut hasste es, unnötig Zeit zu verlieren. Zeit ist Geld, wie man in Deutschland wohl sagt. Ich ließ mir das nicht zweimal sagen, schlenderte wieder zum Lift und fuhr hinunter in den Keller. Ich war froh, auch nur für fünf Minuten aus dem kalten Zimmer rauszukommen. Nur weg von dem Toten, weg von der deutschen Lehrkraft.
Natürlich fand ich den Rohrschlüssel nicht. Er war nicht an seinem Platz, dort, wo Helmut zwei Nägel in die Wand geschlagen und den Umriss des Rohrschlüssels nachgezeichnet hatte.
Die Werkzeugwand. Mit einem Filzstift hatte er hingeschrieben: Jedes Werkzeug hat seinen Platz!!! Drei Ausrufezeichen. Wem nützten nun die Nägel in der Wand und die Umrisse eines Rohrschlüssels? Ich hatte den Rohrschlüssel nie gebraucht. Ich konnte ihn also auch nicht verlegt haben, was ich Helmut bei Gelegenheit auch sagen würde. Ich suchte eine Weile, dann setzte ich mich auf die Werkbank und bohrte in der Nase. Den trockenen Rotz zerrieb ich zwischen Daumen und Zeigefinger und spickte das braune Kügelchen an die Werkzeugwand. Dann ging ich wieder hoch.
Entgeistert schaute mich Helmut an, als er mich mit leeren Händen ins Zimmer kommen sah. Doch ich kam ihm zuvor.
»Das Werkzeug ist nicht an seinem Platz«, sagte ich und zeichnete mit dem Zeigefinger drei Ausrufezeichen in die Luft.
Helmut zerbiss einen deutschen Fluch und machte sich selbst auf die Suche. Mich ließ er zurück. Wieder war ich mit dem Schlächter allein im Zimmer 37-A. Zum Glück schlief er. Ich bemerkte, dass Helmut versucht hatte, während der zehn Minuten, in denen ich unten gewesen war, die Zuläufe mit anderen Werkzeugen zuzudrehen. Er war gescheitert. Dafür war die Farbe an den Stellen abgeblättert. Das hatte ihm bestimmt den Tag verdorben.
Helmut war nie unbekümmert, er war ein unzufriedener Mensch, und weil er der einzige Deutsche war, den ich kannte, stellte ich mir vor, dass alle Deutschen so waren. Helmut lachte selten. Helmut hatte, soviel ich wusste, keine Freunde. Helmut hatte keine Frau. Manchmal versuchte ich, ihn mit meinen Sprüchen aufzulockern, meist nur um die müden Nachmittagsminuten schneller vergehen zu lassen, doch richtig gelungen war mir das nur einmal.
Es war an einem Montagmorgen, und wir inspizierten den düsteren Maschinen- und Geräteraum, um ihn dann zu putzen, Staub und Spinnweben zu entfernen und die kaputten Glühbirnen auszuwechseln. Ich hatte einen fürchterlichen Magen, da ich am Wochenende zu viel Bier getrunken hatte und mir entwich ein feuchtwarmer Furz. Der Gestank biss mich in die Nase. Helmut stand etwas abseits in der gegenüberliegenden Ecke, und ich rief: »Meine Güte, was stinkt hier so fürchterlich! Oh, das ist ja grauenhaft!«
Helmut leuchtete mit seiner Taschenlampe zu mir rüber, als könnte er den Gestank im Lichtkegel der Taschenlampe sehen. Er sagte: »Vielleicht eine tote Maus?«
»Chef!«, sagte ich mit einer Grimasse. »Komm mal her. Das musst du dir ansehen!«
Natürlich kam Helmut sofort zu mir, machte ein ernstes Gesicht, schaute sich nach einem toten Tier um und nahm einen tiefen Atemzug. Sofort hustete er den Gestank wieder aus.
»Gütiger Gott!«, sagte er entsetzt und hielt sich die Hand vors Gesicht.
Da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und prustete los. Helmut machte große Augen, er packte mich am Arm und schüttelte mich unbeholfen hin und her.
»Du bist doch ein Schmutzfink!«, sagte er, doch auch er musste lachen, und als ich ihn vor einem weiteren Furz warnte, ließ er schleunigst von mir ab und ging, so schnell er konnte, auf die andere Seite des Raumes, wo ich ihn noch eine Weile husten und lachen hörte.
Doch meist war Helmut so ernst, als stünde Island vor dem finanziellen und politischen Zusammenbruch. Nun war er in der Werkstatt und suchte verbissen nach dem Rohrschlüssel, als würde der Island vor dem Zusammenbruch retten.
Ich trat vorsichtig ans Bett des Schlächters und betrachtete ihn. Nur sein Gesicht war zu sehen, der Rest lag verborgen unter einer dicken Decke. Sein Gesichtsausdruck war steinhart, als strenge ihn das Schlafen an. Manchmal schnappte er nach Luft, als wollte er etwas sagen. Doch er gab keinen Ton von sich. Manchmal legte sich ein Schatten über sein Gesicht, als würde er von Albträumen geplagt.
Sterben tut weh.
Bei seinem Anblick verging mir die Lust, alt zu werden, da würde ich dann doch lieber mit dem Auto ins Meer fahren, wie Björn letzten Winter, ich würde mir noch etwas Zeit lassen damit, und ich würde es auch nicht, wie Björn, mit einem Subaru Impreza Turbo machen. Das ist nun wirklich schade ums Auto. Vielleicht glaubte er, er würde die Karre mit ins Jenseits nehmen dürfen. Was für ein Trottel. Aber immer noch besser, als in einem bitterkalten Altersheimzimmer auf den Tod zu warten, so wie der Alte hier.
Ich dachte kurz an damals, als der Schlächter noch eine Gefahr für uns Kinder darstellte. Oder umgekehrt; was waren wir doch für Bengel gewesen. Und ich war für jede Dummheit zu haben. In dem Kaff am äußersten Ende der Westfjorde gab es auch nichts Besseres zu tun, als sich Dummheiten und Streiche auszudenken. Der alte Grímur war unser liebstes Opfer. Schon Kinder vor mir hatten ihm Streiche gespielt. Ich fragte mich, wieso. Vielleicht, weil er oft zu Hause war, immer zur Verfügung stand, wenn es uns langweilig wurde. Vielleicht, weil er allein in seinem kleinen, schäbigen Häuschen am Dorfrand lebte. Als hätte ein geheimer Kinderrat bestimmt, dass man diesen hier terrorisierte und zu den anderen freundlich zu sein hatte. Vielleicht, weil ihn auch unsere Eltern nicht mochten, zu Hause manchmal schlecht über ihn redeten und uns Kinder vor ihm warnten. Dadurch hatten wir Carte blanche. Bestimmt aber, weil er so schnell wütend wurde. Es genügte, ein paar Kieselsteine an sein Fenster zu werfen, und schon stürmte er fluchend und auf steifen Beinen ins Freie. Wir Kinder machten uns auf unseren Fahrrädern jauchzend und lachend aus dem Staub, während Grímur uns hinterherbrüllte: »Ihr verteufelten Buben! Das Fenster werdet ihr bezahlen! Ich kenne euch!«
Manchmal drohte er uns damit, sich bei unseren Eltern zu beschweren, was er aber nie tat. Sie beschwerten sich auch nie bei ihm, nur das eine Mal taten sie es, als der Schlächter Björn ein ganzes Büschel Haare ausriss und der Arzt das Kinn nähen musste.
Als ich den Schlächter schlafend unter der dicken Bettdecke liegen sah, verdrängte ich einen Anflug von Mitleid. Wie böse und wütend er immer gewesen war. Er hätte uns wohl tatsächlich in Stücke gerissen, wenn er uns erwischt hätte.
Im Zimmer war es düster. Die Pflegerinnen hatten die Vorhänge zugezogen, um sich der Kälte von draußen zu erwehren. Doch inzwischen hatte die Sonne zu scheinen begonnen, ich schob die Vorhänge beiseite und spürte die Wärme auf meinem Gesicht. Der Alte schlief weiter.
Helmut ließ sich noch immer nicht blicken. Offenbar fand auch er den Rohrschlüssel nicht. Gelangweilt schaute ich mich im Zimmer um. Man hatte sich Mühe gegeben, das Zimmer so unpersönlich wie möglich einzurichten. Ein billiger Kleiderschrank aus dem Trödelladen stand gegenüber dem Bett, ein staubiger Koffer lag obendrauf, eine Wanduhr hing neben dem Schrank; das wahrscheinlich wertvollste Stück im Zimmer, wenn auch ziemlich scheußlich. Bestimmt würden Helmut und ich das Zimmer sanieren müssen, sobald sich der Schlächter ausgecheckt hatte. Es musste sich um das billigste Zimmer im Heim gehandelt haben, denn der Teppich war abgenutzt und wies dunkle Wolken auf. Die Farbe des Fensterrahmens begann abzublättern, und die Wand war voller kleiner Löcher von Nägeln, an denen die Bilder von vorgängigen Bewohnern gehangen hatten. Bilder von Toten, die helle Schatten hinterließen. Lediglich zwei kleine Bilder hingen noch, verteilt auf zwei Wände, was das Zimmer noch leerer erscheinen ließ. Auf einem Schwarzweißfoto war eine Frau in traditionell isländischer Sonntagstracht zu erkennen, die Sonne im Gesicht, die Augen zusammengekniffen. Keine schöne Frau. Keine sehr glückliche Frau. Sie war nicht in Feststimmung. Auf dem zweiten Foto war ein kleines Fischerboot abgebildet, eine Trilla aus Holz, schlank, mit einem schmalen Deckshäuschen im hinteren Teil. Das Boot lag vertäut im Hafen von Bolungarvík. Wahrscheinlich war es seins gewesen, dachte ich mir, obwohl ich überhaupt nichts über ihn wusste.
Unter dem Fenster stand ein kleiner Tisch mit einem Stuhl. Auf dem Tisch stand eine Blumenvase mit Wasser, aber es standen keine Blumen darin. Mir wurde kalt. Ich setzte mich auf den Stuhl, vergrub meine Hände tief in den Hosentaschen und zog den Kopf ein. Blickte hinüber zum Schlächter.
Ich erschrak ein bisschen, denn er hatte die Augen geöffnet und blickte mich grimmig an. Sofort stand ich wieder auf und schob den Stuhl unter den Tisch, denn vielleicht mochte er nicht, dass ich auf seinem Stuhl saß. Ich nickte ihm verlegen zu und sagte, dass ich auf Helmut warte, der in der Werkstatt nach dem Rohrschlüssel suche. Der Alte sagte nichts. Nicht die kleinste Reaktion. Er starrte mich nur an, mit seinen wässrigen Augen, mit seinem zähen, eingefallenen Mund, seinen grauen Wangen, die von struppigem Barthaar überwuchert waren. Ich wich seinem Blick aus und schlenderte im Zimmer auf und ab, versuchte, den Alten einfach nicht zu beachten. Ich betrachtete die Löcher in den Wänden, die Wolken auf dem Spannteppich, dann sortierte ich die Werkzeuge, mit denen Helmut herumhantiert hatte. Ich schaute aus dem Fenster, auf die umliegenden Häuser, auf die dicht besiedelte Landzunge, die sich in den Fjord bog und ideale Verhältnisse für den Hafen schuf. Ich blickte auf das Display meines Mobiltelefons, ob ich eine Nachricht erhalten hatte und um die Uhrzeit abzulesen, neun Uhr, die Wanduhr ging volle zehn Minuten nach, dann ertrug ich den stechenden Blick des Alten nicht mehr. Ich drehte mich zu Grímur um und sagte: »Gibt es einen Grund, Mann, dass du mich so anstarrst?«
Keine Regung.
»Du könntest wenigstens einen Ton von dir geben.« Nichts.
»Kannst du mich überhaupt hören? Bist du taub, Mann? Verstehst du, was ich sage?« Wieder nichts.
»Wenn du mich verstehst, dann blinzle mit dem linken Auge!«