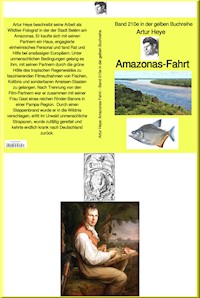
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Artur Heye beschreibt seine Arbeit als Wildtier-Fotograf in der der Stadt Belém am Amazonas. Er kaufte sich mit seinen Partnern ein Haus, engagierte einheimisches Personal und fand Rat und Hilfe bei ansässigen Europäern. Unter unmenschlichen Bedingungen gelang es ihm, mit seinen Partnern durch die grüne Hölle des tropischen Regenwaldes zu faszinierenden Filmaufnahmen von Fischen, Kolibris und sonderbaren Ameisen-Staaten zu gelangen. Nach Trennung von den Film-Partnern war er zusammen mit seiner Frau Gast eines reichen Rinder-Barons in einer Pampa-Region. Durch einen Steppenbrand wurde er in die Wildnis verschlagen, erlitt im Urwald unmenschliche Strapazen, wurde zufällig gerettet und kehrte endlich krank nach Deutschland zurück. Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Artur Heye
Amazonas-Fahrt – Band 210e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 210e in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Artur Heye
Artur Heye: Amazonas-Fahrt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuße der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
* * *
2022 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Artur Heye
Der Autor Artur Heye
https://de.wikipedia.org/wiki/Artur_Heye
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/heyeartu.html
Artur Heye wurde am 4. November 1885 in Leipzig-Lindenau geboren und starb am 1. November 1947 in Ascona in der Schweiz. Er entstammte einer Arbeiterfamilie. Bereits mit 14 Jahren verließ er aus Abenteuerlust Mutter und Stiefvater schlug sich bis nach Antwerpen durch und heuerte ohne Papiere als Schiffsjunge auf dem US-amerikanischen Walfänger „LUISE HENRIETTE“ an. Nach Schiffbruch und weiteren Fahrten als Leichtmatrose auf Seglern, Kohlentrimmer und Heizer auf Dampfern führte er ein abenteuerliches Leben und reiste durch die ganze Welt. Auf seinen Reisen betätigte er sich als Fotograf und begann zu schreiben. Er verfasste er zahlreiche Reiseberichte.
* * *
Artur Heye: Amazonas-Fahrt
Artur Heye: Amazonas-Fahrt
https://www.projekt-gutenberg.org/heyeartu/amazonas/titlepage.html
Erstmals 1944 in Zürich erschienen
* * *
1
1
„So, da wären wir endlich angelangt. Das ist Parà!“ sagte mein Kompagnon Adalbert Bittner, wies mit der qualmenden Zigarre über den Bug des „GENERALISSIMO TEODORO“ hinaus und gürtete den Trenchcoat fester. „Nun wollen wir mal kräftig in die Hände spucken und die Sache unverzüglich anpacken, verehrte Herrschaften!“
Seine deutende Gebärde hatte einer Anzahl von Schornsteinen und Kirchtürmen und einem sonderbaren Gebilde gegolten, das aussah wie eine Vogelspinne auf dreißig Meter hohen Beinen. Das Ganze war allmählich über der Mauer in Sicht getreten, die unsern Dampfer schon seit dem ersten Lichtstrahl dieses Morgens an Backbordseite begleitet hatte, die von schwerem, feuchtheißem Dunst überlagerte, dunkelgrüne und dichtgeschlossene Mauer der Urwälder des Amazonas.
Amazonas – Foto: Neil Palmer
Was die Sache betraf, die hier angepackt werden sollte, handelte es sich um die Aufnahme eines Naturfilms, und die erwähnten Herrschaften bestanden aus Frau Paula Bittner, Frau Ruth Heye, Herrn Joseph Jungblut und meiner Wenigkeit, und wir alle miteinander stellten eine sogenannte Filmexpedition dar.
Die Vogelspinne war, wie sich beim langsamen Heranmanövrieren des Schiffes herausstellte, das Wasserreservoir der guten Stadt Parà; „Santa Belem do Parà – das heilige Bethlehem von Parà“, wie sie mit ihrem vollen frommen Namen heißt. Rund um die hässlichen eisernen Beine des Monstrums herum und unter die Kronen von zahllosen Palmen, Mango- und flammendblühenden Akazienbäumen geduckt schimmerten weiße Hausmauern aus grünen Schatten heraus. Der Ort war nicht groß und unmittelbar hinter seinen letzten Gärten und Gebäuden stand unzugänglich und unermesslich wie überall an diesem Strom der Urwald; halbkreisförmig von Süden nach Norden geschwungen, umklammerten seine dunklen Arme das Weichbild der Stadt.
Santa Belém do Parà
Im Vordergrund aber öffnete sich ein Hafen, und als er beim langsamen Beidrehen des Schiffes in volle Sicht kam, brach ein einziger Ausruf freudigen Staunens aus den Kehlen von uns vier Neulingen im Land. Nur Bittner, der schon hier gewesen war, begnügte sich, seine Zigarre mit gönnerhaftem Stolz über das Panorama hinaus zu schwenken, so, als ob er es gewesen wäre, der es erschaffen hätte.
Es war ein mäßig großes gemauertes Becken, im Hintergrund von den riesigen Palmen und Laubbäumen eines kleinen Parks abgeschlossen, an zwei Seiten eingefasst von gelb- und blau- und rosagetünchten, oder mit bunten Kacheln verkleideten Fassaden niederer Häuser, und das Becken stellte ein Bild von fast unwirklich anmutender leuchtender Farbenpracht dar. Die ganze Wasserfläche war mit Booten bedeckt, Bordwand an Bordwand gedrängt lagen sie in allen Größen nebeneinander, von stattlichen zweimastigen Barken bis herab zum Einbaum, aus einem Urwaldstamm gehauen, oder zum noch winzigeren, lebensgefährlich aussehenden Rindenkanu, und über dem Gewimmel von Fahrzeugen schimmerten die grellbunten Flächen zum Trocknen gehisster Segel, roter, gelber, blauer, brauner und grüner Segel, und darunter, hoch auf Deck und Boden getürmt, Berge von Früchten, Gemüsen, Blumen, Fischen, Tierhäuten und Vogelbälgen, die Farben und Farbnuancen aufwiesen, für die auch die Sprache eines Malers kaum Ausdrücke haben würde, und zwischen alledem ein Getümmel von halb- und dreiviertelnackten Menschengestalten, deren Hauttönungen kaum weniger bunt abschattiert waren als ihre ganze farbenfrohe Umwelt. „Junge, Junge, so was gibt's doch gar nicht!“ sagte Ruth Heye neben mir mit atemloser Stimme und ungläubig aufgerissenen Augen.
Rolleiflex
Dann fing sie an, hastig am Lederkasten ihrer Rolleiflex herumzufingern, doch im nächsten Moment schob sich schon die nüchterne Wellblechwand des Zollschuppens vor das Farbenmärchen, und diese, von der vollen Glut der vormittäglichen Äquatorsonne getroffene Wand strömte eine solch jähe und irrsinnige Hitze aus, dass wir alle miteinander nach Luft schnappend von der Reling zurückwichen.
„Sakrament, Sakrament!“ stöhnte Sepp Jungblut – er war ein bayrischer Vetter meiner Frau und, nebenbei bemerkt, der Geldgeber unseres Unternehmens – und schob sich die verschwitzte Baskenmütze, der er auch in den Tropen unentwegt die Treue gehalten hatte, aus der triefenden Stirn. „Sollen wir am End' in dös Krematorium da hinein!?“
„Ja, natürlich! Nur los, dass wir zuerst drankommen!“ rief Bittner, drückte seiner protestierenden Paula zwei, drei Handtaschen und den Papageienkäfig in die Arme, nahm in jede Hand zwei Gepäckstücke und polterte den Laufsteg hinunter. „Warum nimmst du denn keinen von den Kerlen da für die Koffer? Ich bin doch kein Lastträger!“ rief sie ihm empört nach. Doch sein Trenchcoat war schon im Dunkel des Schuppens verschwunden, und mit einem: „Recht hat er, Ihr Mann! Hier gewinnt, wer der schnellste ist, und außerdem sparen wir a Geld“, schwang sich Joseph seinen überlebensgroßen Wäschesack auf den Buckel und galoppierte Bittner nach.
So etwas von höllischer Glut, wie sie in jenem Zollschuppen herrschte, hatte ich seit den Kesselräumen meiner Seefahrts-Zeit selten wieder erlebt. Von all unseren Sachen wurde zwar nur der Handkoffer Bittners geöffnet – wie er hernach grinsend sagte, hatte darin eine Zwanzigmilreisnote obenauf und griffbereit gelegen – und so war die ganze Abfertigung in fünf Minuten erledigt, aber dennoch sahen wir alle aus wie gebadete Mäuse, als wir durch die gegenüberliegende Tür aus dem Schuppen wieder hinaus- und auf das erstbeste Taxi zu taumelten.
Wie schon in Rio de Janeiro und in all den Hafenplätzen, wo wir auf unserer zehntägigen Reise nach dem Norden angelegt hatten, war auch hier das erste Taxi so gut wie jedes andere. Es sind durchgängig schwere amerikanische Wagen, immer die letzten Modelle, immer dem brasilianischen Geschmack entsprechend, von hyperluxuriöser Ausstattung, und immer ist die Fahrtaxe so niedrig, dass man sich wundert, wie überhaupt nur die Kosten von Benzin und Öl dabei herauskommen können.
„Hotel da Paz!“ beauftragte Bittner den Chauffeur, der seinem Gesicht nach ein reinrassiger Indianer war, Kleidung und Benehmen nach jedoch der Präsident des Völkerbundes sein konnte. Dann brannte er sich eine neue von seinen geliebten einheimischen Zweimännerzigarren an, brummte seiner immer noch leise widersprechenden Frau ein gemütvolles „Na, nun höre mal auf mit deinem Gemecker!“ zu, lehnte sich behaglich zurück und schnupperte, die Nüstern in dem gelblichgetönten Gesicht freudig gebläht, die schwere, schwüle, von tausend fremdartigen Düften geschwängerte Luft der Urwaldstadt ein.
„Herrgott, bin ich froh, dass ich endlich wieder hier bin! Ich möchte vor Freude gleich auf eine von diesen dornigen Akazien klettern und meiner Frau einen Blütenzweig runterholen. Was habe ich in den letzten sechs Jahren nicht alles versucht, um wieder hierher zu kommen und einen Film nach meinem eigenen Kopf zu drehen. Und natürlich auch einen für meine eigene Tasche. Na, was an mir liegt, das soll geschehen, dass es eine Sache wird, gegen die meine ‚Urwaldhölle‘ noch ein Quark war. Und dass wir mindestens denselben Haufen Zaster, und wenn möglich noch ein bisschen mehr dafür scheffeln wie die Bande von der ‚Filmag’ damals gescheffelt hat! Bei Ihnen beiden bin ich mir wenigstens über den einen Punkt sicher, dass ich von Ihnen nicht so reingelegt werde wie von jenen Schweinen. – Um es gleich hier zu erwähnen, Heye: Zwischen uns beiden hat's leider schon öfters Stunk gegeben, wir wollen uns nicht darüber unterhalten, wer die meiste Schuld daran hatte, wahrscheinlich einer so viel wie der andere. Vielleicht werden wir auch in Zukunft noch manchmal aneinander geraten, aber verdammt nochmal, es sollte doch möglich sein, dass wir wenigstens bei unserer Arbeit an einem Strick ziehen. Schließlich ist's ja unser Karren, den wir aufs Trockne bringen wollen! Meinen Sie nicht auch?“
Ich sah ihn an, die leidenschaftliche Liebe zu seiner Arbeit, die immer wieder aus ihm hervorbrach, packte mich stets aufs neue, und ich wollte ihm das eine sagen, was ich in diesem Augenblick sagen konnte, nämlich, dass der gute Wille bei mir ebenso ehrlich vorhanden war wie bei ihm selbst. Dass die Quelle besagten „Stunkes“ zwischen ihm und mir, und eigentlich zwischen uns allen, dem überwiegend von unfreundlichen Gefühlen bewegten Busen von Frau Paula entsprang, konnte ich ihm jetzt und hier nicht gut auseinandersetzen, denn der erwähnte Busen wogte dicht an meiner linken Seite. Aber da fuhr auf einmal Sepp hoch, reckte uns gerührt seine beiden, ständig ein bisschen schweißfeuchten Pratzen entgegen und grölte begeistert: „Gut, dass Sie es mal zu einer Aussprach' gebracht haben, Herr Bittner! Sie haben mir ganz aus dem Herzen gesprochen, und doch sicherlich Ihnen auch, Herr Heye, gelt? Geben wir uns die Hände drauf, dass wir uns nun besser vertragen und daher miteinander was Rechtes schaffen wollen! Es geht mir wirklich nicht nur um das Geld, was ich in die Sach' hineingesteckt hab, wenn auch fünfzigtausend Mark kein Hundedreck sind, aber hier ist ja alles so unglaublich schön und romantisch und unberührt und wie man's sonst heißen will, und wenn ich dran denk', dass wir schon in den nächsten Tagen in diesen fabelhaften Urwald da hineindringen, und alles was darin kreucht und fleucht auf einen Film bringen werden, und der vielleicht wirklich noch packender wird als Ihr erster, Herr Bittner, so könnt ich vor lauter Freud' gradheraus jodeln!“ schrie er, das Jungensgesicht teils aus Verlegenheit, teils aus innerlichem Überschwang und teils aus äquatorialer Bullenhitze krebsrot angelaufen, und zu unserer aller Schrecken ließ er anschließend hier, mitten auf der Rua Jao Alfredo, der belebtesten Straße von Parà, dann tatsächlich noch einen urbajuvarischen Jodel los. Beruhigend und mit verständnisvollem Grinsen klopfte ich ihm die Schulter – Vetter Sepp war immerhin erst dreiundzwanzig Jahre alt.
Ruth hatte während der Fahrt kein Wort gesprochen, anscheinend nicht einmal eins von unserer Unterhaltung vernommen und nur mit ganz offenen Augen und halboffenem Mund um sich gestaunt. Im „La Paz“ angekommen, war es jedoch an mir, zu staunen, zu wie vielen Fragen, die ich natürlich zumeist nicht beantworten konnte, ihr schon der kurze Weg vom Hafen herauf Stoff gegeben hatte. So interessant auch die hunderterlei merkwürdigen Dinge waren, die sie beobachtet hatte, interessierten mich in dem uns beiden angewiesenen Zimmer aber vor allem die Moskitonetze über den Betten. Ihnen hatte, aus langen und kummervollen afrikanischen Erfahrungen heraus, mein erster Blick gegolten, und ihre Beschaffenheit war derart, dass ich mich mit einem langen Schritt und Griff des Bürschleins versicherte, das unser Handgepäck heraufgebracht hatte und soeben wieder entweichen wollte. Mein, in meinem besten Portugiesisch ausgedrückter Wunsch nach zwei heilen Netzen wurde von dem, lediglich mit einer zerrissenen Hose und einem noch zerrisseneren Hemdchen bekleideten Schokoladenmännlein mit einem erstaunten Blick seiner schwarzen Kulleraugen und dem Hinweis beantwortet, dass diese Netze doch heil genug wären für die paar Moskitos, die es um diese Jahreszeit gäbe! Ich nahm verschiedene stotternde Anläufe, doch meine mehr als kümmerliche Kenntnis der Landessprache Brasiliens reichte nicht aus, um ihm begreiflich zu machen, dass ein Moskitonetz eben völlig heil sein muss, wenn es seinen Zweck erfüllen soll. Schließlich sprang Ruth ein. Ihr jüngerer Kopf hatte in den zwei Monaten, die seit unserer Landung in Rio vergangen waren, immerhin etwas mehr von dem wirklich ziemlich schwierigen brasilianischen Portugiesisch erfasst als der meine. Der kleine Mulatte verstand auch schließlich, worauf es uns ankam und versank ob des Gehörten in ein längeres ernsthaftes Nachdenken. Wobei er sich zum kichernden Ergötzen Ruths heftig in der Nase bohrte. „Neue Netze haben wir nicht im Haus, Senhora. Ich weiß es bestimmt. Aber wie wäre es, wenn ich eine Nadel und einen Faden besorgte, Senhora?“ fragte er zuletzt und betrachtete dabei eingehend das, was er aus seiner Nase zutage gefördert hatte. „Außerdem gibt es in dieser Jahreszeit aber wirklich kaum eine Handvoll Moskitos, Senhora. Kaum drei Fingerhüte voll. Soll ich dennoch Nadel und Faden bringen?“
Jetzt prustete Ruth laut heraus, und ich wusste nicht recht, ob ich dasselbe tun oder das braunhäutige Lumpenbündel, das ungeniert mitlachte, zur Tür hinauswerfen sollte.
„Also, hör nun auf und übersetze ihm bitte: Wenn bis heute Nachmittag um drei keine neuen Netze da sind, kaufe ich selber welche ein und ziehe den Betrag von der Rechnung ab. Und wenn dieser unglaubliche Rotzjunge es wagt, uns angesichts der Fetzen, die hier über den Betten hängen, tatsächlich Nadel und Faden herbeizubringen, nähe ich ihm damit die Nasenlöcher zu, dass er nicht mehr – Pardon! – popeln kann!“
Sie gab dem Schokoladenmann meine Drohung in etwas gemilderter Form wieder, er zeigte als Antwort nur lachend seine prächtigen weißen Zähne; Ruth fotografierte darauf noch in aller Geschwindigkeit das ganze Stücklein Mensch, und mit dem Versprechen, dass es mit seinem „Padron“ reden wolle, und dem Rest einer Praline-Packung in der schmutzigen Faust, schob es ab.
Nach diesem ersten Einblick in die gelassene Menschlichkeit, mit der am Amazonas anscheinend auch Geschäftliches betrieben wurde, gingen wir zum Mittagessen in den Speisesaal hinunter. Da die Zimmer mit voller Pension sich kaum teurer gestellt hätten als ohne, hatte Sepp, der für alle finanziellen Dinge unseres Unternehmens allein zuständig war, natürlich das scheinbar Vorteilhaftere gewählt und war damit, wie sich gleich erweisen sollte, wieder einmal hereingefallen.
Landesüblicherweise gab es kein Menu für die Pensionäre, jeder konnte sich, wenn er wollte, die ellenlange Speisekarte hinunter- und auch wieder heraufessen, es wurde alles prompt gebracht. Aber, es waren samt und sonders einheimische Gerichte, und zu denen gehören eben auch einheimische Zungen und Mägen. Die Gemüse schmeckten entweder wie angekohlte Kokosfasern, gedünstetes Haberstroh oder faulig gewordener Seetang, und die schwärzlichen, verschrumpelten, wie angesengte Schuhsohlen aussehenden Dinger, die als Beefsteaks und Rinderfilets serviert wurden, waren schlechthin nicht entzwei zu kriegen. Nicht einmal mit dem Messer, geschweige denn mit den Zähnen. Ob die verschiedenen Fischarten irgendwelchen eigenen Geschmack aufwiesen, war nicht festzustellen, denn sie wurden in Saucen schwimmend auf den Tisch gebracht, die an Schärfe alles übertrafen, was mir bis dahin zwischen die Zähne gekommen war. Es war einfach fürchterlich. Sepp, der von Natur aus ein bisschen zur Verfressenheit neigte, hatte sofort einen Brocken Brot in eine dieser höllischen Fischsaucen getunkt und ihn leichtsinnigerweise in den Mund geschoben. Er zuckte zusammen, riss entsetzt die Augen auf, fuhr, wie von einer Hornisse gestochen, in die Höhe und durch die weit offene Tür auf die Straße hinaus und sprudelte das Gegessene höchst unkavaliermäßigerweise einer Senhorita vor die Füße, die gerade aus einem Auto ausstieg.
Nachdem unsere Tafelrunde mit immer trübseligeren Mienen alle ausprobierten Vorspeisen, Fleisch und Fisch- und Gemüsegerichte zurückgeschoben hatte, fiel zuletzt jedermann heißhungrig über die gewaltige Schale voll farbenbunter, herrlich duftender Früchte her, die der Kellner, ein tiefschwarzer, in einen tadellosen weißen Anzug gekleideter, aber barfuß gehender Mann, schließlich mit bekümmertem Gesicht auf den Tisch stellte. Die gute Hälfte der Früchte war mir trotz meiner neun Tropenjahre völlig unbekannt, und auch unser Operateur, der doch schon ein halbes Jahr hier verbracht hatte, konnte nicht alle benennen. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Erde, das eine derartige Fülle von Fruchtarten aufweist, wie die tropischen Gebiete Brasiliens.
Da ich schon seit mehreren Jahren an einem chronischen Gallenleiden laborierte, hielt ich mich lediglich an meine geliebten und mir immer wohlschmeckenden Papayos, „Mamao“, wie sie hierzulande hießen. Es sind Baummelonen; aus ihrem zartrosaroten Fleisch, mit kleinen schwarzen, kaviarähnlichen Kernen wird das verdauungsfördernde Pepsin gewonnen.
Die anderen aber hielten sich vor allem an Bananen, von denen allein es vier oder fünf verschiedene Sorten gab, und ferner an Ananas, Mangos und Guaven, an Gajù, Cajàs, Pitanga, Abacate, Pinhos und wie sie alle heißen, und keiner, auch der landeskundige Kurbelmann inbegriffen, beachtete die tausendundeine Regel, die nach Ansicht der Einheimischen über das Essen von Früchten zu beachten ist. Es ist eine ganze Wissenschaft, welche Frucht und zu welcher Tageszeit und in welcher Beschaffenheit an sich, und weiterhin mit welcher anderen zusammen genossen werden darf, was danach zu trinken erlaubt ist und was nicht, und so weiter und so weiter, ohne nach der felsenfesten Überzeugung der Brasilianer einen grässlichen Tod zu riskieren oder zum mindesten eine galoppierende Kolik oder eine katastrophale Verdünnung davonzutragen. Unser Negerkellner hatte mit sichtlicher Beunruhigung all den lebensgefährlichen Verstößen zugesehen, deren sich unsere Tischgesellschaft auf diesem Gebiet schuldig machte; als aber Bittner nach einer letzten saftigen Mango sich sein gewohntes Glas Helles bestellte, nahm die gute schwarze Haut einen innerlichen Anlauf und machte den Kurbelmann mit leiser höflicher Stimme darauf aufmerksam, dass derjenige, der nach einer Mango-Frucht Alkohol zu sich nimmt, einem unrettbaren Tod innerhalb von sechs Stunden verfallen ist. Bittner schüttelte darauf zwar nur unwirsch den Kopf, doch es schienen ihm zuletzt doch Bedenken zu kommen, und er trank das Glas nicht aus. Wie er dann mannhaften Tones versicherte, allerdings nicht wegen dieses blödsinnigen Aberglaubens, sondern aus Protest, weil das Bier, das wie fast allerwärts auf der Welt, so auch hier von einer deutschen Brauerei hergestellt wurde, geradezu unverschämt teuer war.
Wie ich immerhin bemerken muss, ist keiner von uns an diesem Frevel gegen die Speisegesetze des Amazonenstromes gestorben, aber im Lauf des Nachmittags und mehr noch in der folgenden Nacht traten unter der Filmexpedition, mit alleiniger Ausnahme meiner selbst, tatsächlich Leibweh und Übelkeiten von sagenhaften Ausmaßen und abschließend dann ein wahrer Stafettenlauf nach dem Gelass mit den zwei Nullen auf der Tür ein. Ruth erklärte mir verzerrten Antlitzes, dass sie mir, sobald sie wieder einigermaßen bei Kräften sei, den Schädel einschlagen würde. Ich hätte mich lange genug in aller Welt herumgetrieben, um die Gefährlichkeit von Tropenfrüchten zu kennen und sie pflichtgemäß vorher warnen müssen. Worauf ich ihr ein Opiat und als Zugabe den Bibelspruch einflößte: „Es gehet dir lieblich ein, aber nachher wird es dich grimmen in deinem Bauch.“
Die mittägliche Hitze in dem Speisesaal war trotz der offenen Türen und Fenster und der großen Ventilatoren, die sich unablässig unter der Decke drehten, immer stickiger und zuletzt schier unerträglich geworden. Uns allen lief der Schweiß in Strömen über die Gesichter. Vetter Sepp, der seiner körperlichen Veranlagung nach in den zehn faulen Tagen an Bord bemerkbar feist geworden war, zerrte und würgte fortwährend an seinem verweichten und schwärzlich verfärbten Kragen herum und schimpfte in bayrisch-kernhaften Ausdrücken auf die „saudamischen“ Ansichten, die hierzulande über schickliches Bekleidetsein herrschten. Trotz allseitiger Warnungen hatte er in Rio hartnäckig immer wieder versucht, auf der Straße oder sonst wo in der Öffentlichkeit, wenn es ihm zu warm war, einfach seine Jacke auszuziehen und sie über den Arm zu nehmen, so wie es in europäischen Ländern an heißen Tagen allgemein üblich und selbstverständlich ist. In Südamerika, und besonders in Brasilien, denkt man jedoch hierüber aus unerforschlichen Gründen ganz anders. Man kann hier notfalls ohne Schuhe und Strümpfe zum Diner oder in die Oper gehen und niemand wird daran Anstoß nehmen; in Rio ist es sogar möglich, im Badeanzug quer durch die ganze Stadt zum Strand hinunter zu promenieren oder zu fahren, auch das ist zulässig. Nicht aber, sich irgendwo außerhalb der eigenen vier Wände ohne Jackett blicken zu lassen. Als es Sepp dennoch einmal tat, war er auf offener Straße von einem Polizisten höflich, aber bestimmt verwarnt, eines anderen Tages aus einem Kaffeehaus hinauskomplimentiert und bei einem dritten, obstinaten Versuch schließlich von einem Tram hinuntergeworfen worden. Was die Brasilianer gegen das Sichtbarwerden von Hemdärmeln haben, habe ich nie herausfinden können.
Als wir den abschließenden sirupsüßen Kaffee einnahmen, verdüsterte sich auf einmal das Tageslicht, ein drohendes, rasch anschwellendes Murren dröhnte durch die Mittagsstille, ein plötzlicher Windstoß fegte die Papierblumen – sie waren hier, in diesem blütenüberschütteten Land wirklich aus Papier! – von den Tischen herunter, ein Feuerstrahl durchflammte die jäh herniedersinkende Dunkelheit, und, nur Sekunden später, rauschte, prasselte, goss und schüttete es herab, wie es eben nur in den Tropen schütten kann. In kompakter grauer Masse stürzten die Fluten des Himmels nieder, fetzten Laub und Zweige von den Straßenbäumen, bogen die Wedel der Raphia- und Königspalmen auf dem gegenüberliegenden Opernplatz unter ihrer Wucht fast zur Erde nieder, brausten im nächsten Augenblick schon in fußtiefen schäumenden Strudeln auf dem Pflaster dahin, knatterten wie Hagelschlag auf die Dächer und erfüllten das ganze Haus mit einem alles verschlingenden Gedröhn.
Ich war in die Tür getreten, schaute in die Sintflut hinaus und war froh, dass ich dabei ein Dach, und nicht wie so oft in Afrika, nur eine leckende Zeltleinwand oder, noch öfters, lediglich meinen alten Filz über dem Kopf hatte; da tauchte in dem von Blitzen durchglühten Wasserschwall etwas ganz Sonderbares auf. Ein turmhoch beladener Handkarren, von vier halbertrunkenen Gestalten gezogen und geschoben, und ganz zuoberst schwankte etwas Monströses, Glitschendes, bedrohlich hin und her, das aussah wie ein urweltlicher Ochsenfrosch, und gerade, als ich den Leuten ein warnendes „Hallo!“ zurufen wollte, plumpste das Ding herunter, kollerte in den Rinnstein hinein und wurde von dem bereits knietief angeschwollenen Wasser erfasst und die abschüssige Straße hinuntergewälzt. Die Ladung bestand aus dem Gepäck unserer Expedition, und was da die Straße hinabgeschwemmt wurde, war Vetter Sepps sagenhafter Wäschesack! – Mit einem „Heda! Was zum Teufel ...!“ war Bittner aufgesprungen und zur Türe gelaufen; auf einmal aber stieß er ein Gebrüll aus wie ein angeschossenes Nilpferd, bog sich wiehernd vor Lachen nieder, klatschte sich die Schenkel und japste in das Lokal hinein: „Sie, junger Mann ... haben Sie ... haben Sie das gesehen? – So hilft der Himmel den Seinigen! Er hat Ihnen das Waschen schon besorgt und jetzt haben Sie überhaupt nichts dafür zu bezahlen!“ Sepp war mit rotem Kopf aufgefahren und wortlos seinem davonschwimmenden Wäschesack nachgesetzt; ich schaute den immer noch weiterwiehernden Kurbelmann verständnislos an und fragte schließlich: „Sagen Sie mal, was ist an der Sache eigentlich derart lächerlich?“
„Ja, Sie wissen wohl gar nicht, was in dem Sack ist?“ fragte er zurück.
„Nun, was wird anderes drin sein als Kleider, Wäsche, Stiefel und so weiter. Oder hat er am Ende seinen geliebten Zaster da reingestopft?“
„Nee, wirklich nur Wäsche. Aber nur dreckige! Seine sämtliche gebrauchte Wäsche seit Berlin! – Mensch, Heye, es klingt natürlich unglaublich, aber dieser Dreckspatz hat es tatsächlich fertiggebracht, den Haufen, der sich bei ihm schon bis Rio de Janeiro angesammelt hatte, nicht einmal dort in die Wäscherei zu geben, und nur darum, weil ich gelegentlich einmal erwähnt hatte, dass hier in Parà auch diese Ausgabe fast wegfallen würde, sobald wir ein Haus gemietet und eine eigene Wäscherin angestellt hätten. Daraufhin hat diese unsagbare Rübe von Kerl den ganzen Berg schmutziger Hemden und Socken noch einmal von Rio aus viertausend Kilometer weiter bis hierher an den Amazonas geschleppt! Nur um eine Wäscherechnung zu schinden! Auf diese Weise hat er schon seit Wochen kein reines Hemd mehr zum Wechseln gehabt, und das ist der Grund, warum unser verehrter Herr Kompagnon geradeheraus gesagt seit einiger Zeit stinkt wie ein Wiedehopf.“
„Mein Gott!“ sagte Ruth, die neben uns getreten war, mit leiser Stimme. „Dass der Geiz bei ihm so weit geht, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Ich habe ihm schon verschiedene Male zu verstehen gegeben, dass er sich ein bisschen sauberer halten sollte, aber es hat nichts genützt. Jetzt müsst ihr einmal mit ihm reden, denn das geht doch einfach nicht mehr!“
Da sagte auf einmal eine gereizte Stimme hinter uns: „Wenn Sie es für angebracht halten, sich in die Privatangelegenheiten von Herrn Jungblut einzumischen, so beauftragen Sie bitte Ihren Mann damit, Frau Heye, und nicht den meinen! Ich finde es unerhört, wie hier über einen Teilnehmer an unserer Unternehmung gesprochen wird! Du solltest dich schämen, Adalbert!“
Unserem Kameramann schien ob dieser unerwarteten Verlautbarung seiner Frau einfach der Verstand stehengeblieben zu sein; eine Sekunde lang starrte er sie offenen Mundes an, dann fragte er in leisem, drohendem Ton: „Nun, sag mal, wie kommst denn gerade du dazu, dem Dreckferkel die Stange zu halten? Du hast doch sonst anders über ihn gesprochen! – Ich kann dir nur sagen ...“ Er hatte mit immer lauterer Stimme auf sie eingeschrien, unter den anderen Gästen war Totenstille eingetreten; mit beschwörend erhobenen Händen kam der Besitzer aus seinem Büro herausgeschossen, und mit einem verzweifelten Satz sprang ich aus der unerträglich peinlichen Situation in den Wolkenbruch hinaus und begann geschäftig den vieren am Karren beim Abladen der Kisten mit unserer kostbaren Apparatur zu helfen.
Ruth war bei der widerlichen Szene plötzlich wie vom Erdboden verschwunden, hinter seiner Frau her verhallte die brüllende Stimme Bittners auf der Treppe, die Gäste im Lokal steckten flüsternd die Köpfe zusammen, und mir war über diese Art von Anfang, den unser Aufenthalt hier genommen hatte, ziemlich beklommen zumute. Ich hatte sogleich begriffen, was Frau Bittner zu jener Bemerkung veranlasst hatte – mir war schon seit langem klar geworden, dass die gegenseitige herzliche Abneigung zwischen den beiden Frauen eine Dynamitpatrone darstellte, die wahrscheinlich unser Unternehmen eines Tages in die Luft sprengen würde.
* * *
2
2
So jäh wie das Einsetzen des Gewitters war auch sein Ende. Als wir uns gegen drei Uhr nach der landesüblichen Siesta droben von unsern Betten erhoben, blitzten die Riesenblätter der Bananen und die Wedel der Palmen drüben auf dem Opernplatz im Sonnenschein, als wären sie frisch lackiert. Aus dem durchtränkten Erdreich unter den Bäumen wirbelten Schwaden von weißem Dampf empor, auf dem Straßenpflaster aber war keine Spur mehr von den niedergegangenen Wassermassen zu sehen, die Paràenser hatten die Gassen ihrer Stadt den verheerenden Regenfluten dieses Himmelsstriches angepasst und ihnen eine hohe Wölbung gegeben, eine so hohe, dass die vorbeirollenden Autos bemerkbar schräg auf der Fahrbahn lagen.
Das Hotel war eines der wenigen mehrstöckigen Häuser von Parà, der kleine Balkon unseres Zimmers gewährte einen Überblick über den größten Teil der Stadt und die sonnenglitzernde uferlose Weite des Riesenstromes, die sich dahinter ausdehnte. Zwischen den vielerlei Schattierungen von Grün und den glühenden Farbflecken von Blumen und blühenden Schlinggewächsen der Anlagen schimmerten die feierlichen Marmorsäulen des Opernhauses hindurch, hoch im Tiefblau des Himmels segelten einige letzte weiße Wolkenfetzen dahin und darunter, all überall, wohin das Auge auch fiel, zogen Schwärme von großen dunkeln Vögeln ihre langsamen Kreise.
Opernhaus in Belém
Auch auf dem Dach der pompösen Oper, auf allen Hausdächern überhaupt, saßen in langen Reihen dieselben Vögel, selbst drunten auf der Straße hüpften sie mit ungeschickten Sprüngen vor herannahenden Fuhrwerken auf, und wie Ruth mit einem hellen Ausruf feststellte, hockten zwei sogar auf dem Balkon des Zimmers unter uns und zerrten dort mit missvergnügtem Gezisch an etwas Undefinierbarem herum.
„Du, was sind denn das für Vögel? Sie sehen ja fast aus wie Truthähne in der Mauser?“ fragte sie.
„Urubù sind es. Eine Geier-Art. Hierorts wäre der Name sinngemäß mit ‚Pleitegeier’ zu übersetzen.“
Henry Walter Bates (* 8. Februar 1825 in Leicester, England; † 16. Februar 1892 in London) [1] war ein englischer Naturforscher, Evolutionsbiologe und Entomologe.
„Wieso? Meinst du jetzt unsere persönliche Pleite oder herrscht hier herum auch eine? – Du hast doch auf der Überfahrt dauernd das Buch über den Amazonenstrom von dem Engländer Bates vor der Nase gehabt, und da darin auch etwas über Parà gestanden haben muss, könntest du mir eigentlich ein paar Brocken von deiner angelesenen Weisheit abgeben. Sintemal du doch ganz gern ein bisschen den Schulmeister spielst! Also schieß mal los!“
„Ich gebe den Besitz einer schulmeisterlichen Ader mit dem würdigen Stolz des berufenen Pädagogen zu und erkläre mich bereit, dir einen Vortrag über das erwähnte Thema zu versetzen, sofern du ihn mit dem geziemenden sittlichen Ernst aufnimmst, mein Kind“, grinste ich und strich mir einen imaginären Vollbart. „Drück deine Zigarette aus, denn Damen, die auf der Straße rauchen, werden hierzulande als verworfene und verlorene Geschöpfe betrachtet, und dann lass uns dort drüben vor dem kleinen Kaffeeausschank einen geruhsamen Mokka genehmigen. Dabei werde ich dir alles Wissenswerte über diese Stadt verzapfen. Nur das eine will ich gleich hier noch sagen, und zwar in verdammtem Ernst: verlass dich nicht so fest darauf, dass wir beide eine ganze Weile hier blühen werden! – Nach dem, was sich heute Mittag wieder getan hat, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass sich ein ersprießliches Zusammenwirken unserer Kumpanei die vorgesehenen acht Monate lang durchhalten lässt. Die hier einzig angebrachte Devise ist: nur Mut, 's wird schon schief gehen!“ dozierte ich, während ich in das unvermeidliche Ausgangsjackett fuhr.
„Fang nicht schon wieder mit deinem Unken an und komm endlich!“ rief sie ungeduldig vom Korridor ins Zimmer herein. „Ach, du kriegst die Motten! – Da kommt einer, der dich anscheinend sprechen will. Schmeiß ihn bald wieder raus und komm dann nach! Ich muss jetzt an die Luft.“
Damit war sie weg und mit diskretem Räuspern erschien das hakennasige Gesicht des Hoteliers im Türrahmen. Er grüßte und hielt mir unter lebhaften Gestikulationen nach den Moskitonetzen hin eine längere fließende Rede in der Landessprache, die ich ebenso fließend nicht verstand.
„Speak English?“ unterbrach ich ihn schließlich. Er schüttelte den Kopf und fragte zurück: „Parlez-vous français?“ worauf ich schüttelte und hoffnungsvoll weiterforschte: „Parla Italiano? – Habla Española? – Auch nicht? Heiliger Nepomuk!“
Ich kratzte mir verzweifelt den Kopf und gurgelte ihn zuletzt, und nur eigentlich zum Spaß, noch an: „Int'arif Arabi?“ – „Sprichst du Arabisch?“
Doch da wurde uns beiden eine Überraschung zuteil, denn mit einem erstaunten Heben seiner kohlschwarzen Augenbrauen rasselte er los: „Ajuwah araf, ya Sihdi! Lakin kallim: Andak el lissan i min fen?“
Es ergab sich, dass er syrischer Abkunft war, und was mich betraf, so hatte ich die Sprache des Propheten im Orient erlernt, und damit war erklärt, wieso sich zwei Landfremde hier am Amazonenstrom schließlich auf Arabisch verständigen konnten.
„Nun sage mir, o Bekenner des wahren Glaubens ...“, hub ich an, doch er unterbrach mich sofort ernst: „Herr, ich bin römisch-katholischer Christ!“
„Umso schlimmer, o Sohn des Heiligen Vaters! Dann dürftest du den Gästen deines Hauses erst recht nicht Lumpen über die Betten hängen, durch deren Löcher eine trächtige Kamelstute ziehen könnte. Wie viel mehr also die kleinen singenden Teufel der Nacht! Ich habe deinem Diener, diesem Vater der Nasenbohrer, bereits meinen Entschluss verkündet, und da die gestellte Frist abgelaufen ist, gehe ich jetzt hin und kaufe auf deine Kosten ...“
„Genug, genug, o Herr, ich werde neue Netze besorgen“, rief er lachend. „Aber du bist der verwunderlichste Deutsche, der mir jemals vorgekommen ist. Du kannst ja reden, als ob du eine Koranschule besucht hättest!“
„Habe ich auch, gewissermaßen“; grinste ich, und mit der Ermahnung: „Möge Allah dein Gedächtnis stärken, dass du die Herbeischaffung der Netze nicht vergisst, und sich der Fluss meiner Worte nicht aufs Neue über dein schuldiges Haupt ergießen muss!“ ließ ich ihn stehen und machte, dass ich endlich hinüber kam zu der wartenden Ruth.
Der gastliche Betrieb bestand nur aus einem Kiosk und einer Anzahl davorstehender Tischchen. Wie ich an der langen Reihe der hier haltenden Wagen, nicht aber an Kleidung und Benehmen der Gäste sah, wurde er lediglich von Chauffeuren frequentiert. Dass wir beide mit dem Besuch dieser Stätte bereits zum zweiten Mal seit unserer Ankunft gegen den Prestigefimmel der hier ansässigen Europäer angeeckt waren, ahnten wir zu dieser Stunde nicht.
„Wer war denn der Mann, und was wollte er von dir?“ fragte Ruth.
„Der Besitzer des ‚La Paz’ war es, und was er eigentlich wollte, weiß ich nicht. Er ist Syrier, also konnte ich mit ihm in seiner Muttersprache reden, und so haben wir begründete Aussicht, neue Netze zu kriegen“, antwortete ich, nahm einen Schluck von dem ein wenig streng schmeckenden einheimischen Getränk, räusperte mich und legte los. – „Also, was dieses verschlafene Nest von Parà betrifft, so hat es einstmals gegen zweihunderttausend Einwohner gehabt und Zeiten erlebt, in denen es sozusagen in Geld und Sekt geschwommen ist. – Übrigens sollen hier heute noch über hunderttausend Menschen vorhanden sein, möchte wissen, wo die alle hausen. – Besagter Mammon wurde mit Kautschuk, also Roh-Gummi, dem berühmten Parà-Gummi, verdient. Die ganze Stadt lebte damals ausschließlich vom Gummihandel, selbst der letzte Lastträger drunten im Hafen verdiente Geld genug, um sich abends ein paar Pullen französischen Champagner hinter die Binde gießen zu können. Und die Großhändler, sogar ein paar Dutzend, und ihre Frauen badeten einfach im Sekt, und fuhren, die letzten Pariser Schöpfungen auf dem Leib und Brillanten, so groß wie eine Haselnuss an jedem Finger, den ganzen Tag im Auto herum. Rolls Royce und Hispano-Suiza mussten es sein, Packards waren schon die unterste Grenze. Und ein Rennboot auf dem Strom gehörte auch dazu, und eine Villa draußen in Santa Nazareth und ein Landhaus in Mosqueira – es war der kleine Badeort, den wir dicht vor Parà passierten, entsinnst du dich? Und der Luxus, den die Priesterinnen der Venus betrieben, soll einfach unbeschreiblich gewesen sein, und ihre Kopfzahl zu jener Zeit zwanzigtausend betragen haben. Sogar die Gummijäger selber, die draußen in den Wäldern herumkrochen und manchmal Baumrinde fressen mussten, weil sie nichts anderes hatten, und schockweise am Fieber, an den Giftpfeilen der Indianer, an Schlangen, Pyranhas und so weiter zugrunde gingen, bekamen ein paar Tropfen von dem Goldstrom ab. Wenn sie mit dem erbeuteten Gummi glücklich hier angekommen waren – er wächst hierzulande ja nicht auf Plantagen, sondern wild im Urwald, wird von Bäumen, die ziemlich vereinzelt stehen, in Form eines Milchsaftes abgezapft und darauf über einem Feuer angeräuchert, um ihn zum Gerinnen zu bringen – und wenn die Händler dann, wie sie es überall auf der Welt tun, die armen Teufel von Gummisuchern nach Kräften beschummelt und bemogelt hatten, so gab es für die eigentlichen Produzenten der Ware immerhin auch ein paar Tage mit Sekt und Mädchen und Autofahrten, bis sie mit geleerten Taschen aufs neue loszogen in die Wildnis und wieder Baumrinde und Sumpfwasser und Giftpfeile an die Reihe kamen. – Wie meinst du? – Ganz recht, es war ungefähr dasselbe wie mit den Seeleuten, den Pelzjägern, Goldsuchern etcetera. Sie alle sind vom lieben Gott speziell zur Ernährung der menschlichen Parasiten erschaffen worden, wie dir wohl klar ist. – Die Knallprotzenoper hier, die für Paris groß genug wäre, ist natürlich in jenen fetten Jahren entstanden. Wie Bates sagt, hat die letzte Vorstellung darin vor nunmehr zehn Jahren stattgefunden, und ein Stück weiter oberhalb an diesem Boulevard gab es eine ganze Batterie von Spielsälen, Tanzpalästen und Luxushotels, und auch die haben Geld gemacht auf Teufel komm raus.
Nur einer einzigen Art von Menschen ging es auch in jenem goldenen Zeitalter ganz und gar nicht gut – den Indianern. Oder richtiger gesagt, es ging ihnen noch schlimmer als es ihnen schon immer gegangen ist, seitdem ihnen Gott in seinem Zorn unsere ehrenwerte Rasse auf den Hals geschickt hat. Sie gingen damals zu Tausenden und Tausenden draußen in ihren Wäldern zugrunde. An Schnaps, an Prügeln, an Messerstichen, Schrotschüssen, satanischen Martern und schamloser Gaunerei. Jede nur ausdenkbare Gemeinheit war recht, um sie zum Gummisammeln zu bringen und sie dann natürlich um ihren Gummi zu prellen. Seitdem gibt es am ganzen Unterlauf des Stromes bis zum Rio Negro hinauf überhaupt kaum noch Indianer. – Ich will nichts weiter über dieses spezielle Thema, sagen, du weißt, dass es mir immer erheblich an die Nieren gegangen ist. Ich habe, was das betrifft, Zuviel gesehen auf diesem erfreulichen Planeten...! Vielleicht komme ich doch noch dazu, einmal ein Buch zu schreiben mit dem Titel ‚Kain, wo ist dein Bruder Abel?’“
Die Hand meines Kameraden legte sich auf die meinige; Ruth sah mich ernsthaft an, dann fragte sie leise: „Ja, und das Ende, die Pleite?“ „Die kam daher, dass eines Tages ein spekulativer Brite mit einem Köfferchen aus Brasilien entwischt ist, in dem ein paar Sämlinge verstaut waren. Sämlinge von jenem Gummibaum nämlich. Die Regierung hatte in weiser Erkenntnis die Ausfuhr jener kostbaren Körnlein mit ich weiß nicht wie viel Jahren Zuchthaus bedroht. Der junge Mann mit dem Köfferchen kam glücklich davon und zog dann ein paar Jahre lang drüben im Malayischen Archipel still und emsig Gummibäumchen aus seinen Sämlingen. Als dann die erste Ernte dieses naturgemäß viel reineren und hochwertigeren Plantagenproduktes auf den Weltmarkt kam, senkten sich die Pleitegeier auf die Dächer von Parà herab. Und wie du siehst, hocken sie heute noch darauf. – Die Preise fielen und fielen, es lohnte zuletzt nicht einmal mehr, Indianer auf die Suche nach Gummi zu schicken, denn, wie gesagt, die Bäume stehen allzu vereinzelt in den Urwäldern, und außerdem war natürlich mit den vorhandenen Beständen ein wahnwitziger Raubbau getrieben worden. Binnen kurzer Zeit kam hier alles zum Stillstand. Nachdem die letzten Kisten Sekt ausgebechert waren, gab es einen ungeheuren Katzenjammer und dann einen umfassenden Totalausverkauf an schönen Villen, Autos und Brillanten. Eine allgemeine Stagnation trat ein – sie hatten das Geld zu leicht und zu schnell verdient und es ebenso wieder ausgegeben, um sich jetzt umstellen und mit kleineren Gewinnchancen abfinden zu können, die es bei den unermesslichen Naturschätzen dieses Landes selbstverständlich in Fülle gibt. Dazu kam noch die durch das Klima bedingte Indolenz. Anderseits hat sie ihnen freilich auch geholfen, diesen ungeheuerlichen Zusammenbruch mit einer gewissen gleichgültigen Gelassenheit zu ertragen und sich mit ihren jetzigen kümmerlichen Verhältnissen abzufinden. Erst seit den letzten zwei, drei Jahren regt sich hier wieder ein zaghaftes Wirtschaftsleben, die Paràenser haben sich jetzt hauptsächlich dem Handel mit Ölfrüchten und Edelhölzern zugewandt, von denen es ja tausendundeine Art in den Urwäldern gibt. – So, das ist alles, was ich über Parà weiß, ich habe mir den Mund trocken geredet und würde eigentlich gern noch einen Kaffee trinken, will ihn mir aber in Anbetracht meiner gottverdammten Galle verkneifen“, schloss ich meinen Vortrag, zahlte den lächerlichen Betrag von ungefähr fünfundzwanzig Rappen für zwei Kaffee mit Rahm und Zucker und einem Teller voll köstlicher gebutterter Toaste, und dann ging ich ins Hotel hinüber, um meinen Partnern vorzuschlagen, den heutigen Nachmittag zu einem gemeinsamen Bummel durch die Stadt zu verwenden und erst morgen ernstlich an unsere Arbeit zu gehen.
Ich fand jedoch Sepp droben in seinem Zimmer mit gewaltigem Schnarchen beschäftigt, und Bittner überhaupt nicht im Haus vor. Wie mir seine Frau achselzuckend sagte, hätte sie ihn seit dem Mittagessen nicht mehr zu sehen bekommen. Meine, wie ich gestehen will, nicht sehr herzliche Einladung, mit uns zu kommen, lehnte sie mit einem kühlen: „Danke, ich habe zu tun“, ab, und so gingen Ruth und ich eben allein auf unsern Bummel. Auf dem breiten, in voller Nachmittagssonne liegenden Boulevard war es irrsinnig heiß, der Schweiß brach uns sofort aus allen Poren, rann in Bächlein am Körper herab und durchnässte unsere Kleidung bis zur letzten Faser. Der nur mit einem dünnen Seidenkleidchen angetanen Ruth war die Sache ein bisschen genierlich, doch sie fand sich zuletzt damit ab, als sie erkannte, dass hier Männlein und Weiblein ohne Ausnahme ständig glitschten und tropften, als wären sie soeben aus dem Strom herausgefischt worden, und bald hatte sie über das sonstige Aussehen der hier herumwimmelnden Menschheit ihr eigenes völlig vergessen. Es waren vor allem die hierzulande „getragenen“ Hautfarben, die sie immer wieder in atemloses Erstaunen versetzten.
An Schwarz und Weiß und alle möglichen Schattierungen von Gelb und Braun hatten wir uns schon in Rio gewöhnt, aber was es darüber hinaus hier noch gab, war schlechthin unwahrscheinlich. Ein vierschrötiger Mann, der dicht vor uns in ein Taxi stieg, hatte ein Gesicht wie hochpoliertes Kupfer, ein zerlumpter alter Kerl, der schlafend vor einer Haustüre hockte, war ausgesprochen olivengrün und blieb auch olivengrün, als wir uns mit ungläubigem Blick zu ihm niederbeugten, und eine junge, wie eine Göttin gewachsene Negerin, die graziös vor uns herschwebte, wies nackte, ebenholzschwarze Beine und Arme, aber einen eindeutig veilchenblauen Nacken auf. Wie sich Ruth durch einen rascheren Schritt überzeugte, rührte diese widernatürliche Tönung allerdings von einer dicken Puderschicht her. Dafür kam uns aber gleich darauf ein „vielköpfiger“ Familienvater entgegen, dessen Nachwuchs an Farbenpracht alles bisher Gesehene übertraf. Von den vier Sprösslingen, die er entlang führte, war der eine elfenbeinfarben, der zweite kaffee- und der dritte schokoladebraun, der vierte jedoch, ein Bürschlein von ungefähr drei Jahren, zeigte ein hellrotes Gesicht und darüber einen gelblichweißen krausen Haarschopf, anscheinend war es ein Albino.
Der Weg den Boulevard hinunter hatte uns deutlich gemacht, dass Parà nur fünfzig Kilometer vom Äquator entfernt liegt – in Zukunft haben wir, wie jeder vernünftige Mensch hierzulande, für diese Strecke das Tram benutzt. So war ich froh, als wir endlich in die Rua Jao Alfredo einbogen, auf die Ruth zielsicher zugestrebt war. Ihr hatten es die Märchendinge angetan, von denen sie auf unserer Fahrt vom Hafen herauf einen Schimmer erhascht hatte. Es ist die Geschäftsstraße von Parà, Laden reiht sich hier an Laden, und das, was man darin alles an seltsamen Sachen kaufen kann, ist in der Tat ungewöhnlich. Neben ganz alltäglichen seidenen Strümpfen und Kombinationen in einem Schaufenster, die aus Europa eingeführt waren, lag ein indianischer Kopfschmuck, aus herrlichen bunten Kolibri-Federn zusammengesetzt, und ein ebenso gleichgültiges Herren-Oberhemd hing auf einem Caboclo-Hut, der so groß war wie ein Mühlstein, und der Vorhang, der die Auslage gegen das Innere des Ladens abschloss, bestand aus lauter Hängematten, dem wichtigsten und oft einzigen Einrichtungsstück brasilianischer Wohnungen. Es gab einfache, billige, aus dickem Baumwollstoff gewebte Schlafmatten und andere aus Fasern, aus Bast oder aus Seidenschnüren geflochtene und geknüpfte, mit Spitzen, Troddeln, Stickereien und bunten Federn verzierte, die fünf- bis sechshundert Milreis, also über dreihundert Franken, kosteten. Und ganz vorn im Fenster stand eine Reihe von lackschwarzen Cuja-Schalen, und in jeder lag ein Häufchen von mattschimmernden kleinen Kieseln. Aber auf weißen Kartontäfelchen, die davor lagen, war geschrieben: „Ungeschliffene Diamanten“ – „Smaragde“ – „Rubine“ – „Opale“ – und darunter: „Sämtliche Edelsteine stammen aus den Fundstätten von Minas Geraes“. Das nächste Geschäft zeigte nur Häute und Bälge, großgetupfte Jaguar- und samtglänzende Affenfelle, mehr als ein Dutzend Arten von barock gezeichneten Schlangenhäuten, herrliche weiße Reiherstöße, große Bündel von buntglühenden Papageien-, Tukas-, Tangaren-, Ibis- und Klippenvogelfedern, und daneben ganze Haufen von Schildkrötenschalen, weißblinkenden Raubtierkrallen, -zähnen und -hauern. Und wiederum im nächsten Laden, einem halbdunkeln Gewölbe, stand zu meinem Erstaunen sogar alles voll von Elefantenzähnen. Mit einem „Ja, wie zum Teufel kommen denn Elefanten an den Amazonas!“ trat ich darauf zu. Doch es waren gar keine Elefantenzähne, sondern Rauchwaren. Nämlich einheimischer Tabak, der in gekrümmte, spitzzulaufende Rollen gedreht und gepresst und mit gelblichweißen Baststreifen umwunden war. Ein von solchem Hauer abgeschnittenes Stück sah dunkel und saftig aus wie Lakritzen und verbreitete einen durchdringenden, beizendsüßen Geruch, der dem von frischem Schnupftabak ähnelte. In einem ebenfalls sehr dämmrigen Lokal gegenüber waren ganz wundervolle Holzarbeiten ausgestellt, Kästen, Schalen, Becher und Schachspiele aus Holzarten geschnitten, die man sonst nirgends auf der Welt sieht. Manche der Hölzer glänzten wie graue Seide, andere waren einheitlich rosenrot, blauviolett, safrangelb und tiefschwarz gefärbt, wieder andere geflammt, geädert, mit roten, goldenen oder orangenen Tupfen wie gebatikt, und auf einem gewaltigen polierten Klotz, der in seiner düsterroten Färbung aussah wie ein blutgetränkter Richtblock, standen die Prachtstücke des Lädchens aufgebaut, eingelegte Arbeiten, deren verschiedene Holzarten mit bewundernswertem Geschmack ausgewählt und zusammengefügt worden waren. Wie uns das zusammengeschrumpfte, uralte Männlein, das den Laden führte, versicherte, waren diese Holzarbeiten ausschließlich von „Indio bravos“, wilden Indianern, angefertigt worden.
Ich hatte eigentlich schon genug vom Schauen, doch aus dem Nachbarhaus drangen derart würzige und fremdartige Düfte heraus, dass Ruth mich am Rockärmel auch noch da hineinzerrte. Die Gerüche entströmten einer langen Reihe von offenen Säcken, und darin befanden sich Nüsse, ausschließlich Nüsse, aber in jedem Sack immer wieder eine andere Art oder Sorte. Sie waren von jeder Größe, Farbe und Form vorhanden, kopfgroße Kokosnüsse und winzige, kaum bohnengroße Nüsschen, dreikantige Paranüsse, vielerlei Arten von Öl-Nüssen, andere, die unsern Wal- und Haselnüssen ähnelten, und mehrere Sorten von flachen, eisenschweren Nüssen, aus deren Schalen Knöpfe hergestellt werden.
Wie in jedem der Geschäfte, die wir betreten hatten, wurden wir auch hier mit größter Liebenswürdigkeit empfangen, und trotz unserer einleitenden Bemerkung, dass wir nichts zu kaufen beabsichtigten, bereitwilligst herumgeführt und über jede Warengattung unter einem Schwall von höflichen Redensarten unterrichtet. Mir war zuletzt vom Schauen, von den betäubenden scharfen Düften und von der brüllenden Hitze dieses Nachmittags ganz benommen im Kopf, und ich hatte eigentlich bereits den Entschluss gefasst, irgendwo noch einen Kaffee zu trinken, Galle hin und Galle her. Als ich jedoch, einem penetranten Mokkaduft folgend, um eine Ecke bog, wurde uns ein Anblick, der mich Benommenheit und Kaffeedurst vergessen und uns beide wie gebannt stehen bleiben ließ. Die Straße führte direkt auf den malerisch-romantischen Bootshafen von heute Vormittag, den berühmten Ver-o-peso von Parà zu. Es war jetzt Ebbe, die Dutzende von ankernden Booten lagen auf Grund, und auf den Schlammbänken zwischen den Fahrzeugen hüpften, flatterten und kreischten Hunderte der schwarzen Urubùs herum, rauften sich um die Abfälle des Marktes, und über dem Gestänge der Masten und den bunten Flächen der Segel flammte der Tropenhimmel in den tiefen satten Farben des Sonnenunterganges und spiegelte seine purpurgesäumten Wolken in der goldblinkenden flutenden Unendlichkeit des Riesenstromes wider. Das lärmende Getümmel der Marktstände war verhallt, der kleine gepflasterte Platz mit seinen Palmgruppen und farbigen Häuserfronten und das umfriedete Becken des Hafens mit den vor Anker liegenden Fahrzeugen lagen still und fast menschenleer, und unbelebt träumte auch das hinabführende, in Grün versponnene Sträßlein in den sinkenden Abend hinein. Unter dem golddurchfluteten Domgewölbe eines alten Mangos lockte eine kleine Bank, wir nahmen beide darauf Platz. Feurige Hibiskus-Blüten glühten aus der Wildnis von Bambus und Bananen hinter unserem Sitz. Ein schwerer Duft von Schlamm und Wasser, von Fischen und Häuten, von Blumen und Früchten und etwas von dem Atem heißer, unbekannter Wildnisse, den alle die Fahrzeuge hier mitgebracht hatten, wehte mit dem leisen Abendwind vom Hafen herauf. Da zuckte es auf einmal wie ein stahlblauer Blitz aus den Blüten der Hibiskus heraus, schwirrte in funkelndem Flug auf und ab, hielt mit summendem Flügelschlag einen Moment lang vor einer Blütendolde inne und war im nächsten verschwunden. Ruth hatte unwillkürlich meinen Arm ergriffen, in stummer Frage zeigte ihr Finger auf den lebenden blauen Funken hin.
„Beja Flor!“ sagte ich leise. „Kennst du den Namen?“
„Beja Flor –? Warte mal, Beja ist ‚Kuss’ und Flor natürlich ‚Blume’ – Oh, jetzt hab ich's: Blumenkuss! Der brasilianische Name für ‚Kolibri’. Mein Gott, Kolibris hier mitten in der Stadt! In welch eine phantastische Welt sind wir hier gekommen! Ich möchte ja ... Oh, da, schau! – Hast du den gesehen? Schade! Es war ein ziemlich großer Vogel, grün und feuerrot, und mit einem Schwanz, der wie ein silberner Schleier nachflatterte.
Schwarzkinnkolibri – User: Mdf
Und dort, dort! – Das ist ja heute Abend, als sollte ich einen Vorgeschmack von all den Wundern erleben, die uns draußen im Urwald beim Filmen erwarten. Junge, wie freue ich mich darauf! Ich möchte die Straße hinunter und durch das goldige Häfchen hindurch in diese Farbensinfonie von Himmel und Wasser hineintanzen!“
Es war ein Schwarm von Papageien, der mit Geschrei in die mit kleinen roten Früchten behangene Krone einer mir unbekannten Palmenart eingefallen war. Ich hatte Papageien und Kolibri ähnliche Nektarinen und Witwenvögel in Afrika zwar alltäglich um mich gehabt, doch es ist eine sonderbare Sache, dass altbekannte Dinge einem wieder so unglaublich frisch und neu werden können, wenn sie das Auge eines Weggefährten zum ersten Mal erblickt.
„Übrigens ist mir im Magen ein bisschen komisch zumute, sogar sehr komisch“, setzte der Weggefährte unvermittelt hinzu, und krümmte sich dabei zusammen wie ein Fragezeichen. Ich sah, dass sie auf einmal sehr blass geworden war, aber im nächsten Augenblick hatte sie ihr Bauchweh bereits wieder über einem Riesenkerl von metallschimmerndem Käfer vergessen, der mit einem dumpfen Knall auf meinem Panamahut gelandet war. Zu meinem Entsetzen packte sie ihn – Käfer sind so ziemlich die einzigen Lebewesen, gegen die ich eine angeborene Abneigung hege – und sperrte das Monstrum, das mir mit seinen gezähnten Zangen und seinen Glotzaugen ein wahres Grauen einflößte, lachend in ihre leere Puderdose, um es im „La Paz“ einer näheren Betrachtung zu unterziehen.
Fern über dem großen Strom verlosch nach dem ungeheuren Brand des Sonnenunterganges das letzte Licht des Tages in kalter grüner Klarheit, es wurde Zeit für uns, an den Heimweg zu denken. Müde von den tausenderlei erregenden Eindrücken ihres ersten Tages in den Tropen, stolperte Ruth neben mir durch die duftschwere, vom Feuertanz der Leuchtkäfer erfüllte Dämmerung stiller, enger Gassen dahin. Dann bogen wir in eine protzig breite, asphaltierte Straße ein, aber die in wildwuchernden Gärten liegenden Villen zu beiden Seiten waren, wie ich in der rasch herabsinkenden Tropennacht noch gerade erkennen konnte, durchweg unbewohnt und in vollem Verfall. Die schweren schmiedeisernen Torgitter und die weißen Marmorsäulen der Veranden verschwanden fast unter Massen von Schlingpflanzen; meterhohe Gräser und Stauden überwucherten die pompösen Auffahrten und durch geborstene Mauern und niedergebrochene Dächer drängten sich junge schlanke Palmen empor.
„Hier kannst du dir eine nachträgliche Illustration zu meinem Vortrag von heute Mittag ansehen – die Paläste der Gummibarone! Nach der Pleite war ihnen also nicht einmal mehr so viel übriggeblieben, um die Unterhaltskosten aufzubringen, die hierzulande doch sicherlich nicht hoch sind“, dozierte ich. Doch meine Hörerin reagierte sauer, „Ja, ja“, stöhnte sie und presste die Hand vor den Magen. „Entschuldige, aber mir ist wieder ziemlich, – nein sogar verdammt bedenklich ist mir geworden. Weißt du ... probier doch mal, ob das Tor da aufzumachen geht. Ich glaube, ich ...“
In promptem Erfassen der Lage sprang ich hinüber und gegen einen Torflügel an. Er drehte sich kreischend nach innen, Ruth drückte mir noch schnell die Dose mit ihrem kostbaren Käfer in die Hand, schoss im Linksgalopp zum Tor hinein und verschwand im schwarzen Dschungel des Gartens.
Mir dämmerte allmählich, dass zwischen der „verdammten Bedenklichkeit“ ihrer Gefühle und ihrer Früchteschwelgerei von heute Mittag ein Zusammenhang bestehen könne; so nahm ich sie, als sie mit käsebleichem Gesicht wieder aus der Nacht auftauchte, sorglich unter den Arm, geleitete sie zum nächsten Taxistand und verstaute sie, im Hotel angekommen, unverzüglich unter dem nagelneuen Moskitonetz, das unser morgenländischer Wirt tatsächlich angeschafft hatte. Die erwähnten Zusammenhänge wurden mir dann endgültig klar, als weder Vetter Sepp noch das Ehepaar Bittner zum Nachtessen erschienen. Wie mich der schwarzlackierte Kellner bei meinem einsamen Mahl in einem höchst putzigen Englisch unterrichtete, wäre der junge Herr den ganzen Nachmittag nicht sichtbar gewesen, und Madame Bittner habe sich so schlecht gefühlt, dass man einen Arzt herbeigerufen hätte. Mister Bittner sei vorhin erst nach Hause gekommen, er habe ganz gelb ausgesehen, hätte, mit Verlaub zu sagen, allerdings auch stark nach Alkohol gerochen und sich ebenfalls sogleich niedergelegt. „Ich bin sehr besorgt, Sir, gesehen habend, dass Ihre Tochter auch nicht fühlen gut, wenn kommend heim vorhin. Die Ursache seiend zu viele Arten von Früchten essend auf einmal. Sie erlauben mir zu offerieren ein sehr gutes Medizin für Bauch und Gedärm, Sir?“ schloss die gute Seele und zog ihr schwarzes Gesicht in lauter fingerdicke Kummerfalten.
„Ja, gern. Bitte, bringen Sie die Medizin. Sie wird der Dame sicherlich gut tun. Auch wenn sie nicht meine Tochter, sondern meine Frau ist“, sagte ich lachend.
Sein Hinweis auf die alkoholische Atmosphäre Bittners jedoch ließ mich nachdenklich den Kopf wiegen. Es war immer wieder dasselbe: wenn unser Kurbelmann irgendeinen Ärger gehabt hatte, ging er unweigerlich hin und versuchte ihn mit etlichen Maß „Hellem“ von der Leber zu spülen. Oder, wenn es ein ganz schwerer Ärger gewesen war, auch mit gebrannten Wassern. Ich erinnerte mich noch gut des verblüfften Gesichts, mit dem Ruth nach seinem ersten Besuch in unserer Berliner Wohnung eine leere Flasche betrachtet hatte, die vorher voll Rum gewesen war. In seinem Kummer, dass wiederum ein ins Auge gefasster Geldgeber für unser Unternehmen abgesprungen war, hatte sie Bittner während der anderthalbstündigen Unterredung so nebenbei ausgepichelt. Dabei war mir zum ersten Mal die vertiefte Gelbfärbung seines Gesichtes aufgefallen, und nach einigen beiläufigen Fragen dann klar geworden, dass die Leber meines Partners nicht ganz intakt war. Es war eine Wahrnehmung, die mich mit einiger Besorgnis erfüllte, denn ich hatte in den Tropen schon manchen Mann, um den es schade war, mit unheimlicher Schnelligkeit zum Teufel gehen gesehen, nur weil er seiner kranken Leber ein paar Flaschen Whisky Zuviel zugemutet hatte.
Nachdem dann Vetter Sepp in Berlin aufgetaucht war – er war ein verkrachter Jus-Student, der einen neuen Beruf und eine gewinnbringende Anlage für einen geerbten Sack Geld suchte – und sich unerwarteterweise gleich für die Idee begeisterte, den Amazonenstrom zu verfilmen und dafür fünfzigtausend Mark aus besagtem Sack zur Verfügung zu stellen, wandte er sich natürlich um Auskunft über die Persönlichkeit Bittners an mich. Ich hatte ihm gesagt, was ich von dem Mann wusste, dass er, nach jenem für die „Filmag“ gedrehten Amazonas-Film zu schließen, ein hervorragender Operateur sein müsse, dem sein Spezialgebiet, der Naturfilm, wirklich am Herzen läge, dass er unermüdlich fleißig, tüchtig und gewandt, und im Übrigen das sei, was man einen guten Kerl nennt. Ich hatte es aber auch für recht und billig gehalten, den jungen Mann auf die möglichen Konsequenzen hinzuweisen, die sich drüben in den Tropen einmal jählings aus den alkoholischen Leberkuren des Kameramannes ergeben konnten.
„Er ist der Operateur und damit die Hauptperson bei einer Sache wie dieser. Ich selbst habe von Afrika her wohl eine Ahnung vom Filmen, aber eine Ahnung ist lange nicht genug, um unter so besonders schwierigen Verhältnissen wie im Amazonas-Urwald etwa einen Film allein weiterdrehen zu können. Sie wollen es erlernen, und Sie werden das Technische an der Sache auch sicherlich bald intus haben, damit aber noch keinerlei Erfahrungen, und die sind natürlich genau so wichtig. So würden wir beide einfach aufgeschmissen und Ihr Geld futsch sein, wenn unser Kurbelmann einmal ausfallen sollte. Überlegen Sie sich also auch diesen Punkt, ehe Sie unterschreiben“, hatte ich ihm bedeutet.
Er hatte es sich überlegt und nach Rücksprache mit verschiedenen bayrischen Onkeln und Tanten, die alle gleicherweise gewiegte Geschäftsleute waren, zuletzt die Bedingung gestellt, dass Bittners Leben, und zu meiner Überraschung auch das meiner minderwichtigen Person, bei Lloyds in London mit je zweieinhalbtausend Pfund, also fünfzigtausend Mark, zugunsten von Herrn Joseph Jungblut versichert wurde. Die Prämie ging natürlich auf seine Kosten. So war sein Kapital auch in dem Fall gerettet, dass unserem Operateur vor Vollendung des Filmes etwas Menschliches zustieß, und sollte auch mir ein bejammernswert frühes Ende dabei beschieden sein, so hätte sich der investierte Mammon durch Gottes Fügung sogar verdoppelt!
Bis anhin war es für unsern Kurbelmann schon häufig nötig geworden, seine Leber zu spülen, sein Teint war in letzter Zeit bedenklich gelber geworden, und zu meinem Schrecken hatte er in Rio auch einmal etwas von sonderbaren Schmerzen unter den Rippen der rechten Seite gemurmelt.
Das war es, worüber ich bei meinem einsamen Mahl den Kopf wiegte und abschließend den unbehaglichen Entschluss fassen musste, mit dem Mann einmal unter vier Augen zu reden. – Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen, muss ich hinzufügen, dass mich keineswegs pure Menschlichkeit dazu veranlasste, sondern ganz überwiegend der Gedanke, was aus Ruth und mir hier am Ende der zugänglichen Welt werden sollte, wenn unser Unternehmen scheiterte. Denn Vetternschaft hin und Vetternschaft her – Sepp Jungblut sah mir nicht danach aus, als ob er in diesem Fall aus freien Stücken auch nur eine Zwischendeckspassage für uns beide nach Europa zurück bezahlen würde. Wir hatten nämlich vergessen, auch für diese Eventualität durch einen entsprechenden Paragrafen im Vertrag vorzusorgen!
* * *
3
3
Am nächsten Morgen waren unter den Teilhabern der „Jungfilm G. m. b. H.“, wie unser Firmenname lautete, die Rollen insofern vertauscht, als der am wenigsten Gesunde von uns dreien, nämlich ich selbst, sich eines Wohlbefindens erfreute, das auf die anderen geradezu aufreizend wirkte. Am schlimmsten war Sepp daran, er sah aus wie eine Wasserleiche und seine sonst so wohlgepflegte schwarze Skalp-Locke hing ihm tief in die gefurchte Stirn hinein. Er stöhnte in einem fort vor sich hin wie eine kranke Kuh, bis ihn Bittner, dessen Teint heute ins Grünliche spielte, schließlich gereizt anfuhr: „Entweder hören Sie jetzt mit Ihrem Gewimmer auf oder gehen Sie in Gottes Namen wieder hinauf ins Nest und leisten Sie meiner Frau Gesellschaft! Können Sie sich nicht ein bisschen zusammenreißen? Mir ist auch kotzübel, und Frau Heye anscheinend auch, und trotzdem jammern wir uns nicht gegenseitig die Ohren voll! – also, wie gesagt, das Nächste ist...!“ Sepp war dunkel angelaufen; mit einem: „Ich verbitte mir...!“ fuhr er auf, doch da fiel sein Blick auf Ruth, die in ihre vorgehaltene Serviette hineinkicherte, und auf einmal begriff auch er, warum, und brach in sein gewohntes versöhnend-frisches Jungenlachen aus.
„Ich verstehe nicht, was es hier zu feixen gibt“, knurrte ihn Bittner erbost an, und erst, als er sah, dass auch ich still in mich hineinschmunzelte, wurde ihm allmählich die Missdeutbarkeit seiner Äußerung mit dem „Gesellschaftleisten“ klar. Eine Sekunde lang wusste er nicht, ob er sich wieder einmal ärgern oder aber mitlachen sollte, und als er sich schließlich für das Lachen entschied, war der kritische Punkt dieses Tagesanfangs überwunden, und wir vier gingen danach einträchtig an unsere erste Aufgabe heran. Sie bestand in der Suche nach einem Haus.





























