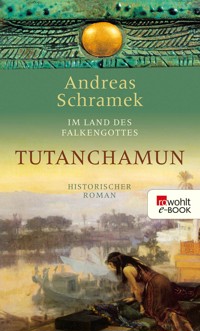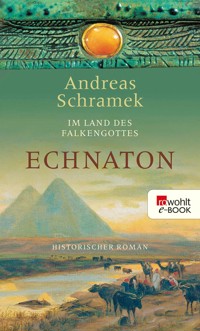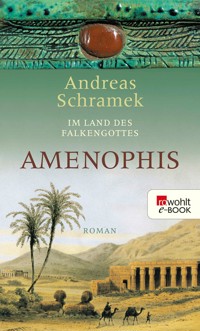
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Im Land des Falkengottes
- Sprache: Deutsch
Pharao – Sohn der Sonne Uralt ist der Pharao Eje und fast blind, als er seine künftige Grabstätte im Tal der Könige aufsucht. Seinen Höflingen vertraut er nicht, darum lässt Eje sich auf dem Gang zu seinem letzten Ruheplatz nur von einem Jungen aus der nahe gelegenen Arbeitersiedlung begleiten. Dem staunenden Jüngling erzählt er sein wunderbares und abenteuerliches Leben als Weggefährte dreier Herrscher – ein Leben, das er als Jugendfreund des Prinzen Amenophis begann und das ihn am Ende selbst auf den ägyptischen Thron führen sollte. Der Beginn einer großen historischen Trilogie über das Land am Nil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andreas Schramek
Im Land des Falkengottes. Amenophis
Historischer Roman
Für meine Eltern und für Rosy und Rolf
Ein Hauch des Lebens ist der Südwind,
und was er mir gewährt hat ist,
dass ich lebe durch ihn.
Seit zwei Stunden schaukelte die Sänfte im unveränderten Gleichschritt der zwölf nubischen Träger. Die Hände des alten Mannes, der in ihr saß, ruhten auf den Rändern ihrer Seitenwände. Doch das Schaukeln war so gleichmäßig, dass er nicht viel Kraft aufwenden musste, um sich festzuhalten, was es ihm erlaubte, ohne dass er sich etwas dabei dachte, mit den Nägeln seiner beiden Zeigefinger über den Goldbelag zu kratzen. Vielmehr gab sein Körper unaufhörlich den Bewegungen der Sänfte nach, so, wie es ein Reiter auf dem Rücken seines Pferdes tut, das er im Schritt gehen lässt.
Es war still, denn niemand wagte zu sprechen. Nicht der Hauptmann der Leibgarde, der den Zug anführte, nicht die vierundzwanzig Soldaten, die den Zug begleiteten, und auch nicht die Wedelträger zur Rechten und zur Linken der Sänfte, die Mühe damit hatten, die Fächer mit Straußenfedern so zu halten, dass dem Antlitz des alten Mannes stets Schatten gespendet wurde. So hörte man nur das Knirschen des Sandes unter den Füßen der Träger und Soldaten, und hin und wieder vereinzelte Schreie zweier Jungfalken, die hoch über der Sänfte kreisten.
Die Augen des Mannes waren schwach geworden, er konnte gerade noch die beiden nubischen Träger vor sich erkennen. Sein Gehör aber hatte ihn nicht im Stich gelassen. Selbst als Zweiundsiebzigjähriger hörte er jedes noch so leise Geräusch, wie er in seinen jungen Jahren die Gabe besessen hatte, selbst im Getümmel eines Markttreibens ein Gespräch zwischen zwei Personen zu verfolgen, auch wenn er acht Ellen davon entfernt stand. An viele Ereignisse in seinem langen Leben konnte er sich nur noch schwach erinnern. Manch unbedeutende Dinge standen ihm jedoch so klar vor Augen, als hätte er sie erst gestern erlebt. Vieles hatte er ganz aus seinem Gedächtnis verdrängt. Er fragte sich jetzt, ob dies der Fluch des Alters war oder eine Gnade, dass man sich im Laufe der späten Jahre nicht mehr mit Dingen beschäftigen oder sogar abquälen musste, die man für sich selbst offenbar längst als belanglos abgetan hatte.
Aber war das überhaupt von Bedeutung für ihn, Eje, der seit drei Jahren Herrscher von Ober- und Unterägypten war, den Sohn des Re, den man den Guten Gott nannte?
Die Einsamkeit auf dem Thron der Beiden Länder quälte ihn. Es gab niemanden, dem er den Titel «Einziger Freund Seiner Majestät» verleihen wollte. Seine Weggefährten von einst ruhten in ihren Wohnungen der Ewigkeit jenseits des Berges, der vor der Sänfte emporragte.
Wo waren sie, seine Freunde? Wo waren sie, die Begleiter seines langen und mühseligen Lebensweges? Er, Nimuria, die strahlende Majestät, der Herrscher über das mächtigste Land der Erde, und seine Große königliche Gemahlin Teje? Wo waren Echnaton und Nofretete, Ejes Tochter, die Kinder des wahren Lichts? Und wo war sein Vorgänger, sein geliebter Tutanchamun, den sie die wieder erstandene Hoffnung Ägyptens genannt hatten?
Ja, wo waren die Helden, die ihn begleitet hatten im nie endenden Kampf um das Licht der Wahrheit?
Er allein war zurückgeblieben. Er ganz allein.
Nur einer war noch da, General Haremhab, sein erbittertster Gegner. Eje hatte verhindert, dass er an seiner Stelle Pharao wurde. Haremhab hasste Eje, weil er durch dessen Thronbesteigung an seiner Rache gehindert worden war. An seiner Rache an Echnaton, den er den Ketzer nannte, und an Tutanchamun.
Am Eingang zum Tal hielt die Sänfte an. Hier lösten die Wächter des Totentales die Soldaten der Leibgarde wortlos ab, und sogleich setzte sich der Zug erneut in Bewegung. Auch wenn er kaum etwas sah, so kannte Pharao den Weg zu seiner Grabstätte genau.
Es mochte eine halbe Stunde vergangen sein, da hörte er ein Geräusch, das nicht von den Trägern oder den Wachen verursacht wurde, sondern von etwas abseits kam. Fast unmerklich hob er die rechte Hand und sagte: «Wer ist da?»
«Ein Junge aus der Arbeitersiedlung, Majestät», gab der Vorsteher der Wächter derart hastig zur Antwort, sodass seine Absicht, Pharao zu beruhigen, allzu offenkundig wurde.
«Er soll zu mir kommen», sagte der alte Mann mit leiser Stimme, und zur Unterstützung seines Befehles winkte er mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand nach dem Knaben, der sechzehn Jahre alt sein mochte. In wenigen Sätzen erreichte der Junge die Sänfte, warf sich zu Boden und presste die Stirn in den Staub.
«Weißt du, wer ich bin?», fragte Pharao und beugte sich etwas nach rechts, um den Jungen sehen zu können.
«Ja, Majestät. Ihr seid der Gute Gott, Eje Cheper-chepru-Re. Ihr lebet, seid heil und gesund», antwortete der Junge so schnell, dass er sich beinahe beim Thronnamen Pharaos verhaspelt hätte.
«Du hast mich also angesehen», stellte Pharao fest.
«Nein, Majestät, das ist doch ohne Eure ausdrückliche Erlaubnis verboten.»
Der alte Mann lächelte milde und sagte: «Woher weißt du dann, wer ich bin?»
Der Junge bekam Angst und wusste nicht, was er sagen sollte, ohne sich noch tiefer ins Verderben zu stürzen, und schwieg.
«Steh auf», befahl Eje und beugte sich noch weiter über den Rand der Sänfte.
«Sieh mich an!»
Nur langsam hob der Junge den Kopf. Eje sah, wie seine Nasenflügel bebten, wie er aus Furcht die Lippen zusammenpresste und der Knabe ihm dennoch gerade in die trüben Augen sah.
«Wie heißt du?»
«Nacht-Min, Majestät», gab der Junge jetzt mit ruhiger Stimme zur Antwort, spürte er doch, dass Pharao keinen Groll gegen ihn hegte.
«Hast du im Grab gearbeitet?»
«Nein, Majestät. Ich brachte meinem Vater gerade Farben hierher, die er in der Siedlung vergessen hatte.»
«Dann begleite mich», befahl Eje knapp. Ein Wink seiner Hand genügte, und der Zug setzte sich wieder in Bewegung. Vor einer schroffen Felswand, an deren Fuß sich ein unscheinbarer höhlenartiger Eingang befand, hielt er an.
«Gib mir deine Hand», befahl Pharao, doch seine freundliche Stimme verwandelte den Befehl in eine höfliche Bitte. Nacht-Min hob seinen rechten Arm und spürte sogleich die knöcherne Hand des alten Mannes, die trotz der Hitze, die schon früh am Morgen herrschte, kalt war.
«Alle sollen das Grab verlassen», sagte Pharao jetzt mit klarer und fester Stimme, und sein Befehl wurde sofort in das Innere des Berges weitergegeben. Es dauerte nur wenige Augenblicke, und zwölf Arbeiter traten ins Tageslicht.
«Nimm dir eine Fackel und führe mich jetzt hinein, Nacht-Min. Ihr anderen wartet hier!»
Die Wächter sahen erstaunt in die Runde und hoben fragend die Schultern an. Doch niemand wagte zu widersprechen.
Nach wenigen Schritten hatte die Dunkelheit des Berges die beiden verschlungen.
«Jetzt kommen sechs Stufen, Majestät», sagte der Junge aufgeregt, denn es überkam ihn eine große Angst, dass dem Guten Gott etwas zustoßen könnte.
«Dass es sechs sind, ist mir bekannt. Schließlich habe ich die Pläne zu diesem Grab mit eigener Hand gefertigt. Sag mir nur, wenn wir die nächste Treppe erreichen!»
Nach einer kurzen Weile fuhr Eje fort: «Was siehst du an den Wänden, Nacht-Min?»
«Nur weiße Farbe, Majestät. Die Wände dieses Gangs sind unbemalt.»
Pharao nickte zustimmend. Sie erreichten die zweite Treppe und den zweiten Gang.
«Und hier?», fragte Eje knapp.
«Nur weiße Wände, Majestät.»
Eje nickte wieder.
«Vor uns liegen jetzt zwei Holzbohlen, die über den Schacht führen, Majestät.»
Pharao setzte vorsichtig erst seinen rechten Fuß auf das rechte der Bretter und stellte dann den zweiten daneben.
«Schacht», sagte Eje, und der spöttische Unterton seiner Bemerkung war nicht zu überhören. «Als ob ich nicht wüsste, dass das, was du einen Schacht nennst, nicht einmal eine Elle tief ist. Aber du hast Recht, Junge. Es soll ein Schacht sein.»
Als würde er tatsächlich einen Schacht von zehn Ellen Tiefe überqueren, tastete sich Eje in winzigen Schritten vorsichtig, ja ängstlich über die Holzbohlen, als wollte er so dem Beistand des Jungen, an dessen Arm er sich noch immer festhielt, seine Rechtfertigung geben.
So gelangten beide in die Grabkammer.
«Die Paviane», sagte Eje unvermittelt und wiederholte: «Die Paviane zuerst!»
Nacht-Min genügte ein kurzer Blick, um auf der Stirnwand der Kammer die Abbildungen von zwölf hockenden Pavianen zu erkennen.
«Hier, Majestät», antwortete der Junge, und nach wenigen Schritten standen sie vor der Wand. Eje trat noch näher an die Bilder heran und flüsterte: «Die Fackel, Nacht-Min! Die Fackel!»
So nah wie es nur irgend ging hielt Nacht-Min die Fackel vor einen der Paviane und neben Ejes Gesicht.
Jetzt, da Pharao sich darauf konzentrierte, etwas von der Pracht seines künftigen Grabes zu erkennen, erst jetzt konnte der Junge zum ersten Mal unbemerkt das Antlitz des Guten Gottes betrachten. Der Hals Pharaos war dünn und faltig. Aber er war nicht gekrümmt, so wenig, wie Eje auch sonst nicht gebückt oder gekrümmt war. Wie der ganze Schädel war das Gesicht hager, ja ausgezehrt. Die Lippen waren schmal und farblos, und wenn Eje lachte, gaben sie den Blick frei auf eine erstaunlich große Zahl von leidlich gesunden Zähnen. Aus dem Gesicht ragte eine kräftige, fleischige Nase hervor, die früher, als der Pharao noch fülliger gewesen sein mochte, vielleicht nicht so sehr aufgefallen war. Die Augen waren klein, und sie verschwanden beinahe völlig in dem schwarzgrünen Band der Schminke, das sie umgab und das bis an die Schläfen reichte. Über dunklen, säuberlich gestutzten und dadurch jugendlich wirkenden Augenbrauen wölbte sich eine von unzähligen Falten durchfurchte Stirn, die bald unter dem Goldreif, der das Kopftuch Pharaos hielt, verschwand. Am vorderen Rand dieses Diadems ragten aus reinem Gold die Beschützer Pharaos empor, Uto und Nechbet, Kobra und Geier.
Langsam wie eine Schildkröte drehte Eje seinen Kopf zu Nacht-Min. Er wollte den Jungen fragen, ob die Paviane gut und nach der Natur getroffen waren. Aber jetzt, wo sich ihre Blicke im Schein der Fackel begegneten und Eje ahnte, dass ihn der Junge genau gemustert hatte, sagte er:
«Du hast gesehen, wie alt ich bin. Nun wirst du Verständnis dafür haben, wenn ich mich in meinem Grab ein wenig umsehe.»
Nacht-Min sah verlegen zu Boden.
Ohne Eile und mit einer Sorgfalt, die den Jungen ungeduldig werden ließ – wussten doch die Wächter nicht, was in dem Grab vor sich ging–, ließ sich Pharao Bild für Bild der Grabkammer beschreiben. Den langen Spruch des Totenbuchs, der die südliche Wand zierte, musste der Junge vorlesen.
«Ist die Fackel bald abgebrannt?», fragte Eje leise.
«Ja, Majestät. Bald.»
«Dann lass uns gehen.»
Kurz bevor die beiden die letzte Treppe vor dem Ausgang erreicht hatten, nahm Nacht-Min allen Mut zusammen, um Pharao die Frage zu stellen, die ihn während all der Zeit im Grab gequält hatte. «Darf ich Euch etwas fragen, Majestät?»
«Ja», brummte der alte Mann vor sich hin, denn er befürchtete, dass ihn der Junge, wie alle Untertanen seines Landes, um eine Gunst bitten würde.
«Warum habt Ihr ausgerechnet mir befohlen, Euch in das Grab zu führen, und nicht dem Vorsteher der Arbeiten, der mit allem viel besser vertraut ist?»
«Er hätte mir alles Mögliche erzählen können, Nacht-Min. Und ich hätte ihm einfach glauben müssen. Er kennt meine Pläne und meine Anweisungen, und er hätte somit genau gewusst, was ich hören wollte. Du kanntest das Grab nicht und konntest mir deshalb nur sagen, was du wirklich sahst. Und da es mit dem übereinstimmte, was ich angeordnet hatte, bin ich zufrieden.»
Als sie zurück ins Tageslicht traten, herrschte unter den Wächtern große Erleichterung, denn in der Tat hatten sie schon beraten, ob einer von ihnen in das Grab gehen und nach dem Herrscher sehen sollte.
«Ich will dich auch etwas fragen», sagte Eje zu dem Jungen, als er in seiner Sänfte saß und die Hände wieder auf dem Rand der Seitenwände ruhten. Er wollte dem Jungen und seiner Familie wirklich eine Gunst erweisen.
«Wie heißen deine Eltern?»
«Mein Vater heißt Meriamun und meine Mutter Inena, Majestät.»
«Inena», wiederholte Eje leise, schloss die Augen und senkte nachdenklich den Kopf. Er schwieg lange, und viele Bilder aus seiner Jugend stiegen empor, Bilder, die längst vergessen waren. Gewiss, vieles war sehr ungenau und kaum wiederzuerkennen oder einzuordnen.
Eje tat jetzt etwas, das keiner der Anwesenden verstand. Mit dem fröhlichsten Gesichtsausdruck seit langem befahl er dem Jungen, ihn für einige Tage in den Palast zu begleiten. Er schickte einen Offizier in die Arbeitersiedlung, um Nacht-Mins Eltern zu verständigen, und gab Befehl zum Abmarsch.
Der Junge war aufgeregt und verwirrt, glücklich und verzweifelt zugleich, hatte er doch keine Vorstellung davon, was Pharao von ihm erwartete.
Eje aber wollte nur, dass ihm ein aufmerksamer und unvoreingenommener Mensch zuhörte.
Mehr nicht.
Ja, unvoreingenommen musste er sein, sonst hätte es keinen Sinn gehabt, dass ihm der alte Mann alles, was er von seinem Leben noch wusste, erzählte.
EINS
Gott schuf die Menschen mit den Tränen seines Auges.
Mein Vater Juja war eine stattliche Erscheinung, groß gewachsen, er hatte breite Schultern und große, kräftige Hände. Aus seinem Gesicht ragte eine lange Nase, die krumm war wie der Schnabel eines Adlers. Seine Backenknochen standen weit hervor, sein Mund mit den wulstigen Lippen war breit und zeigte stets ein freundliches Lächeln. Sein dichtes, kräftiges Haar fiel in hellbraunen Locken herab, sodass er nur zu offiziellen Anlässen oder zu Festlichkeiten eine Perücke trug.
Seine Kleidung war immer auf das Peinlichste gepflegt, wenn sie auch einfach und unaufdringlich war. Auf den ersten Blick mochte man ihn eher für einen Bauern halten als für einen ägyptischen Fürsten. Vater war ein von Grund auf ehrlicher Mensch, doch ungefragt meldete er sich selten zu Wort. Meist behielt er seine Gedanken für sich.
Ich glaube, das nennt man weise.
Meine Mutter Tuja war anders.
In jungen Jahren war sie eine sehr schöne Frau von gleichmäßiger, schlanker Gestalt mit fast schwarzen Augen, immer kunstvoll geschminkt, gekleidet mit den teuersten Gewändern und stets angetan mit der neuesten Perücke. Auch sie war eine sehr umsichtige Frau. Aber anders als mein Vater achtete sie darauf, dass unsere Familie stets den Platz einnahm, der ihr gebührte.
Der Fleiß, die Korrektheit und die Ehrlichkeit meines Vaters einerseits und das einnehmende Wesen und der Ehrgeiz meiner Mutter andererseits waren schließlich der Grund dafür, dass mein Vater zusehends wichtigere Ämter besetzte und dem königlichen Thron näher rückte. Aus der Sicht meiner Mutter war das nicht sehr schwierig, zumal ihre Schwester Mutemwia eine Gemahlin von Prinz Thutmosis war. So zogen meine Eltern nach ihrer Heirat von Achmim, wo mein Vater Oberster Priester des Min und Bürgermeister gewesen war, nach Men-nefer.
Dies war im vierundzwanzigsten Jahr der Regierung des Guten Gottes Amenophis Aa-chepru-Re, dem Jahr, in welchem meine Schwester Teje geboren wurde. Im gleichen Jahr gebar auch Mutemwia, die Schwester meiner Mutter, ihren ersten Sohn, der wie sein königlicher Großvater Amenophis hieß.
Meine Eltern bewohnten zu dieser Zeit bereits einen Palast in Men-nefer, denn mein Vater war Vorsteher der Ställe Seiner Majestät. Bald darauf wurde er zum Hauslehrer des Prinzen Amenophis ernannt.
Sein täglicher Weg in das Große Haus, den königlichen Palast, war nicht weit. Als Vater dieses Amt antrat, war ich drei Jahre alt, und jeden Tag bewunderte ich ihn und staunte, wenn er morgens erschien und sein bescheidenes Mahl einnahm, danach die ihm gebührenden Insignien anlegte, seine Sänfte bestieg und zum Palast des Guten Gottes getragen wurde. Natürlich befragte ich meinen Vater auf das Genaueste über alles, was er im Großen Haus erlebte und sah. Ich bekam zwar nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber dank meines ausgeprägt guten Gehörs erlauschte ich mir so manches aus den Gesprächen meiner Eltern, sodass ich über erstaunliche Erkenntnisse verfügte. Von meinem Vater wusste ich, dass der Gute Gott wegen seines vorgerückten Alters zum Gehen bereits einen Stock benutzte, dass der Sandalenträger zur Rechten des Königs fast vier Ellen groß und das Lieblingstier des Prinzen Amenophis eine schwarze Katze aus Bubastis war. Meinem guten Gehör verdankte ich außerdem die Kenntnis, dass der Gute Gott zwischenzeitlich sehr krank war, bald sterben musste und so Osiris werden würde. Man hatte schon damit begonnen, im Tal westlich von Waset, dort wo die Herrscher unseres Landes ihre letzte Ruhestätte finden, für die Beisetzung letzte Vorkehrungen zu treffen.
Wir alle wussten um das baldige Ende Pharaos, doch als Amenophis Aa-chepru-Re, der mächtige Feldherr und Krieger, tot war, ging ein schreckliches Wehklagen durch das ganze Land. Die Frauen stimmten ihre traurigen Gesänge an, die Männer blieben fortan unrasiert, und überall herrschte ein aufgeregtes Treiben. Das alles änderte sich erst nach der Bestattung des Guten Gottes, der nun Osiris geworden war, und der Thronbesteigung des neuen Horus: Prinz Thutmosis gab sich den Thronnamen Men-chepru-Re.
Schon wenige Wochen später erhielt Vater von Pharao Thutmosis die Erlaubnis, meine Schwester Teje mit in den Palast zu bringen, damit sie dort gemeinsam mit Prinz Amenophis und anderen Kindern hoher Herkunft unterrichtet wurde. Dies war freilich kein Zufall, sondern beruhte darauf, dass meine Familie jetzt dem Königsthron sehr nahe stand. Denn obwohl kaum damit zu rechnen gewesen war, wurde Thutmosis als der drittgeborene Sohn des verstorbenen Pharaos Herrscher über unser Land, und die Schwester meiner Mutter, Mutemwia, war ja eine seiner Gemahlinnen.
Teje war ab diesem Zeitpunkt kaum mehr zu ertragen. Als wäre sie selbst eine Prinzessin, bestieg sie jeden Morgen gemeinsam mit meinem Vater die Sänfte, um sich zum Unterricht tragen zu lassen. Während mein Vater immer nochmals zu mir zurückblickte und mir zulächelte, ließ der Stolz meiner Schwester eine derartige Gefühlsregung nicht zu. Ich glaube, damals gewöhnte sie sich den strengen, ernsten Blick an, den sie ein Leben lang beibehielt. Sie legte auch immer großen Wert darauf, mit dieser Miene abgebildet zu werden. Sie nannte das «würdevoll».
Meine Schwester nahm den Unterricht im Palast sehr ernst, aber von ihr war nicht viel zu erfahren. Da es mir als kleinem Jungen erlaubt war, mich in den Frauengemächern aufzuhalten, war dies die einzige Möglichkeit, um meine Schwester zu belauschen. Meiner Mutter und unserer Amme erzählte sie fast alles: wie freundlich Prinz Amenophis zu ihr sei, wie kräftig er sei, und dass er am schnellsten und schönsten schreiben könne. Teje stellte meiner Mutter natürlich auch viele Fragen, da sie manches, was sie im Palast sah, nicht richtig deuten oder einschätzen konnte. Ihr größtes Problem war die Kleidung der königlichen Gemahlinnen, der Prinzessinnen und der übrigen Hofdamen: Warum trug Tante Mutemwia nur ein Diadem mit zwei Gazellenköpfen, Königin Iaret aber die hohe Doppelfederkrone und die Uräusschlange? Welche Hofdame durfte wann rechts, links oder hinter der Königin gehen – und warum? Und welche Prinzessin welcher Nebenfrau des Großen Gottes war die bedeutendste?
Wenn dies nicht unbedingt Fragen waren, die einen Jungen meines Alters interessierten, blieb mir doch nichts anderes übrig, als mir alles anzuhören, um auch die Dinge zu erheischen, die mir elementar erschienen. So erfuhr ich immerhin, dass Prinz Amenophis als jetzt Zwölfjähriger nicht weniger als sechs schwarze und vier weiße Pferde sein Eigen nannte, dass er bereits einen eigenen Jagdwagen besaß und von diesem aus in der Wüste schon drei Strauße erlegt hatte! Meine Jagderlebnisse beschränkten sich bislang auf den Fang einiger Salamander in unserem Garten.
Ich war mir sicher, dass zwischen dem Delta und dem zweiten Katarakt kein Ägypter lebte, der über die königliche Familie so gut Bescheid wusste wie ich.
Leider gab es Monate, da passierte gar nichts: Mein Vater und meine Schwester blieben zu Hause, da sich der Hof mit allen Prinzen und Prinzessinnen in Merwer, am Rande der Oase Fajum, aufhielt. Dort, im Norden der Stadt, befand sich ein Palast mit Säulenhallen, Vorratsräumen und prächtigen Gärten.
Hier wurden die Kinder des Guten Gottes von Sobekhotep, der aus der Oase stammte und Bürgermeister des südlichen Sees und des Sees von Sobek war, unterrichtet. Während der Abwesenheit des Guten Gottes verwaltete Sobekhotep den königlichen Landsitz.
Endlich, nachdem ich das zwölfte Lebensjahr erreicht hatte und Teje dreizehn Jahre alt geworden war, erhielt ich die entscheidende Mitteilung, auf die ich so lange gewartet hatte. Ich spielte gerade in unserem Garten, als mich meine Amme ins Haus rief. Ohne nähere Erläuterung wurden mir die Haare geschnitten, meine Seitenlocke wurde auf das Sorgfältigste geflochten und geölt. Danach musste ich ein ausgedehntes Bad nehmen, und die Nägel der Hände und Füße wurden mir gekürzt. Zuletzt legte man mir einen neuen Schurz an. Schließlich stand ich vor meinem Vater. Er hielt sich in seinem Arbeitszimmer auf und diktierte seinem Schreiber Dinge, von denen ich nichts verstand. Während ich noch regungslos, nach frischem Salböl duftend, in der Türe stand, ging mein Vater langsam sprechend im Zimmer auf und ab. Immer im selben Moment, in welchem mein Vater kehrtmachte, tauchte der Schreiber die Binse in die Farbe, um danach mit einer neuen Zeile zu beginnen, als mein Vater gerade wieder loslief. Ich fand dies auf das Höchste erheiternd und kicherte leise vor mich hin. Nie und nimmer hätte ich geglaubt, dass mein Vater davon Notiz nehmen würde, doch plötzlich blieb er auf der Hälfte seines Weges vor mir stehen, drehte sich zu mir um und sagte: «Damit ist morgen Schluss, mein Sohn!»–, machte wieder eine halbe Drehung und ging diktierend weiter. Es dauerte noch eine ganze Weile, ehe er den Schreiber mit weiteren knappen Anweisungen entließ.
Nun wandte er sich endlich mir zu.
«Gut», gab er murmelnd von sich, während er mich von oben bis unten musterte wie einen Rekruten.
«So sieht ein ägyptischer Junge aus, der ab morgen zum Unterricht mit in das Große Haus kommen darf! So gefällst du mir!»
Der Satz war kaum ausgesprochen, da rannen mir Freudentränen über die Wangen. Es gab kein Halten mehr: Ich lief ihm entgegen, sprang in die Höhe und wurde von ihm so fest umarmt wie noch nie.
Endlich im Palast! Endlich nicht mehr auf die spärlichen Auskünfte Tejes, auf heimliches Lauschen angewiesen sein!
Ich wurde von meinem Vater noch eine ganze Weile eingehend ermahnt und belehrt, wie ich mich zu benehmen hätte. Begegnete ich dem Prinzen Amenophis, so hätte ich mich tief zu verneigen und in dieser Stellung so lange auszuharren, bis er mir gestattete, mich wieder zu erheben. Vor den übrigen Prinzen und der Prinzessin müsste ich mich ebenfalls tief verneigen, dürfte mich aber nach angemessener Zeit von allein aufrichten. Andere Mitschüler gleichen Ranges müsste ich freundlich grüßen. Sollte allerdings – was mein Vater jedoch selbst gleich wieder ausschloss – sollte aber der Gute Gott selbst erscheinen, müsste ich mich sofort zu Boden werfen, und ich dürfte es nicht wagen, ihm ins Angesicht zu sehen, selbst wenn er sich herablassen würde, mich direkt anzusprechen. Was natürlich ohnehin niemals geschehen würde.
In dieser Nacht schlief ich nur wenig und war am nächsten Morgen der Erste, der angekleidet und abmarschbereit in der Vorhalle unseres Hauses stand.
Meine Schwester Teje zeigte natürlich kein Verständnis für meine Aufgeregtheit und gab sich derart herablassend, dass es den Anschein hatte, als würde sie in der Sänfte jeden Augenblick einschlafen.
Je näher wir dem Großen Haus kamen, um so lebendiger wurde es auf den Straßen. Ich sah hohe ägyptische Beamte und Würdenträger und seltsame Erscheinungen ausländischer Herkunft mit schwarzen, bis auf die Brust reichenden Bärten, zotteligen Haaren und langen dunklen Gewändern. Große Karren mit Getreide, Melonen, Gemüse oder Weinkrügen fuhren zum Palast. Sänften mit zum Teil geschlossenen Vorhängen wurden in alle Richtungen getragen.
Den Palast umgab eine etwa zwanzig Ellen hohe weiße Mauer ohne jede Öffnung. An einer mächtigen Toreinfahrt standen Soldaten der Leibwache des Guten Gottes und befragten diejenigen, die sie nicht von Angesicht her kannten.
Mein Vater wurde militärisch gegrüßt, indem die Soldaten ihren Speer nahe an den Körper heranzogen. Wir konnten ohne weitere Kontrolle das Tor passieren.
Vor uns lag ein gepflasterter Hof, auf dem das Treiben weiterging. Verschiedene Gruppen von Soldaten zu sechs oder acht Mann marschierten in die eine oder andere Richtung, ebenso verteilten sich die Karren dahin und dorthin, bis sie in einem der Gebäude verschwanden. Unser Weg führte nach rechts durch einen Säulengang, welcher nach hundert Ellen in einem geschlossenen Garten mündete.
Hier war es plötzlich viel ruhiger. Es gab Teiche, die mit prächtigen Lotosblüten übersät waren, große Beete, mit Blumen und Sträuchern geradezu überladen, Sykomoren, so hoch wie die Palastmauern, und Palmen, die diese sogar noch überragten.
Auf den peinlich gepflegten Kieswegen stolzierten Flamingos und Kraniche, und da und dort kroch eine Schildkröte. Die Gebäude um diesen Garten herum hatten nur kleine Fensteröffnungen. Aus einigen erklang leises, gleichmäßiges Harfenspiel, aus manchem Fenster die Stimme einer Sängerin oder das Schimpfen einer verärgerten Hofdame.
Schließlich waren wir am Ende des Gartens angelangt. Während wir ausstiegen, hörte ich ein Gewirr von Kinderstimmen. Unzweifelhaft waren wir am Ziel. Der Unterrichtsraum war angenehm groß, vielleicht vierzig Ellen lang und zwanzig Ellen breit. Auf dem Marmorfußboden lagen gleichmäßig verteilt Sitzkissen, und davor standen niedrige Holztische mit Schreibwerkzeug darauf: Eine Schale mit zwei kleinen Vertiefungen, in welchen sich schwarze und rote Farbe befand, und mit einer länglichen Einkerbung für die Schreibbinsen; daneben lagen zwei unbeschriebene Papyrusblätter.
Als mein Vater, gefolgt von Teje und mir, den Raum betrat, wurde es still. Die zwölf anwesenden Kinder und Teje setzten sich, wobei sie vier Kissen ganz vorne und eines ganz hinten frei ließen. Mit nur wenigen Worten teilte mein Vater den Anwesenden mit, dass ich Eje hieß und ab heute ebenfalls Unterricht erhielt. Sodann befahl er mir, auf dem Kissen in der letzten Reihe Platz zu nehmen.
Plötzlich war es völlig still, und ich hörte leise Schritte, die näher kamen. Zuerst betrat ein etwa dreizehnjähriger Junge den Raum, mit Prinzenlocke, goldenem Halskragen, Sandalen und einer goldenen Schärpe über dem Schurz. Als er eintrat, verneigten sich mein Vater und alle Kinder, bis eine selbstbewusste Knabenstimme uns gebot, uns wieder zu erheben. Für mich gab es nicht den geringsten Zweifel, dass das Prinz Amenophis war. Ihm folgten Prinz Amenemhet und Saatum, ein Vetter der Prinzen, und schließlich die Prinzessin Amenipet.
Alle Anwesenden – außer Prinz Amenophis – verneigten sich erneut, richteten sich aber nach kurzer Zeit selbst wieder auf.
Der erste Unterrichtstag verlief im Wesentlichen ohne meine geistige Teilnahme, da ich ausschließlich damit beschäftigt war, mein Umfeld zu mustern, und das hieß an diesem Tag nur Prinz Amenophis. Er war nur wenig größer als ich, aber man sah gleich, dass er viel kräftiger war. Sein schwarzes Haar war kurz geschnitten, und neben einer eher unauffälligen Nase saßen dunkelbraune, mandelförmige Augen. Er bewegte sich nie ruckartig, sondern eher langsam und gesetzt, was seinem Auftreten eine natürliche Würde verlieh.
Im Laufe der ersten Wochen erlernte ich die Grundbegriffe des Rechnens, die ersten einfachen Buchstaben unserer Schrift und wurde ein wenig mit der Verwaltung unseres Landes vertraut gemacht. Mein Vater hatte eine schwierige Aufgabe zu bewältigen, da ich der einzige Anfänger war und die anderen Schüler schon einige Jahre am Unterricht teilgenommen hatten. Aber irgendwie nahm er sich immer wieder die Zeit, um sich mit mir allein zu beschäftigen. Außerdem hatte ich ja reichlich Gelegenheit, unseren Lehrer außerhalb des Unterrichtes zu konsultieren, was meist ein zweischneidiger Vorteil war, denn Vater setzte alles daran, dass ich die anderen bald eingeholt hatte. So schrumpfte meine freie Zeit mehr und mehr zusammen.
Die Prinzessin und die Prinzen schienen während des Unterrichtes die übrigen Kinder gar nicht wahrzunehmen. Dass sich mein Vater um sie am meisten bemühte, war eine Selbstverständlichkeit. Schließlich konnte und durfte es gar nicht sein, dass zumindest Prinz Amenophis nicht der beste Schüler war. Anders war es in den Pausen. Während sich alle größeren Jungen in dem Hof vor dem Unterrichtsraum mit Ballspielen und Verstecken austobten, hielten sich die Mädchen meist im Schatten der Sykomoren auf und beschäftigten sich auf ihre Art: Sie tuschelten und kicherten über die Jungen.
Nur mit mir wollte niemand so recht etwas zu tun haben. Für die einen war ich noch zu neu und vor allem zu klein, und bei den Mädchen wollte ich mich nicht aufhalten. So saß ich meist allein am Rand eines der Teiche, hielt meine Füße ins Wasser und sang ein Kinderlied oder versuchte, mich mit einem der Flamingos anzufreunden. Ich spürte sehr wohl, dass mein Vater dies mit gemischten Gefühlen beobachtete, aber genauso wenig wie er ließ ich mir irgendetwas anmerken.
Nach einiger Zeit fasste eines der Tiere – ich konnte es an einer Verletzung am Fuß wiedererkennen – richtig Vertrauen zu mir, was im Wesentlichen daran lag, dass ich es fleißig mit Brot versorgte. Die Knaben tobten wieder mit einem Ball durch den Hof, während ich mit im Wasser baumelnden Füßen meinen gefiederten Freund fütterte und es mir zum ersten Mal gelang, seinen Kopf und den langen Hals zu streicheln. Unvermittelt verspürte ich einen dumpfen Schlag am Hinterkopf, fiel vornüber und landete im Teich. Ich verlor die Besinnung und erwachte erst wieder, als mich mein Vater auf der Wiese neben dem Teich niederlegte. Die Ursache meines Unglücks war schnell geklärt: Ein mit ganzer Kraft geschossener Ball hatte mich niedergestreckt. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, wenn sich nicht Acha, der Sohn des Oberstallmeisters, verplappert hätte. «Ich habe dir ja gleich gesagt, lass den Kleinen hier in Ruhe», fauchte er respektlos Prinz Amenemhet an. «Du wolltest es ja unbedingt wissen!»
«Sei still», forderte der verratene Übeltäter, «was musst du dich überhaupt einmischen? Dann soll er eben besser aufpassen, wo er sich hinsetzt!»
Nun meldete sich Prinz Amenophis zu Wort. «Du könntest dich wenigstens bei ihm entschuldigen, Amenemhet. Sehr heldenhaft war das nicht! Im Übrigen hat Eje dir nichts getan.»
Ging der kurze Streit bislang an mir vorüber, da ich mehr mit meinem schmerzenden Kopf beschäftigt war, so war ich nun auf das Äußerste erstaunt: Prinz Amenophis nannte meinen Namen!
Nachdem Prinz Amenemhet nichts dergleichen tat, sondern bockig die Arme vor der Brust verschränkte und sich verärgert auf die Lippen biss, kam sein älterer Bruder auf mich zu, griff mit beiden Armen um meine Schultern und hob mich hoch. «Ich möchte mich bei dir für meinen Bruder entschuldigen.» Er reichte mir seine Hand und sagte weiter: «Komm mit, Eje! Du brauchst einen trockenen Schurz.»
Ich wusste nicht wie mir geschah.
Ich spürte, wie einige meiner Mitschüler wie vom Donner gerührt dastanden und derart fassungslos waren, dass sie die tiefe Verneigung vergaßen, während Prinz Amenophis mit mir den Platz verließ, einigen anderen stand der blanke Neid in den Gesichtern. Selbst mein Vater verlor ein wenig die Orientierung, wollte noch irgendetwas sagen und ließ es dann kopfschüttelnd bleiben.
Wir beide verschwanden in den Palast, ließen den Eingang zum Unterrichtssaal rechts liegen und betraten eine Halle, die von Säulen gerahmt und nach oben hin in der Mitte über einem Teich offen war. Die Säulen stellten am Ende offene Papyrusstauden dar und waren in dunklem Rot und oben, unter dem Dach, in sattem Grün gestrichen. Die Grundfarbe der Wände, hinter den Säulen in Felder eingeteilt, war ein kräftiges Ocker. Die einzelnen Bilder zeigten Szenen von Jagden des Pharao: Einmal stand er auf seinem Streitwagen, in der Linken die Zügel fest in der Hand, während die Rechte gerade ausholte, um einen Speer nach einem Löwen zu schleudern, der vor dem Wagen auf dem Rücken lag und mit seinen Pranken um sich schlug. Der König trug den blauen Kriegshelm, den Chepresch, einen goldenen Halskragen und einen kostbaren weißen Schurz mit vielen Falten. Im Vorübergehen erkannte ich auf einem anderen Bild den Guten Gott und einige seiner Krieger mit langen Harpunen auf Booten stehend, vor und neben ihnen eine Vielzahl von Flusspferden, die sie jagten.
Zum Innenhof hin schwebten zwischen den Säulen weiße, fast durchsichtige Vorhänge. Deren schwache Schatten verliehen den Bildern – verursacht durch einen leichten Windhauch – eine wunderbar magische Bewegung. Kaum, dass ich dies alles wahrnahm, verließen wir diesen Saal auch schon wieder und gelangten in einen sicher dreißig Ellen langen, nach oben offenen Gang. Er war so breit, dass in seiner Mitte noch Platz für ein ebenso langes, vier Ellen breites Wasserbecken war. Rechts und links des Ganges führten kostbar geschnitzte Türen aus Zedernholz in die anliegenden Räume. Durch eine dieser Türen verschwanden wir in ein nicht sehr großes Zimmer, an dessen weißen, schmucklosen Wänden einige offene Schränke standen, an denen sich nubische Dienerinnen zu schaffen machten. Aus geflochtenen Körben nahmen sie Wäschestücke und schichteten diese gewissenhaft in die Schränke. Als Prinz Amenophis den Raum betrat, fielen die Dienerinnen nieder und berührten mit der Stirn solange den Boden, bis sie vom Prinzen mit den Worten «Erhebt euch!» die Erlaubnis erhielten, sich wieder aufzurichten. Das waren seine ersten Worte, seit wir den Schulhof verlassen hatten.
«Meinem Freund Eje ist ein Ungeschick passiert. Er braucht einen trockenen Schurz!», befahl er in knappen Worten.
Sogleich hastete eine der Nubierinnen an einen Schrank, holte einen Schurz hervor, und auf einen Fingerzeig des Prinzen hin überreichte sie ihn mir. Ohne weitere Aufforderung drehten sich die Dienerinnen um, sodass ich mich umziehen konnte.
Prinz Amenophis wandte sich an mich. «Gib ihr das nasse Kleidungsstück. Du erhältst es gereinigt zurück.»
Mir war dies alles eher unangenehm, ich wagte aber keinen Widerspruch, denn schon nahm er mir den nassen Schurz vom Arm und warf ihn einer der Nubierinnen hin. Zu mir gewandt befahl er nur knapp: «Komm!» und machte kehrt.
Ich hatte tausend Fragen auf dem Herzen. Mussten die Dienerinnen wirklich jeden Befehl ausführen, den er gab, und waren sie Tag und Nacht für ihn da? Konnte er jede Speise bestellen, auf die er gerade Appetit hatte? Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, da erlöste er mich von meiner Neugier: «Ja, sie sind alle meine Dienerinnen. Sie sind für meine Körperpflege zuständig, für die Ordnung in meinen Räumen und, wie du siehst, für meine Kleider. Aber du hast nur einen Teil von ihnen gesehen. Insgesamt hat mir mein Vater sechs Diener und zehn Dienerinnen zur Verfügung gestellt.»
Inzwischen waren wir wieder in dem Saal mit den Jagdbildern angelangt. Auf der gegenüberliegenden Seite erkannte ich jetzt die Darstellung einer Vogeljagd. Der Pharao, wieder mit blauem Chepresch, stand mit seinen Begleitern im Papyrusdickicht und schoss einen Pfeil auf eine gerade auffliegende Wildgans ab, während die anderen Jäger Wurfhölzer nach Enten schleuderten.
Prinz Amenophis bemerkte, dass ich trotz unseres raschen Ganges aufmerksam die Bilder zu betrachten versuchte, und hielt kurz inne: «Die Bilder zeigen den Guten Gott bei der Jagd in der Oase Fajum. Du weißt ja, wir verbringen jedes Jahr mehrere Wochen in Merwer, und nur dort hat mein Vater genug Zeit, im Dickicht des Schilfes zu jagen. Weil er dieser Leidenschaft hier mitten in der Wüste nicht nachgehen kann, ließ er diese Bilder anbringen. Gefallen sie dir?»
«Oh ja, Prinz, sie sind wunderschön! Die Farben so prächtig, so naturgetreu. Und der Gute Gott. Wie herrlich und mächtig er ist!»
Während ich noch das Bild bestaunte, ging der Prinz bereits weiter, und ich musste mich beeilen, ihm zu folgen.
«Wir müssen wieder zum Unterricht!», klärte er mich über seine Eile auf. Als wir fast den Unterrichtssaal wieder erreicht hatten, sagte ich im Gehen: «Prinz Amenophis», – er blieb stehen und drehte sich nach mir um – «Prinz Amenophis, ich möchte Euch vielmals danken!» Dabei verneigte ich mich tief und mit vor der Brust gekreuzten Armen.
«Schon gut», sagte er, während er bereits den Unterrichtsraum betrat und die dort Anwesenden sich ebenfalls tief verneigten.
«Erhebt euch!», befahl der Prinz, und ehe der Unterricht seinen Fortgang nahm, bemerkte ich das auf das Höchste zufriedene Gesicht meines Vaters.
In den nächsten Tagen gab es natürlich keinen derart engen Kontakt mehr, aber ich spürte doch, dass Prinz Amenophis mir deutlich mehr Aufmerksamkeit schenkte, als vor diesem für mich so denkwürdigen Tag.
Unauffällig nahm er mich in den Unterrichtspausen beim Ballspiel in seine Mannschaft auf, oder er warf mir den Ball zu, obwohl sich ein anderer Mitspieler in einer besseren Position befand. Auch befragte er mich über mein Zuhause, was er vorher nie getan hatte.
In meinem Elternhaus war ich es jetzt, dem Fragen über den Prinzen und den Palast gestellt wurden. Man brachte mir mehr Respekt entgegen, man nahm mich ernster.
Teje hingegen war erstaunlich still und zeigte keine große Neugier. Sie tat gerade so, als kenne sie ohnehin schon alles, und aus ihrer Sicht war das ja auch konsequent. Schließlich hatte sie sich in der Vergangenheit so benommen, als ginge sie im Palast ein und aus.
Nach wenigen Monaten gehörte ich nun zum Kreis derjenigen Schüler, die regelmäßig Prinz Amenophis und seine Geschwister umgaben. Zwischenzeitlich hatte auch Prinz Amenemhet seinen Frieden mit mir gemacht. Eines Tages, wir saßen im Schatten einer der Sykomoren unseres Schulhofes und erholten uns vom Ballspiel, sprach er mich an: «Bist du mir noch böse?», und warf dabei mit einem kleinen Kiesel nach einem der Flamingos.
«Nein, Prinz Amenemhet, überhaupt nicht», konnte ich ganz freimütig entgegnen, hatte ich doch ihm und seinem Übermut meine jetzige Situation zu verdanken.
«Mir tut es Leid, wie ich mich benommen habe und vor allem, dass ich mich so lange nicht entschuldigt habe!»
«Die Geschichte ist längst vergessen», beruhigte ich ihn.
Er stand auf, ergriff meine rechte Hand und zog mich hoch, damit wir weiterspielen konnten. Nun war ich vollkommen zufrieden.
Mein erstes Schuljahr war nun vorüber. Während der Zeit der großen Hitze, da der große Fluss nicht mehr als ein Rinnsal ist, blieb die Schule für vier Wochen geschlossen.
Das ist die Zeit, in der Men-nefer wie ausgestorben ist. Der gesamte Hof und alle Großen und Mächtigen des Landes beziehen ihre Paläste und Landsitze im Fajum, der großen Oase im Westen.
Die einfache Bevölkerung, die Bauern und die Armen müssen während der Hitze viel erdulden, denn wenn die vorangegangene Ernte nicht gut ausgefallen ist, werden schnell die Vorräte knapp. Wenn dann die Verteilung schlecht durchgeführt wird, kommt es manchmal sogar zu Unruhen.
Der Wesir als Stellvertreter des Guten Gottes und die Beamten, die zur Aufrechterhaltung der Verwaltung und Ordnung zurückbleiben, haben in dieser Zeit alle Hände voll zu tun, um Mensch und Vieh mit ausreichend Getreide, Gemüse und Wasser zu versorgen.
In diesem Jahr gab es aber nichts zu befürchten. Gleichwohl waren wir nicht sehr glücklich darüber, dass es diesmal uns getroffen hatte, zu Hause zu bleiben. Als Vorsteher der Ställe seiner Majestät war mein Vater für die Pflege von mehr als zweitausend Pferden des Palastes, für die Wartung der Pferdegeschirre, der Wagen und der Sänften und für die dazugehörenden Diener und Sklaven verantwortlich.
Am Anfang genoss ich die freie Zeit sehr. Ich trieb mich viel in unserem Garten herum oder war mit den Freunden aus der Nachbarschaft zusammen. Ab und zu durfte ich meinen Vater in die Stallungen begleiten, wo ich mich bei den Dienern über alles, was mir wissenswert erschien, genauestens kundig machte. Bald wusste ich, welche die persönlichen Pferde des Guten Gottes waren und wie sie hießen, was für Pferdegeschirre zu welchen Anlässen benutzt wurden und wo die Pferde der Prinzen und ihre Wagen standen. Ich ließ keine Gelegenheit aus, um den Pferden von Prinz Amenophis Brot oder ein Stück Gemüse mitzubringen.
Doch schon bald fehlten mir meine Freunde aus dem Palast, und ich sehnte mich nach der bevorstehenden Überschwemmung, da mit ihr das Leben im ganzen Land zurückkehren würde. Die Überschwemmung kündigte sich für uns stets durch die nach und nach aus dem Fajum Heimkommenden frühzeitig an. Zuerst kehrten die weniger bedeutenden Familien zurück und dann, in kurzen Abständen, die Mächtigen, bis schließlich Pharao, der Gute Gott und seine Familie feierlichen Einzug hielten. Tausende von Menschen säumten die Straßen vom Rand der Stadt bis zum Großen Haus und jubelten ihrem Herrscher zu, weil sie wussten, dass mit seiner Rückkehr die schwere Zeit der großen Hitze und Trockenheit endgültig vorüber war.
Ich hielt mich in diesem Jahr ebenfalls in der Menge auf, konnte aber den Guten Gott nicht sehen, da mir die Erwachsenen die Sicht völlig versperrten und es mir nicht gelang, mich in die vorderste Reihe zu drängeln.
Je näher die Überschwemmung schließlich kam, desto aufgeregter wurden alle. Die Dämme und Wälle wurden ein letztes Mal überprüft, damit sie einer möglicherweise sehr starken Flut standhielten, die Bauern bereiteten das Saatgut vor, die Fischer überprüften die Netze, da die Überschwemmung gleichzeitig einen großen Reichtum an Fischen mit sich brachte.
Und die Steuerbeamten des Guten Gottes bereiteten die Maßbänder und die Bücher zum Vermessen der Anbauflächen vor, denn ehe die Aussaat begann, musste die jeder Familie zustehende Anbaufläche genau vermessen und niedergeschrieben werden, um so später die Höhe der Steuerabgaben festlegen zu können.
Naturgemäß waren die Steuerbeamten nicht sehr beliebt, und mancher Bauer versuchte auf seine Art für sich den größten Vorteil zu erzielen. Die einen behaupteten, ihr Boden sei nicht von so guter Qualität wie der der übrigen Nachbarn, weswegen ein anderer Bewertungsmaßstab heranzuziehen sei, der nächste führte an, dass sein Land in einem Gebiet lag, in dem es besonders viele Krokodile gab, weswegen Kosten für zusätzliche Schutzmaßnahmen anfielen, und wieder andere redeten nicht lange herum und versuchten, die Beamten zu bestechen – was auch manchmal gelungen sein soll. Wurde allerdings ein Beamter dieser ruchlosen Tat überführt, bedeutete dies den sicheren Verlust zumindest eines Ohres und viele Jahre harter Arbeit im Steinbruch.
Endlich trafen wir uns alle im Palast wieder, und es kam uns vor, als hätten wir uns eine Ewigkeit nicht gesehen. In der ersten Unterrichtspause tauschten wir Ferienerlebnisse aus, wobei Prinz Amenophis natürlich den Vorrang hatte. Mit Begeisterung berichtete er von seinen Jagderlebnissen im Fajum, und seine Geschichten fesselten uns vom ersten Augenblick an.
Er begann seine Erzählung mit dem Aufbruch im Morgengrauen, als der Gute Gott mit ihm und den übrigen Begleitern auf Streitwagen bis zu einer Stelle im Sumpfgebiet fuhr, wo die Boote für die Jagd bereits vorbereitet lagen.
«Von Ferne hörten wir schon das Schnaufen und wohlige Brummen der Flusspferde, die sich vor Sonnenaufgang daranmachten, wieder in das schützende Wasser zurückzukehren. Wir standen mit den Booten im Dickicht des Schilfes verteilt und lauerten ihnen mit unseren Harpunen auf. Mein Vater erlaubte mir, mit auf sein Boot zu kommen, auf dem sich noch drei seiner tapfersten Krieger befanden. Mit eigener Hand erlegte er an diesem Morgen vier Flusspferde», berichtete der Prinz jetzt aufgeregt.
«Ich selbst durfte auch zweimal eine Harpune nach ihnen werfen. Einmal traf ich mitten in den Rachen eines dieser Ungeheuer, das mit fünf Harpunen im Körper laut brüllend verendete.»
Wir anderen waren sprachlos vor Ehrfurcht.
«Ein anderes Boot wurde von drei Tieren angegriffen, weil ein Bulle schlecht getroffen war und ein weibliches Tier sein Junges verteidigte. Der Bulle tauchte unter das Boot und schnellte mit ohrenbetäubendem Gebrüll empor, sodass das Boot mehrere Ellen hochgeschleudert wurde und alle sechs Jäger ins Wasser stürzten. Noch bevor irgendjemand helfen konnte, hatten die Flusspferde drei Jäger angegriffen, totgebissen und in die Tiefe gezerrt. Ihnen war nicht mehr zu helfen! Die anderen drei Jäger hatten Glück: Der Gute Gott stieß dem wütenden Bullen mit aller Macht eine Harpune so fest in die Seite, dass er nur noch einmal sein Maul weit aufriss, seine Lunge leerkeuchte und verendete. Die drei konnten so aus dem blutroten Wasser in die anderen Boote gezogen und gerettet werden.»
Wir schüttelten nur noch ungläubig die Köpfe, und mit trockener Kehle flüsterte ich: «Und dann?»
«Vier Flusspferde haben wir an diesem Morgen getötet. Mit langen Seilen wurden sie von den Jagdgehilfen ans Ufer gezogen und dort zerteilt. Die Zähne der Tiere erhielten die Jäger, die sie erlegt hatten. Die vier Eckzähne des Bullen hat mir mein Vater geschenkt», schloss der Prinz stolz seinen Bericht.
Wir anderen – und vor allem ich selbst – hatten nichts Vergleichbares erlebt, sodass ich erst gar nicht den Versuch unternahm, meinen Freunden eine Geschichte aufzutischen.
Einige Tage später wandte sich Prinz Amenophis nach dem Unterricht ohne Vorankündigung an meinen Vater und bat um Erlaubnis, mich in den Palast mitnehmen zu dürfen.
«Ihr müsst Euch keine Sorgen machen, Juja. Eje wird vor Sonnenuntergang nach Hause gebracht.»
Selbst wenn die Frage des Prinzen eher einem Befehl als einer Bitte gleichkam, gab mein Vater in gütigem Ton sein Einverständnis. Bis zum Ende des Unterrichts konnte ich mich kaum mehr konzentrieren und dachte ständig darüber nach, was mich erwarten würde. Ich zog in Erwägung, dass ich dem Wesir oder einer der königlichen Gemahlinnen begegnen könnte und sie mich ansprechen würden. Was aber geschähe mit mir, wenn der Gute Gott selbst – nein, daran wagte ich nicht zu denken. Zuletzt war mir vor Aufregung richtig schlecht, und die Aufforderung des Prinzen, jetzt mitzukommen, habe ich vor Herzrasen fast nicht gehört.
Während die Prinzessin und die anderen Prinzen vorausliefen, hielt mich der Prinz zurück und sah mich wortlos an.
«Wohin gehen wir?», fragte ich respektvoll leise und mit hochgezogenen Augenbrauen.
«Ich weiß es noch nicht. Entweder ich zeige dir erst meine Gemächer, oder wir statten vorher den Pferden einen Besuch ab – wie du willst!»
«In den Stallungen war ich während der Ferien ein paar Mal gewesen», wandte ich ein.
«Das wurde mir schon berichtet. Übrigens: Vielen Dank, dass du an meine Pferde gedacht hast!»
Dabei strahlte der Prinz über das ganze Gesicht und gab mir so zu verstehen, dass er über alles bestens unterrichtet war.
«Also gut, erst der Palast!», beschloss er.
Inzwischen waren wir den Gang mit den Jagdbildern entlanggegangen. Die Szenen erinnerten mich wieder an die Geschichte des Prinzen mit den Flusspferden. Diesmal bogen wir aber nicht rechts ab, sondern gingen nach links in einen langen Gang, der an beiden Seiten von insgesamt vierzehn Figuren des Guten Gottes eingesäumt wurde, sieben auf jeder Seite. Sie alle waren aus rötlichem Stein, gleich groß und kaum zu unterscheiden. Sie zeigten den Guten Gott in der Blüte seiner Jugend auf einer rechteckigen Standplatte, die Kronen der Beiden Länder mit dem Uräus auf dem Haupt, mit heiligem Bart, einem reich geschmückten Schurz und Sandalen. Die Krone, der breite Brustschmuck, die Ober- und Unterarmreifen waren mit Gold überzogen, der Schurz der Figuren war dunkelrot bemalt, der linke Fuß leicht vorgestellt. In der Tat sah eine Figur aus wie die andere!
Am Ende betraten wir einen Saal, an dessen vier Seiten sich jeweils in der Mitte eine mächtige Tür befand und dessen Wände bis oben hin mit Holzregalen verstellt waren. Nahezu alle Regale waren restlos mit Papyrusrollen oder beschrifteten Tontafeln ausgefüllt. Im Saal verteilt standen sechs oder acht Tische, an vier von ihnen saßen Schreiber bei ihrer Arbeit. Noch ehe sie aufspringen konnten, rief ihnen der Prinz zu: «Behaltet Platz! Wir wollen euch nicht stören!»
Die so Angesprochenen nickten mehrmals mit freundlichem Lächeln und setzten ihre Arbeit fort.
«Das ist das Staatsarchiv», flüsterte mir Prinz Amenophis zu.
«Hier befinden sich alle Anweisungen und Gesetze des Guten Gottes und der Briefwechsel mit anderen Ländern. Wir sollten aber von hier schnell wieder verschwinden, weil man uns hier nicht gerne sieht – du verstehst?» Ich nickte, und sogleich verließen wir den Saal durch eine der Türen und standen bald im nächsten. Dieser war ganz anders ausgestattet. Sechzehn Säulen, gleichmäßig auf den ganzen Raum verteilt, trugen in einer Höhe von vielleicht fünfzehn Ellen eine Decke mit schweren Holzbalken aus Zedernholz. Wie so oft waren die weißen Säulen über und über mit heiligen Zeichen beschriftet und endeten unter der Decke als geöffnete, dunkelgrüne Lotosblüten. In der Mitte der Decke spendete eine quadratische Öffnung Licht, das sich auf einen darunter stehenden Tisch ergoss. In den Ecken des Raumes standen dreibeinige Opferschalen mit glühender Kohle und verströmten den heiligen und betörenden Duft von Weihrauch. Auf dem Tisch selbst war eine karge Landschaft in ihrer natürlichen Form nachgebaut. Ich sah ein Gebirgsmassiv, dessen größte Erhebung der Form einer Pyramide glich. An seinem Fuß weitete sich ein Tal, dessen Ende eng zulief und so einen natürlichen torartigen Zugang bildete. Abseits von diesem Tal war eine kleine Siedlung aufgebaut, viele kleine, weiße Arbeiterhäuser, Mauer an Mauer, wie man sie in allen Vorstädten unseres Landes sieht.
Eine Papyrusrolle lag daneben ausgebreitet, an beiden Enden mit einem faustgroßen heiligen Käfer aus Elfenbein beschwert, damit sie sich nicht einrollte. Darauf war ein Plan eingezeichnet, den ich nicht verstand: Gänge, teils gerade, teils abknickend, quadratische und rechteckige Räume, einer mit zwei, der vorletzte mit sechs Säulen bestückt.
Prinz Amenophis stand eine Weile schweigend neben mir. «Der Gipfel dort heißt ‹Sie, die das Schweigen liebt›», flüsterte er betont langsam und würdevoll vor sich hin, während er mit dem rechten Zeigefinger in die Mitte des Tisches wies. Ich verstand gar nichts.
«Es ist der höchste Berg im westlichen Horizont, am Begräbnisort der Könige, bei Waset, der Hauptstadt des Südens», flüsterte er weiter.
«Aber warum ist das hier nachgebildet?», wollte ich wissen.
«Mein Vater bereitet seit Jahren seine Grabstätte vor, wie das jeder König tut, schon immer. Wenn nicht alles genau geplant und nach den Vorschriften ausgeführt wird, kann der Gute Gott nicht Osiris werden und in Ewigkeit weiterleben!»
Er wies auf den Plan und fuhr fort: «Jeder Raum, jede Säule, jedes Bild, ja sogar die einzelnen Schriftzeichen haben ihre besondere Bedeutung und dürfen nicht fehlen oder falsch sein. Darüber werden wir aber im Unterricht noch einiges erfahren.»
«Warum ist das auch für mich wichtig, wo ich doch kein Prinz bin?», wollte ich wissen.
«Weil es kaum möglich sein dürfte, dass nur Prinzen die Gräber ihrer Väter errichten und die Arbeiter beaufsichtigen. Da brauchen wir schon ein paar andere kluge Köpfe dazu. Aber die Planung der Begräbnisstätte selbst ist Sache des Guten Gottes.»
Ich warf noch einen kurzen Blick auf die kleine Landschaft, als ich bemerkte, dass der Prinz schon weitergegangen war.
Ich wusste von meinem Vater, dass man den Toten die verschiedensten Dinge mit in ihr Grab gab, von Nahrungsmitteln über Möbel, Waffen und Salbölen bis hin zu 365 kleinen Arbeiterfiguren, eine für jeden Tag des Jahres.
«Weiß der Gute Gott denn auch schon, was er auf seine Reise jenseits des Horizontes mitnehmen wird?»
«Ja», bestätigte Prinz Amenophis nach kurzem Überlegen, «die meisten Gegenstände stehen schon fest. Vieles befindet sich in geheimen Räumen, die strengstens bewacht werden. Manches wird aber auch vom Thronfolger oder der Großen königlichen Gemahlin, dem Wesir oder engsten Vertrauten des Königs ausgesucht.»
Nachdem wir erneut einen fast unendlich langen offenen Gang durchschritten hatten, gelangten wir in einen überwältigend schönen Garten. Sykomoren, Olivensträucher, Akazien, Granatapfelbäume und Palmen wechselten sich hier mit Teichen und Beeten, bepflanzt mit den herrlichsten Blumen, ab. Dichte, mehr als fünf Ellen hohe Hibiskushecken teilten den Park in verschiedene Abteilungen, und jede von ihnen war von einer anderen Farbe beherrscht. So überwogen in der einen gelb blühende Blumen und Sträucher, in der nächsten weiße und wieder in einer anderen ein knallendes Rot, wie die Blüten des Hibiskus selbst. Dazwischen führten schlängelnde Kieswege vorbei an Bäumen, Teichen, Gartenhäusern, die man Schattenhäuser nannte, und an kleinen Kapellen.
In den Teichen schwammen verschiedene Arten von Wildenten mit bunt schillernden Federn, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Auf den Grasflächen stolzierten Kraniche, Strauße und Flamingos, Schildkröten krochen schwerfällig umher, sich ein schattiges Plätzchen suchend. Auf einigen Bäumen hockten Paviane, die mit langen Lederriemen am Davonlaufen gehindert wurden, und fraßen gemächlich eine Dattel nach der anderen. Aus einigen Schattenhäusern ertönten die zärtlichsten Klänge von Harfen und Flöten, und für einige Augenblicke hatte ich den Eindruck, als wäre das alles nicht von dieser Welt.
Gewiss, auch unser Garten war groß, üppig bepflanzt und sehr gepflegt, aber die Gärten des Guten Gottes übertrafen alles, was ich bis dahin gesehen hatte. Immer wieder blieb ich kurz stehen und sah mir in einem Teich Fische an, suchte in den Baumkronen die keckernden Affen oder bestaunte die Pracht tausender Blüten. Zuletzt schloss ich einfach kurz die Augen, um den mich umgebenden Duft noch intensiver zu erfassen, und atmete schwer ein und aus.
Als ich wieder aufblickte, erschrak ich von dem Anblick, der sich mir bot, so sehr, dass ich sofort gestorben sein wollte: Er, den man den Guten Gott nannte, Pharao Thutmosis Men-chepru-Re, Herrscher von Ober- und Unterägypten, stand vor mir.
Vier Würdenträger waren bei ihm, doch ehe ich mir auch nur den kleinsten Gedanken darüber machen konnte, wer sie waren, tat ich das einzig Richtige: Ich ließ mich vornüber zu Boden fallen, streckte die Hände nach vorne und blieb völlig bewegungslos liegen. Nur Prinz Amenophis konnte mich jetzt von der ewigen Verdammnis retten. Ich hatte es gewagt, die unzugänglichen Gärten des Guten Gottes zu betreten! Ich, ein Knabe von zwölf Jahren!
«Solltest du nicht beim Unterricht sein, Amenophis?», fragte eine Stimme, die gleichmäßig, ruhig und überlegen klang.
«Juja hat den Unterricht für heute schon beendet, Vater, und mein Freund und ich waren gerade auf dem Weg zu den Ställen. Wir wollten nach meinen Pferden sehen.»
«Wie heißt denn dein Begleiter?», wollte der Gute Gott jetzt wissen, und mir war klar, dass ich ab sofort keinen noch so kleinen Fehler machen durfte, wollte ich länger der Freund des Prinzen sein.
«Vater, das ist Eje, der Sohn von Juja und Tuja.»
«Erhebe dich, Eje!», befahl Pharao.
Mit den Armen richtete ich erst meinen Oberkörper auf, bis ich kniete, immer darauf bedacht, den Kopf nicht zu erheben. Schließlich stand ich mit gesenktem Haupt vor dem Guten Gott.
«Du darfst mich anblicken, Eje!»
Langsam hob ich den Kopf und überlegte dabei, ob ich ihm wirklich in die Augen schauen durfte oder ob ich den direkten Blickkontakt zu vermeiden hatte. Ich entschloss mich zu Letzterem und starrte meinem Gegenüber auf den goldenen Halskragen.
«Ich möchte in deine Augen sehen, Eje, schau mich an!», befahl er.
Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich in die Augen eines Herrschers unseres Landes, des Guten Gottes. Es waren müde Augen, mit dunkelgrünen Pupillen, umrahmt von grün-schwarzer Farbe, die seitlich der Augen spitz auslief. Das schmale Gesicht war faltig. Der König trug unter einem goldenen Stirnreif mit einem prächtigen Uräus das Nemes-Kopftuch. Der goldene Halskragen schien ihn fast zu erdrücken. Im blendend weißen Faltenschurz, den er ohne Prunkgürtel trug, steckte ein Zierdolch. Sein kahl rasierter, extrem schlanker Körper wirkte muskulös. Es war der Körper eines großen Kriegers.
«Weißt du, Eje, ich will immer die Augen der Menschen sehen, die mir gegenüberstehen – die Augen meiner Freunde und die meiner Feinde.»
Ich blieb stumm vor Aufregung. Außerdem wusste ich, dass der König nur angesprochen werden durfte, wenn man auf eine Frage zu antworten hatte.
Während mich der Gute Gott ansah, bemerkte er zu seinen Begleitern: «Der Junge kann seinen Vater wirklich nicht verleugnen.» Dann machte er einen Schritt auf mich zu, gab mir einen Klaps auf den Hinterkopf und sagte zu Amenophis und mir: «Also, ab zu den Pferden! Und ärgert mir den Stallmeister nicht zu sehr!»
Während Prinz Amenophis an der Gruppe vorbei und davon lief, verneigte ich mich nochmals tief vor dem Guten Gott und jagte schließlich dem Thronfolger hinterher, was die Beine hergaben. Erst im Pferdestall konnte ich wieder verschnaufen.
Ich hätte Prinz Amenophis zu gerne gefragt, ob ich alles richtig gemacht hatte. Irgendeine innere Stimme sagte mir, dass es besser sei, wenn ich mir gar nichts anmerken ließe. So beschloss ich, später, wenn ich meinem Vater von der Begegnung berichtete, ihm die Frage zu stellen.
Im Stall herrschte rege Betriebsamkeit, da jetzt am späten Nachmittag, wo die größte Hitze des Tages vorbei war, alles für den zweiten Ausritt vorbereitet wurde. Die eine Hälfte der Pferde hielt sich morgens auf der Koppel auf, während die andere Hälfte beritten wurde, gegen Abend wechselte man. Einigen Pferden wurden Sättel und Reitgeschirr angelegt, andere vor Streitwagen gespannt. Jenseits der Stallungen lagen die Übungsbereiche. Zwischen Palmen und Sykomoren hindurch schlängelten sich in deren Schatten die Wege für die Streitwagen. Neben den verschiedenen Koppeln für Hengste, Stuten und ihre Jungpferde gab es ein weiträumiges Übungsgelände mit Hindernissen wie niedrige Mauern, Holzstapel, umgekippte Streitwagen und kleine Teiche. Dazu waren zahlreiche, aus Bast geflochtene Zielscheiben aufgestellt und etwa vier Ellen hohe Baumstämme in den Boden eingelassen. Zehn oder zwölf Reiter jagten auf ihren Pferden kreuz und quer durch dieses Gelände und schossen im Reiten ihre Pfeile auf die Zielscheiben oder schlugen mit Streitäxten auf die Baumstämme ein. Das Treiben wurde vom Kampfgeschrei der Krieger oder von noch lauter gebrüllten Kommandos der Vorgesetzten begleitet.
«Die Krieger und die Pferde üben hier, mit Schwierigkeiten fertig zu werden, wie es sie so oder ähnlich in einer Schlacht gibt», erklärte mir der Thronfolger.
«Es sind die Soldaten der Leibgarde meines Vaters, die besten Krieger unseres Landes!», fuhr der Prinz mit stolzem Ton fort, als wären es seine eigenen.
«Habt Ihr auch schon einmal daran teilgenommen?», wollte ich wissen.
«Ja, schon mehrmals! Da war ich aber alleine auf dem Gelände, und der Hauptmann der Garde beschäftigte sich nur mit mir. Sonst durfte niemand auf dem Gelände sein und zusehen.»
«Weshalb wart Ihr alleine?» Mit hochgezogenen Augenbrauen schaute ich den Prinzen an und konnte diese Vorsichtsmaßnahme gar nicht verstehen.
«Es könnte ja sein, dass ich Fehler mache oder sogar vom Pferd stürze. Es ist nicht gut, dass Soldaten sehen, wenn ein Prinz als ihr künftiger Vorgesetzter oder sogar Herrscher eine Schwäche zeigt.»
«Auch vor mir nicht?», wollte ich wissen.
«Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden sicher an vielen militärischen Übungen gemeinsam teilnehmen. Aber erst, wenn ich über ausreichende Kenntnisse verfüge, und von keinem der Beteiligten wegen eines Anfängerfehlers verspottet werden kann.»
Durch solche Äußerungen des Prinzen wurde mir klar, dass er neben unserer gemeinsamen Erziehung noch weiteren, tiefer gehenden Unterricht erhielt, wodurch seine freie Zeit sicher noch knapper bemessen war als meine. Umso mehr war ich mir natürlich der Ehre bewusst, dass er sie mit mir verbrachte.
Inzwischen rasten auch schon die ersten Streitwagen durch die Baumalleen. Sie waren mit zwei Soldaten besetzt, einem Wagenlenker, der auch ein Schild trug, und einem Schützen. Beide trugen einfache Lederhelme, und nur ihre Arme waren durch Lederbandagen besonders vor Verletzungen geschützt. Der Kämpfer trug einen Kriegsbogen. In zwei Köchern, die seitlich am Wagen befestigt waren, steckten die Pfeile, in einer besonderen Halterung befanden sich weitere drei Speere. Hinter einigen Sykomoren hatten sich Krieger versteckt, die plötzlich, wenn ein Wagen vorbeifuhr, mit einer Stange hervorsprangen und versuchten, den Kämpfer herunterzustoßen. Aufgabe des Wagenlenkers war es, in voller Fahrt sofort zu reagieren und seinen Nebenmann mit dem Schild zu schützen und den Stoß abzuwehren.
In unterschiedlichen Entfernungen zu dieser Rennbahn standen Zielscheiben. Die Scheiben direkt neben dem Weg wurden mit den Speeren beworfen, auf die anderen Scheiben schossen die Kämpfer ihre Pfeile ab.
«Wie auch die Armee selbst, so besteht die Leibgarde aus drei Einheiten, die nach Amun, Re und Ptah benannt sind. Man erkennt sie an der Farbe der Helme und an der Brüstung der Wagen: Amun blau, Re gelb und Ptah rot», erklärte mir Prinz Amenophis.
«Das ist auch hier nötig, um den Ehrgeiz anzustacheln. Die Soldaten führen genaue Listen über die Treffer und die abgeworfenen Krieger.»
«Deine Lieblingsfarbe ist demnach blau, habe ich recht?»
«Genau so ist es, Eje! Komm, lass uns jetzt zu meinen Pferden gehen.»
Als wir den mir bereits so vertrauten Stall mit den Pferden des Prinzen betraten, stellten die fünf Stallburschen sofort ihre Unterhaltung ein und verneigten sich tief, ein jeder, wo er gerade stand.
Amenophis würdigte sie nicht eines Blickes und gab ihnen durch einen knappen Wink mit der rechten Hand zu verstehen, dass sie sich zu entfernen hatten. Sofort huschten sie lautlos aus dem Stall.
Der Prinz ging zu einem tiefschwarzen Hengst. Es war ein herrliches, wildes Tier, das nicht einen Wimpernschlag lang ruhig stehen konnte. Es war das Lieblingspferd des Prinzen, wie mir ein Stallbursche schon bei meinem ersten Besuch berichtet hatte, und ein Geschenk von Pharao Thutmosis Men-chepru-Re.
«Wer von euch hat heute ‹Chons ist groß› geritten?», rief Prinz Amenophis nach draußen.
«Noch niemand, mein Prinz», gab einer der Stallburschen zur Antwort.
«Gibt es noch Schwierigkeiten mit der rechten Hinterhand?» Zu mir gewandt, fuhr der Prinz fort, ohne die Antwort des Befragten abzuwarten: «Letzte Woche brach er in ein Loch ein und hat sie sich gestaucht.»
«Vielleicht sollte er noch ein oder zwei Tage Ruhe haben, mein Prinz. Aber viel länger können wir ihn ohnehin nicht still halten. Der erste Ausritt wird dann nicht einfach sein. Vielleicht ist es besser, ihn erst zwei Tage alleine auf die Koppel zu lassen, wenn ihr mich versteht.»
Der Stallbursche lächelte sehr verlegen, denn er wusste, dass dieser Rat nicht unproblematisch war, unterstellte er doch dem Prinzen, dass er mit ‹Chons ist groß› nicht zurechtkommen würde. Prinz Amenophis nickte zustimmend, und im Hinausgehen flüsterte er mir zu:
«Er hat Recht, es käme einem Selbstmord gleich, wenn ich mich morgen auf das Pferd setzen würde. Das Temperament dieses Tieres ist kaum zu bändigen! Komm Eje, wir gehen essen, ich habe schrecklichen Hunger», rief er mir wieder mit lauter Stimme zu, und rannte los.
Im Laufschritt ging es wieder durch Höfe, Gänge und Gärten, alles flog an uns nur so vorbei, und schließlich erreichten wir die Gemächer des Prinzen.