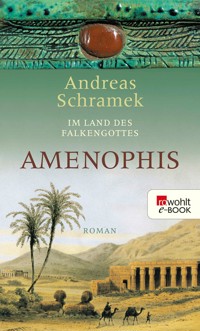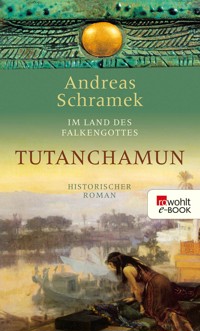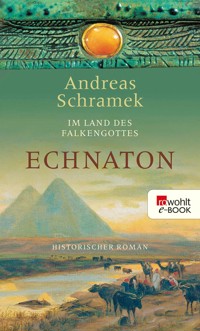
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Im Land des Falkengottes
- Sprache: Deutsch
Der Kampf um die Sonnentempel Pharao Amenophis ist auf der Höhe der Macht, als sein ältester Sohn einem Anschlag zum Opfer fällt. Mit dem Zweitgeborenen, den er zum Thronfolger erhebt, kommt es aber bald zu Spannungen, und von Seiten der mächtigen Priesterschaft des Amun schlägt dem jungen Regenten bitterer Hass entgegen. Denn er verehrt einen anderen Gott, Aton, dem zu Ehren er sich einen neuen Namen gibt. Zusammen mit seiner schönen und klugen Frau Nofretete macht Echnaton sich daran, eine neue Hauptstadt zu bauen und das Reich am Nil von Grund auf zu verändern. Der zweite Teil der großen Trilogie über die Herrscher des Neuen Reichs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andreas Schramek
Im Land des Falkengottes. Echnaton
Historischer Roman
Für Kiki, Philipp und Leopold
Verehrt den einzigen König wie Aton,
denn es gibt keinen anderen Großen als ihn.
Er gibt euch die Lebenszeit in Freude.
Pharao Eje stand auf der Terrasse des Palastes, den Amenophis, der dritte Herrscher dieses Namens, am Westufer des Nils, jenseits von Waset, errichtet hatte, und der den Namen «Palast der leuchtenden Sonne» trug. Die knöchernen Hände des Greises ruhten unbeweglich auf der Brüstung vor ihm. Die goldenen Köpfe von Kobra und Geier an der Vorderseite des Stirnbandes, das er über dem blau und weiß gestreiften Kopftuch trug, der mit rotem Karneol und dunkelblauem Lapislazuli besetzte Schulterkragen, die schweren Goldreife an seinen dünnen Oberarmen offenbarten seine Macht, vor allem aber war es die Haltung seiner Hände, die dem alten Herrscher eine jedermann Ehrfurcht einflößende Würde verlieh. Er sah hinab auf die weite Ebene mit ihren Getreidefeldern, in deren goldgelbem Meer Tausende tiefroter Mohnblumen blühten, er sah auf den breiten und träge dahinfließenden Fluss, die Lebensader der Beiden Länder, und auf die mächtige Hauptstadt Oberägyptens, auf Waset. Doch er sah dies alles nur in seiner Erinnerung, denn die Kraft seiner Augen war in all den Jahren seines langen Lebens dahingeschwunden.
Seit drei Tagen weilte Nacht-Min, der Sohn eines Arbeiters aus der Totenstadt, bei ihm und hörte ihm geduldig zu. Jetzt stand der Jüngling neben Pharao und sah wie jener schweigend hinab. Obwohl Eje den Sechzehnjährigen nie zuvor gesehen hatte und obwohl Nacht-Min zu den unbedeutendsten und ärmsten Untertanen im riesigen Reich Pharaos gehörte, hatte er sich für ihn entschieden.
Ejes Wahl war auf den Jüngling gefallen, weil dieser nichts von der Welt wusste, da er in der Abgeschiedenheit der Berge in einer kleinen Siedlung, die kein Fremder betreten durfte, aufgewachsen war. Nacht-Min kannte nicht die große Stadt, er kannte keinen der prächtigen Paläste, und vor allem wusste er nichts von den Intrigen des Hofes. Eje hatte gehofft, auf ein offenes, auf ein gutes Herz gestoßen zu sein, als er sich im Totental entschloss, dem fremden Jüngling alles, was er bisher erlebt hatte, zu erzählen.
Er erzählte ihm von Nimuria, dem Herrn der Beiden Länder, dem Herrn über alle Fremdvölker, dem Herrn der Welt, Amenophis Mer-chepesch, Herrscher von Waset, Pharao und Gott, der achtunddreißig Jahre über Ägypten geherrscht hatte.
Von dem schönsten, reichsten und mächtigsten Land der Erde, das die Götter liebten und das Re jeden Tag aufs Neue mit seinem Glanz erfüllte, das von der Flussmündung im Norden bis weit in den Süden Nubiens, bis über die fünfte Stromschnelle hinaus reichte. Er erzählte ihm, dass die Völker Asiens Pharao untertan waren und seiner Majestät huldigten, dass die Könige und Fürsten befreundeter Länder ihre Töchter nach Ägypten schickten, wo sie als Nebenfrauen Pharaos im Palast von Merwer ein sorgloses Leben führten, auch wenn sie von seiner Majestät meist unbeachtet blieben. Er berichtete von den adligen Söhnen Mitannis, Babylons und Nubiens, die in den Palastschulen von Men-nefer und Waset von den besten Lehrern des Landes unterrichtet wurden, um später in ihrer Heimat als Freunde Ägyptens zu leben und zu arbeiten. Und er erwähnte, dass zu jener Zeit aus allen Fremdländern Rohstoffe, Handelswaren und Edelsteine an den Nil kamen, Holz aus dem Libanon und aus Nubien, aus dem Sinai Türkis und Lapislazuli, aus Knossos, Mykene und Ilias kunstvolle Töpferwaren und Weihrauch aus dem fernen Punt, und dass Pharao sie dafür mit dem Fleisch der Götter entlohnte, mit Gold.
Pharao erhob die linke Hand und streckte sie Nacht-Min entgegen. Der Jüngling bot höflich und zuvorkommend den braun gebrannten rechten Arm, den die dünnen kalten Finger des alten Mannes dankbar umfassten. Während sie langsam und in kurzen Schritten in die Kühle des Palastes zurückkehrten, begann Eje zu sprechen.
«Amenophis hatte in den Beiden Ländern, in Ober- und Unterägypten, prächtige Tempel errichtet, die an Schönheit und Reichtum durch kein Bauwerk anderer Völker übertroffen wurden. Sie glänzten von Gold und Elektron. Edelsteine aller Art und jeder Größe prangten an ihren Toren, und in ihren Hallen und Säulengängen standen Steinfiguren von Pharao und allen Göttern des Landes, wie sie anmutiger vorher nie geschaffen worden waren. Die Felder Ägyptens bescherten reiche Ernten, sodass die Kornkammern des Landes zum Bersten voll waren und niemand Hunger leiden musste. Fleisch und Fisch, Gemüse und Honig, Bier und Wein, es gab alles im Überfluss.
Ägypten erlebte unter Nimuria eine lange Zeit des Friedens. Viele Jahre hatten wir keine Kriege mehr geführt, hatte es keine Aufstände in Nubien, dem elenden Kusch, gegeben, musste kein Soldat unseres Landes unter Waffen sterben. Wie ich dir schon erzählte, war Pharao im fünften Jahr seiner Regierung mit seinem Heer nach Süden gezogen, um dort, wo der Atbara, der aus Äthiopien kommt, in den Nil fließt, weit südlich der fünften Stromschnelle, ein Heer von Aufständischen niederzuschlagen. Der Sieg Nimurias war so vernichtend, so überwältigend, dass das elende Kusch es nie mehr wagte, sich gegen Pharao zu erheben.
Ja, Nacht-Min, die Herrschaft Nimurias war von Amun, seinem göttlichen Vater, gesegnet. Und Nimuria selbst war gesegnet mit allen Wohltaten, die Amun ihm gewähren konnte. Die Große königliche Gemahlin Teje, meine Schwester, war eine erfahrene und stolze Frau. Mit großer Aufmerksamkeit nahm sie an allem Anteil, was im Land vor sich ging, und ihr Einfluss auf die Geschicke unseres Landes war größer, als mancher ahnte und es manchem recht war. Jeder, der mit einer Bitte an den König herantrat, tat gut daran, die Große königliche Gemahlin Teje nicht zu übergehen. Teje führte einen regen Briefwechsel mit den Herrschern Babylons und Mitannis, Syriens und Hattuschas. Sie verfügte über ein gewaltiges Vermögen, und zu Recht galt die Verwaltung ihres Palastes und ihrer Domäne im ganzen Land als vorbildlich.
Als ich in die Palastschule kam, begann eine Freundschaft, die bis zum Tode Nimurias unverbrüchlich hielt. Er hatte mir nie ein Amt gegeben. Ich führte unter seiner Herrschaft nur den Titel ‹Einziger Freund Seiner Majestät›, und doch hatte ich mehr Einfluss, war ich mächtiger als jeder Wesir, jeder General oder Priester. Ich kannte die Gedanken Nimurias, und er kannte meine. Mit eigener Hand rettete er mein Leben. Er ließ mich nach Babylon ziehen, damit ich dort die Liebe meines Lebens finden konnte, meine Merit. Er gab mir einen Palast, in dem Merit unserer Tochter Nofretete das Leben schenkte. Und er machte mich zum Erzieher seines zweitgeborenen Sohnes, des Prinzen Amenophis.
Der Prinz wurde nicht zum Herrschen geboren, denn er hatte einen älteren Bruder, Thutmosis. Amenophis war weich, oft in Gedanken versunken und der Gerechtigkeit, der Wahrheit in einem Maße verschrieben, wie es mir bei einem Menschen seines Alters bis dahin völlig fremd gewesen war. Es schien, als besäße er mit den siebzehn Jahren, die er damals zählte, die Weisheit eines Hundertjährigen. Sein Äußeres war nicht schön, eher eigentümlich. Auf einem langen, dünnen Hals saß ein großer Kopf mit übermäßig wulstigen Lippen, großen, schwarzen Augen und hervorspringenden Backenknochen. Seine Beine waren auffallend lang, doch er hatte pralle, runde Oberschenkel, während die Waden, wie auch seine Arme, dünn waren. Dennoch liebte ihn meine Tochter Nofretete über alles. Sie, die selbst so schön, so vollkommen war wie keine andere, deren Antlitz strahlte wie die Sonne, deren Augen glänzten wie alle Schätze dieser Welt und deren Gliedmaßen so vollendet waren, dass jede Göttin sie beneidete, meine Nofretete hatte keine Augen für sein Äußeres. Sie liebte seine reine Seele, sein gutes Herz.
Wie anders war da Prinz Thutmosis! Der Erstgeborene Pharaos, der Thronfolger, übertraf alle Söhne des Landes an Kraft und Schnelligkeit. Sein Körper war so makellos wie die Steinfiguren überall im Land, die Pharao zeigten. Es war, als wäre Prinz Thutmosis für Generationen von Bildhauern Vorbild gewesen und als hätte es dafür nie einen anderen gegeben als diesen erstgeborenen Sohn Pharaos. Er war gebildet und schrieb unsere Schriftzeichen so vollendet wie kaum ein Zweiter. Er sprach Akkadisch fehlerfrei wie seine Muttersprache, und nur Nimuria selbst übertraf ihn im Bogenschießen. Prinz Thutmosis war der Stolz seines Vaters, und er gab dem ganzen Land die Zuversicht, dass der Wohlstand, der innere wie äußere Friede, das goldene Zeitalter, in dem wir lebten, ja, das Glück Ägyptens ewig währten.»
Eje und Nacht-Min waren endlich im Arbeitszimmer des Herrschers angelangt. Eje ließ seinen Diener in zwei Becher aus Alabaster Wein einschenken und befahl ihm sodann, den Raum zu verlassen. Mit einem Fingerzeig bat er seinen besonderen Gast, auf einem der Stühle Platz zu nehmen. Er selbst blieb jedoch vor einer lebensgroßen Steinfigur aus dunkelgrünem Stein stehen und sah sie lange schweigend an. Es war Echnaton, den jetzt viele hinter vorgehaltener Hand den Ketzerkönig nannten.
Dann ging Eje zu seinem Schreibtisch und setzte sich bedächtig nieder. Im Schweigen suchte er nach der Erinnerung, nach der Erinnerung an Amenophis Waen-Re, der sich den Namen Echnaton gegeben hatte. Von ihm erzählte Eje in jener Nacht.
EINS
Ein königliches Opfer für Isis, Nephthys
und die Götter des Westens, dass sie geben den süßen Hauch
des Nordwindes für Thutmosis, den Gerechtfertigten.
Prinz Thutmosis war tot.
Er war die Hoffnung unseres Landes auf eine Zukunft gewesen, von der alle Menschen geträumt hatten. Auf eine Zukunft in Frieden, Wohlstand und Gerechtigkeit. Auf eine Zukunft, in der nur Maat, unsere göttliche Ordnung, herrschte. Der Prinz war voller Kraft und Tatendrang gewesen, von allen Untertanen geliebt und durch seine Erziehung ohne jeden Zweifel befähigt, die Beiden Länder als strahlender, mächtiger Horus zu regieren. Noch wenige Monate, und Nimuria hätte ihn zum Mitregenten ernannt. Aber diese Hoffnung wurde mit dem Tod des erst einundzwanzigjährigen Thronfolgers grausam zunichte gemacht.
Eine tiefe Trauer legte sich wie ein schwerer Schleier über die königliche Familie, ja über das ganze Land.
Nimuria und Teje baten mich, gemeinsam mit Prinz Amenophis nach Men-nefer zu reisen, um von dort den toten Thutmosis nach Waset zu holen, damit er hier bestattet werden konnte.
Seit meiner Heirat mit Ti war es das erste Mal, dass ich sie mit Nafteta und unserer Tochter Mutnedjemet für längere Zeit allein in unserem Palast zurückließ.
Am Abend vor unserer Abreise fuhr ich in den Palast der Goldenen Sonne, um mit Nimuria ein letztes Mal die Einzelheiten meiner Reise zu besprechen. Wie unzählige Male vorher erwartete er mich allein auf seiner Dachterrasse. Amenophis stand zwischen zwei Wedelträgern an der Brüstung und sah mit starrem Blick auf die andere Seite des Flusses, auf Waset und die Tempelanlage von Ipet-sut. Ein leichtes Obergewand verdeckte seine Leibesfülle, und auf dem Kopf trug er das Nemes-Kopftuch mit dem königlichen Stirnband, von dessen Vorderseite Kobra und Geier, Uto und Nechbet, die Herrinnen der Beiden Länder, emporragten.
«Glaubst du, dass den Dienern Amuns das Blut meines Sohnes an den Händen klebt?», fragte er mich ohne Umschweife und ohne sich nach mir umzudrehen. Ich schwieg, bis Pharao sich mir zuwandte. Dann antwortete ich.
«Mit fünfzehn Jahren gabst du in Men-nefer den Befehl, einen gerade im Bau befindlichen Tempel Amuns niederzureißen. Mit der Erweiterung des Tempels von Ipet-sut und der Verpflichtung der Priester, sich an den Baukosten zu beteiligen, hast du den Schatz Amuns halbiert. Dein Palast steht nicht in Waset, sondern hier, auf der Westseite des Flusses, und Tag für Tag blicken die größten Steinfiguren Ägyptens von deinem Tempel der Millionen Jahre hinüber nach Ipet-sut in das Antlitz Amuns. Seit Jahren huldigst du mehr und mehr Re-Harachte und Aton, und dein zweiter Sohn scheint dich darin übertreffen zu wollen. Ich glaube nicht, Ameni, dass sie dir und deiner Familie besonders freundlich gesonnen sind.»
«Du hast meine Frage nicht beantwortet, Eje», hakte Amenophis nach, und sein Blick wurde jetzt noch ernster.
Ich wollte mich aber nicht festlegen lassen, auf keinen Fall. Antwortete ich mit Ja, würde er von mir Beweise verlangen. Sie zu erbringen, hielt ich für unmöglich. Sagte ich Nein, könnte er glauben, ich wäre feige, und er wäre von mir unendlich enttäuscht. Ich wich ihm erneut aus.
«Ich werde in Men-nefer nichts unversucht lassen, um die Wahrheit zu erfahren. Ich bin vorsichtig geworden, Ameni. In der Vergangenheit sind zu viele Dinge geschehen, für die wir keine Erklärung fanden. Denke nur an das schreckliche Ende von Anen. Obwohl er selber ein Priester Amuns war, lag er eines Tages, nachdem er mich gewarnt hatte, tot vor dem Torturm und zu Füßen einer deiner Steinfiguren. Wenn wir uns jetzt in unserer Meinung festlegen, könnte noch Schlimmeres passieren.»
Ich spürte, wie Amenophis in seinem Inneren zusammensackte, als hätte er jede Hoffnung, die Wahrheit über den Tod seines Sohnes zu erfahren, aufgegeben.
«Ameni», rief ich mit flehender Stimme. «Wenn es mir gelingt, dir den Beweis eines Verbrechens zu liefern, wenn sie es waren, die das Ende deines Sohnes beschlossen haben, dann magst du an ihnen Rache nehmen, und es soll ihnen ewige Verdammnis drohen. Wenn nicht, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als fest daran zu glauben, dass es der Götter Wille war, der dir den Sohn nahm. Dann darfst du den Dienern Amuns nicht den Hauch eines Gefühls geben, als seiest du eingeschüchtert und demütig.»
«Hat Pharao keine andere Wahl, Eje?»
Voll Mitleid sah ich ihn an und schüttelte zaghaft den Kopf.
Nach einer langen Weile des Schweigens atmete er schwer durch, zeigte mit der Rechten auf einen Sessel und bat mich so, Platz zu nehmen. Dann schnippte er mit den Fingern und bedeutete einem Diener, unsere Becher zu füllen. Es war der beste Rotwein, den es in Waset gab. Er wuchs in der Domäne Amuns.
«Wie du gesehen hast», fuhr er jetzt fort, und wie ein wahrhafter Herrscher war er jetzt wieder ruhig und gefasst, «liegt für Amenophis und dich ein Ruderschiff bereit. Ich möchte, dass du so schnell als möglich in Men-nefer eintriffst, um vielleicht noch auf frische Spuren zu stoßen. Niemand weiß etwas von unserer Eile, und man rechnet mit deinem Eintreffen erst in Wochen. Du hast die kräftigsten Ruderer und die besten Soldaten bei dir. Mein alter Schiffsbaumeister Meru wird selbst das Schiff lenken, damit ihr Tag und Nacht durchfahren könnt. Was du in Men-nefer zu tun hast, wirst du selbst wissen. Nur, Eje, bedenke eines: Du allein trägst die Verantwortung für meinen Sohn. Ich habe keinen anderen Thronerben mehr.»
Ameni trank seinen Becher in einem Zug aus und ließ erneut einschenken. Dann sah er wieder nachdenklich nach Waset hinüber.
Der Schein der untergehenden Sonne ließ die Stadt erglühen, die Paläste, Tempel und Häuser flimmerten goldgelb und rot wie flüssiges Erz. Darüber wölbte sich der Himmel, dessen klares Blau nur allmählich in ein dunkles Grau wechselte. Dann, als die Sonne endgültig versank und Re seine Nachtfahrt antrat, verlor zuerst das vor uns liegende Land seinen Glanz, dann der Fluss und die dahinter liegenden Häuser, bis zuletzt nur noch die Türme der Tempel und Paläste und die vergoldeten Spitzen der Obelisken für eine kurze Weile im Schein des Sonnengottes strahlten, bevor auch sie im Schatten der hereinbrechenden Nacht verschwanden.
«Immer wieder vergehen, immer wieder entstehen», murmelte Ameni in Gedanken versunken vor sich hin. Er zeigte mit seiner Linken nach Westen, dorthin, wo in den steilen Felswänden des Gebirges die Königsgräber liegen, und sagte: «Wenn wir einmal dort drüben Einzug halten, ob wir dann auch jeden Morgen wie Re…»
Er brach seinen Satz ab und sah mich mit einem Blick an, der mir verriet, dass er sich schwer tat, daran zu glauben.
«Weißt du es besser?», fragte ich leise, und gab mir dann doch selbst die Antwort. «Seit mehr als tausend Jahren verbringen die Menschen unseres Landes ihr Leben auf dieser Welt nur in dem Bemühen, alles Erdenkliche für das Dasein im Jenseits zu tun. Unser ganzes Handeln ist darauf ausgerichtet, hier gute Werke zu vollbringen, Maat gerecht zu werden, damit wir auch in der Ewigkeit von Osiris für gerecht befunden werden. Ein jeder richtet nach seiner Stellung und seinen Möglichkeiten Wohnungen der Ewigkeit ein, damit wir im jenseitigen Leben als Gerechtfertigte immer wieder aufs Neue einen schönen Tag verbringen.»
Ich hielt kurz inne, dann fuhr ich fort.
«Wissen? Nein, Ameni. Es weiß niemand. Aber ich glaube es gerne. Denn so fällt mir vielleicht eines Tages das Sterben leichter.»
«Und wenn morgen ein Priester kommt, einer, dem du vertraust, den du für weise hältst, und er sagt dir, es sei doch alles anders? Glaubst du dann ihm?»
«Irgendetwas wird sein, Amenophis, irgendetwas.»
Ich verließ in dieser Nacht den Palast Nimurias mit dem bedrückenden Gefühl, dass sich Amenis Leben durch den Tod seines Sohnes Thutmosis grundlegend geändert hatte. Er war sich nicht mehr sicher, dass all das, was er vollbracht hatte, richtig war, dass es einen Sinn gehabt hatte. Anders konnte ich mir seine Zweifel nicht erklären. Es war aber noch nicht an der Zeit, ihm die Frage zu stellen, warum er zweifelte. Ich brachte es nicht fertig, weil ich Angst davor hatte, er würde zusammenbrechen, wenn er feststellte, dass es vor allem Ruhmsucht war, die ihn getrieben hatte, all die mächtigen Bauwerke zu errichten. Vielleicht würde Nimuria erkennen, dass der wahre Anlass für sein Wirken und Treiben über all die Jahre nicht tragfähig war, um Grundlage für ein Lebenswerk zu sein. Aber war ich mir denn sicher, den wahren Grund zu kennen? Es sollten noch viele Jahre vergehen, ehe ich mir, nur mir, eine Antwort geben konnte.
Es begann gerade zu dämmern, als ich mein Haus verließ. War wenige Augenblicke vorher der durchdringende Jubel einer Nachtigall das Einzige gewesen, was ich im Dunkel der Nacht vernommen hatte, so stimmte jetzt eine Amsel nach der anderen ein. Erst war es nur eine, die leise und zaghaft ihr Morgenlied anstimmte, dann eine zweite, doch bald war der ganze Garten erfüllt vom Gesang all der Vögel, die hier ihre Heimat hatten, und um so stiller wurde die Nachtigall, ehe ihr unvergleichlicher Gesang gänzlich verstummte. Als junger Mensch hatte ich dieses Erwachen des Tages oft erlebt. Nach einem Fest, das bis in den Morgen dauerte, oder wenn mich die Liebe erst bei Tagesanbruch einschlafen ließ.
«Komm gesund wieder», flüsterte mir Ti zu, als ich mich über sie gebeugt hatte, um sie zum Abschied zu küssen.
«Ich komme bald zurück, meine Ti», sagte ich leise für mich, als ich jetzt am Tor meines Gartens angelangt war, und mich noch einmal umdrehte, um einen Blick zurückzuwerfen, ehe ich auf den Wagen stieg, der mich schon erwartete. Ti stand auf der Terrasse, und wir winkten einander zu. Jetzt, ausgerechnet jetzt, da ich meine Ti für einige Wochen verlassen musste, dachte ich an Merit, meine erste Frau. Seit siebzehn Jahren war sie schon tot, doch wie würde sie jetzt aussehen, wäre sie noch am Leben? Wären wir noch immer die glücklichsten Menschen der Welt, die wir einmal waren? Oder hätte der Alltag seinen Schleier der Gleichgültigkeit auch über unsere Liebe geworfen? Ich spürte, wie meine Augen feucht wurden. Sollte ich mich meiner Tränen, die ich für Merit vergoss, schämen? Ti wusste, wie sehr ich Merit geliebt hatte, hatte sie doch schon Jahre vor deren Tod in meinem Haus gelebt. Aber es war offenkundig, wie sehr ich jetzt Ti liebte, und ich ließ sie hierüber keinen Tag im Zweifel. Sicher, es war nicht die Liebe von jungen Menschen, die nicht mehr wahrnehmen, was neben ihnen geschieht, die vor Freude singen und tanzen, unendlich lange Liebesbriefe schreiben und meinen, sie müssten sterben, sollte diese Liebe je ein Ende finden. Es war vielmehr eine sehr bewusst erlebte Liebe, tief verankert im Herzen und gepaart mit der Gewissheit, den richtigen Weggefährten für die letzten Lebensjahre gefunden zu haben. Ja, mit dieser Gewissheit verließ ich an diesem Morgen Ti.
Der Wagenlenker fuhr nicht übermäßig schnell. Er wusste nicht, welch wilder Fahrer ich einst gewesen war, wahrscheinlich nahm er sogar auf mein Alter Rücksicht. Mir war es recht, denn so konnte ich ohne jede Hektik die Kühle des Morgens genießen, bis wir im Hafen eintrafen.
Das Schiff war zum Ablegen bereit. Nebenkemet, der Kommandant der königlichen Flotte, den alle Meru nannten, stand zwischen einem Spalier von vierundzwanzig Soldaten an der Hafenmauer und begrüßte mich wie einen alten Freund.
«Ich glaubte schon, du hättest verschlafen, Eje», rief er mir zu, als ich vom Wagen stieg. Dann hielt er mir die rechte Hand zum Gruß entgegen, und mit der Linken klopfte er mir auf die Schulter.
«Ich bin hoffentlich nicht der Letzte?», fragte ich etwas verlegen, denn ich fürchtete, Prinz Amenophis war vor mir eingetroffen. Ehe Meru mir eine Antwort geben konnte, hörten wir das Trampeln von Pferdehufen. Ein Trupp von acht Streitwagen jagte von Osten kommend auf der breiten Prachtstraße zum Hafen. An ihrer Spitze fuhr Prinz Amenophis. Wagenrennen waren die einzige Leidenschaft, die er von seinem Vater geerbt hatte.
«Wenn es mir deine Stellung nicht verbieten würde, Prinz Amenophis, und wenn ich nicht schon ein älterer Herr wäre, ich hätte dich schon längst zu einem Rennen herausgefordert», rief ich ihm entgegen und verbeugte mich tief, wie die anderen auch, als er auf uns zutrat.
«Oh Eje, alter Schmeichler! Wüsste ich nicht von meinem Vater, welch waghalsiger Wagenlenker du immer gewesen bist, ich würde deine Herausforderung noch hier annehmen. Doch wir haben Eile, nach Men-nefer zu kommen.»
In wenigen Sätzen sprang er auf das Schiff und nahm, ohne dass um seine Person Aufsehen gemacht werden durfte, unter dem Baldachin Platz, geradeso, als wäre er ein einfacher Offizier und nicht der Sohn des Guten Gottes.
In knappen Worten erteilte Meru seine Befehle, und kurze Zeit später legte unser Schiff ab. Die gleichmäßigen Schläge der zwanzig Ruder trieben die schlanke Barke mit der Strömung zügig nach Norden, vorbei an der Stadt, ihren Gärten und Feldern.
Über dem Fluss lagen da und dort noch Schleier des nächtlichen Nebels, denn es war kühl. Die wenigen Fischer, die schon so früh am Morgen ihr Glück versuchten, beachteten uns nicht, denn das schlichte Äußere des Kriegsschiffes verriet ihnen nicht, dass Pharaos einziger lebender Sohn, der Thronfolger Amenophis, auf ihm fuhr.
Waset lag schon weit hinter uns, als sich der Prinz von seinem Platz erhob und an die Reling trat. Er hielt sich mit beiden Händen am Geländer fest und blickte mit weit geöffneten, regungslosen Augen nach Osten. Als die ersten Sonnenstrahlen hinter den Bergen hervorblitzten, als Chepri, die emporsteigende Sonne, ihre zarten Arme nach Amenophis ausstreckte, erhellten sich die Gesichtszüge des Prinzen. Erst als die Sonnenscheibe über dem Horizont stand, schloss er die Augen und genoss das wärmende Licht des erscheinenden Gottes, ja es war, als saugte er die Sonnenstrahlen mit seinem ganzen Körper in sich auf. Der Prinz war völlig in Gedanken versunken, seine Gesichtszüge zeigten nicht die geringste Regung, und doch schien er zufrieden zu lächeln. Mir war, als würde Amenophis nicht einmal mehr atmen, und ich musste ihn genau betrachten, um zu bemerken, dass sich seine schwächliche Brust ganz leicht hob und senkte.
So stand die Sonnenscheibe schon hoch über den östlichen Hügeln, als mein Schüler noch immer regungslos dastand. Schweißperlen sammelten sich auf seiner hohen Stirn, und erst, als sich genügend Tropfen gesammelt hatten, um vereint als dünne Spur über seine Wangen und den schlanken Hals hinabzugleiten, erst jetzt öffnete Amenophis die Augen, seine Hände ließen das Seil der Reling los, und er wandte sich wieder mir zu.
«Ist es nicht ein Wunder, das wir jeden Tag erleben? Ich kenne nichts, was mich so tief berührt, wie der heranbrechende Tag und der kurze Augenblick, bis sich die Sonnenscheibe über den Horizont erhoben hat.» Der Prinz breitete die Arme aus. «Erhebt sich nicht unser Geist und sehnt sich danach, eins zu sein mit dieser göttlichen Erscheinung? Mich erfüllt bei diesem Anblick immer wieder ein Gefühl tiefer, inniger Dankbarkeit. Welch erbärmliche Geschöpfe müssen das sein, die nichts dabei empfinden, die diesen täglichen Akt des Neubeginns der Schöpfung nicht mit dankbarem Herzen bejubeln!»
Ich schwieg. Amenophis trat auf mich zu, legte seine Hände auf meine Schultern und sagte mit seiner ruhigen und wohlklingenden Stimme: «Ich weiß Eje, dass du so denkst, so fühlst wie ich. Du hast es Nafteta gelehrt, und sie lehrte es mich.»
Prinz Amenophis wandte sich von mir ab und besah sich allein das Schiff, ehe er von Meru bemerkt wurde. Bereitwillig erklärte dieser seinem künftigen Herrscher jede Kleinigkeit und beantwortete ihm alle Fragen.
Ich blieb unter dem Baldachin zurück, denn es begann, heiß zu werden. Die Worte des Prinzen hatten mich verwirrt. Langsam setzte ich mich nieder und sah schweigend in den Fluss, so, als würde ich dort eine Antwort finden können. Er hatte gewiss Recht, denn mich begeisterte schon immer der Anbruch eines neuen Morgens, das tägliche Erwachen der Natur. Ich hätte aber nie daran gedacht, dies mit so inniger Frömmigkeit zu tun, ja einen Sonnenaufgang mit einer geradezu kultartigen Handlungsweise zu begleiten.
Ich wusste schon seit langem, dass meine Tochter Nofretete und Prinz Amenophis vieles über alle Erscheinungsformen der Sonnengottheiten wussten, dass sie Priester und alte, weise Männer befragten und mit ihnen ihre Gedanken austauschten. Ich wusste auch, dass beide noch mehr als Nimuria Gefallen fanden am Atonkult. Doch nun fragte ich mich zum ersten Mal, wohin das alles führen würde.
Die Genauigkeit und Geradlinigkeit, die Amenophis in allen anderen Dingen an den Tag legte, beruhigte mich wieder. Er war von einem Wissensdrang, wie man ihn als Lehrer – und im Grunde war ich nichts anderes als sein Lehrer – nur selten erlebt. Verstand er etwas nicht auf Anhieb, fragte er nach, ohne darüber Scham zu empfinden. Ihm war bewusst, dass er mit seiner Gründlichkeit so manchen bis an den Rand der Geduld brachte, und es war wohl seinem Rang als Königssohn zu verdanken, dass jeder bis zuletzt freundlich blieb. Der Prinz lehrte mich einen Grundsatz: Nur das habe ich begriffen, was ich selber einem anderen bis in jede Kleinigkeit und fehlerfrei erklären kann.
Daran sollte er sich ein Leben lang halten.
Wir sprachen viel miteinander in diesen Tagen. Amenophis war begierig danach, alles von mir zu erfahren, was ich wusste, was ich erlebt hatte. Erzählte ich ihm von meiner Reise an den Euphrat, die ich als junger Mann im Auftrag seines Vaters unternommen hatte, von Babylon und dem königlichen Palast von Dur-Kurigalzu, davon, wie ich dort meine erste Frau Merit kennen lernte, dann hörte er mir schweigend und mit unendlicher Geduld zu, ohne mich auch nur einmal zu unterbrechen.
Wie anders aber verhielt er sich, als ich ihm von unserem Feldzug nach Nubien berichtete, von der Schlacht gegen Icheni, den Anführer der Aufständischen von Kusch, Irem, Tiurek und Weresch, davon, wie der unbeugsame Icheni und zwei seiner Mitstreiter nach der Schlacht hingerichtet wurden, davon, wie die Soldaten Ichenis zuvor den tapferen Offizier Maj gefoltert und verstümmelt hatten, sodass ihn Pharao aus Mitleid mit eigener Hand von seinen Qualen erlöste. Da empörte sich der Prinz über so viel Ungerechtigkeit und Grausamkeit, über so viel unnötiges Leid, welches sich Menschen gegenseitig zufügten! Er presste die Lippen zusammen, und seine Augen huschten unruhig umher.
Dann platzte es aus ihm heraus: «Glaubst du wirklich, Eje, dass die Götter Wohlgefallen daran finden, wie sich ihre Geschöpfe gegenseitig quälen und umbringen?»
«Dein Vater, er lebe, sei heil und gesund, war und ist der Herrscher über die Beiden Länder und alle Welt ist ihm untertan. Er ist als unser König verantwortlich dafür, dass Maat herrscht, die göttliche Ordnung. Icheni und seine Horden haben diese Ordnung verletzt und damit den Zorn Pharaos heraufbeschworen. Sie haben einen Offizier Pharaos auf das Grausamste gefoltert, und sie haben sich zuletzt geweigert, Pharao Treue zu schwören und seine Gnade zu erbitten. Kannst du in dem Handeln deines Vaters Unrecht erkennen, Amenophis?»
«Die Art deiner Frage verbietet es mir, eine ehrliche Antwort zu geben. Wie könnte ich behaupten, dass Pharao Unrecht begeht. Er mag richtig gehandelt haben, Eje. Mir aber stellt sich die Frage, ob man auch anders, vielleicht besser hätte reagieren können. Ich bin mir bewusst, dass mir die Kunst des Herrschens noch fremd ist. Man hat sie nur meinen Bruder gelehrt. Ich fühle aber, nein, Eje, ich weiß, dass es noch etwas anderes gibt, als Gerechtigkeit nur um der Gerechtigkeit willen.»
Ich konnte ihm keine Antwort geben, denn mich beschlich eine Ahnung, dass er vielleicht Recht haben könnte.
Auf unserer Fahrt nach Norden gingen wir nur viermal an Land, um unsere Vorräte an Wasser und Brot aufzufüllen. Mit allem anderen waren wir ausreichend versorgt. Obwohl Meru und ich höflich zur Eile mahnten, ließ sich der Prinz nicht davon abhalten, an Land zu gehen und mit den Menschen zu sprechen. Er tat dies aber nicht, wie es dem Sohn Pharaos entsprochen hätte, mit Abstand und Herrscherwürde. Nein, er ging selbst auf die einfachen Menschen zu, begrüßte sie freundlich und fragte nach ihren Sorgen und Nöten. Manche der Angesprochenen waren überrascht, ja verwirrt, denn es lag völlig außerhalb ihres Vorstellungsvermögens, dass sich der Sohn des Guten Gottes ihnen zuwandte. Dank meines außerordentlichen Gehörs konnte ich einmal vernehmen, dass man den Prinzen wegen seines leutseligen Umgangs sogar für geistesschwach hielt. Anderen dagegen war anzusehen, wie sehr sie durch die Begegnung mit ihrem künftigen Herrscher beglückt wurden, und sie priesen diesen Tag als den schönsten und wichtigsten ihres sonst so bedeutungslosen Lebens.
Meru und ich schwiegen und ließen Prinz Amenophis gewähren.
Genau wie es Meru bei Antritt der Reise berechnet hatte, trafen wir am Abend des neunten Tages in Men-nefer ein. Noch am frühen Morgen entsandte ich an Land einen berittenen Boten in den Palast des Wesirs Ramose, um unser Eintreffen anzukündigen. Gleichzeitig bat ich Ramose in meinem Schreiben darum, jeden Aufwand zu vermeiden, damit wir unbemerkt in den königlichen Palast gelangen konnten.
Als unser Schiff anlegte, dauerte es noch eine ganze Weile, ehe plötzlich vier Wagengespanne auftauchten und neben dem Landungssteg anhielten. Ein Mann von gut vierzig Jahren stieg vom ersten Wagen und kam auf uns zu, als wir gerade den Boden von Men-nefer betreten hatten. Er verneigte sich tief vor Prinz Amenophis. Es war Hebi, dessen Vater Ramose Wesir des Nordens war. Er begann einst seine Laufbahn als Schreiber Seiner Majestät, dann war er einige Jahre Verwalter meines Palastes, bis er Bürgermeister von Men-nefer wurde. Mit wenigen, doch gleichwohl freundlichen Worten bat er uns, die Gespanne zu besteigen, um uns zum Palast zu bringen. Amenophis bestieg den Wagen Hebis, lächelte ihm freundlich zu und sagte: «Ich kenne den Weg zum Palast.»
Dann streckte er Hebi die Hand entgegen und bat ihn so um die Zügel. Hebi verstand, übergab die Zügel, und hielt sich sogleich mit beiden Händen an der Brüstung des Streitwagens fest. Ich nahm die offenkundige Herausforderung des Prinzen an, ergriff ebenfalls die Zügel meines Gespanns, und sogleich begann eine Hetzjagd mitten durch das nächtliche Men-nefer, wie ich sie zuletzt vor über zwanzig Jahren mit meinem Freund Ameni erlebt hatte. Ich war über die Maßen erstaunt, mit welchem Geschick ich trotz meines Alters noch den Wagen zu lenken vermochte, und spürte, dass ich durchaus in der Lage gewesen wäre, Prinz Amenophis zu bezwingen. Doch wie damals, so wagte ich es auch an diesem Abend nicht, ein Mitglied der Königsfamilie, und sei es nur andeutungsweise, einer Schmach auszusetzen, und ließ meinen Schüler mit reichlichem Vorsprung den Königspalast von Men-nefer erreichen.
Wie oft schon war ich in diesen Palast zurückgekehrt, dorthin, wo ich in meiner Jugend vor der Krönung meines Freundes Ameni einige Wochen verbracht hatte. Die Räume, die mir mein Freund einrichten ließ, waren nahezu unverändert. Einige Möbelstücke waren ersetzt, da ich vieles nach Waset mitgenommen hatte. Die Wandgemälde, die Fußböden waren unverändert, selbst die alten Vorhänge waren noch da. Mich erstaunte sehr, dass auch der diesen Räumen eigene Geruch über all die Jahre erhalten geblieben war. Man hätte mir die Augen verbinden können, und ich hätte dennoch gewusst, wo genau ich mich befand. In das vertraute Zuhause der Kindheit kehrt man offenbar immer wieder voll Freude zurück, so wie man ein Leben lang gerne zu seiner Mutter kommt, ganz gleich, wie lange die Kindheit zurückliegt.
Wie vor nahezu dreißig Jahren saß ich mit angezogenen Beinen im Fenster meines Schlafzimmers und blickte in den Garten hinaus. Der Palast mit seinen vielen Sälen, Hallen und Zimmern, meine Wohnräume und der mir so vertraute Geruch ließen mich jünger werden und gaben mir ein wenig von der Unbekümmertheit früherer Tage zurück. Doch ein Blick in den Garten machte mir nur allzu deutlich, wie viel Zeit vergangen war. Die Bäume, die ich noch mannshoch kannte, überragten jetzt um vieles die Palastmauern und die meisten Gebäude. Die Kieswege waren von den alten Sträuchern fast ganz zugewachsen, und es war nicht zu übersehen, dass Nimuria und sein Hofstaat kaum mehr in Men-nefer weilten. Ja, es war viel, sehr viel Zeit vergangen.
Hebi war ein überaus freundlicher Mann. Wie es der Mode entsprach, trug er einen kurzen, rechteckig geschnittenen Kinnbart. Seinen Kopf bedeckte eine tadellose Perücke, und darunter strahlte stets dasselbe fröhliche Gesicht. Obwohl er so viel älter war als Prinz Amenophis, war ich mir sicher, dass er am Hof des künftigen Herrschers einen bedeutenden Posten einnehmen würde. Noch am Abend unserer Ankunft bat ich Hebi darum, während unseres Aufenthaltes in Men-nefer Prinz Amenophis uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen. Der Prinz musste keinen offiziellen Verpflichtungen nachkommen, und so verabredeten sich beide schon für den nächsten Morgen. Mir kam diese Verbindung sehr gelegen, konnte ich doch so ungestört meiner eigentlichen Aufgabe nachgehen.
Mit großer Verwunderung stellte ich am folgenden Morgen fest, dass der Leichnam des Prinzen Thutmosis nicht im königlichen Reinigungszelt auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses lag, sondern weiter flussabwärts, am nördlichen Stadtrand von Men-nefer. Der Wesir Ramose selbst versicherte mir, dass der Körper des Toten zunächst feierlich auf das westliche Ufer gebracht worden war. Weswegen er jetzt nicht mehr dort war, wusste er nicht.
Die Werkstätte der Balsamierer war der widerlichste Ort, den ich mir vorstellen konnte. Schon von weitem wehte mir der Gestank menschlicher Eingeweide, von Blut und ranzigem Fett entgegen. Der königliche Leibarzt Ramessu, der mich begleitete, machte sich wenig daraus und schwatzte unentwegt auf mich ein. Obwohl ich mir ständig ein mit Duftöl getränktes Tuch vor die Nase hielt, war mir schon übel, bevor wir den schrecklichsten aller Orte erreicht hatten. Es war die größte Werkstätte dieser Art, die ich je sah, und es herrschte ein emsiges Kommen und Gehen, ein Schreien und Schachern wie auf einem Markt. Auf den ersten Blick ließ sich erkennen, wer von den Trauernden einen Toten brachte und wer gekommen war, um einen einbalsamierten Körper abzuholen. Bei den Männern, die einen Toten brachten, sah man nur kurze Bartstoppel, und ihre Frauen hatten vom vielen Weinen verquollene und gerötete Augen. Die Männer, die einen Balsamierten holten, trugen stattliche Trauerbärte, und die Mienen der Frauen waren längst nicht mehr von Trauer gezeichnet. Die einfachen Leute, Tagelöhner, Bauern und Arbeiter, wurden mit ihren Toten vor dem Eingang abgefangen und auf ein Gelände seitlich der eigentlichen Werkstätten geleitet. Diese Verstorbenen legte man zusammen mit vielen anderen Leichen in Gruben, ohne ihnen die Eingeweide und die inneren Organe entfernt zu haben. Dann warfen die Hilfsarbeiter der Balsamierer ein paar Schaufeln Salz auf die Leichen und ließen sie einige Tage dort liegen. Dann wurden die Toten, ohne dass sie auch nur annähernd ausgetrocknet waren, in Leinensäcke eingenäht und an die Familien zurückgegeben. Meist reichten ihre Mittel nur für ein einfaches Begräbnis im Sand der Wüste.
Die Wohlhabenderen unseres Volkes wurden dagegen ins Innere der Anlage gebeten, wo man ihnen Binden und Amulette, Särge und Gesichtsmasken, Eingeweidekrüge und Salböle vorführte und ihnen versicherte, die lieben Toten auf das Sorgsamste für die Ewigkeit vorzubereiten. Entsprechend hoch war auch der Lohn der Balsamierer.
Lediglich die Verstorbenen der Vornehmsten unseres Landes wurden so behandelt, wie ich es mir immer vorgestellt hatte, abseits und in aller Stille und mit der Würde, die ihnen zukam.
Der Vorsteher der Balsamierer hieß Sethi. Er war mir auf den ersten Blick unangenehm. Ich stellte mich kurz vor, zeigte ihm das königliche Siegel und erkundigte mich ohne Umschweife nach der Leiche des Prinzen. Er begleitete mich und den schwatzhaften Ramessu in einen abseits gelegenen Saal, in dessen Mitte ein großer Steinblock, der Balsamiertisch, stand.
Sethi zeigte auf den Tisch und flüsterte mir und Ramessu gekünstelt ehrfurchtsvoll zu: «Unter dem Salz ruht der Körper von Prinz Thutmosis.»
Aus zwei Schalen seitlich des Tisches stieg unentwegt Weihrauch empor, was den Geruch in diesem Raum erträglich machte. In einer Ecke standen die vier Eingeweidekrüge.
«Wie lange liegt sein Körper schon unter dem Salz?», fragte ich Sethi, der mich mit aufgeregt flackernden Augen anstarrte. Er drehte sich nach einem seiner Arbeiter um und gab so die Frage an diesen weiter.
«Zehn Tage, hoher Herr. Genau zehn Tage.»
«Wartet einen Augenblick», sagte ich knapp und nahm Ramessu zur Seite. Ich schob ihn vor den Eingang und flüsterte ihm zu: «Kann man in diesem Zustand noch irgendwelche äußeren Einwirkungen auf den Körper erkennen?»
Ramessu schüttelte den Kopf. «Herr, Prinz Thutmosis wurde weder erstochen noch erschlagen. Das hätte ich beim Auffinden seiner Leiche bemerkt. Derartige Verletzungen würde man immer erkennen können.»
«Und Gift? In den Innereien und Eingeweiden?», fragte ich weiter. «So manches Gift ließe sich gewiss auch jetzt noch erkennen.»
Ramessu zeigte in Richtung der Balsamierhalle und sprach noch leiser als zuvor. «Doch wer sagt Euch, dass sich in diesen Krügen überhaupt Leber, Lunge, Magen und Gedärm von Prinz Thutmosis befinden? Nicht einmal der Rumpf unter dem Haufen Salz muss der des Prinzen sein», fuhr der Arzt fort.
Ich war entsetzt.
Ramessu ließ sich nicht aufhalten. «Manche Balsamierer trennen den Kopf des Toten ab, um das Gehirn einfacher entfernen zu können. Danach wird der Kopf mit einem Stock aufgesetzt und angenäht. Hierher gelangen jeden Tag unzählige Körper, die unbemerkt gegen den des Prinzen ausgetauscht werden könnten.»
«Selbst wenn Prinz Thutmosis eines gewaltsamen Todes starb, werden wir an dem Körper unter dem Salz nicht die Spur einer Gewalttat entdecken, wenn seine Mörder mit diesem Gesindel hier zusammenarbeiten», stellte ich resignierend fest.
«So ist es, mein Herr», bestätigte mir Ramessu, zufrieden, dass ich seine Lektion verstanden hatte.
Im Grunde gab es hier nichts mehr für uns zu tun. Wir gingen zurück in den Saal, und ich fragte Sethi, wann er seine Arbeit an Prinz Thutmosis vollendet haben würde.
«In genau dreißig Tagen kann er geholt werden, hoher Herr, damit er von den Priestern gesalbt, gewickelt und mit Amuletten versehen werden kann.»
Ich verneigte mich zum Dank und bat Sethi mit einem Handzeichen, uns zum Ausgang zu führen.
Während Sethi und Ramessu bereits losgingen, fasste mich der Helfer Sethis von hinten am Arm und sagte mit leiser, ja ängstlicher Stimme: «Es gibt einiges zu sagen, Herr. Morgen nach Sonnenuntergang am Hafen, wo Euer Schiff liegt.»
Ich nickte nur, um ja kein Aufsehen zu erregen und folgte den anderen. Sethi hatte nichts bemerkt, und so verließen wir nach einem knappen und förmlichen Abschied diese Grauen erregende Stätte.
Ich erzählte Ramessu kein Wort von dem beabsichtigten Treffen am Hafen, denn ich musste ausschließen, dass irgendjemand davon erfuhr und die Begegnung mit dem Unbekannten vereiteln würde. Der Balsamierer schien mir in viele Dinge eingeweiht zu sein, denn woher sollte er sonst wissen, mit welchem Schiff ich am Abend vor unserer Begegnung nach Men-nefer gekommen war? Der Ekel über das gerade Erlebte lastete noch auf mir, bis wir in die Stadt zurückgekehrt waren und ich vom Anblick der vielen Menschen und von ihrem geschäftigen Treiben abgelenkt wurde. Gleichwohl ließ mir der tote Prinz keine Ruhe.
«Ist es möglich, einen Menschen zu töten, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen?», fragte ich Ramessu, kurz bevor wir den Palast erreichten.
Erst sah er mich etwas ratlos an, dann sagte er: «Oh ja! Wenn man dem Opfer gleichmäßig ein großes Kissen fest auf das Gesicht drückt, erstickt es, ohne dass Druckstellen zurückbleiben. Wenn es nicht gerade ein altersschwacher oder ein volltrunkener Mensch ist, wird er sich aber heftig wehren, sodass man alle Gliedmaßen festhalten müsste, damit das grausige Werk gelingt.»
Das half mir auch nicht weiter, denn ich wusste, dass der Prinz nur selten Wein trank, und bei seiner Kraft hätte es der halben Leibgarde bedurft, um seine Gegenwehr zu brechen.
Ich hätte jetzt die gesamte Priesterschaft von Men-nefer befragen können, die Palastwache, alle Dienerinnen und Diener, und doch würde ich wohl von keinem eine Antwort erhalten, wie Prinz Thutmosis starb und wer seinen Leichnam zu den Balsamierern im Norden der Stadt bringen ließ.
So blieb mir nur noch der unbekannte Balsamierer.
Nach meiner Rückkehr in den Palast ließ ich mich von Ramose in die Gemächer des Prinzen führen und bat darum, in den folgenden beiden Stunden allein gelassen zu werden.
Ich konnte mich des Eindruckes nicht erwehren, als hätte Thutmosis in diesen Räumen nie wirklich gelebt. Im Schlafzimmer des Prinzen fand sich außer zwei Truhen mit Kleidungsstücken kein einziger persönlicher Gegenstand. Da lag kein vergessener Armreif, kein in Eile liegen gelassenes Schweißtuch, keine Perücke, kein Kamm, keine Sandale. Im Wohnraum sah es kaum anders aus. Ich fand keinen Gegenstand, von dem ich mit gutem Gewissen hätte behaupten können, dass er einst dem Prinzen gehört hatte. Nur sein Bogen und der Köcher mit einigen Pfeilen hingen an einer Wand.
Dann betrat ich das Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch lagen das goldene Behältnis mit Thutmosis’ Schreibzeug und zwei unbeschriebene Papyrusblätter. Daneben stand das aus Elfenbein geschnitzte Königspaar. Es war mein Geschenk an den Prinzen aus Anlass seiner Volljährigkeit. Hinter dem Schreibtisch stand ein Holzregal, in welchem fein säuberlich geschichtet unzählige Papyrusrollen lagen. Während ich eine von ihnen wahllos herauszog, überkam mich ein schlechtes Gewissen, drang ich doch jetzt möglicherweise in persönlichste Bereiche des Toten ein. Ich konnte auf Gedichte stoßen, auf einen Briefwechsel des Prinzen oder auf sonstige geheime Aufzeichnungen. Aber war es nicht gerade das, was ich zu finden gehofft hatte?
Ich wurde herb enttäuscht. Landkarten ohne Zahl, Bewässerungspläne, Bauzeichnungen für Tempel und Kultstätten jeder Art und Abschriften zahlreicher religiöser Texte waren alles, was ich vorfand. Im Nachlass des Thronfolgers, eines gebildeten, von jedem geschätzten und stets freundlichen Menschen, der ebenso stark wie wendig war und dessen makellosem Körper mit Sicherheit alle Töchter des Landes erlegen wären, in diesem Nachlass fanden sich ellenlange Sargtexte, aber nicht ein Liebesbrief!
Ich war zutiefst enttäuscht, und doch nötigten mir die Bescheidenheit und Geradlinigkeit, die sich hier offenbarten, großen Respekt ab. Ich hatte den Prinzen ganz offensichtlich völlig falsch eingeschätzt. Konnte ein Sohn so anders sein als der Vater?
Sicher, es bestand noch die Möglichkeit, dass irgendjemand vor mir auf der Suche gewesen war und Schriftstücke hatte verschwinden lassen, nach welchen ich jetzt suchte. Aber welchen Grund hätte diese Person gehabt, ausnahmslos alles Persönliche mitzunehmen und damit zu verbergen?
Nach allem, was ich sah, war ich fest davon überzeugt, dass es derartige Schriftstücke nicht gab. Leise, ja ehrfurchtsvoll verließ ich die Gemächer und traf im Palastgarten auf Prinz Amenophis und Hebi, die sich in einem der Schattenhäuser angeregt unterhielten. Die Wedelträger zu ihrer Seite und die Dienerinnen verneigten sich knapp, als sie mich kommen sahen, während Hebi und selbst Amenophis aufstanden, um mich zu begrüßen.
Mir selbst lag daran, mein Gemüt so schnell als möglich zu erheitern, und so erzählte ich den beiden, wie ich als Knabe dem Großvater des Prinzen, dem mächtigen Pharao Thutmosis, in diesem Garten und nur wenige Ellen von unserem Schattenhaus entfernt, begegnet war und vor Ehrfurcht und aus Angst, irgendetwas falsch zu machen, fast gestorben wäre.
«Glaube ihm kein Wort», fügte Amenophis meiner Erzählung schmunzelnd hinzu.
«Eje ging schon als Kleinkind in diesem Palast ein und aus, sodass viele meinten, er sei ein Prinz und gehöre zur Familie.»
«Gehöre ich etwa nicht zur Familie?», protestierte ich scherzend.
«Doch, Eje», sagte Prinz Amenophis, und seine Gesichtszüge wurden sehr ernst und nachdenklich. «Du gehörst mehr zur Familie, als es mancher wahrhaben möchte. Und es ist gut so.»
Etwas Schöneres hätte mir Amenophis nicht sagen können. Auch jetzt erinnerte ich mich wie so oft an jenen Nachmittag im Palastgarten von Men-nefer, als ich – ein kleiner Junge noch – vom Thronfolger des großen Pharao Thutmosis zum ersten Mal durch die königlichen Gemächer und den Palastgarten geführt wurde. Ja, seit jenem Tag vor nahezu dreißig Jahren gehörte ich zur Familie, war ich Pharaos Freund.
Den darauf folgenden Tag verbrachte ich zunächst damit, Freunde und Weggefährten von früher aufzusuchen, um vielleicht von einem von ihnen irgendetwas über den Tod des Thronfolgers in Erfahrung zu bringen. Zwar lobten sie alle Prinz Thutmosis als ein Vorbild in jeder Hinsicht, und vor allem die Väter vornehmer Töchter bedauerten sein allzu frühes Ende, doch konnte mir niemand bei meinen eigentlichen Erkundigungen behilflich sein. Konnte es etwa sein, dass mir niemand helfen wollte?
Ungeduldig fieberte ich deswegen dem Abend entgegen. Ehe ich den Palast verließ, füllte ich eine Hand voll Gold in einen Lederbeutel, musste ich doch davon ausgehen, dass mich die Bereitschaft des Balsamierers, mir etwas zu erzählen, einiges kosten würde. Ich hatte lange überlegt, ob ich nicht den Vorsteher der Palastwache in mein Vorhaben einweihen und ihn um die versteckte Begleitung einiger Soldaten bitten sollte. Um der Heimlichkeit der Sache willen entschloss ich mich jedoch, allein zu gehen. Ich war mir bewusst, dass mir Pharao diesen Leichtsinn sehr übel nehmen würde.
Wie immer um diese Zeit ging es im Hafenviertel recht laut zu, da aus allen möglichen Bierschänken das Singen und Grölen betrunkener Seeleute und Taugenichtse in die Nacht drang. Der Bereich um den Hafen selbst war menschenleer. Lautlos wie eine Katze näherte ich mich Schritt für Schritt unserem Schiff, ohne es auch nur einen Wimpernschlag aus den Augen zu lassen. Weil ich niemanden in seiner Nähe sah, versteckte ich mich hinter einer Mauer und beobachtete von dort aus das Schiff und den Platz davor. Doch nichts geschah. Ich schloss meine Augen, um meine Wahrnehmungen allein auf mein gutes Gehör zu beschränken.
So mochte fast eine Stunde vergangen sein, ehe ich mich aus meinem Versteck hervorwagte. Im Schatten von Lagerhäusern näherte ich mich vorsichtig unserer Barke, bis ich ein Geräusch vernahm, das ich mir nicht gleich erklären konnte. Ich strengte mich noch mehr an als zuvor und hielt beide Hände hinter die Ohrmuscheln, um noch besser hören zu können. Jetzt war ich mir sicher: Es war das Stöhnen eines Sterbenden, ganz schwach, ganz leise. Teils aus Angst, teils vor Aufregung schlug mein Herz jetzt doppelt so schnell wie wenige Augenblicke vorher. Ich ließ alle Vernunft und alle Vorsicht beiseite und ging geradewegs zum Schiff, zu der Stelle, woher das Wimmern kam. Ich hatte es befürchtet: Es war der Gehilfe des Balsamierers, der an Händen und Füßen gefesselt und mit dem Kopf nach unten am Vordersteven des Schiffes hing. So wurden in Verbrecherkreisen Verräter bestraft.
Als ich jetzt bei ihm war und ihn hängen sah, gab er keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Ich hatte ihn zu spät entdeckt. Ich konnte nicht einmal das Seil abschneiden, an welchem der Arme hing, denn sonst wäre er ins Wasser gefallen und sein Leichnam für Untersuchungen verloren gewesen. Ich hoffte aber, einige Spuren zu entdecken, die mich auf die Fährte seiner Mörder bringen konnten, und holte vier Polizisten herbei, die ich in der Nähe auf ihrer nächtlichen Streife antraf.
Ramessu nahm im Palast eine eingehende Untersuchung des Toten vor. Außer Schürfwunden und roten Flecken konnte er aber nichts feststellen.
«Es müssen mehrere Täter gewesen sein, sodass es nur ein kurzes Handgemenge gab, ehe sie ihn fesselten und henkten. Andernfalls hätte er mehr Verletzungen davongetragen», stellte Ramessu in der offenbar allen Ärzten eigenen nüchternen Art fest.
«Und ich hätte etwas gehört», fügte ich hinzu.
«Das muss nicht sein», widersprach mir Ramessu. «Wer weiß, wie lange er schon so hing.»
Ich erzählte ihm nichts von dem Stöhnen, das ich vernommen hatte, kurz bevor ich den Unglückseligen entdeckte. Ich wollte nicht, dass außer Nimuria jemand etwas von meinem außergewöhnlichen Gehör wusste.
In der folgenden Nacht tat ich kaum ein Auge zu. Ich saß im Fenster meines Schlafzimmers, hatte wie immer die Beine angezogen und mit den Armen umklammert und sah nachdenklich hinaus in die dunkle Nacht. Wer waren diese Menschen, die mir seit so vielen Jahren Angst und Schrecken einjagten? Waren es Menschen, die mir meine Stellung bei Hofe und meine Nähe zu Pharao neideten und die mir durch all die Verbrechen, die in meiner Umgebung geschehen waren, zu verstehen geben wollten, dass ich mich zurückzuziehen hatte, um vielleicht einem von ihnen Platz zu machen?
War es einer der vielen Beamten, deren Verbrechen ich aufgedeckt hatte, als ich noch die Steuereintreiber und die Landvermesser beaufsichtigt hatte? Das konnte ich mir nur schwer vorstellen, da mir Nimuria nie ein offizielles Amt gegeben oder mir einen Titel verliehen hatte, gerade um mich vor ihnen zu schützen. Dennoch, jeder ägyptische Beamte, der auch nur über ein bisschen Einfluss und Einblick verfügte, wusste, wer ich war und worin einst meine Aufgabe bestanden hatte.
Oder waren es doch die Priester Amuns, die der königlichen Familie und mir nachstellten, um sich für die alte Schmach zu rächen, die ihnen Nimuria angetan hatte, als er sie vor mehr als zwanzig Jahren zwang, sich an den Kosten seines Tempelbaues in Ipet-sut zu beteiligen?
Zwischen all diesen Gedanken beschlich mich immer wieder Angst, noch in dieser Nacht selbst Opfer eines Verbrechens zu werden. Ständig lauschte ich deswegen angestrengt in die Dunkelheit, damit mir kein noch so unauffälliges Geräusch entging, das mich warnen und so vielleicht mein Leben retten konnte. Das leise Klappern vertrockneter Palmwedel, die der Südwind vorsichtig aneinander schlug, das leise Scharren einer Schildkröte im Sand der Gartenwege oder der ferne Schrei eines Käuzchens ließen mich zusammenfahren, als stünde der schakalköpfige Anubis bereits vor mir. Ich hielt es dort, wo ich saß, nicht mehr aus. Ich ging zurück in mein Zimmer, trank hastig und in kurzer Folge vier Becher Wein und legte mich in mein Bett. Ich dachte an Ti, an ihre weichen Lippen, ihre wunderschönen Brüste und an ihre kleine Hakennase, über deren Rücken ich so gerne mit meinem Zeigefinger fuhr. Mit den schönsten Gedanken an meine Frau schlief ich endlich ein.
Jetzt, da nach dem schrecklichen Ende des Balsamierers ohnehin alle Hoffnung verloren war, irgendetwas aufzudecken, was mit dem plötzlichen Tod von Prinz Thutmosis zu tun haben könnte, offenbarte ich mich dem Thronfolger. Anfangs war er etwas verstört, ja sogar beleidigt, weil ich ihn so lange nicht von meinem geheimnisvollen Tun unterrichtet hatte. Dann zeigte er jedoch Verständnis und meinte: «Ich werde mich nicht mit solchen Dingen beschäftigen, wenn ich einmal Herrscher der Beiden Länder bin. Wenn wirklich Schreckliches passiert, wird sich einer der Wesire darum kümmern und mich am besten gar nicht damit belästigen.»
Diese Bemerkung des Prinzen erschreckte mich sehr, und ich fragte mich, worin er einst seine Aufgabe als Pharao sehen würde, wenn nicht darin, Tag für Tag verantwortlich dafür zu sein, dass Maat, unsere göttliche Ordnung, im ganzen Land herrschte.
ZWEI
Fern bist du, doch deine Strahlen sind auf Erden;
Du bist in ihrem Angesicht,
Doch unerforschlich ist dein Lauf.
Die alte Stadt On lag etwas nördlich von Men-nefer, vor den Mauern der nördlichen Hauptstadt. Seit den Tagen des alten Reiches beherbergte sie das älteste Heiligtum der Beiden Länder, den Tempel des Re. Hinter seinen Mauern und Tortürmen wurden die Thronfolger des Landes in die alten Wahrheiten und in die Geheimnisse, die nötig waren, um als Pharao über das Land herrschen zu können, eingeführt. Auch Prinz Thutmosis verbrachte hier viele Monate, ehe er sein rätselhaftes Ende fand.
Die Fahrt vom königlichen Palast in Men-nefer nach On dauerte weniger als eine Stunde, und so konnte man jeden Tag dorthin fahren, ohne auf die Annehmlichkeiten des Palastes in Men-nefer verzichten zu müssen. Prinz Amenophis hatte On vorher noch nie besucht und ich spürte genau, wie ihn seine Neugier auf das Sonnenheiligtum mehr und mehr erregte.
Der Morgen war noch jung und die Luft angenehm kühl, als uns Merire, der Erste Sehende des Re, am großen Torturm der Tempelanlage empfing. Ich hatte unseren Besuch angekündigt, denn ich wusste, dass gerade ältere Menschen unerwartete Besuche nicht schätzen, sie werden dabei zu sehr in ihren festgefahrenen Lebensgewohnheiten gestört.
Merire dankte mir mein Entgegenkommen mit aufrichtiger Freundlichkeit und dem Versprechen, dem Thronfolger beliebig lange zur Verfügung zu stehen.
Unser Besuch begann mit einem Rundgang durch die gesamte Tempelanlage von On. Gewiss, alles war sauber und gepflegt, und man spürte, dass hier mit großer Umsicht Ordnung gehalten wurde. Aber es war ebenso nicht zu übersehen, dass seit langer Zeit die Herrscher unseres Landes ihr Sonnenheiligtum nicht mehr mit nennenswerten Neubauten bedacht hatten. Kein Baumeister Ägyptens würde heute solch dicke, grobschlächtige Mauern und so schwerfällige Säulen errichten lassen, wie ich sie hier sah. Auch Prinz Amenophis schien dies aufzufallen, denn schweigend und mit ernstem Blick folgte er Merire überall hin und sah sich alles genau an.
«Ein so altehrwürdiges Heiligtum habe ich nie zuvor gesehen, Merire», beendete schließlich der Thronfolger sein Schweigen.
«Ich wäre Euch nicht böse, Prinz Amenophis, wenn Ihr es heruntergekommen nennen würdet. Aber Ihr seht selbst, dass wir uns größte Mühe geben, unsere Mauern, von welchen manche mehr als tausend Jahre alt sind, wenigstens regelmäßig zu streichen. Mehr können wir zumindest für das Äußere des Tempels nicht tun.»
Der kahlköpfige Siebzigjährige sah Amenophis mit gütig blinzelnden Augen an und zeigte dabei hinter dünnen, ausgetrockneten Lippen seine wenigen abgenutzten Zähne. Der Gedanke, Merire wäre hier schon vor tausend Jahren von Pharao Djedefre vergessen worden, gefiel mir.
Dann fuhr Merire fort: «Es gibt Gotteshäuser in Ägypten, deren Reichtum allenfalls durch die Schatzkammern Pharaos übertroffen werden. Jahr für Jahr werden sie mit neuen Tortürmen, Säulenhallen und immer höheren Fahnenmasten verschönert. Aber ihr Inneres…»
«…birgt das Allerheiligste», unterbrach ihn Amenophis mit dem Eifer eines Schülers, der stolz ist über sein unerwartetes Wissen.
«Nein, Prinz!»
Der Priester des Re schaute sich um, als wollte er sich vergewissern, dass uns niemand gefolgt war, der uns belauschte. Dann beugte er sich etwas zu Amenophis und flüsterte lächelnd: «…birgt ein finsteres Loch!»
Der Prinz sah mich verstört an. Ich nickte ihm leicht zu. «Merire wird dir beizeiten erklären, was er damit meint. Du musst keine Bedenken haben. Er ist kein Lästerer!»
Der weise Priester wirkte jetzt wieder in sich gekehrt, und ich merkte ihm an, dass er über das, was er uns gleich sagen würde, angestrengt nachdachte.
«Die Tempel des Sonnengottes Re sind alt, Prinz Amenophis, uralt. Aber sie bergen einen Schatz, den andere Tempel nicht kennen», fuhr Merire mit seiner Rede fort.
Zwei junge Priester, die er mit einem Wink herbeigerufen hatte, öffneten vor uns eine schwere Holztür, durch die wir in einen weiträumigen Saal gelangten. Seine Decke war niedrig, sie wurde von schweren, dicken Säulen getragen, wie es der alten Bauweise entsprach. Sie waren in ihrer ganzen Höhe bemalt. Ich sah frühe Herrscher unseres Landes, wie sie Re Opfer brachten oder wie sie mit einer mächtigen Keule die Feinde Ägyptens niederschlugen. Ich las in den Schriftreihen die Ehrfurcht einflößenden Namen von Königen wie Chufu, Djedefre, Pepi und Mentuhotep. An den Wänden ragten endlose Regale empor, und zwischen den Säulen standen verschlossene Holztruhen, gewiss dreißig an der Zahl. In diesem Raum verbarg sich mehrtausendjähriges Wissen, die gesamte Weisheit Ägyptens.
«Hier, mein Prinz, findet Ihr die ältesten Niederschriften der Pyramidentexte ebenso wie den Papyrus, auf welchem der weise Ptahhotep mit eigener Hand seine Weisheitslehre aufzeichnete. Hier liegen die Baupläne der Pyramiden von König Djoser, die der Weiseste aller Weisen, unser als göttlich verehrter Imhotep, mit eigener Hand gezeichnet hat. Wir verwahren Befehle, die das Siegel der Könige Menes und Narmer tragen. Ihr findet in diesen Truhen alles, was die Menschen über die Sterne wissen. Hier werden Landkarten der ganzen Erde verwahrt. Jede uns bekannte Krankheit wird hier in endlosen Papyri beschrieben, und jeden erdenklichen Rat für ihre Behandlung könnt Ihr darin nachlesen. Auf fast jede Frage, mein Prinz, erhaltet Ihr bei uns eine Antwort.»
Der Alte hielt für eine kurze Weile den Atem an und schloss bedächtig die Augen. Das, was er gerade dem jungen Thronfolger preisgab, schien selbst ihn, den Hüter des Schatzes, zu beeindrucken, ja zu überwältigen.
Amenophis öffnete langsam eine der Truhen, zeigte mit der rechten Hand auf ihren Inhalt und sah Merire fragend an, bis dieser seine Augen wieder geöffnet hatte.
«Ihr braucht mich nicht um Erlaubnis zu bitten, Prinz Amenophis. Wir sind nur die Diener Pharaos und die Hüter seines Besitzes», antwortete Merire auf die unausgesprochene Frage.
Dann erklärte er: «In dieser Truhe findet Ihr ausschließlich Schriften über Krankheiten und Verletzungen des menschlichen Kopfes.»
Mein Schüler griff wahllos nach einer der gelblich-braunen Papyrusrollen, entknotete bedächtig ihre Schnur und las laut vor:
«Wenn du einen Mann untersuchst mit einer Klaffwunde an seinem Kopf, die bis zum Knochen reicht und seinen Schädel spaltet, sollst du seine Wunde abtasten. Du wirst jenen Splitterbruch finden, der in seinem Schädel ist, tief eingesunken unter deinen Fingern. Eine Beule wird sich über ihm erheben, er wird bluten aus beiden Nasenlöchern und seinen beiden Ohren, er wird leiden an einer Versteifung seines Nackens und wird nicht auf seine Schultern und seine Brust blicken können. Dann sollst du dazu sagen: Eine Klaffwunde an seinem Kopf, die bis zum Knochen reicht und seinen Schädel zersplittert. Er ist erkrankt an einer Versteifung seines Nackens. Es handelt sich um eine Krankheit, die man nicht behandeln kann. Du sollst die Wunde nicht verbinden, er werde abwartend auf seinem Ruhebett beobachtet, bis die Zeit seines Leidens vorübergeht.»
Dann hielt Amenophis inne, sah Merire für einen kurzen Augenblick schweigend an und fragte: «Wie alt ist dieses Schriftstück?»
Ich sah deutlich, wie Merire zusammenzuckte. Seine Augen verkleinerten sich zu schmalen Schlitzen, und mit spitzen Lippen antwortete er. «Etwa zweihundert Jahre, Prinz. Es wurde zu Anfang des mittleren Reiches verfasst. Weshalb fragt Ihr?»
Der Alte wartete gespannt auf eine Antwort, und er ließ den Prinzen nicht den Bruchteil eines Augenblicks unbeobachtet.
Amenophis legte die Stirn in Falten und sah noch eine Weile schweigend auf den Papyrus.
«Verbessert mich, Merire, falls ich etwas Falsches sage! Wenn ich dieses Schriftstück lese, entspricht das, was da geschrieben steht, genau dem, was ich spreche. Heute benützen wir noch dieselben Schriftzeichen, dieselben Worte, unsere Aussprache ist aber eine andere. Ich will damit sagen, dass sich das, was wir sprechen, weiterentwickelt hat, aber nicht die Schrift. Ist das richtig?»
Schon während Amenophis sprach, nickte der Priester zustimmend. Das alte, faltige Gesicht Merires erhellte sich, und mit zusammengekniffenen Augen sah er Amenophis an.
«Mit dieser völlig zutreffenden Feststellung, mein Prinz, berührt Ihr Fragen, die seit Tausenden von Jahren für unser Volk von großer Bedeutung sind.»
Merire zeigte auf einen Tisch und sechs Stühle und fuhr fort: «Wollen wir uns jetzt nicht lieber setzen? Es könnte sein, dass unser Gespräch etwas länger dauert, wenn Ihr die Zeit dazu habt.»
Amenophis nickte kurz, ohne ein Wort zu sagen, und wir setzten uns nieder. Merire legte seinen rechten Arm bedächtig auf die Kante des Tisches und begann zu sprechen.
«Wenn ein Babylonier sieht, wie wir Ägypter Gebäude zeichnen, Tempel, Paläste und Häuser, oder wie wir unsere Gärten darstellen, dann lachen sie uns aus. Denn das, was sie sehen, entspricht nicht der Wirklichkeit, nicht dem, was unser Auge sieht. Einen Teil der Gebäude sehen wir von oben, einen anderen von der Seite. Auf die Teiche sehen wir von oben herab, aber seine Fische sehen wir ebenfalls von der Seite. Aber seit mehr als zweitausend Jahren stellen wir Ägypter unsere Gebäude so dar, und niemand verfiele auf den Gedanken, daran etwas zu ändern. Wir halten die Art unserer Darstellung einfach für richtig. Dasselbe gilt für die Darstellung von Menschen, gleich ob sie gezeichnet oder in die Wände gemeißelt sind. Die Haltung des Oberkörpers ist immer dieselbe, gleich was der Abgebildete tut. Wir sehen die Brust von vorne, sehen zwei Schultern, das Becken aber von der Seite. Kaum anders verhält es sich bei Kopf, Armen und Beinen. Wir stellen unsere Pharaonen stets als junge, schlanke und kräftige Männer dar, gleich wie alt sie sind oder wie sie tatsächlich aussehen. Und Ihr habt soeben die nämliche Feststellung für unsere Sprache getroffen.»
Der Prinz und auch ich nickten zustimmend.
«Wir tun das alles aber gewiss nicht, weil wir ungebildet sind oder weil wir die Wirklichkeit nicht wahrhaben wollen. Irgendwann vor langer Zeit haben wir festgestellt, dass der erreichte Zustand gut war. Das, was abgebildet und geschrieben war, galt einfach als richtig. Und weil dieser Zustand gut war, schön war, wagte es niemand mehr, daran etwas zu ändern. Die Angst, dass durch Veränderung der gute, der schöne Zustand vernichtet würde, war zu groß. Angefangen bei Pharao bis hinab zum einfachsten Bauern nahm man als selbstverständlich hin, dass die Schöpfung abgeschlossen und somit vollkommen war. Nie dürfte es ein Baumeister wagen, anders zu zeichnen, als man es vor tausend Jahren tat, dürfte ein Steinmetz Pharao anders darstellen, als wir es noch heute kennen, und ein Schreiber es wagen, an den heiligen Schriftzeichen etwas zu ändern. Da bedurfte es in