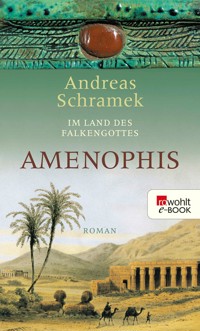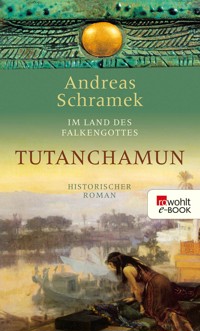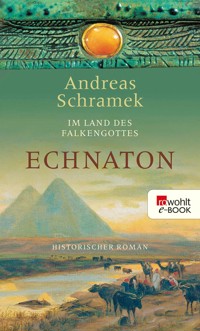7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der über neunzigjährige und nahezu blinde Doge Enrico Dandolo sollte mit mehr als 200 Schiffen Venedigs das Heer der Kreuzritter an die Küste des Heiligen Landes bringen. Unter der Führung des Markgrafen Bonifaz von Montferrat sollten die Ritter Jerusalem von den Sarazenen befreien. Ein junger deutscher Baron, ein byzantinischer Prinz und rätselhafte Briefe des ägyptischen Sultans geben dem Kreuzzug einen ungeahnten Verlauf, an dessen Ende im Jahr 1204 die Eroberung und Plünderung Konstantinopels steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Epilog
Enrico Dandolo
Historischer Roman
von
Andreas Schramek
Kontakt: [email protected]
Paul-Schneider-Str. 13, 99423, Weimar
Originalausgabe
1. Auflage 2023
Copyright 2023 Schramek & Narijni Media
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie,
Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Publishing and communications: Ilia Narijni
Print: Multiprint EOOD
Printed in Bulgaria
ISBN Print 978-3-00-074160-9
Ohne die Nacht wüssten wir nichts von den Sternen.
Für Kerstin
Prolog
“Und ich sah, wie das Lamm das erste der sieben Siegel öffnete, und hörte eines der vier Wesen mit Donnerstimme rufen: >Komm und sieh!< Und ich sah, siehe, ein weißes Ross, und der auf ihm saß, hielt einen Bogen, und es wurde ihm ein Kranz gereicht, und er zog als Sieger aus, um zu siegen. Als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Wesen rufen: >Komm und sieh!< Und es kam ein anderes Ross daher, feuerrot, und dem, der auf ihm saß, wurde gegeben, den Frieden hinwegzunehmen von der Erde, und dass sie einander hinschlachteten, und es wurde ihm ein großes Schwert gereicht.”
Dies sind nicht meine Worte, sondern die Worte dessen, der dazu berufen war, das Ende zu schauen nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus. Die Engel Gottes des Allmächtigen kündeten einst dem Johannes, dem Evangelisten, das Ende der Zeit, so, wie es mir der Herr selbst kund getan hat durch das, was er mich sehen und erleiden ließ in jenem schrecklichen Frühjahr des Jahres 1204.
“Und ich sah, siehe, ein fahles Ross, und der auf ihm saß, des Name ist >Der Tod<, und die Unterwelt war sein Gefolge. Es wurde ihnen Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten durch Schwert, Hunger und Pest und durch die wilden Tiere der Erde.”
Ja, Hunger habe ich erlitten und das Wüten der Pest habe ich gesehen. Das Schwert aber habe ich selbst geführt und gegen die gerichtet, die man meine Feinde genannt hat. Wie der Evangelist hörte ich die Posaunen der Engel, und ich sah Hagel und Feuer, mit Blut vermischt, ich sah einen feuerglühenden Berg, der in das Meer geworfen wurde und ich sah, wie der dritte Teil des Meeres zu Blut wurde. Ich sah, wie der Schlund der Erde sich öffnete, und es stieg Rauch aus diesem Schlund empor wie der Rauch eines mächtigen Ofens, und die Sonne und der Mond wurden verfinstert durch den Rauch des Schlundes. All das haben meine Augen gesehen, als ich noch ein Jüngling war.
Und meine Ohren haben die Stimme des Herrn vernommen. So wie Johannes, dem der Herr sich geoffenbart hat, hörte auch ich die Stimme des Engels, der rief: “Cecidit, cecidit Babylon illa magna, quae a vino irae fornicationis suae potionait omnes gentes.”
Ja, ihr Gottesfürchtigen, gefallen ist sie, gefallen ist Babylon, jene Große, die mit dem Glutwein ihrer Hurerei alle Völker getränkt hat!
Aber die große Stadt, die ich wie Johannes fallen sah, war nicht Babylon, sondern es war Konstantinopel. Eine größere Stadt als diese haben meine Füße nie betreten. Eine prächtigere haben meine Augen nie gesehen und eine reichere Stadt hat es nie zuvor gegeben.
Doch auf den Rössern, die ich sah, saßen nicht die Racheengel Gottes, des Allmächtigen. Auf dem roten Ross ritt einher Bonifatius, der Markgraf von Montferrat. Und auf dem weißen Ross ritt einher Enrico Dandolo, der Herzog von Venedig. Und auf dem fahlen Ross folgte ihnen der Tod, der Tod und das Gefolge der Unterwelt. Und ruhmvolle Namen gab es in seinem Gefolge: Es waren darunter Gottfried von Villehardouin und Milo der Brabanter, Balduin von Flandern und Johann von Friaize, Simon von Montfort und Rainald von Montmirail, auch Werner, der Bischof von Troyes. Ebenso Walter von Brienne, Eustachius von Conflans und Veit du Plaissie und viele andere Krieger, die dieses Buch nicht erwähnen kann.
Auch viele edle Herren aus deutschen Landen waren in seinem Gefolge: Es waren darunter Berthold von Katzenelnbogen und Werner von Bollanden, Dietrich von Loos und Heinrich von Ulmen, Dietrich von Diest und Rüdiger von Suiter, Alexander von Villers und Ulrich von Thone, Abt Martin von Païris und viel andere gute Krieger, die ich hier nicht erwähne. Auch mein Vetter war in seinem Gefolge, Konrad Krosigk, der zu dieser Zeit Bischof von Halberstadt war, bevor er im Jahre des Herrn 1209 sein Amt niederlegte und sich in die Stille und die Abgeschiedenheit der einsamen Zisterzienserabtei Sittichenbach zurückzog. Viele Jahre der Buße und des Schweigens liegen seither hinter ihm.
Und was ist aus mir geworden? Ich bin nach all dem Schrecklichen, das ich erlebt habe, dorthin zurückgekehrt, wo ich schon einmal mein Glück gefunden hatte. Aber erst jetzt, als Mann von über fünfzig Jahren, besitze ich die Kraft und hat meine Seele die Ruhe gefunden, damit ich das niederschreibe, was geschah, als Innozenz unser Papst war, als in England König Richard regierte, als sich in Deutschland Otto und Philipp als verfeindete Könige gegenüberstanden und als Isaak und Alexios als Kaiser von Byzanz herrschten.
Sei der Herr einst meiner armen Seele gnädig!
Eins
Die Schwalben waren schon davongeflogen.
An den Spinnweben, die über Nacht von Geisterhand zwischen den Ästen der Fichten und der Buchen gewoben worden waren, hatte sich Tau festgesetzt. Seine winzigen Tröpfchen glitzerten im ersten Licht der Morgensonne wie feinste Körner aus Silber, dicht an dicht gereiht. Oder wie nasse Flussperlen, die eine mächtige Zauberin den Quellwassern entnommen und mit einem geheimnisvollen Spruch versehen hat, damit sie für kurze Zeit nur als das Kostbarste erschienen, das dieser Wald je barg. Darüber hingen Vogelbeeren, tiefrot wie der Purpur eines Kardinals oder wie der Augfleck eines balzenden Auerhahns. Und es brauchte nicht viel Vorstellungskraft, um sich einzubilden, es wären nicht Vogelbeeren, die da hingen, sondern winzige, verzauberte Bratäpfel. Überall lösten sich Blätter von den Ästen und schwebten gemächlich und lautlos dem feuchten Waldboden entgegen, jedes in seinem unruhigen Fall eine andere Figur beschreibend. Die einen bohrten sich um die eigene Achse kreiselnd geradewegs nach unten, andere schwebten genüsslich hin und her schaukelnd zwischen den Ästen hindurch, als sollte alle Welt gewahr werden, dass sie es gar nicht eilig hatten, dort nieder zu fallen, wo sie zwischen Millionen anderer Blätter endgültig der vollkommenen Bedeutungslosigkeit verfielen.
Die stolzen Farne, bis vor kurzem noch tiefgrün und fettglänzend, deren elegant gebogene Stengel sich prahlerisch emporhoben, damit kein Geschöpf ihre kunstvoll gezackten Blätter übersehen konnte, waren jetzt verdorrt und gebrochen. Wie vor Urzeiten zurückgelassene und bis auf den letzten Fetzen abgenagte Gerippe sahen sie jetzt aus. Erbärmlich, ja, ganz erbärmlich.
Unter den Hufen der Pferde knackten die Bucheckern. Bei jedem Schritt aufs Neue, denn in diesem Herbst war der Waldboden von Bucheckern nur so übersät. Eicheln gab es in diesem Jahr nicht so viele. Aber Bucheckern. Sie waren ihm zunächst gar nicht aufgefallen, denn Bucheckern waren ihm gleichgültig. Aber Philipp mochte sie und so griff der Junge wieder und immer wieder in die Tasche seiner Jacke, damit die Spitzen von Daumen und Zeigefinger wie ein Hühnerschnabel nach einer der winzigen, braunen Früchte pickten. Auf dem Weg zum Mund brachen seine Fingernägel ihre manchmal doch recht widerspenstige Schale und während dann endlich der kleine, süßlich-bittere Kern mit einer einzigen Bewegung seines Kiefers zermalmt wurde, pickte der Hühnerschnabel schon nach der nächsten Buchecker. Philipp wurde ärgerlich, wenn sich ein Stück der harten Schale – und war es noch so klein - in seinem Mund verirrte, sich zwischen den Zähnen verfing oder in seinen Gaumen oder in die Innenseite einer Wange stach. Lag das lästige Stück endlich auf seiner Zungenspitze, spuckte er es zornig und laut hörbar aus.
„Ferkel!", schimpfte Johannes ihn deshalb, denn ihn widerte dieses unentwegte Ausspucken an. Der recht lustlos ausgesprochene Tadel ging aber im Rascheln der aufgewirbelten Blätter, dem Knacken der Bucheckern und dem aufgeregten Rätsch-Rätsch eines wippend davonfliegenden Eichelhähers, den sie bei seiner Vogelbeerenernte gestört hatten, unter. Er beließ es dabei und anstatt seinen Tadel laut hörbar zu wiederholen, nachdem Philipp erneut ausgespuckt hatte, atmete der junge Ritter nur tief durch, denn erst jetzt war ihm bewusst geworden, wie herbstlich es um ihn herum duftete. Es war der Geruch von Waldpilzen, geheimnisvoll und zart, den er aber doch immer im Verdacht hatte, giftig zu sein, wie die Pilze selbst. Es roch nach feuchtem Moos, nach welkenden Gräsern und abgestorbenen Farnen. Und wie ein dichter Nebel lag über all diesen Gerüchen der schwere Duft des modernden Waldbodens und der gekrümmten, immer dürrer werdenden Blätter, die unaufhörlich herabfielen, um eins zu werden mit dem Moder ihrer Vorfahren vergangener Jahre. Ja, es war nichts anderes als der Geruch von Fäulnis und Moder, der Geruch der sterbenden Natur, den Johannes jetzt so leidenschaftlich und genießerisch einatmete. Er war sich aber dessen nicht bewusst, denn ein junger Mensch von etwas mehr als zwanzig Jahren denkt nicht an Fäulnis und Moder, nicht an den Winter, wenn es erst Herbst ist. Und nicht an das Sterben, wenn er verliebt ist.
"Under der linden an der Heide", begann er leise und von Philipp unbemerkt seinen Gesang. "dâ unser zweier bette was, dâ mugt ir vinden schône beide gebrochen bluomen und gras. vor dem walde in einem tal, tandaradei, schône sanc diu nahtegal."
Philipp spuckte hastig ein Stückchen Schale seiner letzten Buchecker aus und sagte:
"Sie scheint dir wohl nicht mehr aus dem Kopf zu gehen!" Er gab ihm keine Antwort, sondern fuhr mit seinem Lied fort. Er sang es jetzt lauter als zuvor, denn Philipp sollte ruhig wissen, wie wohl ihm ums Herz war, wenn er an Agnes dachte.
"Ich kam gegangen zou der ouwe, dô was mîn friedel kommen ê. dâ wart ich enpfangen, hêre frouwe, daz ich bin sælic iemer mê. Kust er mich? Wol tusend stunt, tandaradei, seht wie rôt mir ist der munt."
Vom Singen hatte er jetzt genug und so summte er nur noch einmal die Melodie des Liedes vor sich hin, ehe er ganz verstummte. Umso überraschter war er, als sich Philipp zu Wort meldete und spöttelte:
"Ist deine Liebe schon erloschen? Oder hat mein Hans den Rest des Liedes vergessen?"
Johannes drehte sich nicht einmal nach seinem Knappen um, denn er hasste es, Hans genannt zu werden. Wie zum Trotz erhob er erneut seine Stimme und sang lauter als zuvor:
"Dô hât er gemachet also rîche von bluomen eine bettestat. des wirt noch gelachet inneclîche, kumt iemen an daz selbe pfat. bî den rôsen er wol mac, tandaradei, merken wâ mirz houbet lac.
Daz er bî mir læge, wessez iemen nû enwelle got!, sô schamt ich mich. Wes er mit mir pflæge, niemer niemen bevinde daz wan er und ich und ein kleinez vogellîn, tandaradei, daz mag wol getriuwe sîn."
Eine nur knappe, ruckartige Bewegung seiner Arme straffte die Zügel und im selben Augenblick blieb sein Pferd stehen. Aufgeregt hob und senkte der Braune den Kopf, während er sich nach hinten zu seinem Schildknappen umwandte.
"Bist du etwa nicht verliebt?", fragte er den Jungen, dessen Schamröte jede Vogelbeere blass erscheinen ließ, kaum, dass er seine Frage vernommen hatte.
Philipp fühlte sich ertappt. Doch nie hätte er, der gerade Fünfzehnjährige, ihm gegenüber offen zugegeben, dass er seit Wochen schon bis tief in seine nächtlichen Träume hinein vom Bild eines gewiss wunderschönen Mädchens verfolgt wurde. Lieber hätte er sich von seinem jungen Herrn erschlagen lassen, bevor er ihm den Namen der Angebeteten preisgegeben hätte. Philipp redete manchmal im Traum, was Johannes zwar um seinen Schlaf brachte, ihm aber bislang ungeahnte Kenntnisse über das Seelenleben seines Knappen verschaffte.
"Weshalb sollte ich verliebt sein?", wies er stattdessen jeden Verdacht von sich.
"Ich und verliebt! Sich bei den Händen halten, sich unentwegt in die Augen schauen und sich alberne Lieder vorsingen. Viel weiter hast du es doch bei Agnes noch nicht gebracht!"
Überrascht hob Johannes die Augenbrauen etwas an und schob sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Was wusste der Junge schon von ihm und von den jungen Schönheiten, denen er den Hof gemacht hatte? Von Sibylle, der stillen aber so anschmiegsamen Tochter des Bildhauermeisters? Nie würde er ihr samtenes, braunes Haar und ihre ebenso samtenen Küsse vergessen! Auch über Johanna, die viel zu früh verwitwete Schwester des Bischofs von Salzburg, hat er nie ein Wort verloren. Sie war ein paar Jahre älter als er und von ihr hätte er vielleicht nie gelassen, wenn nicht ihr Bruder ihre Liebe entdeckt und Johanna gezwungen hätte, das sorglose Leben, das sie an seiner Seite geführt hatte, gegen das traurige und sittenstrenge Dasein einer Klosterfrau einzutauschen. Er war Philipp nicht wirklich böse. Aber dass er sich über sein Lied lustig gemacht hatte, nahm er ihm doch ein wenig übel und so rief er nach hinten: "Meister Walther würde kein Wort mehr mit dir wechseln, wenn er wüsste, wie abfällig du über seine Lieder redest. Allein dafür hättest du eine prächtige Ohrfeige verdient!"
Philipp bedauerte gewiss zutiefst, was er soeben gesagt hatte und überlegte sich wohl die passenden Worte für eine Entschuldigung. Aber Johannes kam ihm zuvor: "In deinem Alter habe ich auch so gedacht und so leichtfertig dahergeredet. Sunt pueri pueri et puerillia tractant!" Dann wandte er sich wieder um, schob sich erneut die widerborstige Haarsträhne aus dem Gesicht und schlug sachte beide Fersen gegen die Flanken seines Braunen, der gehorsam lostrabte, nicht ohne zuvor noch einmal aufgeregt den Kopf nach oben geworfen zu haben.
"Was hast du da gesagt?", fragte Philipp und spuckte sogleich wieder ein lästiges Stück einer Buch-eckernschale aus.
"Ferkel!", schimpfte Johannes noch einmal verärgert und setzte seinen Ritt fort, ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern.
"Kinder sind Kinder und treiben eben kindische Dinge", wiederholte er noch einmal still vor sich und rief sich das Antlitz jenes Mädchens in Erinnerung, das er für seine erste Liebe gehalten hatte: Irmhilde. Sie war ein wunderschönes Mädchen. Und den ersten scheuen Kuss, den sie wechselten, würde er nie vergessen. Aber welch ein entsetzlicher Name für dieses Mädchen! Wie anders klang Agnes! Agnes wollte er niemals wieder verlieren. Niemals! Dessen war er sich ganz sicher. Wie rein war ihre Liebe stets geblieben! Das einzige, was er sich bislang erlaubt hatte, war ein schüchterner Kuss auf ihre Stirn. Und dies unter den Augen ihres Onkels! Landgraf Hermann war ihm wohl gesonnen und als der Vormund dieser elternlosen Schönheit würde der alte Graf gewiss seinen Segen geben, wenn er in einem Jahr um Agnes` Hand anhielt. Keine andere wollte er mehr haben als seine Agnes.
Philipp war ein wenig böse auf sich selbst und auf die Dummheit, die er so unbedacht hinausgeplappert hatte. Aber er wusste, dass sich Johannes bald wieder beruhigen und alles vergessen haben würde. Sein Herr war noch nie nachtragend gewesen, solange Philipp in seinen Diensten stand. Und das waren jetzt schon mehr als vier Monate.
In Gedanken versunken ritten beide schweigend dahin, Stunde um Stunde, und sie bemerkten nicht, dass Mittag längst vorüber war und es nicht mehr lange dauern würde, bis die Sonne hinter den schwarzen Wipfeln der Tannen verschwand, ehe sie eine Stunde später ganz unterging.
Philipp hatte im hohen Buchenbestand und doch geschützt von wenigen, verkrüppelten und wild gewachsenen Fichten einen Hirsch ausgemacht. Es mochte ein junger Sechser sein, aber mehr als acht Enden hatte sein Geweih gewiss nicht. "Ssst", zischte der Knappe seinem Herrn vorsichtig zu. Aber er hörte ihn nicht, denn er weilte in Gedanken noch immer auf der Wartburg, von der sie kamen, und bei Agnes.
"Ssst", wiederholte er etwas lauter. Jetzt sah er zu ihm hinüber und eine knappe, ruckartige Kopfbewegung des Jungen genügte, um auch seine Blicke auf den noch immer so arglosen Hirsch zu lenken. Johannes nickte kurz, und mit drei, vier für jeden Außenstehenden völlig unverständlichen Handbewegungen tat er seinem Begleiter seinen Plan kund. Philipp hatte sogleich verstanden, denn es war nicht das erste Mal, dass sie mit derlei List einem Hirsch nachstellten.
Und so ritt der Knappe in jene Richtung, in welche das Haupt des Tieres zeigte und begann nach wenigen Schritten zu pfeifen. Erst leise, dass nur er selbst es hören konnte, dann lauter und lauter werdend, bis der Hirsch neugierig sein Haupt hob, damit er den Eindringling mit äußerster Aufmerksamkeit so lange beäugte, bis dieser wieder aus seinem Einstand entschwunden sein und keine Gefahr mehr darstellen würde. Die Sinne des Hirsches waren so sehr von Philipp beansprucht, dass er nicht bemerkte, wie in seinem Rücken die eigentliche Gefahr immer näherkam. Der Bogen war schon gespannt und wenig später verunsicherte eine unerwartete Kehrtwendung des Knappen den Hirsch so sehr, dass dieser es nun vorzog, sich langsam und unauffällig abzuwenden, um sich alsbald in der Tiefe des Waldes unsichtbar zu machen. Johannes aber schnitt dem ahnungslosen Tier den Weg ab und trug ihm nur wenig später den tödlichen Schuss an. Der Pfeil durchbohrte seine linke Flanke und drang tief in die Lunge ein. Das tödlich getroffene Tier ging vorne hoch und stellte sich für einen kurzen Augenblick auf die Hinterläufe, um sogleich mit gesenktem Haupt zur Flucht anzusetzen, die nach wenigen Sprüngen prasselnd im Unterholz endete. Johannes war erfahren genug um zu wissen, dass das Aufbäumen des getroffenen Hirsches und dessen tiefe Flucht die untrüglichen Zeichen eines tödlichen Lungenschusses waren. Und als er wenige Schritte vom Anschuss entfernt mehr und mehr hellrot gefärbten, blasenartigen Blutes entdeckte, war der Erfolg auch schon Gewissheit.
Kurze Zeit später lag der Hirsch auf leicht abschüssigem Boden auf seinem Rücken, das Haupt weit nach hinten gebogen, sodass die Enden seines Geweihs im Waldboden steckten, um dem Tier den nötigen Halt zu verleihen, damit es der Knappe ausweiden konnte. Johannes selbst kniete hinter dem Haupt ihrer Beute und hielt sich wegen des vortrefflich gelungenen Schusses nicht ohne Stolz an den Geweihstangen fest. Er sah Philipp aufmerksam zu, gab ihm da und dort einen Hinweis, damit er nicht unnötig den Pansen oder gar die Leber verletzte, denn die wollten sie noch am selben Abend verzehren. Süßlich bitter roch der Dampf, der in der Kühle der hereinbrechenden Nacht aus der geleerten Höhle des Wildkörpers emporstieg und den nur Jäger ertragen, ohne dass es ihnen übel wird. In ihrem waidmännischen Tun versunken bemerkten sie nicht, dass sie selbst umstellt waren, dass sie, die Jäger, schon bald die Beute anderer sein würden. Von vier Seiten gleichzeitig eilten die Soldaten des Bischofs heran, vier von ihnen sprangen von den galoppierenden Pferden und warfen sich auf die beiden. Johannes spürte einen heftigen Schlag gegen seinen Kopf. Mit seiner Rechten versuchte er noch die schmerzende Wunde zu ertasten. Doch für kurze Zeit entschwanden ihm die Sinne und er blieb regungslos auf dem Waldboden liegen. Die beiden Soldaten, die sich auf ihn gestürzt hatten, fesselten ihn an Händen und Füßen und ein Dritter presste ihm einen ekelerregenden Knebel in den Mund, um ihn bald darauf mit einem anderen, ebenso widerlichen Tuch zu verbinden. Er war so benommen, dass er von seinen Peinigern nur einzelne Wortfetzen wahrnahm. Aber so viel hatte er verstanden, dass sie meinten, in Philipp und ihm endlich lange gesuchte Wilddiebe gefangen genommen zu haben.
"Halt dein freches Maul!", herrschte ihn einer der Reiter an, weil er mit lautem "Hm, hm" versucht hatte, auf sich aufmerksam zu machen, damit er, von dem Knebel wieder befreit, erklären konnte, dass er kein Wilddieb, sondern der Vetter ihres Herrn war. Philipp war es nicht besser ergangen und nur wenig später saß auch er gefesselt und geknebelt auf seinem Pferd und ritt an seiner Seite und umringt von den Soldaten der Bischofsstadt entgegen, über die sich schon längst die kalte Herbstnacht gelegt hatte.
"Es gab weiß Gott Zeiten, da bin ich fröhlicher nach Halberstadt hineingeritten", dachte sich Johannes und sah mitleidsvoll zu seinem Knappen hinüber, während sich vor ihnen das schwere Stadttor laut quietschend öffnete. Im spärlichen Schein eines unruhig im Wind flackernden Kienspans erkannte er das Gesicht des Wachhabenden. Ja, es war Romuald, ein Freund aus vergangenen Tagen, mit dem er erst zwei Jahre zuvor in den Wäldern des vormaligen Bischofs Gardolf Wildschweine gejagt hatte. Wie stolz waren sie damals gewesen, als sie ihre Beute in die Küche des Bischofs gebracht hatten!
"Verfluchter Trottel!", tobte Johannes innerlich, weil es sein einstiger Gefährte jetzt nicht einmal für nötig hielt, ihm als seinem Gefangenen wenigstens einen Wimpernschlag lang ins Gesicht zu sehen. Stattdessen fauchte Romuald nur: "Macht vorwärts! Ich will endlich meine Ruhe haben."
Die Möglichkeit, hier von einem Offizier als der Vetter des Bischofs erkannt und freigelassen zu werden, war vorerst vertan. Stattdessen ritt der kleine Trupp weiter zur nahen Festungsanlage, wo man beide von den Pferden und schließlich in die Tiefe eines Verlieses zerrte. Dort wurden sie von den Fesseln und den Knebeln befreit und ein gewaltiger Fußtritt ließ sie der Länge nach auf den mit fauligem Stroh bedeckten Boden stürzen.
"Euer Herr, der ehrwürdige Bischof Konrad, ist mein Vetter", brüllte Johannes sofort drauf los, um all ihrer Schmach endlich ein Ende zu bereiten.
"Ich bin ein Verwandter von Konrad Krosigk. Ich bin sein Vetter, Johannes Ilfeld. Meine Mutter Mathilde Ilfeld war die Schwester seines Vaters. Und ihr Dummköpfe werdet es bitter bereuen, wenn wir nicht heute Nacht noch aus diesem Drecksloch herauskommen!"
Aber er erhielt keine Antwort. Stattdessen schlug das schwere Eisengitter scheppernd ins Schloss.
"Ich bin der Vetter des Bischofs!", rief er ihnen noch einmal verzweifelt hinterher.
"Der letzte Wilddieb, den unser Bischof aufhängen ließ, war angeblich ein Sohn Kaiser Friedrichs", sagte ihr Anführer in solch höhnischem Ton, dass dem jungen Ritter endgültig alle Hoffnung schwand, seinem Vetter noch einmal lebend zu begegnen.
"Dann ist dein Begleiter vielleicht der jüngste Sohn von Richard Löwenherz", murmelte er durch die Gitterstäbe hindurch und ging weg, nachdem er den Schlüssel umgedreht und an seinen Gürtel gehängt hatte.
"Konrad ist erst seit einem halben Jahr Bischof und war vorher hier Dompropst. Er ist der Nachfolger von Bischof Gardolf", rief Johannes den Soldaten hinterher.
"Gardolf von Harbke. Er starb im Frühjahr. Fragt Romuald nach mir! Er kennt mich und er wird es auch sein, der dir den Strick um den Hals legen wird. Das verspreche ich dir elenden Hundsfott!", brüllte er wütend und mit hochrotem Kopf so laut, dass sich seine Stimme überschlug. Zuletzt hämmerte er wie ein Besessener mit beiden Faustballen zornig gegen die Gitterstäbe. Philipp beeindruckte die bislang nicht gekannte Wortwahl und geradezu ungläubig starrte er seinen Herrn mit offenem Mund an. "Elender Hundsfott! Was immer das sein mag. Aber das merke ich mir, wenn man uns noch ein wenig Zeit dafür lässt", sagte der Junge. Johannes bezweifelte, dass Philipp überhaupt den Ernst ihrer Lage begriffen hatte.
In dieser Nacht schien die Zeit in dem finsteren Verlies still zu stehen. Während Philipp Stunde um Stunde mit angezogenen Beinen und frierend in einer Ecke der Zelle kauerte, blieb Johannes ohne jede Regung an den Gitterstäben stehen und starrte wortlos in den dunklen Gang hinaus. Seine Wut wollte sich nicht legen und aufgeregt schnaufend atmete er ein ums andere Mal mit der stickigen Luft den beißenden Gestank von Urin, Rattenkot und fauligem Stroh ein. Er wusste, wie man manchenorts mit Wilderern umzugehen pflegte: Sie werden in das abgezogene Fell des gewilderten Tieres eingenäht und dann wird die Hundemeute auf die armen Teufel losgelassen. Es soll ein schlimmer Tod sein, erzählte man sich.
Aber wie konnte es nur so weit kommen? Bis vor wenigen Stunden noch hatte er ein - weiß Gott - sorgloses Leben geführt. Auch wenn er nicht gerade wohlhabend war und ihn sein Hof eher schlecht als recht ernährte, hatte er dennoch keinen Grund, sich zu beklagen! In seinem Stall stand leidlich gutes Vieh und seine Pferde konnten sich sehen lassen. Er brauchte sich nirgendwo seiner Kleider zu schämen und wer immer bei ihm zu Gast war, fand einen anständig gedeckten Tisch vor. Ihn hatte es nie nach Höherem gedrängt. Ihn hatten keine Ämter gelockt und schon gar nicht die Ehre des Schlachtfeldes. Die verliebten Augen einer jungen Frau galten ihm mehr als alle Ehren, mit welchen ihn selbst der Kaiser hätte überhäufen können. Er mochte sein Leben, so wie er es geführt hatte, auch wenn er eine gewisse Mittelmäßigkeit seines Daseins nicht leugnen konnte. Alles, wonach er sich noch gesehnt hatte, war ein treues Weib und eine unüberschaubare Zahl von Kindern. Aber jetzt saß er als namenloser Wilddieb im Kerker seines eigenen Vetters!
Fast hätte er darüber lachen mögen. Aber nach Lachen war ihm zusehends weniger zumute, je näher der Morgen kam. Johannes stellte sich Konrads entsetztes Gesicht vor, wenn dieser in ein paar Tagen eher zufällig am Schindacker vorbeiritt und in dem, der da baumelte, seinen eigenen Vetter erkannte. Nein, es schien wahrlich nicht gut um das noch so junge Leben des Johannes Ilfeld zu stehen!
Es mochte um die Zeit der Morgenhore gewesen sein, wenn sich allmorgendlich das Domkapitel zum Gebet versammelt, lange vor Sonnenaufgang noch, als Philipp wieder einmal aus einem schrecklichen Albtraum erwachte, in welchem er sich selbst am Galgen baumeln sah, während darüber schon die Raben krächzend ihre Kreise zogen, damit sie dem Toten wenig später die gebrochenen Augen aushacken konnten. Aber es war nicht das Rasseln des Schinderkarrens, was er gehört hatte, sondern es war das Klirren von Schlüsseln, der Lärm von Stiefeln und das Krachen von Türen, das ihn aus seinem schlimmen Traum riss.
"Jetzt werden wir sehen, was mit uns geschieht", sagte Johannes mehr für sich und richtete dabei seinen Oberkörper auf, wie es sich nach seinem Dafürhalten für einen Mann von Stand gehörte, wenn Entscheidendes bevorstand.
"Beeilt euch!", befahl eine dunkle, klangvolle Männerstimme, und kaum, dass er sie vernommen hatte, hellten sich seine Gesichtszüge auf. Johannes wandte sich kurz zu Philipp um und sagte erleichtert:
"Steh auf! Mein Vetter kommt!"
"Ich möchte nur wissen", begann der Bischof, nachdem sie in dessen Amtsstube angekommen waren, und das gerade noch freundliche Lächeln des einzigen Verwandten, der sich für den jungen Ritter verantwortlich fühlte, wich einer besorgten Miene.
"Ich möchte nur wissen, warum du nicht von dieser verdammten Jagd lassen kannst. Du magst jeden Hirsch erlegen, der dir gefällt und wann und wie es dir beliebt. Aber lass es vorher mich, meinen Jäger oder meinen Verwalter wissen! Du kannst doch nicht einfach hierherkommen und noch ehe du mich begrüßt hast, in den Wäldern des Domkapitels nach Herzenslust wildern!"
Mit rotem Kopf und schuldvoll zusammengekniffenen Augenbrauen blickte Johannes in das Gesicht seines sichtlich erbosten Vetters.
"Verzeih mir diese Dummheit, Konrad, aber dieser Hirsch", sagte er schamvoll und mit belegter Stimme, denn noch mehr als vor seinem Vetter schämte er sich vor seinem Knappen.
"Verzeih mir!", unterbrach ihn Konrad missgelaunt und wandte seine Blicke von ihm ab, weil er wissen wollte, was unten im Burghof vor sich ging. Zwei Soldaten stritten sich lauthals um die Leber des gewilderten Hirsches und lenkten so die Aufmerksamkeit ihres Herrn auf sich. Konrads Finger spielten scheinbar gedankenlos mit dem Ring, den er an seiner Rechten trug. Er überlegte für einen kurzen Augenblick, welchen seiner vielen Ringe er an diesem Tag überhaupt trug und der ebenso kurze Blick nach unten bestätigte seine Ahnung, dass es jener mit dem Amethyst war - ein Geschenk von König Philipp.
"Wäre der Offizier, der euch eingesperrt hat, so dumm wie die meisten meiner Soldaten, würdet ihr beide jetzt schon draußen auf dem Schindacker hängen", sagte der Bischof und beobachtete dabei noch immer die streitenden Soldaten.
"Mein lieber Giovanni, vermutlich hast du es nur deinem vorlauten Mundwerk zu verdanken, dass ihr beide noch lebt." Johannes sah verlegen zu Boden, als sich Konrad wieder ihm zuwandte. Aber er wusste, dass sein Vetter ihm nicht wirklich böse war, denn sonst hätte er ihn nicht Giovanni genannt. Mit großen Schritten ging Konrad jetzt auf seinen jungen Vetter zu, breitete die Arme aus und drückte ihn fest an sich.
"Es ist gut, mein Freund", beruhigte Konrad gewiss mehr sich selbst, als ihn, den eben noch so heftig Gescholtenen.
"Es ist gut", wiederholte er und sah dann schweigend, aber mit freundlichem Gesicht zu Philipp hinüber, der all die Zeit regungslos abseitsgestanden hatte, damit das Strafgericht des Bischofs nicht auch über ihn hereinbrach.
"Das ist Philipp Zobel", klärte Johannes den Bischof über seinen Begleiter auf.
"Er ist der einzige Sohn von Heinrich Zobel, dem Lehnsherrn von Giebelstadt."
Konrad streckte dem Knappen seinen rechten Handrücken entgegen, aber noch ehe Philipp, der von dieser unerwarteten Geste überrascht war, den violett schimmernden Amethyst küssen konnte, hatte der ehrwürdige Herr die Hand schon wieder zurückgezogen und spielten die Finger seiner Linken erneut mit dem so lieb gewordenen Schmuckstück.
"Sein Vater hat ihn mir vor vier Monaten auf der Wartburg anvertraut, dass ich aus ihm einen anständigen Ritter mache", sagte Johannes voller Stolz, denn auch seinem Vetter konnte nicht entgangen sein, dass Philipp der erste Knappe war, der in Ilfelds Diensten stand.
"Er soll dich zu einem anständigen Ritter machen?", fragte Konrad mit hochgezogenen Brauen und vergnügtem Gesicht den Jüngling und zeigte mit dem Zeigefinger seiner Linken auf Johannes, ohne dass die übrigen Finger von dem Ring abgelassen hätten. Dann sah er vergnügt lächelnd seinen Vetter an.
"Zum Wilddieb oder zum Bänkelsänger?"
"Konrad!", verbat sich Johannes vorsichtig und dennoch selbstbewusst den Spott.
"Es ist gut", wiederholte der Bischof und strich sich dabei durch die mit reichlich grauen Haaren durchsetzte und nach hinten gekämmte Mähne, die ihn aussehen ließ, wie einen in die Jahre gekommenen Löwen. Konrad war schon vierundvierzig Jahre alt.
"Seid mir also beide willkommen! Bezieht erst einmal euer Quartier und kümmert euch um eure Pferde. Dann werden wir weitersehen."
Johannes mochte seinen Vetter. Er bewunderte nicht nur dessen Äußeres: Die stattliche Erscheinung, denn Konrad war um einiges größer als er, und dessen dichtes, widerborstiges Haar, ließ dem ansonsten gewiss frommen Mann etwas Wildes und Unbezähmbares anhaften. Und er bewunderte seinen grau-schwarzen Bart, der sich über Konrads schmalen Mund wölbte und der in einem säuberlich gestutzten Kinnbart endete. Grüne Augen funkelten aufmerksam unter dichten Brauen und darüber wölbte sich eine hohe, von tiefen Querfalten durchfurchte Stirn, die manches von der Wehrhaftigkeit der Grafen von Krosigk erahnen ließ. Vor allem aber schätzte er trotz aller Würde und Strenge, die sein Vetter ausstrahlte, dessen heiteres und gern zum Spöttischen neigendes Wesen. Gerade dieser Charakterzug Konrads war es, der ihm den Vetter so liebenswert machte und der es ihm erlaubte, Johannes wie seinen jüngeren Bruder zu behandeln. Vielleicht sah er in ihm sogar den Sohn, den ihm die kirchlichen Gelübde verwehrt hatten.
"Benedicite!", begann Konrad das Tischgebet, nachdem sich die drei an den nicht gerade üppig gedeckten Tisch gesetzt hatten. "Benedicite!", antworteten die beiden Gäste mit andächtig gesenkten Köpfen, ehe der ehrwürdige Herr fortfuhr:
"Aller Augen warten auf dich, oh Herr, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllest alles, was da lebt mit Segen."
"Amen", hallte es ehrfürchtig durch den schmucklosen und düsteren Raum, den ein paar Kienspäne an den Wänden nur dürftig erhellten. Einer alten Gewohnheit folgend schnitt Konrad selbst Stück für Stück von einem gewaltigen, runden Brotlaib ab und reichte die unförmig dicken Scheiben weiter. Danach verfuhr er in gleicher Weise mit einem Schinken, der vom Räuchern so schwarz war wie Holzkohle.
"Ich habe dich zu mir gebeten", begann der Bischof, nachdem er sich mit einem kurzen Blick auf den Tisch davon überzeugt hatte, dass seine Gäste versorgt waren, "weil ich dich um einen großen Gefallen bitten will."
"Von einem Gefallen, den ich dir erweisen soll, stand nichts in deinem Brief", sagte Johannes während er mit seinem Messer ein kleines Stück von dem Geräucherten aufspießte, um es sogleich in seinem Mund verschwinden zu lassen.
"Das wäre auch nicht angemessen gewesen", gab Konrad betont freundlich zur Antwort, denn er wollte es sich nicht anmerken lassen, dass ihn die schnippische Bemerkung doch etwas gekränkt hatte.
"Es ist auch keine Kleinigkeit, die ich von dir erbitte und ich habe Tage und Wochen darüber nachgedacht, ob es angesichts dessen, was dir und deinem Vater widerfahren ist, überhaupt recht ist, was ich von dir erbitte. Aber ich glaube, du bist alt genug, um mir nach reiflicher Überlegung eine ehrliche Antwort geben zu können."
Konrads Worte wurden Johannes unheimlich und er sah sein Gegenüber so angestrengt an, dass er sogar aufhörte, das Stück Speck in seinem Mund weiter zu zerkauen. Würde ihn sein geliebter Vetter jetzt etwa bitten, in ein Kloster einzutreten, weil er es sich nicht mehr leisten konnte, seinen armen Verwandten zu unterstützen? Eher wollte er sich sogleich bereit erklären, sein Leben grundlegend zu ändern und sogar Philipp würde er aus seinen Diensten entlassen, nur um mit weniger Geld auszukommen. Herr im Himmel! Und Agnes? Was würde aus Agnes werden?
"Es könnte sein, dass du dabei sogar dein Leben lässt", fuhr Konrad Krosigk langsam und bedächtig fort.
"Also nicht in ein Kloster?", unterbrach Johannes ihn vorsichtig und seine Gesichtszüge hellten sich wieder auf, denn ein Leben im Kloster wäre für ihn schlimmer gewesen, als der grausamste Tod.
"Giovanni! Nicht doch, Giovanni!", rief Konrad ehrlich entrüstet.
"Einen Konvent, der dich ertragen könnte, gibt es nicht - da bin ich mir sicher. Den Gedanken, dich in ein Kloster zu stecken, haben dein Vater und ich schon aufgegeben, als du sechs Jahre alt warst. Schon damals waren dir Mädchen wichtiger als alles andere.“
Konrads Miene wurde wieder ernst und er fuhr fort: "Nein, es ist etwas Anderes, was ich von dir erbitte: Du sollst wie ich das Kreuz nehmen und mich auf meiner bevorstehenden Pilgerfahrt ins Heilige Land begleiten.“
"Ins Heilige Land?", wiederholte Johannes ungläubig, denn er hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass er einmal an die Stätten seiner Kindheit zurückkehren und sogar bis vor die Mauern Jerusalems ziehen sollte. Konrad legte seine Hand auf die seines Vetters, sah erst Philipp an, dann Johannes und schließlich begann er zu sprechen:
"Seit so vielen Jahren ist das vornehmste und heiligste Anliegen der gesamten Christenheit, Jerusalem der Hand der Heiden zu entreißen und über dem Grab Christi die Fahne des Heils und der Kreuzritter wehen zu lassen. Seit Papst Urban zum ersten Mal zur Fahrt ins Heilige Land aufgerufen hat, wurde viel edles Ritterblut vergossen, um die heiligen Stätten von den Sarazenen zu befreien. Jetzt ist es wieder so weit: Innozenz hat die gesamte Christenheit zu einem neuen Kreuzzug ins Heilige Land aufgerufen. Tausende Ritter aus Frankreich und Italien haben sich schon auf den Weg gemacht und unzählige andere aus deutschen Landen haben es ihnen gleichgetan und sich von ihren Familien verabschiedet, um Jerusalem zu befreien."
"Ich habe davon gehört, Konrad", sagte Johannes leise und umklammerte mit beiden Händen den silbernen Weinbecher vor ihm so fest, als wollte er sich an ihm festhalten. Er neigte das kostbare Gefäß ein wenig und sah auf seinen Grund, als müsste er dort nach etwas suchen, von dem er aber nicht wusste, was es war. Die rote Farbe des Weins erschreckte ihn. Er erinnerte sich der Stimme seines Vaters und der Stimmen so vieler anderer Ritter im Heerlager vor Akkon. Er hörte ihr fröhliches Johlen und ihr Singen, aber noch deutlicher hörte er ihr Kriegsgeschrei. Er erinnerte sich an ihr erbärmliches Wehklagen und an blutverschmierte Gesichter und Hände. Ja, er glaubte Ströme von Blut zu erkennen, während er in den Becher starrte.
"Wieder einer dieser unheiligen Kriege? Glaubst du wirklich, Konrad, dass unser Herr Jesus das von uns verlangt? Steht nicht geschrieben, du sollst nicht töten? Und dennoch ruft Innozenz die Christenheit zu einem neuen Zug ins Heilige Land, zu neuem Morden auf?"
Enttäuscht und mit traurigem Blick sah er seinen Vetter Konrad an, von dem er immer geglaubt hatte, er wäre der friedfertigste Mensch auf Erden, und schwieg. Dann holte Konrad tief Luft und sagte mit fester Stimme: "Ja, es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Aber es war kein geringerer als der heilige Augustinus, der zwischen einem gerechten und einem ungerechten Krieg unterschieden hat. Der gerechte Krieg wird um der Erhaltung eines allgemeinen Friedens willen geführt, damit auf Erden die von Gott gewollte Ordnung hergestellt wird. Ein dauerhafter Friede wird nur erlangt, wenn man für das Recht kämpft und dafür, dass es dauerhaft eingehalten wird".
"Das Unrecht", fuhr der Bischof aufgeregt fort, "muss bekämpft und bestraft werden, wo immer man es antrifft. Augustinus gestattet es deshalb auch einem Christen, dass er nach eingehender Gewissensprüfung zu den Waffen greift, um den Frieden zu erreichen."
Johannes sah seinen Vetter noch immer schweigend und mit unverändert ernster Miene an. Aber er ging auf dessen Argumente nicht ein. Johannes` vermeintliche Gleichgültigkeit verstimmte den Bischof, weswegen er sich jetzt Philipp zuwandte, der Konrad schon die ganze Zeit ehrfurchtsvoll und mit weit geöffneten Augen angestarrt hatte.
"Und was kann gerechter sein, als ein im Auftrag Gottes geführter Krieg?", rief Konrad jetzt so laut, dass sich seine Stimme beinahe überschlug, wodurch seine Rede aber unsicher wirkte. So unsicher, wie er gewiss auch in seinem Innersten in Wahrheit noch war. Denn das, was er da sagte, entsprach nicht wirklich dessen Überzeugung.
"Deus lo vult!", sagte Johannes leise und mit fast spöttischem Unterton, nachdem er seine Blicke ebenfalls auf Philipp gerichtet hatte.
"Ja", rief Konrad begeistert, denn er glaubte, dass seine Worte die Zweifel seines Vetters zerstreut hatten.
"Deus lo vult! Gott will es! Das sagte auch Innozenz, als er die Christenheit aufrief, Jerusalem von den Muslimen zu befreien. Also folgt auch ihr beiden dem Ruf des Heiligen Vaters und zieht mit mir ins Heilige Land?" Der Bischof wartete erst gar nicht eine Antwort ab, sondern erhob seinen Becher und rief noch einmal in die kleine Runde hinein:
"Deus lo vult!"
Johannes hörte gar nicht mehr zu, als Konrad dem ahnungslosen Philipp von den Heldentaten der Ritter und ihrer Könige erzählte. Vom französischen König Philipp August und von Richard, dem englischen König, dem sie den Beinamen Löwenherz gaben; von König Friedrich, dem Rotbart, und von Herzog Leopold von Österreich.
Johannes dachte nur an seinen Vater. Vor elf Jahren war Akkon gefallen und so lange lag der Tod seines Vaters jetzt zurück. "Deus lo vult" hatte auch er immer gerufen, wenn er in eine Schlacht ritt. Aber erschlagen brachte man ihn dem wartenden Sohn zurück. So, wie Konrad es jetzt tat, hatte vor zwölf Jahren auch Johannes` Vater von dem Zug ins Heilige Land geschwärmt und keine Macht der Welt hätte vermocht, ihn aufzuhalten. Auch Konrad würde sich nicht aufhalten lassen, dessen war sich der junge Ritter nach dessen flammenden Worten gewiss. Aber weshalb zog es gerade ihn, einen Mann der Kirche, einen Bischof, in den Krieg, fragte er sich. Und ohne darauf zu achten, dass Konrad sich noch immer über die Heldentaten der Ritter ereiferte, unterbrach er ihn:
"Ist es nicht Sache von Rittern, Kriege zu führen, seien sie nun gerecht oder nicht? Warum willst ausgerechnet du als ein Mann Gottes das Kreuz gegen ein Schwert eintauschen und gegen die Sarazenen ins Feld zu ziehen?"
Die Antwort des Bischofs kam schnell. Sie kam so schnell, dass es für Johannes den Anschein hatte, als hätte er schon lange nur auf diese eine Frage gewartet:
"Ich muss mich den Kreuzfahrern anschließen, Giovanni. Ich muss!", rief Konrad laut, griff hastig nach seinem Becher, trank einen kräftigen Schluck und fuhr dann fort:
"Es ist schon viele Jahre her, 1179 war es, um genau zu sein, als Heinrich der Löwe unsere Stadt belagerte, sie eroberte und sie niederbrannte, weil sich Bischof Ulrich im Streit um den deutschen Thron auf die Seite der Staufer geschlagen hatte. Auch unser Dom wurde damals ein Opfer der Zerstörungswut dieses jähzornigen Welfen. Nach dem plötzlichen Tod König Heinrichs trat ich in aller Öffentlichkeit dafür ein, dass Philipp, der jüngste Sohn Friedrich Barbarossas, zum deutschen König gewählt wurde, und nicht Otto, der Sohn jenes Welfen, der unsere Stadt in Schutt und Asche gelegt hatte. Innozenz hatte sich aber für Herzog Otto entschieden und gedroht, über jeden, der nicht seiner Weisung Folge leisten würde, den Bannfluch zu verhängen."
"Und stur, wie du als Krosigk nun einmal bist, hast du an Philipp als König festgehalten und wurdest dafür gebannt", fügte Johannes hinzu und sah dabei wieder in seinen Weinbecher.
"Innozenz wird den Bannfluch nur lösen, wenn ich seinem Aufruf folge. Genau so ist es", antwortete Konrad beinahe kleinlaut und mit belegter Stimme.
Es folgten nur wenige Augenblicke des Schweigens, aber Johannes kamen sie unendlich lange vor.
"Veni, creator Spiritus" hörte er die Kreuzfahrer in seiner Erinnerung singen. Und dazwischen erschallte immer wieder ihr Ruf "Deus lo vult". Ein Meer von Fahnen sah er, Spieße und Schilde. Und unzählige Ritter in glänzenden Rüstungen mit weißen Umhängen, auf welchen weit sichtbar das rote Kreuz der Pilger prangte.
"Veni, creator spiritus, mentes tuorum visita: imple superna gratia, quae tu creasti pectora", begann er jetzt leise zu singen.
"Du kommst also mit mir?", fragte Konrad mit weit geöffneten Augen und umklammerte zur Bestärkung der Frage den linken Arm seines Vetters. Dieser aber sang weiter und es war ihm, als wäre sein Geist, als wäre er selbst an einem anderen, weit entfernten Ort. Er sah längst vergessen geglaubte Burgen. Er sah Zeltlager von unvorstellbarer Größe und zahllose Schiffe.
"Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt; aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst den Schwachen Kraft und Mut."
"Er kommt mit mir!", rief der Bischof dem Knappen freudig zu und ließ Johannes unbeirrt weitersingen. "Er kommt mit!", wiederholte er noch einmal.
"Dich sendet Gottes Allmacht aus im Feuer und in Sturmes Braus; du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund."
Tränen liefen über seine Wangen, denn jetzt sah Johannes nicht mehr kampfesmutige Ritter in ihren glänzenden Rüstungen, sondern er erinnerte sich geschundener Leiber, zerfetzter Fahnen und zerbrochener Lanzen. Und er erkannte in seiner Erinnerung unter den vielen Toten den leblosen Körper seines Vaters.
"Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner
Kraft das Gute tut."
Johannes konnte jetzt seine Tränen nicht länger zurückhalten. Aber seine Tränen waren Tränen der Rührung, nicht Tränen trauriger Erinnerung. Über viele Jahre hinweg hatte er versucht, die Erinnerung an diese Zeit aus seinem Gedächtnis zu löschen. Der strenge Glaube, in dem er erzogen wurde, war ihm dabei kein Helfer gewesen. Nur die Leichtigkeit seines zuletzt geführten Lebens, die Unbekümmertheit, mit der er sich über all die Jahre hinweg mehr und mehr vertraut gemacht hatte, war ihm eine wirkliche Trösterin gewesen. Jetzt schien alles umsonst gewesen zu sein.
"Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden allezeit! Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann", sang er den Choral leise weiter.
Konrad wandte sich wieder Philipp zu, der all die Zeit nur dem Gesang seines jungen Herrn zugehört hatte.
Auch über Philipps Wangen liefen einige Tränen. Aber es waren Tränen der Angst, blanker Angst. Die Ahnung eines blutgetränkten Schlachtfeldes mit all den Toten, Freund wie Feind, mit dem Wimmern der Sterbenden und dem Wehklagen der Verletzten, ließ den Jüngling vor Angst beinahe starr werden.
"Wirst auch du mich begleiten, Philipp?", fragte der Bischof den Knappen und hoffte im Grunde, dass der Junge ablehnen würde. Denn die Verantwortung für dessen junges Leben wollte Konrad nicht übernehmen. Aber Philipp gab keine Antwort und hörte weiter nur seinem Herrn zu.
"Lass gläubig uns den Vater sehn, sein Ebenbild, den Sohn, verstehn und dir vertraun, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt."
Mit einem andächtigen "Amen" beendete der Bischof den Choral und bekreuzigte sich gleichzeitig. Und Philipp fügte leise hinzu: "Ich komme mit Euch!"
Zwei
Die kleine Schar um Konrad Krosigk – sie zählte sieben Mann – war spät dran. Eigentlich schon so spät, dass sich Konrad kaum mehr Hoffnung gemacht hatte, das Heer und die Flotte in Venedig rechtzeitig zu erreichen. Erst hatte er Schwierigkeiten, die nötigen Mittel für die Pilgerfahrt aufzubringen. Doch aus dieser Verlegenheit half ihm ein Freund, der Domdechant Albert Hallermund. Dann bescherte der spät hereingebrochene Winter zuerst Konrad und dann auch Johannes eine fiebrige Erkältung, die zumindest den Bischof reichlich zehn Tage ans Bett fesselte. Ein über Vierzigjähriger steckt eine Erkältung nicht so leicht weg. So wurde es schließlich Palmsonntag, bis sie nach einem festlichen Gottesdienst endlich Halberstadt verließen.
Erst ging es in östlicher Richtung bis an die Saale und von dort nach Süden immer den Fluss entlang von Burg zu Burg und von Kloster zu Kloster. Sie durchquerten weite, fruchtbare Ebenen und zogen über sturmumwehte Höhen und durch endlose, dunkle Wälder, aus welchen es manchmal kaum ein Entkommen zu geben schien. Wenige Tage vor Pfingsten erreichten sie das Kloster Waldsassen, das dicht am Böhmerwald und in einer kargen, ärmlichen Gegend lag. Zisterzienser hatten es erst siebzig Jahre zuvor gegründet, so dass sich vor allem die Klostergebäude in einem noch sehr guten Zustand befanden und eine angenehme Unterkunft versprachen. Abt Eckenberg aber war entweder ein asketischer Heiliger oder ein herzloser Geizkragen. Seinem Konvent gestand er außer an hohen Festtagen nur Wasser, dünne Kohlsuppe und trockenes Brot zu. Gaumenfreuden wie gebratenes Fleisch, Bier oder gar Wein verachtete er. Der einzige Trost war wohl, dass er sich selbst noch weniger gönnte als seinen Mitbrüdern. Und so sah dieser fromme Mann aus, als hätte man ihn gerade erst aus jahrelanger Kerkerhaft entlassen: Bleich und abgemagert. Sowohl Konrad als auch Johannes war eine bescheidene Lebensführung durchaus nicht fremd oder lästig, solange sie sich zeitlich in Grenzen hielt; aber Karfreitag lag noch keine fünfzig Tage zurück, so dass sie sich nach nur zwei Tagen bei Wasser und Brot einen Tag vor dem Pfingstfest wieder auf den Weg machten. Allerdings ließen es sich Johannes und Philipp trotz aller Bedenken Konrads nicht nehmen, in den Wäldern des enthaltsamen Prälaten zum Abschied ein Reh zu wildern, das sie am Pfingstabend am offenen Feuer brieten und genüsslich verzehrten.
Zwei Tage später erreichten sie weiter südlich ein unbedeutendes, kleines Dorf, dessen Namen sie bald wieder aus ihrem Gedächtnis gelöscht haben würden. Es lag in einer weiten Senke und an einem recht unscheinbaren Flusslauf, dessen Name in der kaum verständlichen Sprache der dortigen Bewohner so ähnlich klang wie Noh und dessen Ufer von Weiden gesäumt waren, so weit das Auge reichte. Es hatte in dieser Gegend wohl schon längere Zeit nicht mehr geregnet, denn das Flüsschen mit dem merkwürdigen Namen Noh führte sehr wenig Wasser. So sahen die Felder erbärmlich aus und nur da und dort ragte ein kümmerlicher Halm aus dem kargen Boden, der in dieser Gegend ohnehin mehr aus Steinen denn aus Erde bestand, empor. In diesem armseligen Dorf gab es nicht einmal eine Herberge, weshalb Konrads Knechte die Zelte mitten auf dem Dorfanger aufschlugen. Die Menschen misstrauten ihnen, denn keiner kam näher als einen Steinwurf an die Fremden heran und selbst die Kinder, die überall auf ihrer bisherigen Fahrt ohne Scheu und voller Neugier zu ihnen kamen, sie begafften und befragten, hockten teilnahmslos im Schatten der heruntergekommenen Hütten. Von Häusern wie in Halber-stadt oder andernorts konnte hier wahrhaftig keine Rede sein!
"Haben wir etwas falsch gemacht, weil sie uns so offenkundig meiden?", fragte Johannes seinen Vetter.
"Wir werden es bald wissen", antwortete er knapp und ging geradewegs auf jene Hütte zu, die noch am ehesten einem Haus glich und die vielleicht dem Ältesten dieses Dorfes gehörte. Johannes folgte ihm und umklammerte den Griff seines Schwertes, denn hier traute er keinem über den Weg. Knarrend öffnete sich die Tür und Konrad trat ohne Scheu ein.
"Der Herr sei mit euch!", rief er mit fester Stimme in den Raum, ohne dass er überhaupt ausmachen konnte, wer sich in ihm aufhielt, so duster war es dort. Aus der einen Ecke des stickigen, engen Raumes kam unaufhörlich das trockene Husten einiger Kinder; aus einer anderen das schwere und rasselnde Atmen einer alten oder kranken Person, von welcher man aber wegen der Dunkelheit noch nicht sagen konnte, ob es ein Mann oder eine Frau war. Die Tür zu dem kleinen Stall, der sich an die Stube anschloss, stand offen und von dort kam ihnen ein Mann entgegen. Sein Alter war kaum einzuschätzen, denn sein Gesicht war schmutzverschmiert, seine Gestalt eher unscheinbar und seine Kleidung bestand aus kaum mehr als einigen alten Lumpen. Mit freundlichen Worten klärte Konrad ihn auf, wer sie waren und wohin ihr Weg sie führte. Weder beugte die verkommene Gestalt ihr Knie vor dem Bischof, noch schien den Alten zu beeindrucken, dass ein Graf und ein Baron, die sich auf dem Weg nach Jerusalem befanden, seine Hütte betreten hatten. Johannes war sich sicher, dass dieser Mann noch nie in seinem Leben einem Bischof begegnet war und ihn darüber hinaus der Name Jerusalem herzlich wenig beeindruckte.
"Wer ist euer Herr?", wollte Konrad wissen.
"Der Leuchtenberger", brummte der Alte. Ohne ihn weiter zu beachten, machte Konrad zwei Schritte und öffnete einen Fensterladen, damit er wenigstens etwas sehen konnte. Das wenige Licht, das jetzt in die Hütte drang, ließ die ganze Erbärmlichkeit des Daseins ihrer Bewohner offenbar werden. In der Ecke, aus der sie das Husten vernommen hatten, kauerten drei kleine Kinder, die sie mit großen Augen ängstlich anstarrten. Und in der anderen Ecke lag auf einer Holzpritsche und in einer zerlumpten Decke gewickelt ein Weib.
"Sie ist krank, sehr krank", klagte der Mann leise.
"Ich verstehe mich ein wenig auf die Heilung von Krankheiten", sagte Konrad mitleidsvoll.
"Soll ich mir sie ansehen?". Der Mann zuckte nur hilflos die Schultern.
"Hildegard von Bingen hat viel über Krankheiten und deren Heilung geschrieben", fuhr Konrad eifrig fort, während er sich neben die Pritsche kniete und vorsichtig die Lumpen, welche die Frau bedeckten, beiseite zog.
">Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum< oder >Buch über das innere Wesen der verschiedenen Kreaturen und Pflanzen< heißt ihre Schrift, die mir und anderen schon viel geholfen hat", fügte er in seiner Eitelkeit selbst vor diesen einfältigen Menschen belehrend hinzu, während er erst seine Hand auf die Stirn der Kranken legte, dann vorsichtig ihr Handgelenk umklammerte und schließlich mehrmals die Arme der Frau abtastete. Dann ging er zu den Kindern und verfuhr mit ihnen ebenso.
"Die Krankheit, an der deine Familie leidet, ist nicht ansteckend", sagte Konrad zuletzt mit bedächtiger Stimme und sah den Mann mit besorgten Blicken an. "Hildegard von Bingen hat sie auch mit keinem Wort in ihren Schriften erwähnt. Aber sie ist schlimmer als Pest und Cholera; sie ist schlimmer als alle Krankheiten zusammen und ihr Name klingt einfach aber erschreckend: Hunger! Gib deiner Familie etwas zu essen, und dieses Mitleid erregende Siechtum wird bald ein Ende haben!"
"Wir haben nichts, Herr", gab der Alte leise zur Antwort und senkte aus Scham über das Elend, das ihn umgab, den Kopf.
"Wir sind nicht die einzigen, die Hunger leiden. Die meisten anderen im Dorf sind noch schlimmer dran. Seht in den Stall: Er ist leer. Der Winter war lang und hart. Das Frühjahr hat es uns verregnet und das wenige Korn, das
Wurzeln geschlagen hat, ist vertrocknet."
"Und der Leuchtenberger?", fragte Konrad vorsichtig.
"Von Herzog Diepold ist außer dem Galgen nichts zu erwarten. Zieht weiter Herr! Ihr könnt uns nicht helfen. Und wenn Ihr zur Burg Leuchtenberg kommt, dann beklagt nicht unser Schicksal! Wir müssten es nur schwer büßen. Der Herzog will von unserem Leid nichts wissen und rächt sich an jedem, der die Worte Leid, Elend und Hunger auch nur ausspricht."
Sie konnten für diese armen Leute wirklich nicht viel tun. Konrad hatte einige Beutel mit getrockneten Kräutern bei sich, aus welchen er ein Gebräu kochte, das er den hustenden Kindern liebevoll einflößte. Johannes und Philipp suchten derweil in ihren Vorräten alles zusammen, was sie entbehren konnten und verteilten es an die Kinder. Aber es war nicht viel mehr als etwas Brot, Äpfel vom vergangenen Herbst und ein paar Stücke des bei Abt Eckenberg gewilderten Rehbocks. Vielleicht wurde dadurch wenigstens ihre gewiss sündhafte Wilderei vergolten!
Schweigend und mit dem beklemmenden Gefühl der Hilflosigkeit verließen sie früh am anderen Morgen jenes unglückliche Dorf an dem Flüsschen Noh.
Die Burg des Leuchtenbergers thronte stolz auf einer hohen, oben abgeflachten Granitkuppe und zu ihren Füßen breitete sich eine Landschaft von herber Schönheit mit sanften, bewaldeten Höhen aus und dazwischen lag jenes Tal, das sie eben noch durchquert hatten. Das Elend derer, die dort unten lebten, war von hier aus nicht wahrzunehmen. Die Sonne stand hoch über ihnen und so waren die Reisenden dankbar, als die schwere Holzbrücke herabgelassen wurde und ihnen der enge, schattige Burghof kühlere Luft verhieß. Herzog Diepold war ein kleingewachsener, rothaariger Mann von gut dreißig Jahren, mit buschigem Vollbart und kleinen wachen Augen. Er begrüßte die Fremden überschwänglich freundlich, als ob er nur allzu genau wusste, welchen Groll Konrad und seine Begleiter ihm gegenüber wegen der Armut seiner Untertanen hegten.
"Kreuzritter!", rief er aufgeregt.
"Kreuzritter auf meiner Burg! Welch große Ehre für mich und mein Haus!"
"Ihr müsstet uns nur ins Heilige Land begleiten und Ruhm und Ehre regneten auch auf Euer Haus nur so herab", antwortete ihm Konrad, während er dem Burgherrn, dessen Leibesfülle Johannes erst auffiel, als auch er auf ihn zuging, die Hand zum Gruß entgegenstreckte.
"Mein Vater Gebhard ist einst mit König Konrad ins Heilige Land gezogen und wurde dafür großzügig belehnt. Ich selbst habe mich jahrelang für unseren König Philipp grün und blau schlagen lassen. Ich habe genug vom Kämpfen! Aber jetzt sagt mir: Wen darf ich bei mir willkommen heißen?"
Konrad sagte ihm, wer sie waren und wohin der Weg sie führen würde. Diepold befahl seinem Verwalter, die Pferde zu versorgen und die vier Knechte des Bischofs in deren Unterkunft zu führen. Er selbst begleitete Konrad und die beiden jungen Herren die steile Treppe zum Pallas hinauf, huschte durch zwei, drei schmale und finstere Gänge und führte erst Konrad und schließlich Johannes und Philipp zu deren Kammer.
"Ich lasse Euch warmes Wasser bringen. Dann ruht Euch ein wenig aus!", gab er Konrad und auch den beiden anderen zum Abschied mit und versprach, sie in zwei Stunden wieder abholen zu lassen. Kurze Zeit später füllten zwei unentwegt kichernde Mägde einen Holzzuber, der in einer Ecke des niedrigen Zimmers stand, abwechselnd mit heißem und kaltem Wasser. Schließlich verschwanden auch sie und endlich genoss erst Johannes und nach ihm der Knappe das Bad und anschließend die vollkommene Ruhe dieses heißen Sommernachmittags. Nur hin und wieder hörten sie die Hammerschläge eines Schmieds, der ihre Pferde frisch beschlug und dazwischen das unaufhörliche Gezwitscher der Feldlerchen.
Johannes war wohl in tiefen Schlaf gesunken, denn er vernahm Philipps Stimme wie aus weiter Ferne und erst als er sich bewusst geworden war, dass dessen ständiges "Johannes, komm her!" nicht zu seinem Traum gehören konnte, öffnete er missmutig die Augen und sah in die Richtung, aus welcher die lästigen Befehle kamen. "Jetzt komm schon!", wiederholte Philipp noch einmal und machte mit seinem Kopf eine ruckartige Bewegung hin zu der Fensteröffnung, neben der er stand. Schlaftrunken ging Johannes zu ihm und sah in die Tiefe. Dort lag ein kleiner Garten, der nach Osten an der Wand unter ihnen und nach Westen an einer niedrigen Mauerbrüstung endete. Dahinter fiel das felsige Gelände steil ins Tal hinab, wo es in eine gleichmäßig hügelige, schier unendliche Landschaft überging. Vor der Brüstung und im Schatten eines Birnbaums stand eine junge Frau, die an der rechten Hand einen kräftigen ledernen Handschuh trug und über ihrem Kopf ein aus Leder geflochtenes Band kreisen ließ, an dessen Ende ein Gegenstand hing, der kleiner war als eine geballte Faust. Ihre Bewegungen wirkten gesetzt, ja sogar langsam, aber sie verliehen dieser Frau, die etwas älter als zwanzig Jahre gewesen sein mochte, eine besondere Würde und wirkten auf die Betrachter beruhigend. Stundenlang mochte man dieser Schönheit – und schön war diese Frau ohne jeden Zweifel – völlig gedankenlos zusehen, hätte sie jetzt nicht das Kreisen der Leine sowohl durch ihre Bewegung, als auch durch das Verkürzen der Leine selbst, die sie schwang, mehr und mehr beschleunigt und wäre nicht plötzlich wie ein Blitz ein Falke vom Himmel gestoßen, der sich erst an dem Gegenstand am Ende des Seils und wenig später am Handschuh der Schönen festkrallte. Sie legte dem Falken eine lederne Fußfessel an und stülpte ihm ein kleines Lederhäubchen über den Kopf, damit er nichts mehr sehen konnte und sich still hielt. Dann wandte sie sich einem Tisch zu, auf dem neben allerlei Gerätschaften auch eine kleine Schale mit Fleisch stand. Sie nahm davon ein kleines Stück und hob den Falken etwas in die Höhe und fütterte ihn. In diesem Augenblick trafen sich für kurze Zeit ihre und Johannes` Blicke. Doch sie ließ sich nichts anmerken und kümmerte sich weiter nur um ihren Falken. Johannes aber erschrak beinahe zu Tode, denn zum einen wurde ihm erst jetzt bewusst, dass er während all der Zeit mit völlig entblößtem Oberkörper am Fenster gestanden hatte und zum anderen hörte er von weitem die Stimme des Leuchtenbergers.
"Geh weg!", fauchte er Philipp an und machte sogleich selbst ein paar Schritte nach hinten, bis er sich sicher war, dass man ihn von dort unten aus nicht mehr sehen konnte. Denn Herzog Diepold sollte auf keinen Fall bemerken, dass er die Schöne im Garten, wer immer auch sie gewesen sein mag, beobachtet hatte und noch dazu mit nacktem Oberkörper!
Während er sich ankleidete, versuchte Johannes, sich das Äußere der Schönen ins Gedächtnis zu rufen, denn er wollte sich ihr Bild für immer einprägen. Er erinnerte sich ihrer langen, dunkelbraunen Haare, die in weiten Locken über ihre Schultern dahinglitten wie die Wellen eines vom Sturm aufgepeitschten Sees. Er glaubte, weite, fröhliche Augen und sanfte Lippen erkannt zu haben. Und er zweifelte nicht einen Augenblick, dass ihr knöchellanges, gelbes Kleid einen so makellosen Körper verbarg, wie ihn selbst eine Heilige nicht gehabt haben konnte! Wer mochte diese Frau nur sein? Und wie mochte sie nur heißen? Namen vermögen alles. Und Namen vermögen nichts! War Irmhilde nicht ein jedes Liebesgefühl im Keim erstickender Name, mochte die Arme, die ihn trug, auch noch so liebenswert sein? Gleichwohl würde niemand ernsthaft behaupten wollen, dass das reizvollste Wesen auf Erden nur deshalb etwas von seinem Liebreiz verliert nur, weil es einen seltsam klingenden Namen trägt.
"Geben wir einer Distel einen so hässlichen Namen wie Distel, weil sie wirklich hässlich ist, oder ist der Name Distel oder die Distel selbst in Wirklichkeit gar nicht hässlich?", fragte er Philipp, der sich wieder langsam ans Fenster herangewagt hatte.
"Oder könnte auch eine Rose Distel heißen? Würden wir eine Rose nur deshalb als hässlich empfinden, wenn sie Distel hieße?" Philipp schüttelte verständnislos den Kopf und sagte:
"Ist dir nicht recht wohl?"
"Es ist schon gut. Du verstehst mich ja doch nicht!"
"Disteln sind etwas Wunderschönes", setzte Philipp dennoch nach.
"Stell dir einfach vor, du sähest in ihr Herz, wenn du ihre Blüten betrachtest! Was interessiert dich dann ihr stachliger Rest? Rosen haben schließlich auch Dornen!"
Es war Herzog Diepold selbst, der diese etwas eigenartige Unterhaltung beendete, als er an die Kammertür klopfte und sie bat, mit ihm zu kommen. Desgleichen tat er bei Konrad. Es war noch früh am Abend und so führte er sie wieder in den Burghof hinab und von dort in den Pferdestall, wo er seine Gäste nicht ohne Stolz davon überzeugte, dass ihre Tiere bestens versorgt und tatsächlich frisch beschlagen worden waren, wie sie es nachmittags erhofft hatten. Sie durchliefen einige Wehrgänge und stiegen die engen Stufen eines Turms hinab, von wo aus sie in eine kleine Kapelle gelangten. Dort knieten sie alle zum stillen Gebet nieder und verharrten so lange schweigend, bis Konrad ihnen durch ein laut gesprochenes "Amen" erlaubte, wieder aufzustehen. Zuletzt erreichten sie einen angenehm kühlen, kleinen Saal, in dessen Mitte ein langer Tisch und an dessen Längsseiten zwei gleichlange Holzbänke standen. Ehe sie sich setzten, öffnete sich an der Stirnseite des Saales eine Tür und die Schöne aus dem Burggarten trat ein. Sie trug über einem bodenlangen Rock ein hochgeschlossenes, dunkelblaues Mieder mit enganliegenden, langen Ärmeln, so dass von ihrem gewiss bezaubernden Körper nicht mehr als der Kopf, ein wenig von ihrem schlanken Hals und die Hände zu sehen waren. Ihre langen Locken hatte sie kunstvoll geflochten und nach oben gesteckt. So konnte man ihre zierlichen und wohlgeformten Ohren sehen.
"Alexandrine, mein Weib!", begrüßte Diepold die Frau, und sein überschwänglicher Ton ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er auf seine schöne Gemahlin sehr stolz war. Aus Eitelkeit und Hochmut hielt Konrad ihr den Bischofsring zum Kusse entgegen, während der Herzog die Fremden vorstellte. Als Schmeichler schöner Frauen, der Konrad trotz seines geistlichen Standes geblieben war, sagte er:
"Ich hätte nicht gedacht, dass der Herzog in dieser armen Gegend einen so kostbaren Schatz, wie Ihr es seid, verborgen hält!"