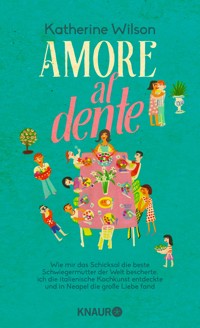
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr erstes Date in Neapel hat sich die junge Amerikanerin Katherine Wilson anders vorgestellt. Statt in ein lauschiges Restaurant fährt Salvatore sie nach Hause zu seiner Mamma. Diese steht elegant gestylt und gut gelaunt am Herd und kocht für die Famiglia. Für Salvatore. Für die Schwester mit den unglaublich blauen Augen. Und für den Vater, der nichts mehr genießt als gutes Essen. Und kaum nimmt Katherine den ersten Bissen, da fühlt sie, dass sie angekommen ist bei sich und im Herzen von Salvatores Großfamilie. Erst pasta al dente dann l'amore.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Katherine Wilson
Amore al dente
Wie mir das Schicksal die beste Schwiegermutter der Welt bescherte, ich die italienische Kochkunst entdeckte und in Neapel die große Liebe fand
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Erst Pasta al dente, dann Amore.
Ihr erstes Date in Neapel hat sich die junge Amerikanerin Katherine Wilson anders vorgestellt. Statt in ein lauschiges Restaurant fährt Salvatore sie nach Hause zu seiner Mamma. Diese steht elegant gestylt und gut gelaunt am Herd und kocht für die Famiglia. Für Salvatore. Für die Schwester mit den unglaublich blauen Augen. Und für den Vater, der nichts mehr genießt als gutes Essen. Und kaum nimmt Katherine den ersten Bissen, da fühlt sie, dass sie angekommen ist im Herzen von Salvatores Großfamilie – und bei sich.
Inhaltsübersicht
Widmung
Einleitung
’A pizza
State Department
Oreos
’O sartù
Schmutzige Wäsche
’O ragù
Brot und Wein
Insalata di polipo
Presenza
Ein einzelner Teller Pasta
Stracchino-Weichkäse direkt aus dem Kühlschrank
Englischunterricht
Melanzane a funghetto
Pasta e fagioli
Rococò und Eierlikör
Capitone
Pizzetta, Cappuccino und Orangensaft
Frische Eier
Impepata di cozze
Casatiello
Gelato alla nocciola
Pasta al forno
Caffè macchiato
Burger & Pommes
Bologna
Tonino Reale
Maniküre vor der Messe
Heimkommen
’O purpo
Bis dass das Dessert uns scheidet
Rom
San Gennaro
Teppichboden
Autospurgo
Pasta alla Genovese
Vestiti
Extracomunitari
Essen und Schauspiel
Cotoletta alla Milanese
Das macht den Braten nicht fett
Parmigiana di melanzane
Eifersucht
Klimaanlagen
Totaler Hunger
Erdnussbutter
’A Marenna
Raffaella jr.
Lasagne
Salat
Rezepte
Ragù
Zutaten:
Insalata di polipo
Zutaten:
Parmigiana di melanzane
Zutaten:
Sartù di riso
Zutaten:
Dank
Für meine Eltern, Edward und Bonnie Wilson,
und für meine Schwester Anna
Einleitung
In der griechischen Mythologie trieben auf Klippen nahe Neapel die prachtvoll gelockten Sirenen ihr Unwesen. Mit ihrem betörenden Gesang lockten sie vorüberfahrende Schiffer an ihre Gestade – in Gefahr, in den Schiffbruch und in den Tod. Keiner, der ihrem Gesang lauschte, kam mit dem Leben davon.
Odysseus war sehr begierig, diesen Gesang zu hören. Er sollte schöner sein als alles andere auf der Welt, und er wollte der einzige Mensch sein, der ihm gelauscht und es überlebt hatte. Mit einer Mischung aus Stolz, Neugier und Gewitztheit schmiedete er einen Plan. Er beschaffte Ohrstöpsel für seine Mannschaft und ließ sich von ihr an den Mast binden. Als sein Schiff die Sirenen passierte, brüllte er seine Männer an, sie sollten ihn losbinden und Kurs auf die Küste nehmen. Sie taten es nicht, und er überlebte.
Im Nachhinein war Odysseus sicherlich froh darüber, dass ihn seine zeitweise ertaubte Belegschaft vor dem Tod bewahrt hatte. Aber er wäre bestimmt auch gerne umgekehrt. Nicht nur, um die Sirenen zu sehen und zu hören, sondern auch, um jenes märchenhafte Land unter dem Vulkan zu betreten, das da hieß: Neapolis, die Neue Stadt.
Und damals war die Pizza noch nicht mal erfunden.
Ich kam nicht an einen Mast gebunden nach Neapel. Ich kam im Herbst 1996 mit einem brechend vollen Delta-Airlines-Flug aus Washington, D.C. Sirenen gab es keine mehr, doch auch ich wurde angelockt und verwandelt. Mein Kopf war von Wissensdurst erfüllt, mein Körper von Gelüsten, mit denen ich noch nicht recht umzugehen wusste.
Goethe schrieb: »Siehe Neapel und stirb!« Ich sah Neapel und begann zu leben.
’A pizza
Als Salvatore zu unserer ersten Verabredung in seinem kleinen roten Fiat angescheppert kam, war er über zwanzig Minuten zu spät. Der Wagen sah aus wie eine Blechbüchse und klang, als pfiffe er aus dem letzten Loch. Die Abgasfahne, die er ausspie, brachte mich zum Husten. Salvatore reagierte, indem er zweimal kurz hupte und mir ein strahlendes Lächeln schenkte.
Ich traf mich das erste Mal mit dem Typen, und er kam zwanzig Minuten zu spät. Was fiel ihm ein?
Ich war gerade mit dem College fertig und erst ein paar Tage zuvor in Neapel eingetroffen, um am dortigen amerikanischen Konsulat ein dreimonatiges Praktikum zu beginnen. Ich stand vor dem Eingang des Internats, in dem ich ein Zimmer gemietet hatte, und trug einen blauen Blazer und eine schwarze Hose.
Dieses Praktikum war weniger ein Karriereschritt als vielmehr ein Initiationsritus: In meiner Familie gehörte es dazu, dass man in seiner College-Zeit oder anschließend »Auslandserfahrung« sammelte. Große, in Leder gebundene Fotoalben auf dem Dachboden meines Elternhauses in Washington zeigen meinen lächelnden Vater ganz Upper-Class 1961 in Bordeaux und meine Mutter in einem Wildleder-Outfit 1966 in Bologna. Sie hatten dort Fremdsprachen erlernt und die aufregendste Zeit ihres Lebens verbracht. Nun war die Reihe an mir, und die Frage war: Wohin sollte ich gehen?
Dass meine Wahl auf Neapel fiel, war alles andere als naheliegend. Bei den Italienurlauben meiner Kindheit hatten wir die Stadt entweder gemieden oder schnellstmöglich hinter uns gebracht, um nach Pompeji oder zum Vesuv zu gelangen. Schmutzig und gefährlich sei es dort, hatten wir gehört. Mein Großvater, dessen Eltern aus Kalabrien stammten, sagte gern, Neapolitaner könnten einem die Strümpfe stehlen, ohne einem vorher die Schuhe auszuziehen.
»Du solltest in die Toskana gehen«, rieten mir Freunde meiner Eltern. »Warst du schon mal in Siena? Oder in Florenz?«
Die heitere Pracht der Toskana wäre für ein Oberschichtmädchen wie mich genau das Passende gewesen. Es schien das zu sein, was von mir erwartet wurde, und zu tun, was von mir erwartet wurde, war schon immer eine große Stärke von mir gewesen. Meine ganze Kindheit hindurch hatte ich an Privatschulen Spitzenleistungen erbracht, und auf dem College hätte mein Hauptfach auch »Erwartungen übertreffen« oder »Mommy und Daddy stolz machen« heißen können. Es wurde Zeit, dass sich das änderte.
Der amerikanische Konsul in Neapel hatte an derselben Uni wie meine Eltern Internationale Beziehungen studiert. Im Frühjahr zuvor hatten mich die beiden bei einem Fundraising-Dinner in Washington neben ihn plaziert, und er hatte mich gefragt, ob ich für meinen Auslandsaufenthalt auch Neapel in Erwägung gezogen habe. Falls ich interessiert sei, könne er mir ein unbezahltes Praktikum in der politischen Abteilung des Konsulats verschaffen.
Neapel?
Ich dachte an gestohlene Strümpfe und Brieftaschen, an Mafia und Korruption. Ich dachte auch an Pizza. Die Saat war gelegt.
Ich erwähnte die Idee Leuten gegenüber, die mich fragten, was ich nach dem College machen wollte. »Ich überlege, nach Neapel zu gehen«, sagte ich und erntete damit diesen ganz besonderen Blick: die Augen aufgerissen und ein »bloß nicht« in Großbuchstaben ins Gesicht geschrieben. Begleitet wurde das von Warnungen wie »Da ist es schmutzig!«, »Da ist es gefährlich!« und sogar »Da sehen die netten und die fiesen Typen genau gleich aus! Man erkennt überhaupt keinen Unterschied!«
Soso, dachte ich. Klingt faszinierend.
Heute weiß ich, mit Neapel ist es wie mit New York: Man liebt es, oder man hasst es. Und liebt man es, dann bringt es nichts, dafür zu werben. Diejenigen, die es hassen, wird man ohnehin nicht bekehren. Neapel strotzt von einer chaotischen Lebensenergie, die einen zwingt, sich ihr hinzugeben. Wenn man sich dagegen sträubt, wenn man sie verurteilt oder sich gar davor versteckt, sollte man die Stadt besser gleich wieder verlassen – bevor einem noch die Brieftasche geklaut wird.
Mir war zum Glück nicht die Brieftasche geklaut worden, während ich auf diesen Salvatore wartete, dachte ich, als er die knarrende Autotür öffnete und ausstieg, um sich vorzustellen. Also ehrlich: Zwanzig Minuten?
Salvatores Mutter, Raffaella Avallone, war es, die mir das Zimmer in dem Internat vermittelt hatte. Ich hatte den Konsul gebeten, mir bei der Suche nach einer Unterkunft behilflich zu sein, nachdem wir die Einzelheiten des Praktikums geklärt hatten. Er leitete das gleich an seine Frau weiter, eine italienische Signora, die nicht nur in Diplomatenkreisen, sondern auch in der neapolitanischen High Society verkehrte. Und sie wusste: Die Dame, die bei Benefiz-Lunches, Charity-Galas und Bridge-Turnieren im Hintergrund alles regelte, war Raffaella Avallone. Und dann hatte diese Raffaella auch noch zwei Kinder im Alter der Praktikantin!
Und so erfuhr Raffaella, dass es da eine junge Frau gab, die eine Sistemazione brauchte, eine Unterkunft. Mi sono mossa subito, war der Ausdruck, den sie gebrauchte: Ich habe mich sofort in Bewegung gesetzt. Sie fand ein Zimmer für mich und sagte ihrem Sohn Salvatore, es gebe da eine junge Amerikanerin, die er anrufen und mit der er sich treffen solle. »Salva!«, sagte sie. »Geh mal mit ihr aus. Das arme Kind kennt doch hier keinen. Und verspäte dich bitte nicht.«
Am nächsten Tag rief Salvatore mich an. So ein Telefonat stellte mich vor eine enorme Herausforderung, denn mein Italienisch war noch sehr lückenhaft, und viel mehr als »Ich habe Hunger« und »Ich bin Amerikanerin« konnte ich nicht rüberbringen. Zwar verstand ich nur das wenigste von dem, was Salvatore sagte, sein Lachen aber fand ich hinreißend. Außerdem kannte ich in Neapel tatsächlich keine Menschenseele. Am Abend zuvor war ich mit zwei siebzehnjährigen Jungs essen gegangen, die ich in einem Bus kennengelernt hatte. Ich wollte Compagnia. Daher war ich froh, dass mich dieser Salvatore – falls ich das richtig verstanden hatte – am nächsten Abend abholen würde. Schlimmstenfalls, dachte ich, könnte ich ein wenig mein Italienisch üben.
»Du siehst gar nicht amerikanisch aus!«, glaubte ich, dass er sagte, nachdem er sich vorgestellt hatte. Also, er sah auch nicht wie ein typischer Neapolitaner aus. Er war groß, dabei nicht muskulös, sondern lang und schmal, mit einer schmächtigen Brust, die in einen Bauchansatz überging, der ihm über den Jeansbund hing. Sein Teint war gebräunt, er hatte volle Lippen und eine große römische Nase. Und er trug ein T-Shirt, auf dem in Comicschrift »MIAMI!« stand.
Ich erwartete, dass er sagen würde: »Freut mich, dich kennenzulernen. Entschuldige bitte, dass ich mich verspätet habe.« Doch da kam keine Entschuldigung, kam keine nette Floskel und auch nicht die Frage: »Was möchtest du denn unternehmen?« Was wieder kam war dieses hinreißende Lachen. Es war ein Lachen beim Einatmen, das mit einem hohen Ton begann, dann die Tonleiter hinabsprang und in der Stimmlage seiner Sprechstimme endete. Und es wurde begleitet von einem Lächeln, das viele weiße, makellose Zähne zeigte.
Er hielt mir die Beifahrertür auf. Als ich einstieg, quietschte unter mir der Sitz. Überhaupt wirkte Salvatore zu groß für dieses winzige Auto. Sein schwarzes Haar klebte statisch aufgeladen unterm Dach. Bei einem Blick zum Lenkrad fiel mir auf, dass seine Fingernägel so vollkommene Ovale bildeten, wie man das nur bei einer professionellen Maniküre hinbekam. Er war ein Junge, noch kein Mann, der gut aß und offenbar ein angenehmes Leben führte.
Salvatores Fahrstil erforderte anscheinend nicht, dass er den Blick auf die Straße richtete. Stattdessen sah er mir in die Augen und probierte an mir sein grausiges Englisch aus, ohne sich dafür zu entschuldigen, dass er alle Verbformen durcheinanderbrachte. Wie konnte ein Junge von dreiundzwanzig Jahren so selbstsicher sein? Ich kam mir dagegen unreif, passiv und schweigsam vor. Sag doch mal was auf Italienisch!, befahl ich mir. Zum Beispiel: Wo fahren wir denn hin? Es geht doch nicht an, dass du hier null Kontrolle über die Situation hast!
»Dove andiamo?«
»To my apartment. America! America! Petrol-dollari!« Amerikanische Öl-Dollars? Glaubte er etwa, ich sei im Ölgeschäft und schwerreich? Heute weiß ich, dass es an der Fernsehserie Dallas liegt, dass viele Italiener glauben, wenn Amerikaner vermögend sind, sei das meist texanischem Öl zu verdanken. An jenem ersten Abend aber war mir schleierhaft, worauf sich das bezog. Ich sah nur, dass Salvatore großen Spaß daran hatte, diese Worte auszusprechen. Immer und immer wieder.
Und dann kam erneut dieses Lachen.
My apartment: Bei einem 23-jährigen Neapolitaner bedeutete das nicht etwa ein Zimmer im Studentenwohnheim oder in einer WG. Es bedeutete: die Wohnung seiner Eltern. Ich hatte angenommen, wir würden in eine Pizzaria gehen, oder er würde mir ein wenig die Stadt zeigen. Doch stattdessen brachte er mich heim zu Mamma und Papà.
Die Avallones wohnten nicht allzu weit von meinem Internat entfernt in Posillipo, einer der schönsten Wohngegenden von Neapel. Von den Griechen Pausilypon – »Ende des Leidens« – getauft, krönt dieser Hügelzug eine Landzunge, die sich in den Golf von Neapel erstreckt. Schon Jahrtausende, bevor die Gegend zu einem Teil der Stadt wurde, verbrachte die Oberschicht Neapels dort, in den Villen, die sich verstreut an der Küste entlangziehen, den Sommer. An der kurvenreichen Panoramastraße Via Posillipo sieht man die Steintafeln der Villa Elena, Villa Emma, Villa Margherita. Stufen führen von diesen Villen hinab zum Marechiaro, dem klaren Meer.
Obwohl Neapel zu den dichtbevölkertsten Städten Europas zählt, weht in Posillipo ein leichter Wind, und es ist ruhig und friedlich. Das Haus der Familie Avallone befindet sich gegenüber dem Eingang zum Virgiliano, einem terrassenförmig angelegten Park mit Blick auf das strahlend blaue Meer, die Inseln Capri, Ischia und Procida und die Amalfiküste. Tagsüber hört man dort das Kreischen der Möwen, abends hin und wieder Motorradgebrumm oder fernes Feuerwerk über dem Meer.
Du glaubst wohl, du wärst aus Posillipo, sagt man in Neapel, um auszudrücken: Du bist ein Schnösel, komm mal runter von deinem hohen Ross.
Der Palazzo der Avallones, von Salvatores Vater in den 1960er Jahren erbaut, stand landeinwärts. Er bestand aus zwölf Wohnungen, von denen neun der Familie gehörten. Das Gebäude hatte das schwere Erdbeben von 1980 ohne größere Schäden überstanden (obwohl Salvatore damals, wie er mir später erzählte, von einer Fußballübertragung im Fernsehen aufgesprungen und eine Treppe hinabgelaufen war, die wie von der Meeresdünung bewegt auf und ab wogte). Es war ein solide gebautes Haus, errichtet an einem schönen, friedlichen Ort.
Wir bogen ein in ein Tiefgaragenlabyrinth. Es war unglaublich, wie viele Fahrzeuge in unterschiedlichen Winkeln zueinander auf derart engem Raum abgestellt waren. Sie standen dort Schnauze an Schnauze, Seitenfenster an Seitenfenster, Stoßstange an Stoßstange. Ich war verwirrt: Draußen war doch so viel Platz! (»Was?«, erwiderte Salvatore, als ich ihn später danach fragte. »Werden da, wo du herkommst, etwa keine Autos geklaut?«) Er parkte den kleinen Fiat schwungvoll und fachmännisch zwischen zwei anderen Wagen ein und führte mich zum Aufzug. Meeresluft hatte ich bisher nicht gerochen. Vielmehr stank es nach Schimmel, Muff und Abgasen.
Dann fuhren wir schweigend in dem engen Fahrstuhl ins dritte, oberste Geschoss. Salvatore öffnete mit einem klobigen silbernen Schlüssel die Wohnungstür der Avallones und geleitete mich hinein. »Vieni, vieni«, sagte er und warf den Schlüsselbund auf eine Chaiselongue aus dem 18. Jahrhundert vorn im Wohnzimmer. Vom Eingangsbereich der Wohnung aus spähte ich in diesen dunklen, eleganten Salone und erblickte goldene Cherubim-Statuen und schwere Seidenvorhänge. Auf Sockeln standen dort Terrakotta-Vasen
Ich wartete gespannt, was als Nächstes kommen würde.
»Mammmmma!«, rief er. Die volltönende Tenorstimme, die ich im Wagen noch so bezaubernd gefunden hatte, klang, als er nach seiner Mutter rief, grell und nasal. Mir begann, vor der Begegnung mit seinen Eltern zu grauen. Es war schon schwierig genug, Italienisch zu verstehen und mit jemandem meines Alters zu sprechen, und ich fühlte mich dem nicht gewappnet, Konversation mit einer imposanten, formellen, wohlhabenden Neapolitanerin zu betreiben, die sich, was ihren Sohn anging, sicherlich ein wenig gluckenhaft verhalten würde. Und dann auch noch auf ihrem eigenen Terrain! Außerdem hatte ich einen Bärenhunger.
»Mammmmma! E’ pronto?« (Ist das Abendessen fertig? Würde er gar nicht erwähnen, dass er die junge Amerikanerin mitgebracht hatte?) Ich hörte Pantoffelgeschlurfe, und herein kam ein Mann, der Salvatores Vater sein musste. Er war um die siebzig, aber kein furchteinflößender Patriarch, sondern ein sanftmütiger, distinguierter Herr in einem dunklen Pullover, der viel Rasierwasser aufgelegt hatte. Wir schüttelten einander die Hand, und er stellte sich als Nino vor. Da er dreißig Jahre lang das Luxushotel der Familie geleitet hatte, sprach er ein wenig Englisch.
»Salvato’, è pronto da mangià?«, wechselte Nino in den neapolitanischen Dialekt, um seinen Sohn zu fragen, ob das Abendessen fertig sei, und ergriff dabei Salvas Arm. Er war ebenso hungrig wie wir.
Ich wurde in die Küche geleitet, wo Raffaela gerade ein Telefonat beendete, währenddessen die selbstgebackene Pizza aus dem Ofen nahm und gleichzeitig mit einem Fußtritt die Kühlschranktür schloss. Das alles war eine einzige fließende, anmutige Bewegung. Sie war also weder dick, noch stand sie wie festgewachsen vor dem Herd, noch rührte sie Pastasauce um. Sie war einfach nur hinreißend.
Gut eins dreiundsechzig groß und bestens in Form, trug Raffaella hochhackige Stiefel und ein rosafarbenes Oxfordhemd. Ihre enge weiße Jeans wurde von einem strassbesetzten Ledergürtel gehalten. Sie war komplett geschminkt: mit Lipliner und -gloss und einem Eyeliner, der gekonnt in den anthrazitfarbenen Lidschatten überging. Das Haar trug sie kurz und blond, mit fachgerecht gemachten Strähnchen. Doch trotz des Glitzerkrams und des aufwendigen Make-ups wirkte sie nicht im mindesten trashig, sondern nur glamourös. Ich in meinem blauen Blazer und der schlabbrigen Hose kam mir dagegen feist und unbeholfen vor. »Das macht schlank«, hatte meine Mutter dieses Outfit in einem geräumigen Anprobierraum in Washington gelobt, aber schlank fühlte ich mich neben dieser 56-Jährigen in weißer Jeans nun wirklich nicht. Eher wie eine dicke, stumme, amerikanische Trine.
»Ciao tesoro! Setz dich, Schätzchen! Ich hoffe, du magst neapolitanische Pizza! Nino, rutsch doch mal mit deinem Stuhl rüber!«
Wenn Raffaella sich bewegte, mischte sich ein Hauch Chanel-Parfum in den Duft von gebackenem Hefeteig und Basilikum. So opulent der Salone der Wohnung war, so klitzeklein war die Küche. An der schachbrettartig gefliesten Wand auf der rechten Seite war ein rechteckiger Resopaltisch angebracht, der höchstens vier Personen Platz bot. Der Herd, der Ofen, die Spüle und die (sehr beengte) Arbeitsfläche befanden sich links. Wenn mehr als zwei Leute am Tisch saßen, kam man nicht mehr zum Kühlschrank durch, der im hinteren Bereich der Küche stand. Warum gönnte sich eine Familie, die offenkundig Geld hatte, keine größere Küche?, fragte ich mich.
Wie sich herausstellte, war die dafür nötige Fläche dem Speisezimmer vorbehalten, das sich an den Salone anschloss. Dort aßen die Avallones, wenn sie Gäste hatten. In der Küche wurde gekocht und in famiglia gegessen. Familienmitglieder kann man schließlich beiseiterutschen lassen und auch mal versehentlich anrempeln. Man kann sich über sie beugen, ihnen auf die Füße treten, sie füttern und sich von ihnen füttern lassen. Wenn man mit Menschen zusammensitzt, die man mag, braucht man nicht viel Raum.
Für Raffaella war am Tisch nun kein Platz mehr frei, doch sie hatte zum Glück auch nicht vor, sich zu setzen. Stattdessen tat sie mindestens acht andere Dinge gleichzeitig, darunter auch, dafür sorgen, dass sich die junge Amerikanerin wie zu Hause fühlte. Später kam Salvatores Schwester Benedetta dazu, zwängte sich zwischen uns und stellte sich mir vor. Sie war 26, drei Jahre älter als Salvatore, und hatte einschüchternde, türkisfarbene Augen, gerahmt von einer zarten Armani-Brille. Ihr langes, glattes, hellbraunes Haar schwang so seidig hin und her wie das der coolsten Mädchen auf meiner Highschool. Seltsamerweise (es war erst acht Uhr abends) trug sie einen Pyjama. Er war mit pinken und weißen Teddybären bedruckt, die Luftballons hielten, und hatte Rüschen am Ausschnitt. »Mi piace star comoda«, erklärte sie mir später: Wenn ich zu Hause bin, habe ich es gern bequem. Ihr Bruder trug seine bequeme Kombi aus Jeans und T-Shirt und sie ihren bequemen Schlafanzug. Nur ihre Mutter hatte Zeit darauf verwendet, sich zurechtzumachen.
»Benedetta lavora, capito? Ha iniziato a lavorare in banca«, erzählte mir Nino lächelnd und mit erhobenen Augenbrauen. Er war sichtlich stolz auf seine Tochter und wiederholte mehrfach, dass sie mit ihren 26 Jahren bereits einer Berufstätigkeit nachging. Sie arbeitete tatsächlich bereits in einer Bank! Für neapolitanische Verhältnisse war das sehr früh, schloss ich daraus. Sie hatte in Rekordzeit und mit Bestnoten ihren Uniabschluss gemacht und war von der Banca di Roma in Neapel als Anlageberaterin eingestellt worden. Sie hatte einen Contratto a tempo indeterminato, einen unbefristeten Arbeitsvertrag, was bedeutete, dass sie praktisch unkündbar war und mit 55 in Rente gehen konnte. Das Leben war schön: Sie hatte mit ihrem Job das große Los gezogen und plante, im nächsten Sommer zu heiraten.
»Matrimonio! Matrimonio! Hochzeit, verstehst du?« Nino war die Begeisterung in Person. Ich warf hin und wieder ein »Veramente?« (Tatsächlich?) oder »Mamma mia!« ein, um zu bekunden, wie beeindruckt ich war. Dann war dieser so überaus selbstsicher auftretende Salvatore also in Wirklichkeit der braunäugige kleine Bruder der genialen Senkrechtstarterin mit den türkisfarbenen Augen. Das musste ihm mächtig gegen den Strich gehen.
Raffaella sagte unterdessen irgendetwas über eine Multa und beträufelte dabei die dampfende Pizza mit Olivenöl. Wer hatte diesen Strafzettel über 50.000 Lire wegen Falschparkens bekommen, und wer würde sich am nächsten Tag zum Postamt bemühen, um ihn zu bezahlen? Hätte ich auch nur im entferntesten geahnt, dass es sich bei einer Multa um ein Knöllchen handelte und dass Salvatore sagte, er sei an jenem Dienstag Ende Juni nicht einmal in der Nähe der Via Toledo gewesen, und dass Benedetta sagte, ihr Bruder sei der Einzige in der Familie, der regelmäßig in vierter Reihe parke, dann hätte ich wahrscheinlich aufgehört, in regelmäßigen Abständen »Veramente?« oder »Mamma mia!« zu sagen.
»Ich? Auf gar keinen Fall!« Nun wurde Raffaella von Benedetta beschuldigt, und um sich zu verteidigen, hielt sie inne, wobei die heiße Pizza, die sie mit einem Ofenhandschuh hielt, direkt über Ninos Kopf verharrte. Sie alle schienen vergessen zu haben, dass ich auch noch da war. Salva stritt mit seiner Schwester, Nino guckte sich fragend um, wo denn seine Pizza blieb, und Raffaella referierte immer noch, wo sie an jenem Dienstag Ende Juni gewesen war. Mir wurde klar, dies war das ganz alltägliche Familienleben.
Schließlich tat Raffaella das erste Stück Pizza auf einen Teller und reichte ihn mir über den Kopf ihres Gatten hinweg. Und zum ersten Mal, seit wir bei ihm zu Hause angekommen waren, richtete sich Salvatores Blick auf mich.
Was ist sie für ein Mensch? Wie wird sie diese Pizza essen?
Ich begriff augenblicklich, dass es allen am Tisch überaus wichtig war, was ich von der Pizza hielt. Die Pizza war heiß, saftig und dick – für mich unmöglich mit den Händen zu essen. Daher nahm ich Messer und Gabel und probierte einen Bissen. Es war eindeutig die beste Pizza, die ich je gegessen hatte. Doch meine sprachlichen Fähigkeiten reichten noch nicht aus, um das zum Ausdruck zu bringen. Daher sagte ich so ungefähr: »Pizza großartig, ja … vielen, vielen Dank, Familie von Salvatore … Tomatenpizza …«
Und dann war da wieder dieses Lachen.
Und ich stimmte in das Lachen ein – denn diese Pizza war wirklich zum begeisterten Lachen köstlich.
Das war das erste von vielen Malen in jenem Jahr, dass das Essen für mich zu einer Art Performance wurde. Das Stimmengewirr verstummte, Stille trat ein, und alle Blicke richteten sich auf mich, die Essende. Ich fühlte mich enorm unter Druck gesetzt, während ich Spaghetti aufdrehte oder ein Stück Pizza abschnitt (Rutscht mir das Messer ab? Werde ich meinen Mund verfehlen? Soll ich zu Ende kauen, bevor ich mit den Lobpreisungen beginne?) Sie alle fragten sich: »Na, was meint die Tussi aus der einzigen verbliebenen Supermacht der Erde nun hierzu?« Und ich enttäuschte sie nicht. Mamma mia! Phänomenal! Buonissimo! Etwas so Köstliches habe ich noch nie gegessen!
Dann aber beging ich einen groben Fauxpas – brutta figura, wie man auf Italienisch sagt. Ich aß ein Stück vom Rand der Pizza, ehe ich das Innere verspeist hatte. Salvatore stand vom Tisch auf, kam zu mir, die ich zwischen Nino und Benedetta eingezwängt dasaß, beugte sich über mich und schnitt den Rest meiner Pizza für mich in kleine Stücke. Er hielt mein Messer und meine Gabel in seinen wunderschön manikürten Händen, und ich roch sein Aftershave, und er sah mir dabei die ganze Zeit in die Augen. Er war so nah!
»Diese Stücke musst du zuerst essen«, sagte er. »Nicht den Rand! Den Rand immer erst zum Schluss!« Es prasselten noch mehr Worte auf mich ein, so schnell, dass ich kaum etwas verstand. Ich bekam jedoch mit, welchen Wert er darauf legte, wie ich meine Pizza in Angriff nahm. Ich hatte durchaus Potenzial. Er musste mir nur noch die Feinheiten beibringen.
Ich schaffte es schließlich, die Pizza aufzuessen, ohne irgendwas fallen zu lassen oder mich erneut zu blamieren. Einige Krümel waren jedoch auf meinem Schoß gelandet (meine Papierserviette hielt ich in der verkrampften, schweißfeuchten Hand). Raffaella hatte sich unterdessen vor der Spüle umgedreht und stand nun direkt hinter mir. Sie war ganz still und sagte keinen Ton … und beäugte meinen Schoß. Ehe ich wusste, wie mir geschah, fuhren ihre Hände – mit dem Smaragdring und den manikürten Fingernägeln – in meinen Schritt hinab. Was zum Teufel …?, dachte ich nur.
»Briciole, briciole«, erklärte sie. So lange ich lebe, werde ich das italienische Wort für Krümel nicht vergessen: Briciole. Es war kein Ärgernis, nur etwas, das erledigt werden musste, bevor die Krümel sich in der ganzen Wohnung verbreiten konnten. Weshalb sollte es ein Problem darstellen, dass sie sich in meinem Intimbereich befanden?
Nun stimmte Raffaella ein Lied an, das von einer Tomatenpizza handelte. Es hatte einen ähnlichen Rhythmus wie Funiculì, Funiculà, und sie wiegte sich beim Singen in den Hüften. »Conosci questa? – Kennst du das?«, fragte sie mich. Und während ihre tiefe, volltönende Singstimme das Lied schmetterte, sprachen die anderen weiter, größtenteils über praktische Belange. Das tägliche Leben dieser Familie wurde von allerlei logistischen Fragen bestimmt. Die Eltern und ihre Kinder, immerhin schon Mitte zwanzig, verbanden das Knöllchen und der Klempnertermin, bei dem die leckende Toilette repariert werden sollte. Es wirkte auf mich ausgesprochen seltsam, dass im Nachbarzimmer Kunstwerke von unschätzbarem Wert und Vasen standen. Dabei kam es mir sonst eher vor, als befänden wir uns in einer italo-amerikanischen Küche in New Jersey.
Ich wusste nicht mal, ob ich diesen Salvatore überhaupt mochte, und ich begriff nur das wenigste von dem, was um mich her gesagt wurde, aber ich spürte, dass ich mich – ohne irgendwelche Zeremonien oder Übergangsriten und ohne zusammenhängende mündliche Verständigung – in diese Familie einfügte. Ohne recht zu verstehen, warum, fühlte ich mich wie zu Hause.
State Department
Das amerikanische Generalkonsulat in Neapel ist ein großes, weißes, kastenförmiges Gebäude am Hafen von Mergellina – von dem aus auch Schiffe nach Capri und Ischia verkehren. Es ist von Palmen gesäumt und wird von mehreren Schützenpanzern bewacht, bei denen mit Uzis bewaffnete italienische Soldaten lächelnd Ausschau nach Terroristen halten. Besucher empfing 1996 eine große amerikanische Flagge und ein Foto eines sehr rosigen Bill Clinton auf dem Hoheitsgebiet der USA.
Meine Arbeit im Konsulat war, gelinde gesagt, stressarm. Ich war in der politischen Abteilung tätig, und glücklicherweise gab es in den späten 1990er Jahren kaum nennenswerte politische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Süditalien. Außerdem war der Job unbezahlt und ich die einzige Praktikantin im ganzen Konsulat. Meine Kollegen waren entweder Einheimische mit jenen schnuckeligen unbefristeten Arbeitsverträgen oder Mitarbeiter des US Foreign Service, des Auswärtigen Dienstes der USA, die begeistert waren, an einem Ort wie Neapel stationiert zu sein, wo sie noch einmal ordentlich durchschnaufen konnten, ehe es weiterging nach Darfur oder so. Ich kam normalerweise gegen 9.30 Uhr ins Büro; die erste Cappuccino-Pause begann gegen 10.15 Uhr.
»Willst du das Foreign Service Exam ablegen?«, fragten mich die Amerikaner im Konsulat. Doch in Wahrheit hatte ich keine Ahnung, was ich beruflich machen wollte. Da meine beiden Eltern Internationale Beziehungen studiert hatten, dachte ich, Diplomatin zu werden wäre vielleicht etwas für mich (oder, wenn ich mal weniger ehrgeizig drauf war, Botschafterin in einem kleinen Land in den Tropen, wo ich dann nette Dinnerpartys mit viel Personal schmeißen konnte). Aber weder Wirtschaft noch Politik waren mein Ding. Meine Liebe galt dem Schauspiel und dem Gesang. In meiner Jugend hatte ich an den bedeutendsten Theatern Washingtons Schauspielkurse absolviert und bei angesehenen Lehrern privaten Gesangsunterricht gehabt. Ich nahm an sämtlichen Monolog-, Lyrik- und Gesangswettbewerben der Hauptstadtregion teil. Auf dem College spielte ich in fast dreißig Theaterstücken die Hauptrolle. Ich graste schwarze Bretter nach Vorspielterminen ab, packte mir für Probenpausen was zu essen ein und nutzte die technischen Proben dazu, meine Hausaufgaben zu erledigen.
Die Bühne war meine Welt.
Doch laut meiner Familie war Schauspielerei kein richtiger Beruf, sondern vielmehr ein schönes Hobby: ein Spielbein, das ein Standbein erforderte. Mein Hauptfach auf dem College war Kulturanthropologie gewesen, was mich einer Berufsentscheidung aber keinen Schritt näher gebracht und mir nur wieder mal bewiesen hatte, was für ein aufgeschlossener Mensch ich doch bin. (Und war es nicht wirklich faszinierend, wie die Rituale der Inuit-Frauen rings um die Geburt eines Kindes ihre komplexe Rolle in der Gesellschaft widerspiegelten?)
Mein Praktikum in Neapel war nicht dazu gedacht, mich einer Berufswahl näherzubringen. Es sollte eher eine Verschnaufpause sein, bevor ich in die USA heimkehren und mir klar werden sollte, was ich mit meinem Leben anfangen wollte.
Meine Vorgesetzte im Konsulat, eine imposante, vollschlanke Afroamerikanerin aus Chicago, nahm mich unter ihre Fittiche. Sie war klug, witzig, sprach ausgezeichnet Italienisch und führte, wie ich bald bemerkte, ein unvergleichlich gutes Leben. Neben den Cappuccino-Pausen bestanden unsere Arbeitstage vor allem aus mehrstündigen Mittagessen mit italienischen Geschäftsleuten in superleckeren Fischrestaurants in der Nähe des Konsulats. Cynthia sprach dabei die meiste Zeit und hielt nur kurz inne, um einen Teller Calamari fritti zu verdrücken, und die blendend aussehenden süditalienischen Magnaten, die auf amerikanische Unterstützung für irgendein Industrieprojekt hofften, saßen schweigend da und wussten sichtlich nicht, was sie von dieser Tina Turner mit der lauten Lache und ihrer Begleiterin, dem pummeligen weißen Mädchen, halten sollten.
Mein Arbeitstag endete um 17.30 Uhr, und dann ging ich an der kurvenreichen Küstenstraße zurück nach Posillipo. Die Pfiffe und Rufe der Moped- und Motorrollerfahrer – unvermeidlich, wenn eine junge Frau allein durch Neapel ging – hörte ich nicht, denn ich hatte Flauschkopfhörer auf, und auf meinem Walkman lief Rockmusik der frühen neunziger Jahre.
Gerade rechtzeitig zum Abendessen kam ich in meine Unterkunft zurück.
Das Instituto Denza war ein katholisches Knabeninternat, das jedoch nicht genug katholische Knaben beherbergte, um über die Runden zu kommen. Da ich im September nach Neapel kam und das Schuljahr erst Mitte Oktober begann, war bei meiner Ankunft tatsächlich kein einziger katholischer Knabe vor Ort.
Der Campus war üppig begrünt mit prächtigen Pinien und Olivenbäumen, dazwischen magentafarbene Bougainvillea; und an den Kreuzungen der Wege gab es illuminierte Madonnenstatuen. Um das alles weiterhin finanzieren zu können – die Gärten, die Fußballplätze, die Gebäude –, hatten die Barnabitenmönche, die das Internat leiteten, beschlossen, gegen Zahlung von Kost und Logis auch Studenten männlichen Geschlechts aus anderen Teilen Italiens im Denza zu beherbergen. Als auch das nicht ausreichte, waren sie – Ahimé! O Schreck, o Graus! – gezwungen, auch weibliche »Gäste« aufzunehmen.
Doch das alles erfuhr ich erst später. An meinem ersten Tag geleitete mich lediglich eine zierliche, weiß gewandete Nonne mit einem »Buongiorno« und einem »Prego« – hier entlang – schlurfend zu meinem Zimmer. Dort gab es ein Einzelbett, einen Schreibtisch und zwei Fenster mit Blick auf die tropisch anmutenden Gärten. An der Stille erkannte ich, dass außer mir niemand im Gebäude war. Wo waren denn die hier einquartierten Studentinnen und Studenten?, fragte ich mich. Hatten sie vielleicht für später einen Empfang für die neue Amerikanerin geplant? Ach ja, und gab es irgendwo noch ein paar zusätzliche Kleiderbügel für meinen Schrank?
»Per cena«, war der Nonne noch eingefallen, mir zu sagen, bevor sie ging: Was das Abendessen angeht … Und dann erging sie sich in weiteren Ausführungen, die ich nicht verstand. Ich konzentrierte mich auf ihre arthritische Hand, die erst nach links und dann nach rechts wies. Hatte sie gerade gesagt: An der dritten Madonna vorbei und dann am zweiten Fußballplatz rechts?
»Grazie«, sagte ich lächelnd. »Grazie tante.«
Und als es Zeit fürs Abendessen wurde, folgte ich meiner Nase.
Die Mensa des Internats befand sich gut zehn Minuten zu Fuß von meinem Gebäude entfernt. Abgesehen von den kleinen Eidechsen, die über den Weg huschten, und den Mücken, die sich in meine Waden gruben, bemerkte ich keinerlei Lebenszeichen. Dann schlug in der Nähe eine Kirchenglocke, und ich hoffte, das hieß: Die Suppe ist aufgetragen!
Schließlich fand ich die Mensa, einen Saal mit marmornen Wänden und Böden, Kristalllüstern und vielen freien Sechsertischen. Da niemand anstand, nahm ich mir ein Tablett und sah einer Nonne, die eine Schürze trug, dabei zu, wie sie mir Pasta mit gebratenen Auberginen und Tomaten auftat. Dann reichte sie mir noch eine Miniaturkaraffe Rotwein. »Buon appetito, Signorina! «
An jenem ersten Abend im Denza waren dort nur zwei Tische besetzt. An dem einen saßen vier Nonnen, die zu Besuch waren, und an dem anderen saßen drei Studenten. Ich stand mit meinem Tablett da und überlegte, wo ich mich dazusetzen sollte, und sie alle beobachteten mich dabei. Es gab eindeutig eine richtige Antwort auf die Frage, wohin ich gehörte, sie fiel mir bloß gerade nicht ein.
Ich entschied mich für die Jungs. (Schluss mit der Geschlechtertrennung! Basta!) Doch sobald ich mich gesetzt hatte, wusste ich, es war die falsche Entscheidung. Keiner sagte einen Ton.
Nur eine Minute später hörte ich weibliche Stimmen durch den Speisesaal hallen. Ich blickte mich um und sah drei lächelnde junge Frauen, die gerade hereingekommen waren. Sie waren Schwestern und hatten alle langes schwarzes Haar und Mandelaugen. Sie wohnten nicht im Denza, erfuhr ich später, sondern nahmen dort nur ihre Mahlzeiten ein. Ihre Eltern lebten in einer Kleinstadt in Kalabrien an der Spitze des italienischen Stiefels, und die Mädels waren zum Studieren in die Großstadt gezogen. Als sie an meinem Tisch vorbeikamen und »Ciao« sagten, wusste ich, dass es einen Gott gab.
Maria Rosa und Francesca (und ihre kleine Schwester Isabella, die nickte und lächelte und die stille der drei Grazien war) hatten nie zuvor eine Ausländerin oder einen Ausländer kennengelernt. Sie waren nie weiter nördlich als Neapel gewesen und hatten noch nie Ketchup probiert. Sie stellten mir Fragen über Fragen: Was machte ich im Konsulat? Sahen in Amerika alle Häuser so aus wie die in Denver Clan? Wechselten Amerikanerinnen ihre Ehemänner tatsächlich so oft wie in Schatten der Leidenschaft?
Ich erzählte in gebrochenem Italienisch von meinem Heimatland. Nur gut, dass ich ein Diplom in Kulturanthropologie hatte, denn das befähigte mich, Sachen zu sagen wie: »Amerika, Scheidung: sehr einfach!«; »Krankenhäuser: sehr teuer!«, und »Zu viele Schusswaffen«. Meine neuen Freundinnen waren nun also bestens informiert, und ich war nicht mehr allein.
Oreos
Ich bin eins sechzig groß und wog im September 1996 knapp siebzig Kilo. Die Mädels aus Kalabrien im Internat meinten: »Das macht das amerikanische Essen mit einem.« Salvatore meinte: »Sie isst halt gern.« Doch in Wirklichkeit litt ich, was in Neapel keinem in den Sinn gekommen wäre, an Binge Eating Disorder. Ich liebte Essen viel zu sehr, um magersüchtig zu werden, und fand es eklig, es wieder auszukotzen – was blieb mir da noch übrig? B.E.D. Ich verschlang enorme Mengen, und anschließend hungerte ich, nahm ein paar Tage lang keinerlei Nahrung zu mir oder kaute allenfalls auf Selleriestangen herum. Sei vernünftig und zügele deine Gelüste, hatte meine Ostküstenoberschichts-Kinderstube mich gelehrt. Ich gab mir Mühe. Doch manchmal aß ich drei Schachteln Oreo-Kekse hintereinander weg.
In meinen ersten sechs Wochen in Neapel stopfte ich mich kein einziges Mal derart voll und nahm neun Kilo ab. Ich machte keineswegs eine Diät. Und tatsächlich hatte ich das Essen noch nie so genossen wie in der Zeit. Was geschah, war eine praktische Konsequenz dessen, dass ich nun in Italien lebte, und zugleich ging etwas Tiefgründigeres mit mir vor.
Neapel ist eine Anti-Fressattacken-Stadt. In der neapolitanischen Kultur sind die Mahlzeiten heilig: Das Essen wird frisch zubereitet und in compagnia verspeist. Dabei gibt es keine Eile, und wenn man bei Tisch auch nur ungeduldig wirkt oder es so aussieht, als stünde man unter Zeitdruck, bekommt man das neapolitanische »statte cuieto« zu hören: immer mit der Ruhe. Man isst, nachdem man Platz genommen hat, ohne sich ablenken zu lassen und vorzugsweise mit einem Glas Wein dazu. Man isst, wenn es Zeit fürs Frühstück, fürs Mittagessen, fürs Abendessen ist. Punkt. Punto e basta.
Wenn ich nach meinem Feierabend in einem kleinen Café einkehrte, bekam ich dort einen Espresso, hätte dort aber nicht einmal dann etwas halbwegs Sättigendes zu essen bekommen, wenn ich darum gebettelt hätte. Weshalb sollte man um 17.30 Uhr etwas essen wollen? Gebäck wird morgens frisch angeboten, Desserts nach dem Abendessen. Werden Lebensmittel nicht industriell verarbeitet und enthalten keine Konservierungsstoffe, bedeutet das automatisch, dass man fades, abgestandenes Zeug zu sich nehmen muss, wenn man außer der Reihe etwas essen will. Und so etwas machen nur verrückte Touristen.
Da alles, was ich in Neapel aß, frisch und wohlschmeckend war, fühlte ich mich nach den Mahlzeiten zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich satt. Es gab keine Zusatzstoffe, die mir gleich wieder Appetit auf mehr gemacht hätten. Ich konnte mich, gemeinsam mit der ganzen Stadt, vom Tisch erheben und bis zur nächsten Mahlzeit meinen Magen ganz einfach vergessen.
Eines Abends, als ich mich im Speisesaal des Denza ausführlich über die Essgewohnheiten der Amerikaner erging, legte sich ein bekümmerter Ausdruck auf Maria Rosas Gesicht. »Das Problem mit deinem Land«, sagte sie, »ist, dass ihr auf eine Art und Weise esst, die scombinato ist.« Das bedeutet »unordentlich« oder »chaotisch«. Ich hatte gerade von amerikanischen Studenten erzählt, die sich um drei Uhr nachts Pizza bestellten, und bei dem Ausdruck auf ihrem Gesicht – dem Mitgefühl in diesen Sophia-Loren-Augen! – kam ich mir vor, als hätte ich gestanden, heroinabhängig zu sein.
»Non è vero? – Habe ich nicht recht? «, fuhr sie fort, während ich noch an der Diagnose des chaotischen Essverhaltens zu knabbern hatte. »Per esempio, in Amerika essen die Leute beim Gehen. Sie machen sich mit klebrigen Sandwiches die Hände schmutzig und lecken sich anschließend die Finger ab. Und die Männer in den USA kaufen sich Nudeln in kleinen Pappkartons zum Abendessen. Sie essen bei der Arbeit am Schreibtisch, nicht wahr? Che tristezza! (Wie trostlos, wie schade, was für ein bedauernswertes Leben diese Leute führen!) Sie sind wirklich nicht sehr gut darin, ihre Mahlzeiten zu organisieren, nicht wahr?«
Moment mal, mokierte sich da etwa ausgerechnet eine Italienerin über die organisatorischen Fähigkeiten der Amerikaner?, meldete die Patriotin in mir Protest an.
»Es ist nicht so, dass sie nicht dazu fähig wären«, erwiderte ich und bemühte mich, ruhig zu bleiben. »Amerikaner essen durchaus auch mal gut, in einem Restaurant zum Beispiel. Aber manchmal ziehen sie sich einfach nur schnell irgendwas rein, weil sie gerade Wichtigeres zu tun haben.«
Die Vorstellung, man könne »Wichtigeres zu tun haben«, wurde mit verblüfftem Schweigen aufgenommen. Francesca war so gnädig, das Thema zu wechseln.
Aber es war nicht allein die Organisation der Mahlzeiten. Italienerinnen meines Alters schienen auf eine Art und Weise in ihrem Körper zu leben, die mir fern lag. Ich sah sie am Hafen vor dem Konsulat, über einen Motorroller drapiert. Sie hakten einander die Daumen in die Hosentaschen, strichen einander durchs Haar, genossen ihre eigene Körperlichkeit ebenso wie die der anderen. Wenn es Zeit wurde aufzubrechen, schwangen sie beiläufig ein Bein über ein Motorino, fuhren zu dritt oder gar zu viert auf einem kleinen Motorroller davon und schlängelten sich ungerührt durch einen Verkehrsstau. Das Adjektiv, das am besten zu ihnen passt, ist carnale – sinnlich, fleischlich, leiblich. Während das englische Wort »carnal« abfällig klingt und eine starke sexuelle Note hat, beschreibt das italienische carnale etwas Kostbares, Heiliges.
Als zehn Jahre nach meiner Ankunft in Neapel meine Tochter zur Welt kam, nannte mein Schwiegervater sie nicht bellissima – bezaubernd oder wunderschön. Nein, er gebrauchte das Adjektiv, das in Italien das ultimative Kompliment darstellt: Er nannte sie carnale. Fleischlich – auf wunderbare Weise fleischlich. Denn wir sind ja schließlich in einem katholischen Land, und als größtes Geschenk gilt dort die Fleischwerdung des Wortes. La parola wurde zu carne. Ich scheine mich aufgrund meiner protestantischen Herkunft mehr auf das Wort konzentriert zu haben. Worte, Worte, Worte. Mein Verhältnis zum Fleisch kam erst an zweiter Stelle; geistigen Dingen wurde Vorrang eingeräumt. Und hin und wieder rebellierte mein Fleisch und verlangte nach drei Schachteln Oreo.
Nach meinem ersten Abendessen bei den Avallones kam es, als ich mich schließlich verabschiedete, zu allerhand Wangenküssen. Ich steuerte dabei beständig auf die falsche Wange zu. (Erst die rechte! Rechts zuerst!, mahnte ich mich anschließend noch wochenlang, bis es mir schließlich in Fleisch und Blut überging.) Dabei stieß ich schmerzhaft mit meiner Nase an Benedettas. (Ihre »Coolere ältere Schwester«-Ausstrahlung brachte mich noch jahrelang dazu, Dinge fallenzulassen, gegen Möbel zu laufen und meine Wortwahl in Frage zu stellen. Wenn sie mit ihrem seidigen Haar und den türkisfarbenen Augen in der Nähe war, suchte ich mir am besten einen Platz auf dem Sofa und hielt die Klappe.) Salva brachte mich zu meiner Unterkunft zurück und sagte nur »Ci sentiamo«. Wörtlich übersetzt heißt das: Wir hören voneinander. Es bedeutet aber: »Wir sprechen uns bald«.
Damals aber glaubte ich, es heiße: Ruf mich an. Daher fragte ich: »Wann?« Und Salvatore antwortete: »Presto.« Bald. Ich verstand: Morgen. Während er sich also mit einem sehr unverbindlichen »Wir sprechen uns bald« verabschiedete, kam bei mir die Aufforderung an: »RUF MICH GLEICH MORGEN AN!« Mir war es recht: Die Vorstellung, sein Lachen bald wieder zu hören, gefiel mir. Ich war noch nie jemandem begegnet, der so fröhlich war. Und ich war auch noch nie jemandem begegnet, der so gut roch, während er sich über mich beugte, um mein Essen zu schneiden.
Also rief ich ihn am nächsten Tag an. Wir sprachen (lauschten? kicherten?) gut fünf Minuten. Er nannte mich Pagnotella, ein dickes neapolitanisches Brötchen, das ein wenig einem Muffin ähnelt (was ich nicht verstand), und neckte mich: »Du isst gern, nicht wahr?« (Was ich durchaus verstand.) Te piace mangiare. Ich hatte den Typ erst ein einziges Mal getroffen, und er wagte es, sich über meine Pummeligkeit lustig zu machen. Ich sollte gekränkt sein, sagte ich mir. Doch seltsamerweise war ich es nicht. Mein Appetit schien für ihn etwas Liebenswertes zu sein, vielleicht gar etwas Attraktives. Es war nichts falsch daran, wenn man gerne aß und das auch zeigte.
Und dann lachte er wieder und sagte erneut »Ci sentiamo«. Und ich dachte: Jetzt muss ich mir eine neue Telefonkarte kaufen, damit ich ihn morgen wieder anrufen kann.
Als ich ihn am nächsten Tag anrief (als braves Mädchen befolgte ich solche Anweisungen grundsätzlich), ließ er sich von seiner Schwester am Telefon verleugnen. Jahre später erzählte er mir, dass er damals dachte, ich sei das aufdringlichste Ding, dem er je begegnet war.
Kann eine Beziehung, kann ein ganzes Leben auf einem Missverständnis beruhen? Dass ich auf einen anderen Kontinent zog, dass ich eine italienische Ehefrau und Mutter wurde: Wäre das auch geschehen, wenn ich die Worte Ci sentiamo, Pagnotella richtig verstanden hätte?
’O sartù
Sartù di riso ist eine neapolitanische Spezialität, die Anfang des 19. Jahrhunderts von den Köchen des bourbonischen Königs Ferdinand IV. von Neapel kreiert wurde.
Nach den Griechen und den Römern herrschten die Normannen über Neapel, dann die Franzosen, die österreichischen Habsburger … Fast jedes Reich und jedes Herrschergeschlecht, das einem in den Sinn kommt, hat Neapel irgendwann einmal regiert. Im Jahr 1735, als Italien noch aus einzelnen Stadtstaaten bestand, eroberte der Bourbonen-König Karl der Irgendwievielte von Spanien (er war gleichzeitig Karl der Erste, der Dritte, der Fünfte und der Siebte, je nachdem, um welches seiner Königtümer es ging) die Königreiche Sizilien und Neapel und vereinte sie unter seiner Krone.
Neapel war unter den Bourbonen eine absolut angesagte Stadt. In Paris schrieb Jean-Jacques Rousseau: »Willst du wissen, ob ein Funken des verzehrenden Feuers des Genies in dir ist? Lauf, fliege nach Neapel …«, um im Teatro San Carlo den Meisterwerken neapolitanischer Komponisten zu lauschen. Mozart besuchte 1770 mit seinem Vater die Stadt im Rahmen seiner ersten, unglaublich erfolgreichen Italienreise (die beiden ließen sich dort auch einige todschicke Seidenklamotten schneidern).
Insomma (kurz und gut): If you could make it there, you could make it anywhere.
König Ferdinand I. war ein Sohn Karl des Irgendwievielten. Mit vollem Namen hieß er Ferdinando Antonio Pasquale Giovanni Nepomuceno Serafino Gennaro Benedetto. Ferdi liebte die Kunst und die Musik und war ein großer Feinschmecker.
Man brachte Köche, die direkt aus Frankreich kamen, in seinen Königspalast im Stadtzentrum von Neapel, der Residenz der Bourbonen, und es waren angeblich die besten Köche der Welt. Pasta, Fisch, Gemüseaufläufe, raffinierte Kuchen und Torten: Diese Männer sorgten dafür, dass Ferdinand der Erste gründlich gesättigt zu Bett ging. Doch als der König eines Tages seinen Leibkoch – den er (abgeleitet vom französischen Monsieur) ’o Monsù nannte –, fragte, was es zum Mittagessen gebe, erhielt er zur Antwort: Als ersten Gang Reis, Majestät.
»REIS?!« König Ferdinand war empört. Reis war etwas, das man Kranken vorsetzte. Und bis heute gibt es in Neapel die Redewendung »O rise d’o mese int’o liett stese« – »Iss einen Monat lang Reis und hüte das Bett«. Reis gilt als fade, belanglose Schonkost. Man bezeichnet ihn sogar als Sciaquapanza, als »Bauchreiniger«.
»Bitte«, beharrte der Monsù. »Genug der Pasta. Wir machen den Reis herzhaft! Wir fügen Butter und Käse hinzu und …«
»Also gut. Ich erteile dir den königlichen Auftrag, Reis so zuzubereiten, dass ich ihn mag!«
Und so kam der neapolitanische Sartù di riso in die Welt. Er wird mit einem dickflüssigen Tomaten-Ragù zubereitet, mit zerkleinerten hartgekochten Eiern, Käse, Wurst, Erbsen und gebratenen Fleischbällchen oder Salami. Anschließend wird er in einer mit Butter ausgestrichenen Auflaufform im Ofen gebacken.
Der König war begeistert. Wer hätte das gedacht? Reis konnte tatsächlich gut schmecken und die Grundlage einer anständigen Mahlzeit abgeben.
Es war Samstagnachmittag, und ich befand mich in der Küche der Avallones, wo Raffaella Sartù di riso zubereitete, eines von Ninos Lieblingsgerichten. Salvatore hatte mich vom Internat abgeholt – stets verspätet, stets lächelnd – und bei seiner Mutter in der Küche abgeladen, während er wieder auf sein Zimmer ging, um noch ein wenig zu lernen. Er studierte im dritten Jahr Jura an der Universität Neapel. In Italien dauerte diese Ausbildung, nach deren Abschluss man dann als Anwalt praktizieren durfte, fünf oder sechs Jahre (manchmal auch länger).
Er paukte tagein, tagaus auf seinem Zimmer und ging alle paar Monate eine Prüfung ablegen. Er hörte keinerlei Vorlesungen, tauschte sich nicht mit Kommilitonen aus und hatte auch keinen Kontakt zu den Professoren. Er lernte immer nur Gesetzestexte auswendig – in seinem Kinderzimmer, das mit Teddybären und Fußballtrophäen aus der dritten Klasse geschmückt war. (Ich erinnere mich, dass ich Salva später einmal erzählte, dass wir in Princeton sogenannte Precepts hatten, Seminare, in denen die Studenten ermuntert wurden, zum Thema des jeweiligen Professors eigene Stellungnahmen abzugeben. Salvatores einzige Antwort darauf war: Warum sollte ein Professor etwas darauf geben, was ein Zwanzigjähriger denkt?)
Ich hatte angenommen, dass wir, wenn Salvatore mich abholte, zusammen etwas unternehmen würden. Die Chemie zwischen uns hatte doch gestimmt, bildete ich mir ein, als er meine Pizza klein geschnitten hatte. Und am Telefon hatte er am Vorabend nicht einfach nur ci sentiamo gesagt, wir hören voneinander, sondern ci vediamo: Man sieht sich!
Da saß ich nun also in der kleinen Küche bei Raffaella. Wer war ich für diese Leute? Ganz bestimmt nicht Salvatores Freundin – aber auch kein Gast der Familie. Es hieß weder »Nehmen Sie doch bitte im Salone Platz! Nehmen Sie Milch oder Zucker?« noch »Salvatore, Schätzchen, komm bitte her und kümmere dich um sie.« Vielleicht fühlte sich so eine Braut bei einer arrangierten Ehe. Dein künftiger Gatte ist anderweitig beschäftigt, und deshalb bringen wir dir in der Zwischenzeit bei, wie er seinen Reis mag. Aber wäre eine arrangierte Ehe denn wirklich so schlimm, wenn mein Verlobter jemand wie Salva wäre, der mich dazu brachte, dass ich mich so glücklich und lebendig fühlte? Ich musste ja schließlich nicht für ihn kochen. Oder etwa doch?
Was ich nicht mitbekam: Ich wurde gar nicht beurteilt, und ich wurde auch nicht vorbereitet. Raffaella war ganz und gar damit beschäftigt, den Sartù zuzubereiten, und sie wollte damit meinen Hunger ebenso stillen wie den der anderen.
Ihr Tanz war perfekt choreographiert: Gleichzeitig rührte sie das Ragù





























