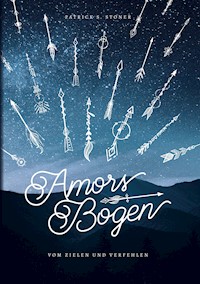
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Liebe ist etwas grossartiges, etwas geheimnisvolles. Wo beginnt - und wo endet sie? Ist sie ein sanftes Wesen? Kann sie dich verletzen? Wir begeben uns auf verschiedene Reisen, um sie wie ein interessierter Zuschauer zu umkreisen. Beginnend im Wilden Westen, wo wir zwei Männer zu ihrem Showdown begleiten - zum Duell - wird die Liebe obsiegen? Im Irak begleiten wir fünf Marines - ist dort Liebe möglich? Bruce - ein Trucker aus den Vereinigten Staaten wird die Liebe des Lebens auf den Straßen Amerikas finden - wird er ihr gerecht - oder sie ihm? In einer heruntergekommenen Straße in den Vereinigten Staaten, in Dave´s Bar wird unsere Reise weitergehen. Dort begleiten wir David durch eine besondere Kindheitserinnerung mit seinem Vater. Wir begleiten zwei Brüder, die das beschwerliche Leben auf einem Hof in den entlegenen Alpen bestreiten - mit der Frage, schafft es die Liebe auch dorthin? Unsere Reise endet mit Celine, die uns ihre Geschichte erzählt und die beschwerliche Reise zur Liebe - zwischen dem Drang aufzugeben - und dem Willen zur Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich dir, Christiane. Meine Mutmacherin.
Dir gehören die Geschichten „Brüder“ und „Das Duell“
Sie wären nicht ohne dich entstanden.
Inhalt
Das Duell
Whiskey-Tango-Foxtrott
Raue Liebe
The American Bohémian
Brüder
Celine
Das Duell
Das Duell
Der Geruch von abgestandenem Bier und Rauch drang ihm unangenehm in die Nase, vermischt mit Träumen, denen er sowieso entfliehen wollte. Er drehte sich auf die andere Seite des Bettes, ohne dabei seine Augen zu öffnen. Edward legte seine Arme um Myra und drückte sich gegen ihren warmen Körper. Er spürte sie; atmete tief ein und ein angenehmer Geruch von Wacholder stieg ihm in die Nase und vertrieb den Kummer des Vorabends und etwas, dass mit scharfen Klauen durch seinen Kopf jagte. Ein Gedanke nur, der ihn jedoch quälend zurücklies. Noch war es nicht so weit. Noch nicht.
Edward streichelte verträumt die Brüste mit der Hand, die er über sie gelegt hatte, und fuhr mit einem Finger die weichen Konturen ihrer Haut nach. Sie atmete einmal hörbar aus und drückte sich wie zur Bestätigung weiter zu machen, gegen seinen Körper. Während er sie mit noch immer geschlossenen Augen betastete, drang die Sonne bereits leicht durch die Spalte der Bretterverschläge und erfüllte den Raum mit angenehmer Wärme und Licht. Langsam öffnete er seine Augen. Er befühlte ihre Haut und atmete ihren Geruch. Nicht nur der Geruch von Wacholder stieg ihm angenehm in die Nase, sondern auch die Erinnerungen an viele Nächte, die er mit ihr im Arm hatte verbringen können und in deren Anschluss er so neben ihr aufgewacht war ... aufwachen durfte.
Immer an anderen Orten. Immer zu kurz, immer nur flüchtig. Wie lange kann das ein Mann aushalten? Edward verscheuchte die Gedanken, die sich schmerzhaft in sein Herz drängten, und versuchte den Moment, den Gott ihm gegeben hatte, zu vereinnahmen, ihn einzufangen, wie einen ganz besonderen Schmetterling, mit einem Muster, welches einen in den Bann zog – den Bann der Liebe.
Als er die Linien ihres Körpers nachzeichnete, dachte er daran, dass ihre Haut morgens irgendwie weicher, geschmeidiger – ja fast wie Samt war. Es hatte den Anschein, als würde sie verletzlicher sein am Morgen, wenn sie nackt neben ihm lag und noch nicht aus ihrem Schlaf und ihren Träumen erwacht war. Vielleicht ist es ja auch so, dass der Körper morgens die Rüstung, die man im Laufe eines Lebens jeden Tag aufs Neue anlegte, um sich gegen die Härte der Welt zu schützen, noch nicht trug. Vielleicht gibt es ein kurzes Zeitfenster, wo man verletzlich ist, wo man wirklich ist, so wie Gott einen schuf. Ohne Sünde. Ohne den Zweifel des Alltags, ohne den Gedanken daran, Menschen auf dem Gewissen zu haben, für eine Handvoll beschissene Dollar. Oder den Gedanken in Sünde mit einer Frau zu leben, deren Herz eigentlich einem anderen gehört. Es konnte sein, dass wir in diesem kurzen Zeitfenster, etwas sind, wonach wir unser Leben lang verzweifelt streben.
Edward war es eigentlich egal. Eigentlich.
Bis auf diese Momente der Trennung und der Gewissheit, dass er sie wieder bei sich hat. Er, ist ein ehemaliger Trapper, der nun mit der Army bei Bear Springs die Maisfelder der Navaho Indianer anzündete und deren Pferde stahl. Ja, er war ein Verrückter, in Edwards Augen. Wahrscheinlich wäre er ihm gegenüber gnädiger, wenn er nicht mit der Frau verheiratet wäre, die neben ihm lag und noch schlief, und die er liebte. Oh, Jesus, und wie er sie liebte.
Er war sich auch darüber im Klaren, dass es nicht so weiter gehen konnte. Nicht einen Zoll weit. Eigentlich war es so, dass es heute enden würde. Damit etwas Neues beginnen konnte. Aber was hatte er Myra schon zu bieten? Er hatte keine Aussicht auf einen Offiziersposten bei der Army wie dieser Bill Crook. Er war auch kein Unternehmer, er hatte keine Ahnung von solchen Dingen. Er hatte sich ein paar Dollar mal hier mal dort verdient. Eigentlich hatten er und sein alter Herr, eine Farm im Westen von Texas, doch als er Myra begegnet war, verfiel er ihr sofort und die Farm war vergessen. Ihre schwarzen Haare, die ihr keck ins Gesicht fielen und diese dunklen Augen, die ihm von Dingen erzählten und Träumen ließen, die er vorher so noch nie in Erwägung gezogen hatte. Dies schenkte sie ihm, in nur einem Augenblick, als sie von ihrem Pferd gestiegen war und ihn anlächelte. Bill Crook kam damals mit einer Karawane durch, die er anführte, bevor er zur Army ging. Bill war schon etwas älter, Edward schätzte ihn auf um die vierzig, er selbst war erst zwanzig gewesen. Bill sprang von seinem Pferd und begrüßte seinen alten Herrn und danach Edward. Er hatte einen festen Händedruck und ein von der Sonne gegerbtes Gesicht. Es zeugte von vielen Jahren harter körperlicher Arbeit an der frischen Luft und Entbehrungen.
Doch seine Augen strahlten eine Klarheit aus, die er bis heute nicht richtig beschreiben kann, er konnte einen damit regelrecht seinen Willen aufzwingen. Seine Worte fühlten sich an wie große Steinblöcke. Unumstößlich, nicht verhandelbar.
Sie kauften ihnen ein paar Stück Vieh ab und blieben zwei Wochen auf der Farm. Dort lernte er sie mehr und mehr kennen. Er hatte in der kurzen Zeit viel Kontakt mit ihr, natürlich war er es, der ihre Nähe suchte. Er spürte dabei immer in ihren Blick, es war klar, dass sie wusste, dass es keine zufälligen Begegnungen waren. Aber sie tat so, als würden es günstige Umstände sein und gab sich immer sehr geschmeichelt. Was Edward freute und ihn ermutigte weiterzumachen. Natürlich vergaß er dabei, dass sie die Frau eines angesehenen Mannes war. Sein alter Herr zog ihn eines Tages in die Scheune und blickte ihn ernster an, als er es von ihm gewohnt war.
„Edward, zum Teufel, was tust du da?“, er blickte ihm in die Augen. „Bei den Sohlen meines Großvaters, sie ist eine Frau, die sehr viele Männern um den Verstand bringen kann, am ehesten solche Jungspunde wie du es bist, die es nicht besser wissen“, er packte ihn jetzt auch an der zweiten Schulter und kam noch ein wenig näher, „unterschätze nie Männer, die mehr als eine Handvoll Dollar in der Tasche haben, und vor allem nicht ihre Frauen, hörst du Edward! Lass die Finger von ihr, kümmre dich um die Farm, mach deine Arbeit. Die Richtige wird kommen, glaub mir.“
Er ließ Edward los und blickte ihn etwas wehmütig an. Er strich ihm über das Hemd und zog die Falten glatt, die durch seine Berührung entstanden waren.
„Es tut mir leid, Junge, ich weiß genau wie es dir geht, ich erkenne mich selbst in dir wieder … in deinen Worten, deinem Gesichtsausdruck.“ Er stemmte beide Arme in die Seite und sah kurz zu den Wolken hoch, um ihn dann wieder anzusehen.
„Hör mir zu, ich und deine Mutter, wir haben ein einfaches, aber schönes Leben. Ich hätte das alles…“, er machte eine ausholende Bewegung mit seinen Händen, die die Farm und das Land, welches ihnen gehörte, umfasste „…fast auf‘s Spiel gesetzt, für eine Dummheit, einen Tagtraum, den ich hatte. Es kostete mich fast mein Leben und meine Ehe.“ Er zog sein Hemd nach unten, und Edward sah die Narben an der Schulter. Drei an der Zahl. Er kannte sie.
„Ja, Edward, das sind drei Löcher die sich auch in meinen Kopf, oder mein Herzen hätten bohren können. Ich werde dir die Geschichte eines Tages erzählen. Aber jetzt geh. Wir haben uns verstanden“, er blickte ihn durchdringend an.
„Ja, Vater.“
Doch Edward tat nicht, worum sein Vater ihn bat. So wie viele Söhne nicht auf ihre Väter hören und genau das Gegenteil taten. Es war nicht so, dass er seinem Vater nicht glaubte und seinen Worten keinen Respekt zollte. Sie sprachen selten miteinander. Nicht weil sie sich nichts zu sagen hätten, aber sie verstanden sich auch so. Ohne Worte. Diese wenigen Worte blieben ihm dafür umso mehr in Gedanken. Fast hätte er sich davon überzeugen lassen. Bis zu dem Tag, bevor die Karawane wieder abreiste und er Myra beobachtete. Er tat das sehr oft, wollte es aber sich selbst gegenüber nicht eingestehen, da er sich ein wenig dafür schämte. Bill Crook bekam indes nichts von der Schwärmerei Edwards, seiner Frau gegenüber, mit, da er zu dem Typ Mann gehörte, der mehr von sich selber hielt, und der festen Überzeugung war, dass er ein Anrecht auf das hatte, was er bekam. Unter anderem zählte dazu auch seine Frau.
Er trug gerade einen Wassertrog zur Farm, es war schon etwas dunkler und die brennende Sonne verließ langsam den Horizont im Westen. Als er bei dem Zelt von Bill und Myra vorbeikam, ging er etwas langsamer. Er hörte bereits aus der Ferne wie sie, lauter als sonst, miteinander sprachen. Als er ganz nah war, und sie versteckt hinter einer Kutsche beobachtete, bemerkte er, dass sie im Streit miteinander lagen: Er wusste nicht genau, worum es ging, was er aber sah, war, dass Bill plötzlich seine Hand erhob und Myra ins Gesicht schlug. Als er sah, wie sie auf dem staubigen Boden aufschlug begann sein Herz mit einem Male wie wild in seiner Brust zu schlagen. Etwas stieg in ihm auf, keine Wut, sondern pure Mordlust, die er so an sich nicht kannte. Er sah sich um und fand ein Holzscheit. Auf einmal lag es in seiner Hand. Edward stand auf und dachte sich, wie bescheuert es war, mit einem Holzscheit in den Kampf zu ziehen. Jedoch war dies nur ein kurzer und flüchtiger Gedanke. Wahrscheinlich lag es am Blut der jungen Männer, wo das Blut nur in die Lenden und Armen schießt, beides machte nur Probleme, so sagte es sein Vater jedenfalls. Doch Edward hatte an diesem Abend Glück. Jemand packte ihn am Arm, zum zweiten Mal in dieser Woche. Ein Mann, der mit der Karawane unterwegs war. Er hatte seinen Hut tief ins Gesicht gezogen und Edward konnte so nur die glimmende Zigarette in seinem Mundwinkel erkennen. Er nahm seinen Hut ab und Edward konnte, einen der Länge nach gefalteten Dollar im Schweißband erkennen. Er wusste nicht genau, warum ihm genau dieses Detail ins Auge fiel. Als er sein Gegenüber wieder anblickte, sah er den strengen misstrauischen Blick; stahlgraue Augen, mit einer Narbe über dem linken Auge, fixierten ihn, hatten ihn gebannt.
„Junge, was willst du mit dem Holz da“, er nickte in Richtung Edwards Hand, die daraufhin das Holz fallen ließ, als wäre es ein glühend heißes Metall.
„Ni… nichts, Sir.“ Edward riss sich aus den Fängen des Mannes los, der ihn ohne Widerstand gehen ließ, und rannte in die Nacht davon.
Er lief auf die Felder hinaus, bis sich ein Feuerring um seine Brust bildete und er nicht mehr konnte.
Er legte sich schwer atmend auf Boden mit dem Gesicht nach oben, kalter Schweiß hatte sich auf seiner Stirn gebildet und er sah weiße Punkte vor seinen Augen herumschwirren.
Ein kühler, sanfter Wind zog über das Land und vertrieb die Hitze, wie einen Schleier, den er mitnahm. Ein Schauer durchfuhr ihn. Er wusste nicht, ob es die hereinbrechende Kälte war, oder die Situation, die er gerade erlebt hatte. Er war feige gewesen. Er hatte sie im Stich gelassen. Das konnte er nicht auf sich beruhen lassen. Er schloss seine Augen und rieb sich mit beiden Händen das Gesicht, um die Gedanken zu vertreiben, und die Tränen, die damit einhergingen.
Über ihm zeigte sich der endlose Sternenhimmel, den Edward manchmal sehnsüchtig betrachtete. Diese Sehnsucht bekam heute eine Stimme in seinem Kopf.
Er wollte mit der Karawane mitziehen. Er wollte diese Frau um jeden Preis. Er liebte sie. Er wusste es mit jeder Faser seines Körpers. Auch wenn sein alter Herr was anderes sagte. Doch wie lange sollte er sich noch etwas sagen lassen? Er wollte sich endlich aus diesem Leben befreien, um ein Neues zu beginnen: Ein eigenes, eines, das nur ihm gehört. Er wollte ein Leben mit Myra. Sie hatte etwas Besseres verdient, als dieses Arschloch!
So kam der Tag, als die Karawane weiterzog und Edward mit seinen Habseligkeiten in der Tür der Wohnstube stand, im Angesicht seiner Eltern; dem Blick nach zu urteilen, den sie ihm zuwarfen, hatten sie beide damit gerechnet, dass es dazu kommen würde.
Seine Mutter weinte und drückte ihren Sohn an ihre Brust, die Hände, die ihn aufgezogen hatten, berührten nun ein letztes Mal sein junges Gesicht.
Sein Vater sagte, er soll noch kurz mitkommen. Er ging mit ihm hinter das Haus. Dort gab er ihm die Zügel seines besten Reitpferdes und das Holster mit der Smith & Wesson Model Nr. 3. Er hatte sie aufpoliert und geölt, der Sandelholzgriff glänzte in der aufziehenden Sonne.
„Dies gehört nun dir Sohn. Ich bin schon alt, weißt du?“, sein Vater sah ihn mit einem wehmütigen Blick an. „Niemals habe ich daran gedacht, dass mir mein Herz noch einmal schmerzen wird, aber ja … verflucht … das tut es“, er wischte sich eine Träne aus seinen Augen. „Ich kann dir nur noch eines sagen Junge: Es gibt zwei Arten von Männern, die du meiden und zu denen du nicht werden solltest“, er holte tief Luft und begann mit sorgenschwerer Stimme zu sprechen:
„Sieh dich vor, ein Mann zu sein, der glaubt seine Frau ist sein alleiniger Besitz, den er behandeln kann, wie es ihm beliebt“, Edward dachte sofort an Bill Crook, und spürte wieder dieses Kribbeln in der Magengegend. „Und sieh dich vor, ein Mann zu sein, der glaubt aus Liebe eine Frau besitzen zu können.“
Mit diesem Satz schloss er und umarmte seinen Sohn. Er wünschte ihm alles Gute und ließ ihn der Karawane nachziehen. Das tat er dann auch. Die Sonne stand gut, als er los ritt.
Als Edward an der Grenze ihres Landes ankam, und sich umdrehte, konnte er die Silhouetten seiner Eltern erkennen. Er wusste nicht, ob sie ihm aus der Ferne zuwinkten, oder die Sonne ihre Körper nur ins Schwingen brachte und es dadurch so aussah. Tränen verwischten das Bild noch mehr und so nahm er die Zügel in die Hand und ritt der Karawane hinterher, in ein neues Leben hinein.
Das war nun vor einem Jahr.
Ein Jahr, in dem er durch das Land zog und sich nach einer Liebe sehnte, die nie ganz die Seine sein würde. Er musste schmerzlich damit Leben, sie mit einem Mann zu teilen, den er hasste, gleichsam aber auch respektierte. Ein seltsames Gefühl; diese ganze Situation war seltsam. Aber eines war sie gewiss: zerstörerisch. Es würde ihn immer mehr auffressen, wie eine Krankheit, die ihn schleichend seiner Lebenskraft beraubt.
Doch auch dieses Gefühl, war an seinem jugendlichen Gemüt vorüber gegangen.
Heute würde es enden, und etwas Neues würde beginnen.
Er drehte sich von Myra weg, auf die andere Seite und klappte seine Taschenuhr auf. Es war gleich elf Uhr. Er musste los. Er stand auf und zog sich an. Im Zimmer befand sich ein kleiner Spiegel, davor, eine Schüssel mit Wasser, daneben etwas Rasierseife und sein Messer, das er am Vorabend dort abgelegt hatte.
Er setzte sich auf den kleinen Holzschemel, der davorstand und trug die Seife auf. Vorsichtig und mit kontrollierten Schnitten entfernte er die Barthaare. Während er die in der Sonne aufblitzende Klinge über seinen Hals führte, sie danach in die Schüssel mit Wasser tauchte und reinigte, um die Klinge erneut am Hals und zum nächsten Zug anzusetzen, dachte er über all das nach.
Er dachte darüber nach, dass es eigentlich so kommen musste, dass Bill ihm – ihnen beiden –auf die Schliche kommen musste. In kurzen Augenblicken, so wie in diesem jetzt, dachte er daran, wie Gott verflucht idiotisch er doch war.
Doch ein Blick zum Bett hin, löschte diese Gedanken sofort wieder aus. Es war für sie. Es war für sie und ihn.
Nach dem Rasieren trocknete er sich das Gesicht mit einem feuchten Tuch ab. Er legte sich das Holster um und schnappte sich seine Smith & Wesson. Er nahm die Trommel heraus, ein Schuss, so wie es sich gehörte.
Er legte sie kurz auf den Tisch, als er bemerkte, dass Myra ihn vom Bett aus beobachtet hatte. Ein reizendes, geheimnisvolles Lächeln umspielte ihre Lippen und hellte ihr bereits wundervolles Gesicht noch mehr auf.
„Du musst jetzt los, oder?“ Er konnte ihren Blick nicht deuten, aber ihre Stimme wärmte sein Herz. Edward atmete einmal tief ein und wieder aus.
„Ich muss nur noch mal austreten, dann geh ich runter“, antwortete er, gab ihr noch einen flüchtigen Kuss und verließ das Zimmer.
Als er zurückkam, hatte sie sich bereits angezogen und kämmte ihr Haar vor dem Spiegel, wo er sich gerade rasiert hatte. Verträumt sah er ihr kurz dabei zu, sammelte sich jedoch gleich darauf. Er ging zum Tisch hinüber und nahm seinen Revolver. Er fühlte sich leichter an. Edward deutete es als ein Zeichen. Nun wird alles leichter werden. Er steckte seinen Revolver in das Holster. Myra stand auf und sah ihm fest in die Augen.
„Ich bin gleich wieder da, Liebste. Bald ist alles vorbei. Ich … ich liebe dich, Myra“, seine Stimme zitterte, als ihm die letzten Worte über die Lippen kamen. Er hatte es ihr zum ersten Mal gesagt. Myra kam einen Schritt näher und schüttelte leicht ihren Kopf, dabei fiel ihr eine schwarze Strähne ins Gesicht.
„Du dummer Junge...“, sie strich ihn mit einer Hand durch sein Haar. „...was weißt du schon von der Liebe?“
Edward konnte nicht genau sagen, wie sie es meinte, da ein leichtes Lächeln ihr dabei auf den Lippen lag, und auch ihre Stimme ein wenig vibrierte. Doch er dachte nicht länger darüber nach. Draußen hörte er eine Stimme seinen Namen rufen.
Es war Bill.
Beide zuckten kurz zusammen. Sein Vorteil war, dass er ein guter Schütze war. Er war sogar verdammt gut. Bill hatte da schon seine Probleme. Seine linke Hand zitterte leicht. Das musste nichts bedeuten. Aber dies und die Tatsache, dass Edward definitiv der bessere Schütze war, ließen ihn für das bevorstehende Duell hoffen.
Edward setzte sich seinen Hut auf und gab Myra einen Kuss. Es war nicht die Art Kuss, die er von ihr kannte, er fühlte sich flüchtig, kurz und zögerlich an. Doch er konnte es verstehen.
Mit entschlossenen Schritten ging er aus dem Zimmer und schloss die Türe langsam hinter sich; es war das Zimmer über dem Saloon, unten waren schon ein paar verlorene Seelen an der Theke und tranken die ersten Becher leer. Trotz alledem war es ruhig.
Alle Blicke waren auf ihn gerichtet, manche nickten ihm zu. Egal wie man zueinanderstand, wer man war, welchen Stand man hatte: Todgeweihten nickte man zu.
Man war freundlich zu denen, die er für sich Ausgewählt hatte, um sie in seinen Ring zu schicken.
Edward verscheuchte den Gedanken und ging mit festen Schritt nach draußen über den festgestampften Boden, verließ den Saloon und stand bald auf dem leicht sandigen Boden. Er hasste Sand. Er windet sich in jede noch so kleine Falte und Ecke hinein und scheuert einem dabei, die Haut wund und viel zu oft hat man ihn sogar zwischen den Zähnen.
Bill stand bereits auf der breit angelegten Straße, die, bis auf ein paar Hühner, die ein Junge verzweifelt einzusammeln versuchte, leer war. Bill ließ sich durch nichts ablenken, sein Blick haftete an ihm, so wie er es immer tat. Auch wenn Edward seine Augen nicht genau ausmachen konnte, jedenfalls nicht so, spürte er diesen Bann, die sein Blick auf ihn ausübte.
Er hatte seinen Hut bis zu seinen Augenbrauen ins Gesicht gezogen. Als Edward die Straße betrat, mit nun etwas langsameren Schritten, spuckte Bill kurz aus. Sein Poncho, den er sonst immer auf der Jagd anhatte – und heute – wehte im Wind.
Die Sonne kroch langsam zu ihrem Horizont, und Edward dachte sich kurz, dass er gleich den zweiten Höhepunkt seines Lebens erleben würde. Einmal gestern, in der Frau des Mannes, der vor ihm stand, und jetzt zum zweiten Mal. Gestern der Kuss der Frau, die er liebte und heute der Pulverkuss. Was war tödlicher?, fragte sich Edward kurz in Gedanken. Er war nervös, sehr nervös. Seine Kehle wurde mit einem Male trocken und er wünschte sich, dass er noch etwas getrunken hätte. Seine Blase drückte auch unangenehm. Er schwitzte, die kleinen Härchen auf seiner Hand stellten sich auf. Er griff mit beiden Händen in seinen Gürtel hinein, damit seine Finger etwas zu tun hatten. Er sah, dass Bills Hand mehr zitterte als sonst. Sie zitterte eigentlich sehr heftig. Er wusste aber, dass Bill sich diesen Moment nicht würde nehmen lassen, dass er nicht aufgeben wird, auch wenn seine Chancen gleich gegen null gehen. Er war einer dieser Männer, von denen sich sehr viele in den Geschichtsbüchern fanden, jene, die einen falschen Stolz nach außen tragen. Einen Stolz, der sie schlussendlich das Leben kosten würde.
Er würde das Feld nicht räumen, bis sich der Sand auf einer Seite rot gefärbt hatte.
Roter Sand. Edward fröstelte es kurz bei der Vorstellung. Aber er wusste, dass er Bill Crook ohne Probleme wegpusten wird. Es war sein Tag, sein Moment.
Edward stellte sich ihm gegenüber. Der Abstand Betrug etwa fünfzig Schritte, schätzte er.
Bill spuckte noch einmal aus und kam auf ihn zu. Sein Herz begann heftiger zu schlagen. Was hatte er vor? Edward wartete ab und tat nichts Unüberlegtes.
Als er vor ihm stand, sah Bill ihn mit einem mordlüsternen Blick an. Worte voller Gift, richteten sich an ihn:
„Du miese Ratte, hast mir meine Frau gestohlen, ich hoffe du weißt, was für ein ehrloses Schwein du bist!“ Seine Stimme war mehr als nur verächtlich. Er nickte in die Richtung des Saloons. „Ich hoffe du und diese Dirne habt euch noch einmal gut amüsiert. Sei froh, dass ich dich nicht einfach umgelegt habe! Du hast sie mir gestohlen du Bastard!“
Edward nahm seinen ganzen Mut zusammen und musste seinen noch immer trockenen Mund befeuchten, bevor er überhaupt einen einzigen Ton hervor brachte.
„Sie liebt mich … ich liebe sie!“
Die Worte kamen einfach aus ihm heraus, ohne dass er es sich vorher überlegt hätte. Aber er musste etwas sagen. Er hatte zu lange weggeschaut, wenn er sie schlug, sie beschimpfte und es mit anderen Frauen trieb. Er hatte einfach zu lange weggeschaut. Bill wollte sich gerade wegdrehen, als Edward ihm diese Worte entgegenrief. Mit einem wütenden Blick drehte er sich noch einmal um. Er bohrte seinen Zeigefinger schmerzhaft in Edwards Brust.
„Halt dein Maul und nimm nicht Worte in den Mund, die du nicht kapierst! Nimm deine Waffe, du Pissgesicht“. Er drehte sich um und ging etwa fünfzig Schritt nach vorne, bevor er in Position ging. Bill nahm seine Taschenuhr. Auch Edward holte seine zitternd aus der Tasche. Er war so nervös, dass er sie fast fallen ließ. Er klappte den Deckel auf. Es war zwei Minuten vor elf.
Gleich würde die Turmuhr schlagen.
Edward schluckte. Sein Mund war immer noch trocken. Er zog seinen Revolver und drehte sich um. Jetzt sah er Bill nicht mehr, sondern blickte in eine ihm unbekannte Ferne. Vielleicht lag ja in diese Richtung die Farm seiner Eltern. Vielleicht hätte er dortbleiben sollen. Vielleicht war das alles, ein einziger großer Fehler gewesen.
Er war nie zu dem Mann geworden, vor dem sein Vater ihn gewarnt hatte. Er hat sich oft überlegt, was seine Worte bedeuten, welche tiefere Bedeutung sie haben mochten. Als er an Myras Seite einschlief, wurden diese Gedanken auch immer leiser. Sie zogen fort. So wie die Karawane, mit der er einst seine Heimat verlassen hatte. Und wie jeder weiß, legt sich irgendwann der Staub. Der verdammte Staub, den man selber aufgewirbelt hat, genauso wie jeder andere.
Edward atmete tief ein und versuchte, sich zu konzentrieren. Schweiß bildete sich in der Hand, in der er den Revolver hielt, ein Tropfen suchte sich seinen Weg, über die Linien der Waffe, ungesehen versickerte er im Sand. Edward wagte es nicht, seine Hand abzuwischen, da jeden Moment die Turmuhr schlagen könnte. Er konzentrierte sich. Eine Liebe. Zwei Patronen. Das war alles, was blieb. Die Frage war nur, in wessen Brust die Kugel am Ende landen wird.
Der Wind heulte. Augen sahen aus verborgenen Ecken zu.
Die Glocke schlug.
Edward drehte sich blitzschnell um und richtete den Revolver in Richtung seines Ziels. Er dachte nicht mehr nach. Er handelte. Wie es ein Mann tun muss.
Bills Hand zitterte, er konnte es sehen, bevor er abdrückte. Doch es passierte nichts. Nur ein hohles Klicken.
Das lag daran, dass seine Trommel leer war.
Bevor die Gewissheit zu ihm vordrang, wer die Patrone herausgenommen haben musste und dass der Revolver nicht wegen Vorsehung oder Schicksal leichter gewesen war, sondern einfach deshalb, weil das Ticket für sein Leben entfernt worden war, nutzte Bill seine Chance. Er konzentrierte sich, brachte seine Atmung unter Kontrolle, sein Zittern wurde weniger, eine Schweißperle rann über seine Stirn hinab bis zu seinem Bart. Er visierte an, drückte ab. Ein Schnalzen durchbrach die Ruhe. Als das Blut aus Edwards Mund lief, war der fragende Blick aus seinem Gesicht gewichen. Stattdessen zeigte seine Miene einen gebrochenen Mann. Später wird man sich erzählen, dass Edward Rose nicht die Kugel umlegte, sondern ein gebrochenes Herz. Ein verdammt junges, gebrochenes Herz, Amen.
Bill ging lächelnd (und sehr erleichtert) auf Edward zu, der bereits in den Himmel sah.
Blut rann aus seiner Wunde, an der gleichen Stelle, auf die sein Vater gezeigt hatte, bevor Edward die Farm verließ, doch er sollte sie nicht überleben. Bills Schatten verdeckte die Sonne. Er bückte sich zu ihm herab, steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen, nahm ein Schwefelholz zur Hand und riss es am Daumennagel an. Er zündete sich seine Zigarette an und blies den Rauch genüsslich aus, bevor er sein hämisches Grinsen auf Edward richtete.
„Jetzt, gehört sie mir“, sagte Bill lächelnd mit zynischer Stimme. Edward versuchte, nach seinem Hals zu greifen, doch Bill schlug seine Hand mit Leichtigkeit zur Seite. „Stirb wenigstens wie ein Mann“. Er nahm eine Patrone aus seinem Holster und lud seine Pistole. Als er damit fertig war, spannte er den Hahn und zielte auf Edwards Gesicht, in dessen Augen auf einmal Unglaube lag. Er wiederholte seine Worte noch einmal grinsend:
„Jetzt gehört sie mir.“
Ein weiterer Schuss durchbrach die Stille.
Aus Bills Kopf lief Blut. Er fiel vornüber zu Boden und regte sich nicht mehr.
Edward sah auf und blickte direkt in den Revolver von Myra, der noch immer in dieselbe Richtung zielte. Der letzte Rauch verzog sich aus der Mündung.
Westwärts.
„Ich gehöre niemandem.“
Sie drehte sich um und ging ihrer Wege. Keiner wusste, wohin. Sie war frei.
Als Edward verblutend, neben Bill lag, dachte er noch einmal an den Satz seines Vaters.
Er wollte nie ein Mann werden, der glaubt, dass er seine Frau besitzt. Doch den zweiten Satz, über den dachte er jetzt noch einmal nach: Werde nie zu einem Mann, der glaubt aus Liebe eine Frau besitzen zu können.
Jetzt wusste er, was es bedeutet.
Beide Gründe lagen nun in der Sonne.
Beide starben den Pulverkuss.
Edward blickte in die Sonne, er dachte an die Farm, seine Kindheit, an seine Eltern. Eine Träne vermischte sich mit seinem Blut und dem roten Sand unter ihm.
Für einen Augenblick glaubte er Wacholder zu riechen, dann starb er.
Whiskey-Tango-Foxtrott
Whiskey-Tango-Foxtrott
Es gibt Geschichten, die hört man einmal und hat sie nach kurzer Zeit wieder vergessen. Vielleicht war sie nicht spannend genug oder erzählte etwas, dass man so, schon hunderte Male gehört hat, nur in einem anderen Kontext. Es gibt auch Geschichten, die völlig abstrus sind, die etwas beweisen wollen, aber eigentlich keine Geschichte erzählen. Mit der Zeit denkt man über solche Qualitäten vermehrt nach, mir geht es auf jeden Fall so. Natürlich kommt es auch darauf an, wann einen eine Geschichte erreicht. Wenn sie im richtigen Moment zu einem findet, wird sie einen verzaubern. Dieser Zauber hat ein genau bemessenes Zeitfenster.
Nicht wir finden sie, sondern sie kommen zu uns, wenn wir dazu bereit sind.
Ich denke oft über solche Geschichten nach, die mich selbst geprägt haben.
Viele Geschichten davon sind aus meiner Kindheit.
Es war wie eine Fantasiereise; meine Mum hatte mir immer gern vorgelesen, jedenfalls denke ich, dass sie es gerne tat. Sie besaß eine weiche Stimme, an die ich mich noch heute mit Freuden zurückerinnere, ich fühlte mich geborgen und irgendwie gab es mir auch Sicherheit.
Wenn ich heute nachts im Bett liege, Ruhe langsam einkehrt und der Mond einen hellen Streifen Licht auf meine Bettdecke wirft, kommen Erinnerungen an diese Zeit in mir hoch.
Manches Mal fühlt es sich so an, als würde ich dann ihre Stimme hören, leise wispernd, an meinem Ohr. An solchen Abenden schlafe ich ein – und was noch wichtiger ist – ich schlafe die ganze Nacht durch. Wenn ich dann morgens aufwache und die Sonnenstrahlen die Decke wärmen, kommen mir fast die Tränen.
Mir kommen die Tränen, weil eine durchgeschlafene Nacht, einem Geschenk Gottes gleichkommt. Denn meist ist es genau andersherum.
Nicht schlafen zu können ...
Vor einem Jahr wäre dieser Gedanke für mich weit weg gewesen, so weit weg wie der Mond in etwa, oder meine Heimat heute. Denn die habe ich gefühlt seit Jahren nicht mehr gesehen, und ich fühle mich hier auch wie auf einem anderen Planeten.
Verflucht, vielleicht ist es das auch.
Mein Körper, oder besser gesagt, mein Inneres, fühlte sich an wie eine Mischung aus pulsierendem Strom, der ständig vom Scheitel bis zur Sohle läuft, Säure pumpt durch meine Adern, durch meine Augen flackert ständig stroboskopartiges Licht, wenn ich sie zumache, und nicht zu vergessen, die Geräusche – in einer Umgebung, die eigentlich kein Geräusch von sich gibt. Es ist wie eine flammende, von schwarzen Rauchwolken, schmutzigem Regen, und einem Nebel durchzogene Stadt, sie zieht mich wie ein starker Magnet in sich hinein. Saugt mich auf, und lässt mich nicht wieder frei.
Letzte Woche versuchte ich mich durch dieses Stroboskoplicht durchzukämpfen.
Ich wollte den Schmerz niederringen. Es war grell, und fühlte sich so an, als würde eine Axt meinen Kopf spalten. Nach schrecklichen Minuten, die sich wie Stunden anfühlten, wurden die blitzenden Lichter weniger und hörten an einem unbestimmten Punkt einfach auf.
Kurz darauf bekam ich in beiden Ohren einen Tinnitus. Es konnte auch nur bei einem Ohr gewesen sein, dass weiß ich nicht mehr genau. Doch das Schlimmste, das, auf das ich eigentlich hinauswollte – kam danach.
Ich sah Bilder. Ich besuchte eine dunkle, von Fratzen durchzogene Vernissage. Ich sah sie alle. Die in den Straßen Gefallenen; die teils entstellten Gesichter der Toten, die anklagend ihren Finger auf mich richteten. Es waren Unzählige von ihnen, sie umringten mich und zogen ihren Kreis immer enger um mich. Ich hatte Angst, bekam Panik, es schnürte mir den Hals zu und ich konnte nur stoßweise atmen, ich hatte das Gefühl gleich ersticken zu müssen. Ein weiteres Gefühl kam hinzu:
Platzangst. Ich wurde erdrückt. Diese anklagenden Finger. Wenn sie wenigsten Waffen auf mich gerichtet hätten, würde ich mich leichter tun. Aber diese Finger ...
Es war eine Anklage. Wie ein Gericht, vor dem ich nie erscheinen wollte. Vor dem ich eigentlich gar nie stehen wollte.
Nun bin ich aber hier ...
Ein Jarhead. Ein Devil Dog.
Ich hatte erst wenige Patrouillen hinter mir, eine davon endete in einer Katastrophe. Oder war die Katastrophe vielleicht die Normalität, die ich einfach noch nicht begriffen, oder sie als solche angenommen hatte? Keine Ahnung. Was ich aber wusste, war, dass ich mich verdammt nochmal zusammenreißen musste, ich hatte meine Gedanken zu ordnen. Ich musste Ordnung in meinen Kopf schaffen, damit ich klar denken konnte.
Als Squad Leader trägt man Verantwortung, die man nach außen auch zeigen muss. Eines habe ich jedoch schnell gelernt im Irak: Die Scheiße, die hier passiert, auf die kann dich niemand vorbereiten. Ich glaube auch, dass sie das gar nicht wollen. Jetzt war ich aber – so wie viele andere auch – hier und musste das Beste aus meiner Situation machen und meine Jungs wieder nach Hause bringen. Vorzugsweise an einem Stück und lebendig.
Zuhause wurden wir vollgepumpt mit Adrenalin, Abenteuerlust und Hass. Wir haben uns alle dem GWOT (Global War on Terrorism) verschrieben. Wir wollten Helden sein, unserem Land dienen und es verteidigen. Jetzt, beim Checken meines Gewehrs, frage ich mich zum ersten Mal ganz nüchtern, gegen wen wir es eigentlich verteidigen?
Ich hörte jemanden vor meiner Tür und brach meine Überlegungen ab, als das Klopfen begann.
„Sergeant, Lance Corporal Wilson, ich ...“
„Kommen Sie herein“, unterbrach ich meinen Besucher. Ich lehnte die Waffe gegen mein Bett und wartete, bis Wilson hereinkam. Er salutierte vor mir und ich winkte ab.
„Stehen Sie bequem, Soldat, und sprechen Sie frei.“ Er war sich kurz unsicher, was er machen sollte, was ich direkt bemerkte, da er nervös mit seinen Fingern spielte.
„Nun? Schießen Sie los, Lance Corporal.“
„Staff Sergeant Anderson möchte Sie sprechen, Sergeant, bevor wir die Patrouille beginnen.“
„Ist gut, danke. Machen Sie sich fertig für die Patrouille. Abmarsch“ Er salutierte und machte sich aus dem Staub. Ich zog meine Ausrüstung an, checkte alles noch einmal, denn erst wenn ich alles bei mir hatte, war ich bereit mein Gewehr aufzunehmen und das Zimmer zu verlassen. Das machte ich immer so.
Ich schwitzte jetzt schon wie verrückt durch die ganze Ausrüstung. Als ich nach draußen trat, trieb es mir den Sand in die Augen und die Sonne blendete mich.
Verdammter Sand. Verdammte Sonne – und ja – verdammtes Land. Verdammter scheiß Irak!
Ich machte mich auf den Weg. Meine Kampfstiefel knirschten im feinen Sand, der den grauen schmutzigen Beton unter mir bedeckte. Es erinnerte mich an Schleifpapier. Schleifpapier auf der Haut – ich fühlte, wie es meine oberste Hautschicht immer weiter abwetzte, wie sie rötlich zu schimmern begann, nach und nach feines Blut hervortrat und dann immer mehr und mehr ...
Ein- und Ausatmen.
Diese verfluchten Gedanken.
Ich sah Staff Sergeant Anderson auf der anderen Seite vor einem Zelt, mit den Händen in die Seiten gestemmt, stehen und ging auf ihn zu. Er trug eine dunkle Fliegerbrille und diesen bescheuerten Schnauzbart, der mich immer an Magnum erinnerte. Vielleicht möchte er auch Privatdetektiv nach dem Ende seiner Dienstzeit werden?
Ich salutierte und wollte mich melden, doch er winkte gleich ab.
„Kommen Sie mir nicht mit dem Scheiß, Sergeant, dafür habe ich weder Lust noch Zeit. Hören Sie mir zu“, er blickte mich durch das sich spiegelnde Brillenglas an und zeigte mit dem Finger auf mich. Ein kurzer Kopfschmerz. Dann war er wieder weg. „Sie bekommen PFC Ramirez, diesen kleinen Scheißer. Als Ersatz für den Mann, den Sie verloren haben. Ramirez ist schon lange im Einsatz und hat bereits ...“ Er überlegte kurz. Ich konnte nicht sehen was mit seinen Augen gerade passierte, aber er überlegte definitiv. Während er dies tat, wollte ich gerne seinen Satz beenden ... hat bereits eine hammermäßige PTBS vorzuweisen. Aber ich tat es nicht. Er drehte seinen Kopf wieder in meine Richtung, ballte eine Hand zur Faust und streckte sie in meine Richtung. Ich dachte mir nur, dass ich ihm gerne meinen Stiefel in seinen Arsch treten wollte. Er wusste genau, dass es mich hart getroffen hat, als ich einen meiner Männer auf der letzten Patrouille verlor. Und jetzt kam er mir auf die Tour?
„... eine Menge unentbehrliche Kampferfahrungen gesammelt. Er ist zwar ein wenig gestört, aber eine gute Kampfmaschine. Also holen Sie ihn und gehen Sie mir aus den Augen.“
Ich wollte gerade wieder gehen, als er mir noch etwas nachrief: „Ach ja, Sie sind das Schlussfahrzeug heute.“
Ich drehte mich um und sah ihn fragend an. Er grinste blöd. Dieser verfluchte Mistkerl. Das letzte Fahrzeug. Das war sozusagen die Arschgeige in einem Orchester. Ich gönnte ihm nicht die Genugtuung eine Reaktion zu zeigen. Wenn ich recht überlege, würde ihm das vermutlich auch egal sein. Er hatte seinen Willen durchgesetzt und mir die Arschkarte zugesteckt. Jetzt konnte ich sehen, wie ich sie wieder los wurde – oder musste damit leben. Also ging ich los, um meine Squad fertig zu machen.
Die Sonne kletterte immer weiter hinauf zu ihrem Thron und mir trieb es Unmengen an Schweiß aus jeder Pore. Ich wischte ihn mir aus den brennenden Augen.
Gottverflucht, wie heiß würde es heute denn noch werden? Ich hatte ein mulmiges Gefühl, wusste aber nicht weshalb, oder woher es kam. Es war so ein Gefühl, dass etwas nicht stimmte. An diesem Punkt meldete sich meine Unsicherheit. War es das Wetter? Das Essen? Der Irak?
Die Kopfschmerzen tauchten wieder auf und ich versuchte sie durch Druck auf den Schläfen zu mildern. Aus westlicher Richtung kam mir SPC Porter entgegengerannt. Er hatte nur sein Shirt an, eine dunkle Sonnenbrille und kaute auf Tabak rum, oder Kaugummi, keine Ahnung. Er kaute immer auf etwas herum. Er salutierte.
„Wann geht‘s los Sergeant?“ Er sah mich mit einem Grinsen an.
„In Kürze. Gehen Sie zum Fahrzeug und überprüfen Sie das 240G und machen Sie alles bereit, wir sind das Schlussfahrzeug heute.“
Porter atmete hörbar auf. Ja, wir würden heute die Arschgeige spielen. Aber wir müssen damit leben, Punkt. Porter war schon von Anfang an dabei, er war der Turmschütze des Fahrzeugs. Einer der Besten. Ich bin sehr froh darüber, ihn in meiner Squad zu haben. Er war verlässlich, und er trank auch nicht so viel.
„Holen Sie auch Corporal Jimenez und Lance Corporal Wilson. Wilson ist dort hinten in den Baracken, die sollen Sie unterstützen“, ich hielt ihn mit einer kurzen Handbewegung auf, da er schon gehen wollten. „Wissen Sie zufällig, wo ich PFC Ramirez finden kann, oder wo er sich gerade herumtreibt?“
Porter nahm jetzt seine Sonnenbrille ab, ich erkannte sofort den verwirrten Ausdruck darin. „Er soll aber nicht McMinn...“, ich unterbrach ihn.
„... ersetzen? Doch. Ich werde mit Ihnen jetzt nicht darüber diskutieren“, ich fixierte ihn und gab ihm damit zu verstehen, dass ich darüber wirklich nicht diskutieren würde. „Also? Wo ist er?“
Porter sah mich mit einem verächtlichen Blick an und schüttelte seinen Kopf. Er nickte in die Richtung, aus der er kam. „Er ist in meiner Baracke. Er zerlegt dort schon seit einer Stunde oder so seine M4. Auseinander und wieder zusammen.“
Er sah mich an und tippte mit dem Zeigefinger zweimal an seine Stirn. Das internationale Zeichen für schräge Vögel. „Der ist irre, Sergeant, der hat sie nicht mehr alle.“
„Lassen Sie das meine Sorge sein, machen Sie sich bereit, ich habe das Gefühl, heute findet eine Party in Ramadi statt, zu der wir aber nicht eingeladen sind, und Sie wissen ja, was man mit ungebetenen Gästen macht? Also, polieren und durchladen.“
Er sah mich durchdringend an, dann sah ich ein leichtes schräges Lächeln in seinem Gesicht auftauchen.
„Oorah!“, rief Porter aus, und verschwand in der schimmernden Umgebung, zwischen Schatten und Licht.
Ich ging auf die Baracke zu, um Ramirez einen Besuch abzustatten. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir ein weiteres Problem mit ihm aufhalste, aber da ich ja eh keine Wahl hatte, musste ich jetzt eben nur herausfinden, wie groß dieses Problem wirklich war. Ich ging durch den staubigen Gang der Baracke, wo es nach Urin und Lösungsmittel stank. Die Tür zu Ramirez Zimmer stand offen. Er saß an einem kleinen Tisch und war mit seiner Waffe beschäftigt, so wie es mir Porter erzählt hatte. Er zerlegte sie und baute sie wieder zusammen. Er war vollkommen in seine Tätigkeit vertieft. Je länger ich ihm zusah, desto mehr zog es mich auch in einen Bann. Als würde man hypnotisiert. Immer wieder dieselbe Tätigkeit. Seine Handbewegungen erschienen mir wie eine lang eingeübte Choreografie. Sie war perfekt. Die Einzelteile wurden immer auf denselben Platz gelegt. Jedes einzelne Mal. Alles hatte seinen Platz. Ich riss mich aus der Starre, in die ich verfallen war und bemerkte, dass Ramirez seine Augen geschlossen hatte. Sein Gesicht machte fast keine Bewegung. Sogar die einzelnen Schweißperlen rollten anmutig von seiner Stirn, über die Wange, zum Hals und verschwanden unter dem Shirt. Ich bemerkte auch erst nach einer Minute, dass meine Faust, mit der ich gegen die Türe klopfen wollte, erstarrt war. Es war wie ein heiliger Moment, dessen Zeuge man wird und den man auf keinen Fall stören wollte. Ich erkannte auch nicht den Irrsinn daran. Primär sah ich nur etwas, dass sogar etwas Ästhetisches an sich hatte.
Ja, fast schon Erhabenes.
Ich verscheuchte die Gedanken und meine zuvor erstarrte Faust schlug gegen die Tür.
Ramirez öffnete langsam seine Augen, drehte seinen Kopf zu mir und sah mich an.
Er hatte so dunkelbraune Augen, dass ich kurz das Gefühl hatte, schwarze Knöpfe würden mich ansehen. Ein dunkler, schwarzer, wogender Teich, der mich in die Tiefe zu ziehen drohte. Ich bekam eine Gänsehaut und ein Schauder lief mir den Rücken hinab. Ramirez sah mich eindringlich an, hörte aber nicht auf sein M4 zu zerlegen und im Anschluss wieder zusammenzusetzen. Ich bekam kurz ein mulmiges Gefühl. Was ist, wenn er durchdreht, die M4 zusammensetzt, lädt, ansetzt, entsichert und schießt?
Er wandte seinen Blick wieder ab und seine Lippen formten Worte, die aus einer mir gänzlich unbekannten Welt kamen; so etwas in der Art hatte ich noch nie erlebt.
„Setzen Sie sich doch Sergeant“ Ich trat in das Zimmer, schloss die Tür hinter mir und setzte mich ihm gegenüber.
Normalerweise hätte ich ihm in den Arsch getreten, ich hatte aber das Gefühl, dass das jetzt nicht angebracht war. Unser Einsatz begann gleich, Staff Sergeant Anderson saß mir im Genick wie ein Kastenteufel, der immer genau dann aus seiner verdammten Kiste sprang, wenn man es am wenigsten erwartete; ich hab einen Mann verloren – wie ich damit umgehen sollte, wusste ich nicht und der Mann, der ihn ersetzen sollte, schien wirklich den Verstand verloren zu haben, oder er war gerade auf dem besten Weg dazu. Also setzte ich mich nur hin, legte meine Hände auf den Tisch und betrachtete Ramirez. Links von uns war in der rechten Ecke ein kleines Fenster. Licht fiel ins Zimmer und man konnte den Staub erkennen, der im Zimmer tanzte. Er wirbelte im Takt von Ramirez Bewegungen umher und schien sich auch seinen Bewegungen unterzuordnen. Die Staubwirbel folgten seinen Handbewegungen. Irgendwie hatte es etwas Poetisches an sich. Es hatte auch etwas Tragisches und Schreckliches. Es widerte mich an und faszinierte mich gleichermaßen.
„Was tun Sie da, Private First Class?“, begann ich das Gespräch.
Ramirez hob kurz den Blick und sah mich an. Es lag nichts darin, was ich erkennen konnte. Keine Wut, Ärger oder Verachtung. Es wirkte höchstens neutral.
Neutral machte mir Angst.
„Ich setze meine Waffe zusammen“, er steckte das Magazin in die Waffe, die damit wieder vollständig war. Dann nahm er das Magazin wieder heraus. „Jetzt zerlege ich meine Waffe“ Ich versuchte, meinen Blick nicht von ihm abzuwenden oder mich durch seine Tätigkeit ablenken zu lassen.
„Ich möchte, dass Sie damit aufhören, Private First Class Ramirez“, ich hielt seinem Blick stand. „Ich benötige Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, verstehen Sie?“
Wieder war er beim Magazin angelangt. Als er die Waffe fertig zusammengebaut hatte, fing er dieses Mal aber nicht wieder von vorne an, sondern stellte sie mit dem Lauf nach oben, neben sich ab. Plötzlich lag eine eigenartige Ruhe im Zimmer.
Für ein paar Sekunden sagte niemand etwas. Ich bemerkte, dass ich den Atem angehalten hatte. Auch Ramirez hielt seinen an. Wir starrten uns an, wie wilde Tiere, die einen stummen Kampf ausfochten. Das Licht flimmerte im Zimmer, stroboskopartig zuckte es durch den Staub und zeichnete seltsame Muster auf den Boden.
„Warum tun Sie das?“, ich nickte mit einem kurzen Blick zu seiner M4 und sah ihn danach gleich wieder an.
Er atmete einmal tief ein, und wieder aus und wischte sich mit seinen dunklen Händen einmal durch das Gesicht, oder vielmehr rieb er es, als wäre er gerade erst aufgestanden, frisch aus einem Albtraum erwacht. Einem Albtraum, den er selbst noch nicht richtig begreifen konnte. Weil vielleicht beides dasselbe ist. Ramirez strich gedankenverloren über den Lauf seiner Waffe, danach sah er mich wieder an.
„Wissen Sie Sergeant, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe mir aber nicht lange den Kopf darüber zerbrechen müssen“, er sah wieder zu seiner Waffe hin, als würde der Anblick ihn dabei helfen weiter zu sprechen. Ich unterbrach ihn nicht und hörte weiter zu.
„Die Stimmen hören auf“, er schnippte mit seinen Fingern. „Einfach so. Wenn ich beginne meine Waffe auseinanderzunehmen, dann verschwinden die Stimmen in meinen Kopf. Es wird ... es wird leiser. Ruhiger. Diese Tätigkeit gibt mir nicht nur die Auszeit, die ich benötige, sondern auch einen Sinn. Ich verstehe, was ich tue und das, was ich tue, funktioniert. Die Teile lassen sich Stück für Stück auseinandernehmen, dann habe ich sie alle da vor mir liegen. Dann beginne ich es wieder zusammenzusetzen. Die Teile greifen ineinander, die Verschlüsse, die gleitenden Teile – alles passt.“ Er stoppte kurz und drückte nervös auf seine Finger herum, die – wie ich erst jetzt bemerkte – zitterten.
„Aber da draußen ...“, seine Augen bebten, als sein Blick nach „draußen“ ging.
Ich konnte nur erahnen, was er sah. Vielleicht sterbende Kameraden, vielleicht Blut oder Lärm, es war auf jeden Fall nichts Gutes. Als er weitersprach, war seine Stimme ein wenig leiser. So als würde er über den Teufel sprechen, und dessen Name er nicht laut aussprechen wollte, deshalb wurde seine Stimme ein Flüstern.
Ein geheimes Flüstern. Ein Zwiegespräch von Todgeweihten.
„... dort draußen ist alles Chaos. Dieses Chaos, ist auch in meinen Kopf. Aus diesem Grund, Sergeant, mache ich das.“
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und überlegte, was ich darauf erwidern könnte.
„Ich kann verstehen, dass es Ihnen nicht gut geht, ich habe von der Squad gehört, in der Sie vorher waren.“
„Ja, die Höllenhunde“, er lachte kurz auf. „Keiner lebt mehr. Die einzige Ausnahme bin ich, und glauben sie mir, ich bin dafür nicht dankbar. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich darüber denken soll, wenn ich ehrlich bin“.
„Haben Sie mit jemandem darüber gesprochen?“, fragte ich ihn. Er sah mich mit einem verächtlichen Blick an.
„Gesprochen? Mit wem? Den Psycho-Fuzzis? Wissen Sie, was die machen?“
Ich musste mit den Schultern zucken, ich wusste es nicht. Ich wollte nach meinem Einsatz eigentlich auch zum Psychologen gehen, da wir alle nach einem Einsatz, oder einem Vorfall hingehen sollten. Ich überlegte kurz, warum ich eigentlich nicht hingegangen war, es fiel mir aber nicht ein. Ich wollte jetzt auch nicht darüber nachdenken, wenn ich ehrlich war. Ich musste meinen fünften Mann mobilisieren.
„Denen erzählst du die ganze Scheiße. Also ich meine ALLES! Du lässt nichts aus. Erzählst jedes Detail, vielleicht heulst du sogar ne Runde – das ist mir einmal passiert und wissen Sie, was er zu mir sagte?“
Ich zuckte mit meinen Schultern.
„Er sagte, ich soll mich zusammenreißen. Dann kommt die Behandlung. Warten Sie, ich kann Ihnen die Therapie zeigen.“
Er griff in seine Hosentaschen und förderte etwas zutage und warf es auf den Tisch vor uns. Es waren Tabletten.
„Ambien. Von ihrem Standort-Quacksalber empfohlen. Eine am Abend. Oder auch mehrere, wie man halt will. Entweder du wirst zum Zombie oder verreckst, aber wen kümmert das schon? Das ist ihre fucking Therapie. Oder besser! Man geht zum Seelsorger. Da gibt‘s dann ein Ave Maria – in den Arsch – meine Fresse! Gott vergibt dir deine Sünden; ich liebe mein Land und wir kämpfen für die Freiheit. Wissen Sie Sergeant, wenn Sie diesen ganzen Müll durchhaben, diesen Militär Scheißdreck Einheitsbrei, dann verlieren Sie irgendwann die Hoffnung.
Du hast hier niemanden, mit dem du reden kannst. Wenn schon einer zum Seelsorger geht, dann natürlich nur um sich eine Ration Snickers aus den Care Paketen zu holen, die uns die patriotische Familie aus Übersee sendet.“ Ramirez schüttelte verächtlich den Kopf, seine Augen waren glasig und funkelten wie Sterne. Er kam jetzt so richtig in Fahrt.
„Irgendwann ist dir alles egal, dann gehst du da raus, bringst Hadschis um, holst dir Alkohol, Marihuana oder Heroin von ihnen und ballerst dich damit zu. Du steigst wieder auf das Fahrzeug, zugedröhnt, irgendwer dreht Metallica auf und das Ganze wieder von vorne. Wenn du wieder nüchtern bist und dich fragst, was zum Teufel du da eigentlich tust, kommt bestimmt irgend so ein bescheuerter Idiot angerannt und erzählt dir was von: Wir bauen Schulen, wir bauen die Infrastruktur auf und so weiter und so fort“, er bildete mit seinen Händen einen Trichter vor Mund und Nase und atmetet wieder tief ein und aus. Ramirez war am Ende, was sollte ich jetzt tun? Teilweise konnte ich nachvollziehen, was er sagte, aber was sollte ich tun?
„Ich verstehe, was Sie meinen, aber wir sind nun einmal hier, daran wird sich nichts ändern. Wir haben unseren Job zu erledigen. Verstehen Sie?“, ich sah ihn fragend an, in der Hoffnung das Ruder irgendwie herumzudrehen.
„Das höre ich ständig, jeden Tag aufs Neue. Wissen Sie Sergeant – bei allem Respekt – aber Sie werden eines Tages auch in dieser Hölle aufwachen und sehr schnell merken, dass Sie ein Gefangener sind“, er schnalzte mit der Zunge. Ich hörte ihm weiter zu. Vielleicht half es, einfach zuzuhören.
„Wissen Sie, wir leben hier in einer vollkommen verdrehten Welt. Stellen Sie sich vor, Sie sind in den Staaten, nehmen wir mal an in ... woher kommen Sie, Sergeant?
„Augusta, Maine“, antwortete ich.
„Augusta, okay. Da fahren Sie durch die Straße und bleiben irgendwo stehen, steigen aus Ihrem Wagen aus, gehen zu einem Typen hin, den Sie nicht kennen und legen ihn einfach um, daneben steht sein Kind, das legen Sie auch um.“
„Auf was wollen Sie hinaus, PFC Ramirez?“, fragte ich etwas gereizt.
„Hören Sie mir einfach zu. Danach können wir gerne auf unseren Höllenritt, wenn Sie so scharf darauf sind.“
Ich nickte kurz und Ramirez sprach weiter. Seine Stimme bekam jetzt mehr Kraft.
Etwas flammte in ihm auf.
„Wenn Sie das in Augusta machen, dann kommen Sie wahrscheinlich für eine verdammt lange Zeit in den Knast, oder man landet in einer psychiatrischen Anstalt und wird für sein restliches Leben als unzurechnungsfähig abgestempelt. Niemand will Sie je wiedersehen. Sie werden ins Exil geschickt, ohne Rückfahrticket versteht sich“, er überkreuzte seine Arme vor der Brust und lehnte sich etwas zurück, bevor er weitersprach.
„Aber was ist mit uns? Wir töten auch Menschen, sehr viele Menschen – und jeder der nicht komplett irre ist weiß, dass wir nicht nur die ‚bösen Jungs‘ abknallen.
Sondern einfach alle. Hier sterben Menschen ohne Grund – wissen Sie, was mit uns passiert, wenn wir zu Hause sind, in den Staaten? Es passiert Folgendes ...“, er beugte sich wieder nach vorne und zog seine Augenbrauen nach oben.
„Gar nichts. Das Einzige was passiert, ist, dass dir irgendjemand mit seinen Wichsgriffeln die Hände schüttelt, und wenn du besonders dumm, oder abartig warst, bekommst du inkludiert mit einem Trauma – eine gottverdammte Medaille umgehängt. Danach kannst du frei in der Welt umherlaufen, tun und lassen, was du willst – irgendwer sagt dir, dass du nicht unbedingt deine Frau schlagen oder umbringen solltest, dann ist alles okay. Dann Schulterklopfer, ‚Danke für Ihren Dienst‘ und ab mit dir kleiner Junge, Uncle Sam braucht dich nicht mehr, er hat‘s dir nämlich schon heftig besorgt, jetzt braucht er neues hartes Fleisch.“
„Das sind ziemlich harte Worte, die Sie hier von sich geben“, sagte ich.
„Und jedes Wort ist wahr, dass wissen Sie auch, Sergeant. Sie haben schon einmal in den Schlund der Hölle hineingeschaut. Ich sehe es. Ihre Augen ... Sie schlafen schlecht, habe ich recht?“ Ich richtete mich auf, ich fühlte mich herausgefordert.
Provoziert.
„Meine Befindlichkeiten tun hier nichts zur Sache. Sind Sie nun fertig? Wir müssen nämlich los, und bis jetzt war ich noch sehr freundlich. Reizen Sie meine Geduld nicht aus.“
Er schüttelte seinen Kopf.





























