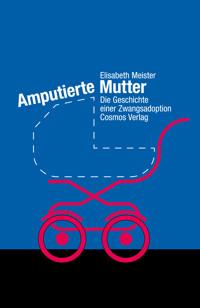
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cosmos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1969 feiern Hippies die freie Liebe, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez treten in Woodstock auf, im Kino läuft «Easy Rider». Und in Zürich bekommt Elisabeth ein Kind. Unverheiratet, ohne Kindsvater, 17 Jahre alt. Das durfte nicht sein in einer Welt, in der Väter jeden Samstag ihren Ford Taunus oder Opel Kapitän schamponierten, die Waschküche ein heiliger Ort war und das Treppenhaus am Sonntag nach Schmierseife zu riechen hatte. Der Druck von Behörden und Familie auf die junge Mutter wurde so gross, dass sie ihre Tochter schliesslich zur Adoption freigab. «Ich bin meinem Kind keine Mutter gewesen.» Schmerz und Scham begleiteten fortan das Leben von Elisabeth. Ihr Buch gibt «amputierten» Müttern eine Stimme. «Sie stehlen sich durch die Gesellschaft und hoffen, dass ihnen niemand auf die Schliche kommt. Man sollte ihnen erlauben, endlich aufrecht zu gehen.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Meister
Amputierte Mutter
Elisabeth Meister, 1952 geboren in Renens, aufgewachsen in Zürich, wohnt in der Nähe von Genf.
Elisabeth Meister
Amputierte Mutter
Die Geschichte einer Zwangsadoption
Cosmos Verlag
Für Jill und Armel
Für Michelle, Léa und Anouk
Für meine Eltern und meine Schwester
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 by Cosmos Verlag AG, Muri bei Bern
Lektorat: Iris Stalder
Umschlag: Stephan Bundi, Boll
Satz: Yuki Lehmann
Druck: Merkur Medien AG, Langenthal
Einband: Grollimund AG, Reinach
ISBN 978-3-305-00515-4
eISBN 978-3-305-00516-1
Das Bundesamt für Kultur unterstützt den Cosmos Verlag mit einem Förderbeitrag für die Jahre 2021–2025
www.cosmosverlag.ch
Inhalt
Davor
Während
Danach
Zum Schluss
Im Jahr 1969 machte der Mensch einen ersten Schritt auf dem Mond. Überall auf der Welt demonstrierten die jungen Leute gegen den Vietnamkrieg, die Hippies feierten die freie Liebe und den Bruch mit den damals gängigen Lebens- und Moralvorstellungen. Man kämpfte für eine friedlichere und humanere Welt. Ein spontan organisiertes Konzert im Bundesstaat New York – Woodstock – zog 400000 Menschen an, die sich gedankenversunken in Haschischwolken zu den neuen Rhythmen wiegten. Rund um die Uhr wurde getanzt, Janis Joplin schrie ihre leidenschaftlichen Songs mit gebrochener Stimme in die Menge, Jimi Hendrix spielte mit den Zähnen Gitarre.
Und ich bekam ein Kind. Unverheiratet und ohne Kindsvater, in Zürich, ich war siebzehn.
Das durfte nicht sein. Man musste es wegzaubern! Abtreibung oder Adoption. Das war zu dieser Zeit moralischer, als ein uneheliches Kind in eine Familie aufzunehmen. Als mein Mädchen zweieinhalb Jahre alt war, habe ich einer Adoption zugestimmt.
Ich will diese Geschichte aufschreiben. So, wie ich sie erlebt habe. Und wie sie in den offiziellen Akten steht. Weil wir freigebenden Mütter, wie wir amtlich genannt werden, eigentlich nie zu Wort gekommen sind. Jetzt ist es aber Zeit.
Mein Verhalten war nicht immer mutig und ich ging oft den Weg des geringsten Widerstandes. In meinem Freundeskreis kennen viele meine Geschichte nicht. Ich schäme mich noch heute dafür. Ich glaube, das sind keine Schuldgefühle, aber es ist Scham. Bei mir, bei uns ist es letztendlich gut ausgegangen. Zwar mit Kollateralschaden, aber gut.
Im eng geschnürten Korsett der damaligen Wertvorstellungen war eine aussereheliche Schwangerschaft – in der Schweiz und wahrscheinlich auch anderswo auf der Welt – nahezu eine Straftat. Es gab sogar Frauen, die dafür ins Gefängnis mussten. Oder «sicherheitsversorgt» wurden, wie sich der Amtsjargon liebenswert bemühte. Man musste die Gesellschaft in den gewünschten Bahnen halten. Also hielten sich die Behörden auf einem Kurs, der es der ausserehelichen Mutter zum Schein doch noch überliess, selbst zu entscheiden. Doch mahlten die Mühlen der Ämter so gründlich und so lange, bis man mürbe wurde und das Kind freigab. Von «frei» und «geben» konnte allerdings selten die Rede sein. Auch das familiäre Umfeld zwang uns in die Ecke, bis wir losliessen.
Dieser Schmerz zieht sich durch das ganze Leben. Als adoptiertes Kind und als freigebende Mutter.
Viele solche Mütter haben es trotzdem geschafft, etwas aus ihrem Leben zu machen. Andere nicht, und sie sind daran zugrunde gegangen. Es ist ja nicht nur, dass man etwas Falsches getan hat. Der fundamentale Wert, die heilige Pflicht, dass eine Mutter für ihr Kind sorgt, wurde uns ausgeredet. Es sei besser für den kleinen Erdenbürger, als Adoptivkind aufzuwachsen, als etwa als Anhängsel einer unverantwortlichen, liederlichen Frau gross zu werden.
Wenn man ein Kind freigibt, spricht man sich vor der eigenen Gerichtsbarkeit schuldig. Und da bekommt man lebenslang.
Nach Einsicht der offiziellen Akten habe ich mich etwas besser gefühlt. In den Protokollen war Adoption als Absicht hinter jeder Massnahme zu entziffern. Mir wurde wacker eingeheizt, mit allen Mitteln. Auf einmal fühlte ich mich nicht mehr so verdammt schuldig und konnte zum ersten Mal wütend werden. Mit einer anderen sozialen und moralischen Software wäre alles anders geworden. Ist es ja heute auch. Aber damals war das nicht möglich.
Man hat viel von den adoptierten Kindern gesprochen, was sie alles erlebten und welches Trauma sie aufarbeiten mussten. Es ist tatsächlich nicht einfach zu akzeptieren, dass die Mutter – oder der Vater – sie als Kind losgelassen hat. Bye-bye Urvertrauen und Geborgensein. Geborensein und dann weg.
Aber auch die «freigebenden» Mütter haben ein Leben lang unter der Zwangsadoption gelitten. Die werdenden ausserehelichen Mütter wurden entsorgt und auch die Entsorgung des Kindes wurde bis ins kleinste Detail durchgedacht. Dieser moralische Mord wurde mit Mitteln begangen, die keine Spuren hinterlassen. Immer schön den Vorschriften entlang und in kleinen Amtsschrittchen.
Die freigebenden Mütter – oder vielleicht sollte man besser von «amputierten» Müttern sprechen – hatten bis anhin nicht einmal das Wort.
Bis heute nicht!
Sie stehlen sich durch die Gesellschaft und hoffen, dass ihnen niemand auf die Schliche kommt. Man sollte ihnen erlauben, endlich aufrecht zu gehen und sich von ihrem Schuldgefühl zu befreien.
Ich möchte Ihnen hier meine Geschichte erzählen. Vielleicht hilft das irgendjemandem auf der Welt, sich etwas besser zu fühlen.
Mein Leben hatte gut angefangen. Aber jedermann kommt irgendwann irgendwo an. Wohl dort, wo das Schicksal es vorgesehen hat. Manchmal ist das Schicksal träge und erlaubt sich viele Windungen und kleine Ewigkeiten, manchmal gönnt es sich eine rasante Achterbahnfahrt. Es geht schnell rauf und schnell wieder runter. Bei Michelle und mir ging es erst ruckzuck und dauerte dann Ewigkeiten.
Es ist lange her, doch erinnere ich mich an gewisse Dinge mit einer Genauigkeit, die alle Sinne umfasst. Ich kann sie noch riechen, fühlen, hören, sehen und ertasten. Andere Erinnerungen habe ich aus meinem Gedächtnis verstossen, in der Hoffnung, dass sie nie wieder auftauchen. Ich habe mir eine Wahrheit zurechtgezimmert, mit der es sich irgendwie leben liess. Mehr oder weniger.
Der Tag ist blass. Der Morgen reibt sich noch die Augen. Mit meiner Tasse Tee, als ob ich mir die Hände wärmen wollte, schaue ich aus dem Küchenfenster. Nebelschwaden schleichen stillheimlich ums Haus. Alle schlafen noch. Alles ist ruhig. Eine samtene Stille, die weit ausholt.
Oben schläft die kleine Jill ganz nahe bei ihrer Mutter. Oder wahrscheinlich quer und in die Bettdecke eingedreht. Michelle, meine Tochter aus erster Liebe, hat sich wohl irgendwo eine Wolldecke geschnappt. Sie sind hier bei mir. Meine Tochter und ihr süsses kleines Mädchen mit den kleinen Grübchen, in die sie lausbübisch hineinlächelt. Ich bin glücklich.
Michelle weiss, dass ich ihren Vater kaum kannte. Eigentlich überhaupt nicht.
Ich habe lange auf sie warten müssen. Und wage kaum, daran zu glauben, dass sie sich bald zum Frühstück an meinen Tisch setzen werden.
Davor
In dem Zürcher Quartier, in dem ich aufgewachsen bin, spielte man heile Welt. Die Mietshäuser sprossen nur so aus dem Boden. In dieser Neusiedlung würfelte sich eine Gesellschaft zusammen, die arbeiten musste, um es zu etwas zu bringen. Auch viele Ausländer, unter ihnen die berühmt-berüchtigten «Tschinggen» (italienische Fremdarbeiter, die es anscheinend faustdick hinter den Ohren hatten und den Schweizer Frauen nachpfiffen), wohnten hier. Die Wohnungen waren eng und mit Familien vollgepackt. Man hörte durch die papierdünnen Wände, wie sich die Nachbarn stritten, doch wenn man sich in der Eingangshalle traf, tat man so, als ob nichts wäre. Es war so etabliert, dass jeder alles von jedem wusste, aber niemand je darüber sprach.
Im Keller stand eine Waschmaschine, die von allen benutzt werden konnte. Die Waschtage waren für jede Familie auf Monate hinaus festgelegt und so unumstösslich wie etwa Weihnachten oder Neujahr. Die Waschküche war eine heilige Stätte, die man nicht entweihen durfte. Nach jedem Waschtag wurde geschrubbt, als wäre vorab die Pest ausgebrochen. Es wäre eine Schande gewesen, wenn auch nur ein einziger übrig gebliebener Wassertropfen am Waschbecken aus Chrom das Bild der perfekten Nachbarin getrübt hätte. An ihren Waschtagen war meine Mutter nicht ansprechbar. Alle drei Wochen musste dieser Glanzakt hingelegt werden, damit nicht nur die Wäsche sauber war, sondern auch der Haussegen gerade hing.
Am Samstag musste das Treppenhaus geputzt werden. Jeder Mieter war verantwortlich für sein Stockwerk, und da jeweils zwei Wohnungen auf einer Etage lagen, war jede Familie alle vierzehn Tage an der Reihe. Man konnte auch mal tauschen, etwa wenn man in die Ferien fuhr oder zu einer Hochzeit eingeladen war. Aber ein triftiger Grund musste schon vorliegen. Es waren nur ein paar Stufen, doch war diese Aufgabe zu einer schier religiösen Handlung auf dem Altar des nachbarlichen Einvernehmens geworden. Wenn die Glocken der nahegelegenen Kirche um sechs Uhr den Sonntag einläuteten, mussten die Stufen noch feucht schimmern und im Treppenhaus hatte es sauber nach Schmierseife zu riechen.
So lernten wir das Kleindenken, wir lernten, uns in das Kleinkarierte einzugliedern. Zwingli wäre stolz gewesen. Da herrschten Gehorsam, Sitte und Tüchtigkeit. Gehorsamkeit nicht etwa gegenüber irgendeinem Gott, sondern eher gegenüber einer gestaltlosen moralischen Obrigkeit. Ohne irgendwelche Hinterfragung, die Dinge waren so etabliert und daran konnte nicht gerüttelt werden. Es kam auch niemandem in den Sinn. Unsere Gemeinschaft funktionierte hervorragend und niemand scherte aus. «Es ist so und fertig!»
Am Samstagabend wuschen die Männer ihre Autos vor den Garagen. Da wurde die Karosserie schamponiert und mit Wachs eingerieben, bis die Limousinen wie neu in der Abendsonne glänzten. Man fachsimpelte über die Vorteile des Opel Kapitäns gegenüber dem Ford Taunus. Und umgekehrt. Die Marke war nahezu ein Glaubensbekenntnis. Wenn Besuch kam, gab man ihm vorab die Garagennummer an, damit sich niemand versehentlich vor die Garage eines Nachbarn stellte. Die Wände zwischen den einzelnen Abstellplätzen waren aus Gitterdraht, so dass man in das Reich der andern schauen konnte. Man war stets auf peinlichste Ordnung bedacht. Die Sommerreifen lagen im Winter – pedantisch gestapelt – im hinteren Teil der Garage, im Sommer lagerten dort die Winterreifen. Es schien fast so, als hätte eine unsichtbare Hand die Stellen für die einzelnen Dinge mit Kreide aufgemalt. Nur nicht auffallen, nur nicht aus der Reihe tanzen, das war hier oberstes Gesetz.
Mein Vater tanzte aus der Reihe. Der guten Ordnung zum Trotz hatte er eine Art Werkstatt in der Garage eingerichtet. Mit einer Werkbank und allerlei Werkzeug. Hier erfand er Dinge, die es leider schon gab. Er dachte sich Steigeisen für Schuhe aus, damit man bei Glatteis nicht ausrutschte. Mit Holz- und Metallresten stellte er jeweils einen Prototyp her. Auch träumte er davon, mit seinen Erfindungen reich zu werden und wir Kinder lauschten ihm bewundernd. Er wollte ein Haus kaufen und eine eigene Waschmaschine. Meine Mutter war etwas pragmatischer veranlagt – was sie wahrscheinlich auch sein musste – und zerredete ihm seine Träumereien schon im Anfangsstadium.
Mein Vater hatte vor dem Mietshaus ein kleines Gärtchen hergerichtet. Wild wuchernde Blumen und da und dort eine versteckte Gurke oder ein Tomatenpflänzchen. Laut Hausordnung war es nicht erlaubt, Gemüse anzupflanzen, denn dieser Streifen Erde sollte der Freude des ganzen Mietblocks dienen. Meinem Vater tat dies im Herzen weh, denn die Erde war gut. Und dann hatte er eine marketingtechnisch grossartige Idee. Er liess gelbe Tomaten wachsen. Man kam aus dem ganzen Quartier, um diese damals exotischen Gewächse zu bewundern. Er schenkte allen Nachbarn, die das Nutzrecht auf diesen kleinen Garten hatten, so eine fremdländische Tomate und von nun an nahm der Gemüseteil immer mehr überhand, obwohl er auch einen eigenen Schrebergarten hatte und immer mit einem Korb Beeren, Bohnen oder grossen weissen Rettichen von dort nach Hause kam. Am Samstagabend – nach getaner Arbeit und dem wöchentlichen Bad – setzte sich die ganze Familie an den Küchentisch und ass den mit Salz bestreuten weissen Kolben. Heile-Welt-Geschmack.
Wir waren alle irgendwie arm oder zumindest nicht reich. Aber das war weiter kein Problem. In dieser Genossenschaftssiedlung lebten viele Kinder. Wir konnten einfach vor das Haus und miteinander spielen. Unsere Mütter gaben uns alte Leintücher und wir bauten riesige Zeltburgen. Rundum wurden neue Mietshäuser erstellt und wir kletterten nach Feierabend der Arbeiter in die noch unvollendeten Gebäude und spielten Räuber und Gendarm. Manchmal mussten wir uns ergeben, weil eine Treppe im Neubau noch nicht vorhanden war und wir in der Falle sassen. Oder wir rasten mit unseren Rollschuhen mit eisernen Rädern, die nur so funkten, durch die Gegend, spielten Himmel und Hölle, Gummitwist und steckten ausgediente Schreibfedern zusammen für eine Art Schreibfederboccia.
Die Mütter, die ganz in ihrem Haushalt aufgingen, schauten ab und zu aus dem Fenster. Aber da passierte nicht viel. Die Grossen kümmerten sich um die Kleineren, kein Auto fuhr vorbei und auch sonst gab es keine grossen Aufregungen. Einmal abgesehen von ein paar aufgeschürften Knien oder einer zerrissenen Hose.
Heute denke ich gerne an diese Zeit. Es war alles in Ordnung. Ich war so wie alle. Normalität ist Geborgensein. Ein nostalgisches Gefühl steigt in mir hoch. Fury- und Lassie-Sendungen am Fernsehen, Klappbetten in den kleinen Wohnungen flimmern durch meine Erinnerungen. Das Abendessen in der schmalen Küche. Der Abwasch mit meiner Schwester.
Wie man Kinder kriegt, davon sprach man in unseren Kreisen nicht. Auch nicht, als wir Mädchen bald die Regel haben sollten. Mein Vater war immer noch in meine Mutter verliebt und nahm sie ab und zu in die Arme. Meine Mutter wimmelte ihn entweder entschieden ab oder kicherte verlegen. «Dummes Zeug!»





























