
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine zarte Liebesgeschichte und eine verrückte, wilde Reise quer durch Amerika
Seit dem Tod ihres Vaters hat sich Amy völlig zurückgezogen. Als ob nicht alles schlimm genug wäre, beschließt ihre Mutter von Kalifornien an die Ostküste zu ziehen, und Amy soll nachkommen … im Auto mit einem wildfremden Jungen! Amy ist verzweifelt. Doch dann steht Roger vor ihr – total süß und irgendwie sympathisch. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und sind sich einig: Amys Mom hat sich für den Trip die langweiligste aller Strecken ausgesucht! Und so begeben sie sich kurzerhand auf eine eigene, wilde Reise kreuz und quer durch die Staaten. Und während Amy noch mit ihrer Vergangenheit kämpft, merkt sie, wie sehr sie diesen Jungen mag ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
DIE AUTORIN
Morgan Matson studierte Schreiben für junge Leser an der New School in New York. Roadtrips sind ihre große Leidenschaft und sie hat schon dreimal die USA mit dem Auto durchquert... bis jetzt. Zurzeit lebt sie in Los Angeles.
Inhaltsverzeichnis
Für meinen Vater
RAVEN ROCK HIGHSCHOOL
Raven Rock, Kalifornien
Jahreszeugnis
POSTEINGANG [email protected]
VON: Hildy Evans ([email protected]) AN: Amy Curry ([email protected]) BETREFF: Hausbesichtigung heute 16 Uhr DATUM: 1. Juni ZEIT: 10:34 Uhr
Hallo Amy,
wollte nur mitteilen, dass ich heute um 16 Uhr ein paar Interessenten das Haus zeigen werde. Nur damit Sie Bescheid wissen und zu dieser Zeit woanders sein können. Wie schon besprochen, wollen wir erreichen, dass die Interessenten sich das Haus als ihr neues Zuhause vorstellen können. Und da ist es einfach besser, wenn ich mit der Familie allein durchgehe!
Außerdem habe ich gehört, dass Sie bald zu Ihrer Mutter nach Connecticut fahren? Schließen Sie die Haustür einfach ab, ich habe ja einen Zweitschlüssel.
Allerbesten Dank!
Hildy
VON: Mom ([email protected]) AN: Amy Curry ([email protected]) BETREFF: Die Fahrt DATUM: 3. Juni ZEIT: 9:22 Uhr ANHANG: Routenplanung
Hallo Amy,
viele Grüße aus Connecticut! Schön zu hören, dass deine Prüfungen gut gelaufen sind. Toll, dass Candide ein Erfolg war. Du warst bestimmt wieder super, wie immer – schade, dass ich nicht dabei sein konnte!
Unglaublich, dass ich dich schon einen Monat nicht gesehen habe! Kommt mir viel länger vor. Ich hoffe, du warst nett zu deiner Tante. Es war wirklich lieb von ihr, sich um dich zu kümmern. Hoffentlich hast du dich bei ihr auch bedankt.
Auf der Fahrt wird bestimmt alles klargehen. Laut der Reiseroute (angehängt), die ich für euch ausgearbeitet habe, erwarte ich Roger und dich hier spätestens am 10. In den aufgelisteten Hotels habe ich jeweils Zimmer für euch reserviert. Übernachtungen, Essen und Benzin kannst du mit deiner Notfall-Kreditkarte bezahlen. Und seid bitte vorsichtig. Falls doch etwas sein sollte, findet ihr alle Informationen vom Automobilclub im Handschuhfach.
Ich weiß, dass du viel an deinen Bruder denkst. Er hat mir eine Mail geschickt – viele Grüße von ihm. In seiner Einrichtung darf man ihn zwar nicht anrufen, aber Mails abrufen kann er. Vielleicht schreibst du ihm ja demnächst mal.
Mom
Routenplanung
Start: Raven Rock, Kalifornien Erste Nacht: Gallup, New Mexico Zweite Nacht: Tulsa, Oklahoma Dritte Nacht: Terre Haute, Indiana Vierte Nacht: Akron, Ohio Ende: Stanwich, Connecticut
Anschließend fahre ich Roger zu seinem Vater nach Philadelphia. Bitte fahrt vorsichtig!
Eureka – I have found it. (Ich habe es gefunden.)
– Motto des Bundesstaates Kalifornien
Ich saß auf der Eingangstreppe unseres Hauses und sah zu, wie der beigefarbene Subaru Kombi zu schnell in unsere Sackgasse gefahren kam. Typischer Anfängerfehler, vor allem von FedEx-Fahrern. Im Raven Crescent gab es nämlich nur drei Häuser, und meistens waren die Leute schon am Ende angekommen, bevor sie es überhaupt gecheckt hatten. Weil Charlies Kifferfreunde sich das nie merken konnten, mussten sie immer noch eine Extrarunde drehen, ehe sie unsere Einfahrt erwischten. Aber der Subaru-Fahrer löste es anders – er bremste scharf und die Rücklichter leuchteten erst rot und dann weiß auf, als er einfach zurückstieß und direkt vor dem Haus hielt. Unsere Einfahrt war so kurz, dass ich die Aufkleber an der Stoßstange lesen konnte: MEIN SOHN WAR STUDENT DES MONATS und MEIN KIND UND MEINE $$$ GEHEN ANS COLORADO COLLEGE. Im Auto saßen zwei Leute und unterhielten sich, wobei sie sich allerdings nicht richtig ansehen konnten, weil sie noch angeschnallt waren.
In der Mitte unseres inzwischen ziemlich zugewucherten Rasens stand nun schon seit drei Monaten dieses Schild, das ich allmählich so abgrundtief hasste, dass es mich selbst manchmal beunruhigte. Das Schild gehörte einem Immobilienmakler und zeigte eine grinsende Frau mit toupierter Haarsprayfrisur. FOR SALE, stand auf dem Schild und darunter in noch größeren Buchstaben: Welcome HOME.
Was die Großbuchstaben sollten, habe ich mich von Anfang an gefragt und nie eine richtige Erklärung dafür gefunden. Ich bin nur so weit gekommen, dass man so was wahrscheinlich gerne liest, wenn man erwägt, in ein Haus einzuziehen. Blöd ist es halt nur, wenn man aus diesem Haus gerade ausziehen muss.
Nie im Leben hätte ich gedacht, dass auf unserem Rasen jemals so ein Immobilienschild stehen würde. Noch vor drei Monaten war mir mein Leben geradezu nervtötend normal vorgekommen. Wir wohnten in Raven Rock, einem Vorort von Los Angeles. Meine Eltern waren beide Dozenten am College of the West, einer kleinen Hochschule, zu der man von uns aus zehn Minuten mit dem Auto brauchte. Nahe genug also, um einen kurzen Arbeitsweg zu haben, aber auch weit genug weg, um nicht jeden Samstag die Saufgelage der Burschenschaftler mit anhören zu müssen. Mein Vater hat Geschichte unterrichtet (Bürgerkrieg und Reconstruction-Ära) und meine Mutter englische Literatur (Moderne).
Mein drei Minuten jüngerer Zwillingsbruder Charlie hatte bei seinen mündlichen Vorprüfungen an der Highschool ausgezeichnet abgeschnitten und hätte um ein Haar eine Anzeige wegen Drogenbesitz kassiert, wenn er nicht dem Bullen, der ihn deshalb hochnehmen wollte, erfolgreich eingeredet hätte, dass das Päckchen Gras in seinem Rucksack in Wirklichkeit eine seltene kalifornische Kräutermischung namens Humboldt und er selbst Lehrling an der Gastronomieschule Pasadena sei.
Ich hatte gerade angefangen, in den Theaterstücken an unserer Highschool Hauptrollen zu übernehmen, und dreimal mit Michael Young, Studienanfänger am College (Hauptfach noch unklar), rumgeknutscht. Mein Leben war zwar nicht gerade perfekt – meine allerbeste Freundin Julia Andersen war im Januar nach Florida umgezogen –, aber im Nachhinein betrachtet doch ziemlich super. Nur dass mir das damals nicht so klar war. Ich war immer davon ausgegangen, dass alles mehr oder weniger so bleiben würde.
Ich hielt Ausschau nach dem unbekannten Subaru, dessen mir ebenso unbekannte Insassen sich immer noch unterhielten, und dachte – nicht zum ersten Mal –, wie dämlich ich doch gewesen war. Und ein Teil von mir (der sich irgendwie immer nur dann meldete, wenn es schon spät war und vielleicht ein bisschen Schlaf für mich angebracht wäre) stellte die bohrende Frage, ob irgendwie ich selber das alles verursacht hatte, weil ich mir so sicher gewesen war, dass sich nie etwas ändern würde. Ganz abgesehen von meinen anderen Fehlern, die dazu geführt hatten.
Meine Mutter beschloss gleich nach dem Unfall, das Haus zu verkaufen. Charlie und ich wurden dabei nicht gefragt, sondern nur informiert. Nicht, dass es was gebracht hätte, Charlie zu fragen. Seit dem Unfall war er so ziemlich ununterbrochen auf Drogen. Bei der Beerdigung hatten alle ganz betroffen getuschelt, weil sie dachten, seine blutunterlaufenen Augen kämen vom vielen Heulen. Offenbar hatten die Leute alle schwerwiegende Nasenprobleme, denn bei Charlie roch man schon zehn Meter gegen den Wind, was los war. Schon seit der 7. Klasse musste er hin und wieder ordentlich abfeiern, und voriges Jahr war es heftiger geworden. Aber nach dem Unfall wurde es derart krass, dass der rauschfreie Charlie zu so einer Art Sagengestalt wurde, an die sich kaum noch jemand erinnern konnte. So ähnlich wie der Yeti.
Die Patentlösung für unsere ganzen Probleme, so befand meine Mutter, hieß Umzug. »Wir fangen noch mal ganz neu an«, hatte sie uns eines Abends beim Essen eröffnet. »An einem Ort, an dem nicht so viele Erinnerungen hängen.« Das Schild der Maklerfirma wurde gleich am nächsten Tag aufgestellt.
Wir sollten also nach Connecticut ziehen, in einen Bundesstaat, in dem ich noch nie gewesen war und auf den ich auch nicht sonderlich viel Bock hatte. Oder, wie mein Englischlehrer Mr Collins es formulieren würde, wohin ich nicht den Wunsch hegte, meinen Wohnsitz zu verlegen. Meine Großmutter wohnte zwar dort, aber sie war uns immer besuchen gekommen, da wir ja nun mal in Südkalifornien wohnten und sie eben in Connecticut. Und nun hatte meine Mutter vom Fachbereich Anglistik am Stanwich College ein Stellenangebot bekommen. Außerdem gab es dort in der Nähe eine megatolle Highschool, die wir ihrer Ansicht nach bestimmt ganz super finden würden. Das College war ihr bei der Wohnungssuche behilflich gewesen, und sobald für Charlie und mich das Schuljahr um war, würden wir allesamt dorthin ziehen, während die Maklerin mit dem Schild Welcome HOME unser bisheriges Haus verhökerte.
Das war zumindest der Plan. Aber einen Monat nachdem das Schild in unserem Garten aufgetaucht war, konnte selbst meine Mutter nicht mehr so tun, als ob sie nicht mitkriegen würde, was mit Charlie los war. Als Nächstes hat sie ihn dann von der Schule genommen und in einer Entzugsklinik für Jugendliche in North Carolina untergebracht. Unmittelbar danach ist sie nach Connecticut abgereist, weil sie dort am College schon ein paar Sommerkurse geben musste und sich »um alles kümmern« wollte. Zumindest war das ihre Begründung. Ich allerdings hegte den starken Verdacht, dass sie hauptsächlich weg von mir wollte. Sie konnte mich ja kaum noch richtig anschauen. Nicht, dass ich ihr das verübelte. Schließlich konnte ich mir an den meisten Tagen selber nicht ins Gesicht sehen.
Deshalb habe ich den letzten Monat allein in unserem Haus zugebracht, abgesehen von Hildy, der Maklerin, die ab und zu mit ein paar Interessenten auftauchte – und zwar meistens dann, wenn ich gerade aus der Dusche kam –, und von meiner Tante, die gelegentlich aus Santa Barbara herkam und kontrollierte, ob ich mich vernünftig ernährte und nicht heimlich Crystal Meth produzierte. Der Plan war simpel: Ich sollte das Schuljahr noch beenden und mich dann direkt nach Connecticut begeben. Einziges Problem war das Auto.
Die Leute im Subaru unterhielten sich immer noch, aber anscheinend hatten sie die Gurte inzwischen abgeschnallt, denn nun sahen sie sich an. Ich warf einen Blick zu unserer Doppelgarage, in der jetzt nur noch ein Auto stand – das einzige, das wir noch hatten. Es gehörte meiner Mutter und war ein roter Jeep Liberty. Sie brauchte ihn dringend in Connecticut, da es langsam ein Problem wurde, sich ständig den Uralt-Cadillac meiner Großmutter auszuborgen. Dadurch verpasste Oma nämlich immer wieder ihre Bridgerunden und sie hatte überhaupt kein Verständnis dafür, dass meine Mutter andauernd in irgendwelche Einrichtungsmärkte fahren musste. Vor einer Woche, am Donnerstagabend, hat mir meine Mutter dann mitgeteilt, wie sie das Autoproblem zu lösen gedachte.
Es war der Premierenabend unseres Frühjahrsmusicals Candide und zum ersten Mal wartete nach der Aufführung niemand im Foyer auf mich. Früher hatte ich meine Eltern und Charlie immer möglichst schnell abgewimmelt und war in Gedanken schon bei der Premierenparty, während ich ihre Blumen und Komplimente entgegennahm. Bis vor Kurzem hatte ich keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn nach der Vorstellung keiner auf einen wartet und sagt, wie toll er die Aufführung fand. Diesmal bin ich gleich mit dem Taxi nach Hause gefahren, ohne zu wissen, wo die Party überhaupt steigt. Die anderen Darsteller, mit denen ich noch vor drei Monaten eng befreundet gewesen war, alberten herum und quatschten, während ich stur meine Tasche packte und dann vor der Schule auf das Taxi wartete. Inzwischen hatte ich ihnen so oft gesagt, dass sie mich in Ruhe lassen sollen, dass sie das nun tatsächlich taten. Eigentlich nicht weiter überraschend. Ich hatte gelernt, dass sich die Leute ziemlich schnell zurückzogen, wenn man sie nur heftig genug vor den Kopf stieß.
Als das Telefon klingelte, stand ich gerade noch in voller Cunégonde-Maske in der Küche. Die angeklebten Wimpern juckten schon und der Song »Best of All Possible Worlds« ging mir nicht aus dem Kopf.
»Hallo, mein Schatz«, hörte ich meine Mutter gähnend sagen, als ich ranging. Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es in Connecticut schon fast ein Uhr nachts war. »Wie geht’s denn bei dir?«
Ich war kurz davor, ihr die Wahrheit zu sagen. Aber da ich das nun schon fast drei Monate nicht mehr gemacht hatte und ihr offenbar nichts aufgefallen war, kam es mir unsinnig vor, ausgerechnet jetzt damit anzufangen. »Gut«, war daher also die Antwort meiner Wahl. Ich stellte einen Rest Pizza Casa Bianca von gestern Abend in die Mikrowelle und schaltete auf Aufwärmen.
»Also, jetzt hör zu«, fing meine Mutter an, sodass bei mir sofort die Alarmglocken schrillten. So leitete sie immer Sachen ein, die für mich nicht gerade angenehm ausfielen. Außerdem redete sie verdächtig schnell. »Es geht um das Auto.«
»Das Auto?« Ich nahm die Pizza heraus und ließ sie auf einem Teller abkühlen. Ganz unbemerkt war dieser Teller von einem x-beliebigen zu dem Teller geworden, denn ich benutzte nur noch diesen und spülte ihn nach dem Essen immer gleich ab. Insofern war das ganze restliche Geschirr praktisch überflüssig geworden.
»Ja«, sagte sie und unterdrückte ein weiteres Gähnen. »Ich habe mich mal informiert, was es kosten würde, es mit dem Autotransporter liefern zu lassen. Dazu kämen noch deine Flugkosten, und na ja ...« Sie machte eine kurze Pause. »Das geht im Moment einfach nicht. Da das Haus noch nicht verkauft ist und Charlies Einrichtung ja auch einiges kostet ...«
»Ja, und was soll das jetzt heißen?«, fragte ich, weil ich ihr nicht ganz folgen konnte. Zögernd biss ich in meine Pizza.
»Beides zusammen können wir uns nicht leisten«, erklärte sie. »Und ich brauche das Auto. Deshalb muss es hierhergefahren werden.«
Obwohl die Pizza noch viel zu heiß war, schluckte ich den Bissen herunter und fühlte, wie es im Mund brannte und mir die Tränen kamen. »Aber ich kann das nicht machen«, antwortete ich, als ich wieder einigermaßen reden konnte. Seit dem Unfall hatte ich nicht mehr am Steuer gesessen und konnte mir auch nicht vorstellen, es bald wieder zu tun. Vielleicht auch nie mehr. Meine Kehle war wie zugeschnürt, aber ich zwang mich zu sagen: »Du weißt, dass ich das nicht kann.«
»Oh nein, du sollst ja auch nicht selber fahren!« Für jemanden, der eben noch gegähnt hatte, klang sie einen Tick zu aufgeräumt. »Marilyns Sohn fährt. Er muss sowieso an die Ostküste, weil er den Sommer bei seinem Vater in Philadelphia verbringt. Von daher passt das ganz prima.«
In diesem Satz blinkten so viele Fragezeichen auf, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte. »Marilyn?«, fragte ich also, um von vorn zu beginnen.
»Marilyn Sullivan«, antwortete sie. »Oder vermutlich inzwischen Marilyn Harper. Ich vergesse immer, dass sie nach der Scheidung wieder ihren Mädchennamen angenommen hat. Egal, meine Freundin Marilyn jedenfalls, die kennst du doch. Die Sullivans haben bis zu ihrer Scheidung gleich um die Ecke in der Holloway Road gewohnt, danach ist sie nach Pasadena gezogen. Du und Roger, ihr habt doch zusammen immer dieses Fangspiel gespielt. Wie hieß das noch mal? Arztschnappen? Krankenhausfangen?«
»Doktorfangen«, erwiderte ich, ohne nachzudenken. »Und wer ist Roger?«
Sie stieß einen ihrer langen Seufzer aus, um mir zu signalisieren, dass ich ihre Geduld arg strapazierte. »Marilyns Sohn«, sagte sie genervt. »Roger Sullivan. Den musst du doch noch kennen.«
Meine Mutter versuchte, mir ständig irgendwelche Sachen einzureden, an die ich mich angeblich erinnern sollte und die angeblich genau so gewesen waren. »Nein, keine Ahnung, wer das sein soll.«
»Natürlich erinnerst du dich an ihn. Du hast doch gerade selbst gesagt, dass ihr immer dieses Spiel gespielt habt.«
»Ich erinnere mich nur an das Doktorfangen«, brummte ich und fragte mich – nicht zum ersten Mal –, wieso Gespräche mit meiner Mutter eigentlich immer so nervig waren. »Von einem Roger weiß ich nichts. Und auch nicht von einer Marilyn.«
»Na dann«, entgegnete sie, krampfhaft um einen optimistischen Tonfall bemüht, »wirst du ihn eben jetzt kennenlernen. Ich habe für euch eine Reiseroute zusammengestellt. Ihr müsstet in etwa vier Tagen hier sein.«
Die Frage, wer sich hier an wen erinnerte, war plötzlich nebensächlich. »Warte mal kurz«, antwortete ich und hielt mich an der Küchentheke fest. »Du willst, dass ich vier Tage mit jemandem im Auto sitze, den ich überhaupt nicht kenne?«
»Ich hab dir doch gesagt, dass ihr euch kennt«, fauchte meine Mutter und machte damit deutlich, dass für sie das Thema erledigt war. »Und Marilyn sagt, er ist ein sehr netter Junge. Er tut uns damit einen großen Gefallen, bedenk das bitte.«
»Aber, Mom, ich ...«, begann ich und wusste nicht, was ich weiter sagen sollte. Vielleicht, dass ich es kaum noch ertragen konnte, im Auto zu sitzen. Mit dem Bus zur Schule und zurück zu fahren, ging einigermaßen, aber schon die Taxifahrt nach der Premiere hatte mir Herzrasen verursacht. Außerdem war ich inzwischen so ans Alleinsein gewöhnt, dass ich es gar nicht mehr so übel fand. Der Gedanke daran, eine derart lange Zeit mit einem fremden Menschen, egal ob nett oder nicht, im Auto zuzubringen, löste bei mir Schweißausbrüche aus.
»Amy«, sagte meine Mutter mit einem tiefen Seufzer. »Jetzt sei doch bitte nicht so schwierig.«
Natürlich würde ich nicht schwierig sein, das war schließlich Charlies Job. Ich war nie schwierig und darauf baute meine Mutter eben einfach. »Okay«, sagte ich leise und hoffte, dass sie mitbekam, wie schwer mir das fiel. Aber falls sie es überhaupt merkte, ignorierte sie es einfach.
»Gut.« Ihr munterer Ton war zurück. »Sobald ich die Zimmer reserviert habe, maile ich dir die Reiseroute. Ich habe dir auch noch ein Geschenk für die Fahrt bestellt. Es müsste eigentlich vor deiner Abreise ankommen.«
Mir fiel ein, dass meine Mutter nicht einmal gefragt hatte. Ich sah auf die Pizza vor mir, aber der Appetit war mir vergangen.
»Ach so, ja«, fügte sie endlich hinzu, »wie war denn eigentlich die Aufführung?«
Und jetzt war das Musical längst Geschichte, die Prüfungen geschafft und in der Einfahrt stand ein Subaru mit Roger, diesem Doktorfangen-Spieler. Die ganze Woche hatte ich gegrübelt, ob ich mich vielleicht doch an einen Roger erinnern konnte. Dabei fiel mir ein Nachbarsjunge mit blonden Haaren und Segelohren ein, der einen rotbraunen Ball an sich presste und uns zurief, ob wir nicht zusammen spielen wollen. Charlie wusste bestimmt noch mehr, denn trotz seiner schrägen Hobbys hatte er ein unglaublich gutes Gedächtnis. Aber Charlie war gerade nicht direkt greifbar.
Beide Autotüren öffneten sich, und eine Frau, ungefähr im Alter meiner Mutter – vermutlich also Marilyn –, stieg aus, gefolgt von einem großen, eher schlaksigen Typen. Ich sah ihn nur von hinten, als Marilyn die Heckklappe öffnete und eine vollgestopfte armymäßige Reisetasche und einen Rucksack herausholte. Nachdem sie die Sachen abgestellt hatte, umarmten sich die beiden. Der Typ – höchstwahrscheinlich Roger – war mindestens einen Kopf größer als sie und musste sich zum Umarmen ein bisschen zu ihr hinunterbeugen. Ich rechnete mit einer ausgedehnten Abschiedsszene, doch ich hörte nur, wie er ihr zurief: »Und meld dich mal.« Marilyn lachte, als ob sie das erwartet hätte. Nachdem sie sich getrennt hatten, bemerkte sie meinen Blick und lächelte mir zu. Ich nickte zurück und sie stieg ins Auto. Als sie in unserer Sackgasse wendete, sah Roger ihr nach und hob noch einmal grüßend die Hand.
Nachdem das Auto weggefahren war, warf er sich sein Gepäck über die Schulter und kam auf das Haus zu. Als er sich zu mir herumgedreht hatte, musste ich zweimal hinsehen. Die Segelohren waren verschwunden. Der Typ, der da auf mich zukam, sah erschreckend gut aus. Er hatte breite Schultern, hellbraune Haare, dunkle Augen und lächelte mich an.
Mir war schlagartig klar, dass das die Fahrt ein ganzes Stück komplizierter machte.
But I think it only fair to warn you, all those songs about California lied.
– The Lucksmiths
Ich stand auf und ging die Treppe hinunter, um ihn zu begrüßen. Dabei wurde mir plötzlich bewusst, dass ich barfuß war, eine uralte Jeans und das Musical-Shirt vom vorigen Jahr anhatte – mein Standard-Outfit, das ich am Morgen, ohne nachzudenken, angezogen hatte. Natürlich ohne den leisesten Gedanken daran, dass dieser Roger-Typ so unanständig süß sein könnte.
Und das war er in der Tat, wie ich bei näherer Betrachtung feststellte. Er hatte große braune Augen, regelrecht verboten lange Wimpern, ein paar Sommersprossen und strahlte entspanntes Selbstvertrauen aus. Ich merkte, wie ich in seiner Gegenwart immer kleiner wurde.
»Hi«, sagte er, stellte seine Taschen ab und streckte mir die Hand entgegen. Ich stutzte kurz – in meiner Umgebung begrüßte sich kein Mensch mit Handschlag –, schüttelte ihm dann aber doch kurz die Hand. »Ich bin Roger Sullivan. Du bist Amy, oder?«
Ich nickte. »Jo.« Das Wort klebte mir ein bisschen in der Kehle, sodass ich mich erst mal räuspern musste. »Also, ich meine, ja. Hallo.« Ich verknotete die Hände ineinander und sah zu Boden. Dabei klopfte mir das Herz bis zum Hals, und ich fragte mich, wann eine simple Begrüßung sich in etwas derart Ungewohntes und Einschüchterndes verwandelt hatte.
»Du siehst ganz anders aus«, sagte Roger nach einer Weile, woraufhin ich aufsah und feststellte, dass er mich ausführlich musterte. Was wollte er denn damit nun wieder sagen? Anders als erwartet? Wie sahen denn seine Erwartungen aus?
»Anders als früher«, erklärte er, als ob er meine Gedanken gelesen hätte. »Ich erinnere mich noch an dich, als wir klein waren, an dich und deinen Bruder. Aber die roten Haare hast du immer noch.«
Verlegen griff ich mir an den Kopf. Charlie und ich hatten früher die gleiche Haarfarbe gehabt, was uns die Leute ständig unter die Nase reiben mussten – als ob wir das nicht selber mitgekriegt hätten. Im Laufe der Jahre waren Charlies Haare dann dunkler geworden, eher kastanienbraun, während meine feuerrot geblieben waren. Bis vor Kurzem war mir das egal gewesen. In letzter Zeit erregte ich damit aber offenbar Aufmerksamkeit, und das war nun wirklich das Letzte, was ich gerade gebrauchen konnte. Ich klemmte mir die Haare hinter die Ohren und bemühte mich, nicht dran zu ziehen. Vor ungefähr einem Monat hatten sie nämlich angefangen auszufallen, was mir gar nicht gefiel, aber ich versuchte, nicht allzu viel dran zu denken. Ich sagte mir, das komme vom Prüfungsstress oder vom Eisenmangel aufgrund meiner stark pizzalastigen Ernährung. Aber meistens versuchte ich einfach, mir die Haare nicht so oft zu bürsten, in der Hoffnung, dass es von alleine wieder aufhören würde.
»Oh«, sagte ich, als ich merkte, dass Roger auf eine Reaktion von mir wartete. Anscheinend waren mir selbst die banalsten Gesprächsregeln entfallen. »Äh, ja. Genau, die roten Haare. Die von Charlie sind jetzt ein bisschen dunkler, aber er ist... also ... gerade nicht da.« Meine Mutter hatte keinem etwas von Charlies Entzug gesagt und mir ans Herz gelegt, stattdessen die von ihr erfundene Geschichte zu erzählen. »Er ist in North Carolina«, fügte ich daher hinzu. »Bei einem Sommerkurs.« Ich presste die Lippen zusammen, wandte den Blick ab und wünschte mir, dass er einfach verschwinden würde, damit ich wieder ins Haus konnte, wo keiner versuchte, sich mit mir zu unterhalten und wo ich allein war. Ich war total aus der Übung, was Unterhaltungen mit süßen Jungs anging. Überhaupt war ich es nicht mehr gewohnt, mit irgendwem zu reden.
Direkt nachdem es passiert war, habe ich kaum etwas gesagt. Ich wollte nicht darüber sprechen und auch nicht gefragt werden, wie ich mit allem klarkam. Meine Mutter oder Charlie haben es dann auch gar nicht erst versucht. Vielleicht haben die beiden ja miteinander geredet, aber was mich anging, war totale Funkstille. Was nachvollziehbar war – schließlich haben sie mir bestimmt die Schuld daran gegeben. Und ich selber ja auch, von daher war es nicht verwunderlich, dass wir am Küchentisch nicht gerade unsere Gefühle voreinander ausgebreitet haben. Also ging es beim Essen meistens ziemlich schweigsam zu, und Charlie war entweder verschwitzt und hibbelig oder schwankte mit glasigem Blick vor sich hin, während meine Mutter stur auf ihren Teller starrte. Das Hin- und Herreichen von Schüsseln und Beilagen und das anschließende Schneiden und Kauen kostete derart viel Zeit und Konzentration, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, wie wir uns früher dabei auch noch unterhalten konnten. Und wenn ich gelegentlich doch etwas sagen wollte, machte der leere Stuhl links neben mir den Impuls sofort zunichte.
In der Schule riefen mich die Lehrer im ersten Monat danach ganz bewusst nicht auf, und irgendwann hatten sie sich wohl so daran gewöhnt, dass sie mich auch weiterhin in Ruhe ließen. Offenbar können die Leute das Bild, das sie von jemandem haben, ziemlich schnell ändern, sodass sich anscheinend keiner von ihnen mehr daran erinnerte, wie oft ich mich früher gemeldet und zu Sachen wie dem chinesischen Boxeraufstand oder dem Symbolismus in Fitzgeralds Roman The Great Gatsby meinen Senf dazugegeben hatte.
Meine Freunde begriffen in null Komma nichts, dass ich nicht darüber reden wollte. Und da wir nicht darüber sprachen, merkten wir bald, dass wir eigentlich über gar nichts mehr reden konnten. Also gaben wir derartige Versuche schnell wieder auf, und nach einer Weile wusste ich nicht mehr, ob ich ihnen aus dem Weg ging oder sie mir.
Einzige Ausnahme war Julia. Ihr hatte ich nicht erzählt, was passiert war. Mir war klar, dass sie mich damit nicht so einfach davonkommen lassen und bestimmt verdammt hartnäckig sein würde. Und so war es auch. Natürlich hatte sie es trotzdem rausgefunden und mich danach ständig angerufen. Aber ich habe sie immer nur auf die Mailbox sprechen lassen. Irgendwann wurden ihre Anrufe weniger, aber stattdessen schrieb sie mir massenhaft Mails. Alle paar Tage kamen Nachrichten mit Betreffzeilen wie »Wollte mal hören«, »Mache mir Sorgen« oder »Verdammt noch mal, Amy!«. Sie stauten sich ungelesen in meinem Posteingang. Ich weiß gar nicht so genau, wieso ich das machte, doch ich hatte das Gefühl, wenn ich mit Julia darüber redete, würde alles irgendwie so real werden, dass ich es nicht aushalten könnte.
Während ich Roger anschaute, wurde mir klar, dass ich schon ewig nichts mehr mit Jungs zu tun gehabt hatte. Das letzte Mal war am Abend nach der Beerdigung, als ich Michael mit eindeutigen Absichten in seinem Wohnheimzimmer besucht hatte. Als ich eine Stunde später wieder verschwand, war ich ziemlich enttäuscht, obwohl ich genau das bekommen hatte, was ich zu wollen glaubte.
»Du weißt aber schon, dass das nicht stimmt«, unterbrach Roger meine Gedanken. Verständnislos sah ich ihn an und versuchte herauszufinden, was er meinte. »Dein T-Shirt«, sagte er und zeigte darauf. Ich sah an mir herunter. Auf der verwaschenen blauen Baumwolle stand: Anyone can whistle. »Ich kann jedenfalls nicht pfeifen«, fuhr er gut gelaunt fort. »Hab ich nie hingekriegt.«
»Ist ein Musical«, erklärte ich knapp. Er nickte und dann breitete sich Schweigen aus. Mir fiel nichts mehr ein, was ich noch zu diesem Thema sagen konnte. »Ich geh mal meine Sachen holen«, murmelte ich und fragte mich besorgt, wie um alles in der Welt wir diese vier Tage überstehen sollten.
»Klar«, antwortete er. »Ich pack mein Zeug schon mal rein. Soll ich dir was helfen?«
»Nee«, rief ich, schon auf der Treppe. »Das Auto ist offen.« Dann floh ich ins Haus, wo es angenehm kühl und dunkel war und ich allein sein konnte. Ich holte tief Luft, genoss die Stille und ging in die Küche.
Auf dem Esstisch lag das Geschenk, das mir meine Mutter geschickt hatte. Es war vor ein paar Tagen angekommen, aber ich hatte es noch nicht aufgemacht. Es auszupacken bedeutete ja irgendwie, dass die Fahrt tatsächlich stattfinden würde. Aber jetzt gab es sowieso kein Zurück mehr. Der lebendige Beweis dafür gab Kommentare zu meinem T-Shirt ab und packte gerade seine Sachen ins Auto. Also riss ich die Verpackung auf und förderte ein Buch zutage. Es war schwer, hatte Spiralbindung und einen dunkelblauen Einband. Away You Go!, stand vorn drauf in weißer Fünfzigerjahre-Schrift. Und darunter: Reisebegleiter. Tagebuch / Scrapbook / praktische Tipps.
Ich nahm es in die Hand und blätterte darin. Es hatte hauptsächlich weiße Seiten mit einem Scrapbook-Teil, wo man irgendwelche »bleibenden Erinnerungen« unterbringen konnte, und einen Tagebuchteil für schriftliche Reiseerinnerungen. Außerdem gab es Rätsel, Packlisten und Reisetipps. Ich klappte das Buch wieder zu und beäugte es skeptisch. Das sollte also allen Ernstes das »Geschenk« sein, das mir meine Mutter für die Reise geschickt hatte?
Ich knallte es auf die Küchentheke. Sie wollte mir doch nicht etwa einreden, dass diese Fahrt irgendwas mit Spaß oder Abenteuer zu tun hätte? Das war eine reine Zweckreise, zu der ich da gezwungen war. Ich konnte keinen einzigen Grund erkennen, wieso ich mich daran noch ewig lange erinnern sollte. Kein Mensch kauft sich doch zum Beispiel Souvenirs von einem Flughafen, an dem man mal eben kurz zwischengelandet ist.
Ich ging noch einmal durch die Räume im Erdgeschoss und kontrollierte, ob alles in Ordnung war. Aber das ging schon klar, dafür hatte Immobilien-Hildy schon gesorgt. Da sie nicht gern leere Häuser verkaufte, standen unsere ganzen Möbel noch drin. Aber alles war mir schon ganz fremd geworden. Seit sie von meiner Mutter als Maklerin beauftragt worden war, hatte sie komplett die Regie über unser Haus übernommen. Mittlerweile konnte ich mich kaum noch daran erinnern, wie es war, als wir noch alle zusammen hier gewohnt hatten und kein Mensch daran dachte, dass hier mal fremde Leute glücklich werden wollten. Es kam mir inzwischen nicht mehr vor wie ein Haus zum Wohnen, sondern eher wie eine Kulisse. Zu viele verzückte, frisch verheiratete Paare waren schon hindurchgerauscht und hatten sich nur für solche Sachen wie Wohnfläche und Lüftung interessiert und unser Haus mit ihren Einrichtungsideen und Heile-Welt-Träumen zugeschüttet. Jedes Mal, wenn Hildy mit einer Besichtigung fertig war und ich von meiner iPod-Wanderung durch die Siedlung mit Sondheim-Musicals im Ohr zurückkommen durfte, hatte sich unser Haus wieder ein Stück weiter von mir entfernt. Fremder Parfümgeruch lag in der Luft, Sachen waren am falschen Platz gelandet, und wieder hatten sich ein paar mit diesen vier Wänden verbundene Erinnerungen verflüchtigt.
Ich ging die Treppe hoch in mein Zimmer, das inzwischen nichts mehr mit jenem Reich zu tun hatte, in dem ich mein ganzes bisheriges Leben verbracht hatte. Stattdessen war es der reinste Girlie-Traum geworden – mit sorgfältig arrangierten Bücherstapeln, alphabetisch sortierten CDs und hübsch ordentlich gefalteten Klamotten. Es hatte sich in »Amy!s« Zimmer verwandelt – picobello aufgeräumt, total unpersönlich und wahrscheinlich die perfekte Ergänzung zu dem adretten Fantasiemädchen, das darin wohnte. Amy! versorgte bestimmt etliche Sportmannschaften ständig mit selbst gebackenem Kuchen und war vermutlich eine begeisterte Cheerleaderin, die nie darüber nachdachte, wie sinnlos Sport eigentlich war, oder jemals das Bedürfnis nach bittersüßen Liebesschnulzen hatte. Amy! passte bestimmt supergern auf die hinreißenden Racker in der Nachbarschaft auf, lächelte auf allen Klassenfotos gleichmäßig bezaubernd und war überhaupt die Wunschtochter sämtlicher Eltern. Sie hätte auch hundertprozentig mit dem süßen Typen in der Einfahrt ganz entspannt gescherzt und geflirtet, anstatt schon beim kleinsten Gespräch derart grandios zu versagen und dann abzuhauen. Und außerdem hatte Amy! höchstwahrscheinlich in letzter Zeit niemanden umgebracht.
Mein Blick fiel auf meinen Nachttisch, wo außer meinem Wecker nur ein schmales Taschenbuch mit dem Titel Food, Gas, and Lodging lag. Es war das Lieblingsbuch meines Vaters – dieses zerlesene Exemplar hatte er mir zu Weihnachten geschenkt. Nach dem Auspacken war ich erst einmal enttäuscht gewesen, weil ich eigentlich auf ein neues Handy gehofft hatte. Natürlich hatte er mitgekriegt, dass sich meine Freude über sein Geschenk stark in Grenzen hielt. Nun grübelte ich um drei Uhr morgens darüber nach, wie sehr ich ihn damit gekränkt hatte, und an Schlaf war dann nicht mehr zu denken.
Ich war nie über die Titelseite hinausgekommen. Als Widmung hatte er mir hineingeschrieben: Für meine Amy – dieses Buch hat mich auf vielen Reisen begleitet. Hoffentlich magst du es genauso wie ich. In Liebe, Benjamin Curry (dein Vater). Und dann lag es auf meinem Nachttisch herum, ohne dass ich es je wieder aufgeschlagen hätte. Bis vor ein paar Wochen – da hatte ich es endlich angefangen zu lesen. Und jetzt fragte ich mich bei jedem Umblättern, weshalb ich es mir nicht schon vor Monaten vorgenommen hatte. Ich kam allerdings nur bis Seite 61, denn bei Seite 62 steckte ein Karteikärtchen, auf dem mein Vater sich Notizen zum Sekretär von Abraham Lincoln gemacht hatte, über den er für ein Buch recherchiert hatte. Aber die Karte steckte nur als Lesezeichen in dem Roman. Beim letzten Mal war er also nur bis Seite 62 gekommen. Irgendwie brachte ich es nicht fertig, umzublättern und weiterzulesen.
Ich wusste immer noch nicht, was Walter da noch sah, und hatte keine Ahnung, ob ich es je erfahren würde. Aber ich wollte das Buch keinesfalls hierlassen. Ich nahm es also an mich und schob es vorsichtig in meine Handtasche. Nach einem letzten Blick durch das Zimmer schaltete ich das Licht aus, zog meinen Rollkoffer in den Flur und machte die Tür hinter mir zu. Es war ein ziemlich gutes Gefühl, dieses Zimmer nicht mehr sehen zu müssen. In den letzten vier Wochen hatte ich mich kaum darin aufgehalten, sondern meistens unten auf dem Sofa geschlafen und mir nur ab und zu Sachen von oben geholt. Ansonsten erinnerte mich alles viel zu sehr an mein Leben davor. Ich hatte ja immer noch nicht so ganz kapiert, wie plötzlich alles in meinem Leben anders sein konnte und wie sich alles in ein Danach verwandelte, während die Bilder an meinen Wänden und das ganze überflüssige Zeug ganz hinten in meinem Schrank gleich blieben. Außerdem würde ich sowieso niemals so werden wie die von Hildy erfundene Amy!, der mein Zimmer nach der Umräumaktion nun gehörte.
Ich wollte gerade meinen Koffer die Treppe hinunterbefördern, blieb aber noch einmal stehen und schaute zum anderen Ende des Flures, wo das Schlafzimmer meiner Eltern lag. Ich hatte es nicht mehr betreten, seit ich am Morgen vor der Beerdigung in der Tür gestanden war, damit meine Mutter mir sagen konnte, ob das schwarze Kleid okay war.
Ich ging den Flur entlang, an Charlies Zimmer vorbei, das direkt neben meinem lag. Die Tür zu Charlies Zimmer war geschlossen geblieben, seit meine Mutter sie vor vier Wochen hinter sich zugeknallt hatte, nachdem sie Charlie buchstäblich herausgezerrt hatte. Ich öffnete die Tür zum Elternschlafzimmer und blieb auf der Schwelle stehen. Obwohl es jetzt aufgeräumter aussah als früher, wirkte es wenigstens noch ansatzweise vertraut, mit dem ordentlich gemachten Doppelbett und den Bücherstapeln auf beiden Nachttischen. Auf der Seite meines Vaters lagen dicke historische Biografien und dazwischen schmale Krimibändchen, die allesamt langsam einstaubten. Hastig wandte ich mich ab und musste mich regelrecht zwingen, Luft zu holen. Ich fühlte mich, als würde mir unter Wasser der Sauerstoff ausgehen, und wusste genau, dass ich hier rausmusste. Die Tür von Dads Kleiderschrank stand offen, sodass ich den Krawattenhalter sehen konnte, den Charlie ihm in der Fünften mal im Werkunterricht gebaut hatte. Seine Krawatten hingen immer noch daran, allesamt vorgeknotet, um morgens Zeit zu sparen.
Die in mir aufsteigende Panik niederkämpfend, kehrte ich der väterlichen Seite des Zimmers den Rücken und ging hinüber zur Frisierkommode meiner Mutter. Einem Impuls folgend, zog ich die oberste Schublade – Socken und Strümpfe – auf und griff ganz nach hinten links. Obwohl das Fach leerer war als sonst, brauchte ich ein Weilchen, bis ich es fand. Aber als meine Finger etwas Glattes aus Plastik umschlossen, wusste ich, dass mein Bruder recht gehabt hatte. Ich nahm es heraus und sah, dass es eine alte eiförmige Strumpfhosendose war. Der goldene Aufdruck L’EGGS löste sich teilweise ab. Ich machte das Ei auf und sah, dass es, wie von Charlie versprochen, prall mit Geld gefüllt war.
Charlie meinte, dass er es irgendwann letztes Jahr entdeckt hatte – wie oder warum, wollte ich lieber gar nicht wissen. Aber im Hinterkopf war mir schon bewusst, wie verzweifelt er gewesen sein muss, wenn er das Geld gefunden hat, das meine Mutter in ihrem Sockenfach versteckt hatte. Ungefähr zu dieser Zeit begriff ich auch, wie fertig er eigentlich war. Charlie hatte mir versichert, dass er dieses Geld nur im äußersten Notfall antastete und immer so bald wie möglich wieder zurücklegte, da Mom es sonst sicher gemerkt hätte. Es waren immer 600 Dollar, hauptsächlich Hunderter-und Fünfzigerscheine. Vielleicht war Charlie am Ende ja so sehr neben der Spur, dass es ihm egal war, oder er hatte einfach keine Zeit mehr zum Auffüllen gehabt, ehe er sich in einem Flieger nach North Carolina wiederfand – jedenfalls waren jetzt nur noch 400 Dollar da.
Ich hörte, wie unten die Tür klappte. Wahrscheinlich wunderte sich Roger, wieso ich so lange brauchte, um meinen Koffer zu holen. Ohne weiter darüber nachzudenken, steckte ich das Geld ein, klappte das Ei zu und legte es zurück an seinen Platz. Innerlich spulte ich schon ein paar Rechtfertigungen ab – schließlich konnte man diesen Besichtigern und Immobilienfuzzis ja nicht über den Weg trauen. Ich wollte doch nur helfen. Aber natürlich war das nicht der wahre Grund, weshalb ich mir das Geld genommen hatte. Doch was war es dann?
Ich schob den Gedanken erst einmal beiseite und beeilte mich, aus dem Zimmer zu kommen. Nachdem ich die Tür hinter mir zugemacht hatte, ging ich die Treppe hinunter und schleifte meinen Koffer hinter mir her. Als ich in die Küche kam, stand Roger dort und starrte den Kühlschrank an. Während ich meinen Koffer auf dem Treppenabsatz parkte, drehte er sich zu mir um.
»Reisefertig?«, fragte er.
»Jep«, antwortete ich, fragte mich allerdings sofort, wieso ich anfing, wie ein Cowboy zu reden. Ich beförderte den Koffer in Richtung Tür und schaute wieder zu Roger, der immer noch in der Küche stand. Er studierte immer noch den Kühlschrank, was mir Gelegenheit verschaffte, ihn ausführlich zu mustern. Er war groß und erfüllte die Küche, in der es in letzter Zeit immer so leer gewesen war, spürbar mit seiner Gegenwart. Meine Mutter hatte mir erzählt, dass er 19 war und gerade sein erstes Jahr am College hinter sich gebracht hatte. Aber er hatte etwas an sich, wodurch er irgendwie älter wirkte – oder ich mir jünger vorkam. Vielleicht lag es ja am Handschlag.
»Die sind ja toll«, meinte Roger und zeigte auf den Kühlschrank.
»Hm, ja«, antwortete ich und ging in die Küche, denn er meinte die Magnete. Am Kühlschrank hingen unzählige davon – wesentlich mehr, als wir eigentlich brauchten, um Flyer von Thai-Lieferdiensten und Einkaufszettel daran zu befestigen. Sie stammten alle aus verschiedenen Städten, Bundesstaaten oder Ländern. Meine Eltern hatten auf ihrer Hochzeitsreise mit dem Sammeln angefangen und es bis vor Kurzem beibehalten, als meine Mutter vor ein paar Monaten einen Vortrag bei einer Konferenz in Montana hielt. Von dort hatte sie einen himmelblauen rechteckigen Magneten mit dem Aufdruck BIG SKY COUNTRY mitgebracht.
»Meine Eltern ...« Ich hörte, wie meine Stimme bei diesem Wort einknickte. Worte, die für mich so selbstverständlich gewesen waren, hatten sich plötzlich in böse Fallstricke verwandelt, über die ich immer wieder stolperte. Roger hatte sich wieder dem Kühlschrank zugewandt und tat so, als habe er nichts gemerkt. »Sie«, fügte ich dann hinzu, »äh ... haben so was gesammelt. Von allen Orten, an denen sie mal waren.«
»Wow«, sagte er und trat einen Schritt zurück, um den Kühlschrank wie ein Kunstwerk in seiner ganzen Schönheit zu betrachten. »Voll beeindruckend. Ich bin noch nie irgendwo gewesen.«
»Echt wahr?«, fragte ich erstaunt.
»Echt wahr«, antwortete er, ohne den Blick vom Kühlschrank abzuwenden. »Nur Kalifornien und Colorado. Ganz schön mager, was?«
»Nee, wieso denn? Ich bin bisher auch kaum aus Kalifornien rausgekommen.«
Das war mir eigentlich derart peinlich, dass ich es außer Julia noch nie jemandem erzählt hatte. Ich hatte unser Land exakt ein Mal verlassen, als wir einen total verregneten Sommer in den Cotswolds in England verbrachten, wo meine Mutter für ein Buch recherchieren musste. Immer wenn ich mich beschweren wollte, hat mir meine Mutter erklärt, dass wir in andere Staaten reisen würden, sobald wir alles besichtigt hätten, was es in Kalifornien zu sehen gab.
»Ach, du auch nicht?« Roger grinste mich an, woraufhin ich sofort und ganz automatisch meine Füße anstarren musste. »Na, da bin ich ja beruhigt. Ich rechtfertige das immer damit, dass Kalifornien ziemlich groß ist. Deutlich blöder wäre es zum Beispiel, wenn man noch nie über New Jersey hinausgekommen wäre oder so.«
»Ich dachte eigentlich ...«, fing ich an und bereute es augenblicklich. Eigentlich wollte ich die Antwort ja gar nicht wissen, wieso fragte ich also? Aber da ich nun schon mal angefangen hatte, räusperte ich mich und beendete meine Frage: »Also, meine Mutter hat mir erzählt, dass dein Vater in Philadelphia lebt und du diese Fahrt hier deshalb machst.«
»Ja, das stimmt«, antwortete Roger. »Ich bin halt bloß noch nie dort gewesen. Er kommt ein paarmal im Jahr her, wenn er beruflich hier zu tun hat.«
»Aha«, sagte ich. Ich sah zu ihm hoch und stellte fest, dass er immer noch den Kühlschrank fixierte. Während ich ihn beobachtete, veränderte sich plötzlich sein Gesichtsausdruck, und ich vermutete, dass er gerade den Programmzettel entdeckt hatte, der links unten hinter dem Magneten ITHACA IS GORGES! klemmte. Jedes Mal, wenn ich an den Kühlschrank ging, hatte ich versucht, nicht hinzusehen – ohne Erfolg. Aber ihn abzunehmen hatte ich irgendwie auch nicht fertiggebracht.
Er war auf beigefarbenen Karton gedruckt und vorn war ein Foto von meinem Vater darauf, das jemand mal im Unterricht von ihm gemacht hatte. Es war zwar schwarz-weiß, aber man konnte erkennen, dass er die Krawatte mit den kleinen schlappohrigen Hunden trug, die ich ihm zum letzten Vatertag geschenkt hatte. Er lachte an der Kamera vorbei und hatte Kreidestaub an den Händen. Unter dem Bild stand: BENJAMIN CURRY: EIN ERFÜLLTES LEBEN.
Roger schaute zu mir herüber, und ich wusste, dass er gleich eine Variante des immer gleichen Satzes von sich geben würde, den ich in den letzten drei Monaten ständig zu hören bekam. Dass es ihm schrecklich leidtäte. Wie tragisch das doch alles war. Dass er gar nicht wusste, was er sagen sollte. Ich wollte es einfach nicht mehr hören. All diese Worte halfen kein bisschen weiter, doch wie hätte er das verstehen können?
»Wir sollten jetzt los«, sagte ich deshalb, um ihm zuvorzukommen. Ich griff nach dem Henkel meines Koffers, aber bevor ich ihn anheben konnte, stand Roger schon neben mir und nahm ihn mir aus der Hand.
»Den nehm ich schon mal mit«, verkündete er und trug ihn zur Haustür hinaus. »Ich warte im Auto.« Dann klappte die Tür, und ich sah mich hektisch in der Küche um, auf der Suche nach etwas, mit dem ich den Moment hinauszögern konnte, von dem an wir beide vier Tage zusammen im Auto zubringen mussten. Ich nahm den Teller, den ich zum Trocknen in den leeren Geschirrspüler gestellt hatte, räumte ihn in den Schrank und machte die Tür zu. Als ich gerade gehen wollte, sah ich das Reisealbum, das noch auf dem Tisch lag.
Eigentlich hätte ich es dort liegen lassen können. Aber ich entschied mich anders. Ich nahm es, dann zog ich spontan den Programmzettel hinter dem Ithaca-Magneten hervor und legte ihn in den Scrapbook-Teil. Danach machte ich das Küchenlicht aus, ging zur Haustür hinaus und schloss sie hinter mir zu.
California is a garden of Eden, a paradise to live in or see. But believe it or not, you won’t find it so hot, if you ain’t got the do-re-mi.
– Woody Guthrie
Ich stieg auf der Beifahrerseite ein und zog die Tür zu. Roger saß schon auf dem Fahrersitz und bewegte ihn langsam erst hoch und runter und dann vor und zurück, um die optimale Position zu finden. Offensichtlich hatte er es inzwischen geschafft, denn er hörte auf mit der Rumstellerei. »Kann’s losgehen?« , fragte er, während er mit den Händen auf das Lenkrad trommelte und mich angrinste.
ENDE DER LESEPROBE
cbj ist der Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House
1. Auflage Erstmals als cbj Taschenbuch Mai 2012
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform © 2012 für die deutschsprachige Ausgabe cbj, München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © 2010 by Morgan Matson Published by Arrangement with Morgan Matson Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen. Die amerikanische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Amy & Roger’s Epic Detour« bei Simon & Schuster, New York. Übersetzung: Franka Reinhart Kartenmaterial: Map Resources; Sonnenblume Bild 1: iStockphoto/Andrew Perdue; Elvis: Bild 2: iStockphoto/Lise Gagne; Postkarte: Bild 3: iStockphoto/Julia Kotowski Alle restlichen Bilder stammen von der Autorin. Umschlaggestaltung: Zeichenpool, München, unter Verwendung des Originalmotivs (Foto: © Gettyimages /Image Source/RF) im ∙ Herstellung: cb Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
eISBN 978-3-641-08585-8
www.cbj-verlag.de
www.randomhouse.de

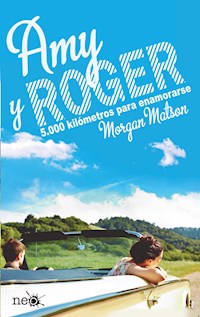


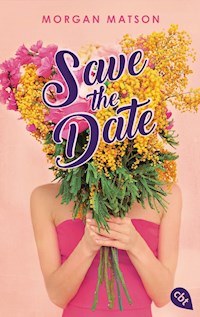












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











