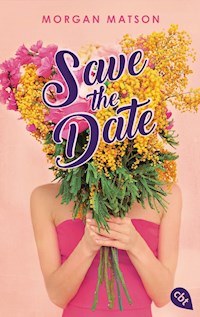
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine Hochzeit, die Liebe und andere Katastrophen
Charlies große Schwester heiratet. Charlie kann es kaum erwarten, dass alle ihre Geschwister noch einmal wie früher unter einem Dach versammelt sind, bevor die Eltern das Haus verkaufen. Noch ein unbeschwertes, fröhliches letztes Wochenende mit der Familie! Die Entscheidung für ein College, das Wiedersehen mit ihrem Kindheitsschwarm Jesse Foster – das alles kann warten. Jetzt zählt für Charlie nur, dass das Wochenende perfekt wird. Doch das Wochenende steuert eher auf ein vollkommenes Desaster zu …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 631
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
MORGAN MATSON
Save the Date
Aus dem amerikanischen Englisch
von Franka Reinhart
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Morgan Matson
Published by Arrangement with 19 STORIES PRODUCTION, INC.
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel
»Save the Date« bei Simon & Schuster Books for Young Readers,
an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division,
1230 Avenue of the Americas, New York, New York 10020.
© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe
cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Aus dem amerikanischen Englisch von Franka Reinhart
Innenillustration: © 2018 by Eric Sailer
Umschlaggestaltung: Kathrin Schüler, Berlin
Umschlagmotiv: © Shutterstock (Evgeniya Porechenskaya)
kk · Herstellung: MJ
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-23805-6V001
www.cbj-verlag.de
In memoriam Amanda Mierzwa
Familie Grant
Eleanor Sheridan Grant und Jeffrey Grant
Sheridan Grant (Danny), 29
Linnea Grant (Linnie), 28
Jameison Jeffrey Grant (J.J.), 25
Michael Grant (Mike), 19
Charlotte Grant (Charlie), 17
Familie Daniels
General Douglas und Rose Daniels
Ellis Daniels
Elizabeth Daniels
Rodney Daniels
Die Hochzeitsgesellschaft
Linnie Grant, Braut
Rodney Daniels, Bräutigam
Max Duncan, Best Man (erster Trauzeuge des Bräutigams) und Zelebrant der Trauung
Jennifer Kang, Maid of Honor (Ehrendame und erste Brautjungfer)
Danny Grant, Trauzeuge
Jennifer Wellerstein, Brautjungfer
J.J. Grant, Trauzeuge
Priya Koorse, Brautjungfer
Mike Grant, Trauzeuge
Elizabeth Daniels, Brautjungfer
Marcus Curtis, Trauzeuge
Charlie Grant, Brautjungfer
GRANT CENTRAL STATION
Weihnachtsferien
Ich weiß auch nicht so genau, wie es eigentlich dazu gekommen war. Aber Jesse Foster war dabei, mich zu küssen.
Ich erwiderte seinen Kuss und öffnete dabei alle paar Sekunden die Augen, um mich zu vergewissern, dass ich mir das alles nicht nur einbildete: die Lichterketten und die Girlanden überall im Keller, die Weihnachtsmütze auf dem Pfosten des Treppengeländers und dann tatsächlich Jesse Foster, über mich gebeugt, die Hände in meinen Haaren, die braunen Augen geschlossen.
Wenn etwas, wovon man sein ganzes Leben lang geträumt hat, dann wirklich passiert, ist es ja oft eher enttäuschend. Denn meistens hat die Wirklichkeit nicht allzu viel mit der Fantasie zu tun, wo immer alles perfekt ist, wo man niemals Hunger hat oder gar schmerzende Füße. Aber diesmal war es genau so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte – vielleicht sogar noch besser.
Immer wenn ich davon träumte, ihn zu küssen – was ziemlich oft vorkam, seit ich ungefähr elf war –, lief alles auf den einen ersten Kuss hinaus. Auf diesen Moment, in dem er mich sah, was er zu mir sagte, wenn sein Gesicht wie in Zeitlupe immer näher kam. Danach folgte in meiner Fantasie ein harter Schnitt, und ich malte mir eine Zukunft aus, in der wir beide Hand in Hand durch die Flure der Stanwich Highschool schlendern und er mich verliebt anlächelt.
Doch Jesse Foster wirklich und ganz real zu küssen war so unendlich viel besser als in meinen Träumen. Er küsste fantastisch und stellte damit alle anderen Jungs weit in den Schatten, die sich viel zu zögerlich und ungeschickt anstellten. Er dagegen ging ganz zielstrebig und entschlossen vor und unterbrach das Geschehen nur ab und zu, um mir in die Augen zu schauen, so als wollte er sich vergewissern, ob mit mir alles in Ordnung war – woraufhin ich umgehend wieder seine Lippen suchte und erneut ganz mit ihm verschmolz.
Mit dem Teil meines Gehirns, der jenseits von Lippen und Händen und OhmeinGott und Jesse Foster noch einigermaßen klar denken konnte, versuchte ich zu begreifen, wie es überhaupt so weit gekommen war. Ich kannte Jesse schon mein ganzes Leben lang – seit er sechs Jahre alt und für sein Alter viel zu klein war und braune Wuschelhaare hatte; mit zwölf samt Zahnspange und Brille; und jetzt mit neunzehn, mit Kurzhaarschnitt und starken, muskulösen Armen. Obwohl er der beste Freund meines Bruders Mike war, hatte ich noch nie Zeit mit ihm allein verbracht.
Hier, im ausgebauten Keller der Fosters, war ich zwei Tage nach Weihnachten nur gelandet, weil Mike uns über die Feiertage nicht besuchen wollte. Nach dem Vorfall im Februar war er den ganzen Sommer nicht nach Hause gekommen, sondern auf dem Campus der Northwestern University geblieben, wo er an einem Sommerkurs teilnahm. Auch an Thanksgiving ließ er sich nicht blicken. Dass er auch an Weihnachten nicht nach Hause kommen würde, hätte ich bis zum letzten Moment nicht für möglich gehalten. Thanksgiving oder den 4. Juli zu schwänzen war das eine. Aber doch nicht Weihnachten. Jedenfalls war er nicht gekommen, sondern hatte uns am 23. Dezember nur mitgeteilt, dass sich seine Pläne geändert hätten. Ohne weitere Erklärung.
Meine Mutter hatte ihren Zorn und ihre Enttäuschung beim Putzen abreagiert und dabei hatte sie in Mikes Zimmer einen Karton gefunden mit der Aufschrift JESSES KRAM. Den hatte sie mir in die Hand gedrückt, damit ich mich darum kümmere.
Obwohl ich stinksauer auf meinen Bruder war, freute ich mich über diese Gelegenheit. Schließlich hatte ich damit einen völlig legitimen Anlass, bei Jesse vorbeizufahren, ohne dass ich mir dafür einen Vorwand einfallen lassen musste. Ich schrieb ihm eine Nachricht, die ich als Entwurf vorher meiner besten Freundin Siobhan zukommen ließ, damit er anhand der drei tanzenden Punkte nicht erkennen konnte, wie lange ich dazu brauchte. Er schrieb zurück, dass sich heute Abend sowieso ein paar Leute bei ihm angesagt hätten und dass ich jederzeit dazukommen könnte, was ich als ungefähr halb zehn interpretierte. Nachdem ich mich fünfmal umgezogen und eine Stunde lang meine Haare auf völlig natürlich gestylt hatte, machte ich mich schließlich auf den Weg zu ihm. Als ich ankam, winkte er mir vom anderen Ende des Partykellers aus zu und bedeutete mir, ich solle den Karton in einer Ecke abstellen. Dann zeigte er auf die Kühlbox, in der Bierdosen in geschmolzenem Eiswasser schwammen. Ich nahm mir ein Natty Ice, an dem ich mich allerdings mehr oder weniger nur festhielt, während mich ein Freund des Mitbewohners von Jesse in ein Gespräch verwickelte, in dem es um die Existenz von multiplen Zeitachsen ging und darum, dass das Universum, in dem wir leben, nur ein Beispiel für potenziell unendlich viele Paralleluniversen sei, wofür es im Internet genügend Beweise gebe, falls ich das anzweifeln sollte.
Ich nickte und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, wie absurd ich das fand, während ich gleichzeitig Jesse aus den Augenwinkeln beobachtete. Siobhan nannte das immer mein Jesse-Radar, womit sie gar nicht so falschlag, denn ich wusste immer, wo er gerade war und in welchem Raum. Jesse war der Mittelpunkt der Party, beherrschte den Bierpong-Tisch, begrüßte alle, die zur Kellertür hereinkamen, oder saß rittlings auf einem Stuhl und diskutierte angeregt über die letzte Staffel von Game of Thrones. Wenn er gelegentlich zu mir herüberschaute, lächelte ich und tat höchst interessiert an meinem jeweiligen Gespräch, um ihm zu zeigen, dass ich ganz locker mit seinen Freunden klarkam und längst nicht mehr nur Mikes kleine Schwester war.
Nach zwei Stunden beschloss ich allerdings, den Rückzug anzutreten. Jesses Freunde suchten nach und nach ihre Jacken und Mützen zusammen, es hatte wieder angefangen zu regnen, und Jesse schien vollauf beschäftigt mit einem Mädchen in rotem Pullover mit tiefem Ausschnitt. Sie saß neben ihm auf dem Sofa, und ihre langen schwarzen Haare bildeten eine Art Vorhang, hinter dem die beiden verschwanden. Da das Badezimmer im Keller besetzt war, ging ich nach oben, wo es ganz still und dunkel war und wo nur in einer Ecke die weißen Lichter des Weihnachtsbaums leuchteten.
Als ich wieder in den Keller kam, blieb ich unvermittelt auf der untersten Treppenstufe stehen. Draußen schlugen Autotüren zu und ein Motor wurde gestartet. Aber vor allem sah ich, dass alle anderen schon gegangen waren und dass Jesse auf dem Sofa saß. Allein.
»Wie lange war ich denn weg?«, fragte ich und ging durch den Raum, um meine Jacke zu holen. Jesse lächelte, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden, wo offenbar irgendeine Sportsendung lief.
»Na los, komm«, murmelte er und beugte sich vor. »Na, jetzt mach schon …« Dann folgte offenbar eine sportliche Enttäuschung, denn er lehnte sich seufzend zurück. Er schaltete den Fernseher aus und warf die Fernbedienung beiseite, sodass nun nur noch das Trommeln des Regens gegen die Fensterscheiben zu hören war. Jetzt schaute er zu mir herüber und lächelte, als ob er mich zum ersten Mal sehen würde. »Du musst noch nicht gehen, Charlie«, sagte er und deutete mit dem Kinn auf meine Jacke. »Bloß weil ich ein Loser bin und alle meine Freunde mich im Stich gelassen haben.«
Ich ließ meine Jacke fallen, als ob sie brennen würde, doch dann fasste ich mich wieder, ging zu ihm hinüber und setzte mich neben ihn auf die Couch, so als ob das vollkommen normal wäre und mich vollkommen kalt ließe.
Jesse blieb regungslos auf dem mittleren Platz sitzen, sodass ich ihm plötzlich näher war als je zuvor – abgesehen von zwei nervenaufreibenden Gelegenheiten, als wir an Mikes vierzehntem Geburtstag im Fahrstuhl einer Lasertag-Arena stecken geblieben waren, und von einer denkwürdigen Autofahrt mit zwölf, als wir vom Minigolf in Hartfield kamen und ich auf dem Rücksitz irgendwie zwischen Jesse und Mike landete. Jesse unterhielt sich die ganze Zeit mit Mike, wobei er sich immer wieder an mich lehnte und sein nacktes Bein gegen meins drückte. Die Fahrt nach Hause dauerte eine halbe Stunde, und ich betete die ganze Zeit um einen dicken Stau, eine Straßensperrung, einen Platten – irgendetwas, was die Fahrt verlängerte. Jetzt auf dem Sofa direkt neben ihm wurde mir bewusst, dass diese Nähe – ganz freiwillig und ohne irgendeine Autositz-Logistik – völlig neu war.
Zuvor hatte sein Arm locker auf der Sofalehne gelegen, und er nahm ihn auch nicht weg, als ich mich neben ihn setzte. Es hatte sogar den Anschein, als ob er ihn noch ein Stückchen näher zu meinen Schultern geschoben hätte – sodass ich vor Aufregung ganz feuchte Hände bekam.
»Willst du irgendwas anschauen?«, fragte Jesse und griff nach der Fernbedienung, die am anderen Ende des Sofas lag. Dabei musste er sich über mich hinwegbeugen, wobei mich sein Arm streifte, was in meinem Kopf eine Art Feuerwerk auslöste.
»Klar«, brachte ich heraus und hoffte, dass es einigermaßen cool und gefasst klang, obwohl ich eigentlich zwischen Euphorie und Brechreiz schwankte. Jesse roch nach Weichspüler und ganz leicht nach Bier. Nachdem er die Fernbedienung wieder genommen hatte, blieb er ziemlich dicht neben mir sitzen.
»Vielleicht einen Film?«, fragte er und zeigte in Richtung Fernseher, ohne den Blick von mir zu wenden.
In diesem Moment fiel bei mir der Groschen, und ich begriff, was hier lief. Auch wenn ich erst vier Jungs geküsst und noch nie einen richtigen Freund gehabt hatte – abgesehen von einer dreiwöchigen Beziehung mit meinem Chemielabor-Partner Eddie Castillo –, war ich schließlich auch nicht von gestern. Und plötzlich wusste ich genau, warum Jesse mich gebeten hatte, noch zu bleiben, und warum ich jetzt neben ihm auf dem Sofa saß. Um einen gemütlichen Filmabend ging es jedenfalls ganz bestimmt nicht.
»Klar«, sagte ich wieder und zwang mich, ihm in die Augen zu sehen, statt meinem Drang nachzugeben, sofort aufzuspringen, zu meiner Handtasche zu rennen, um Siobhan zu schreiben, was hier abging, und sie um Rat zu fragen, was ich jetzt tun sollte. Ich streifte meine Ballerinas ab und zog die Beine an. »Film klingt doch super.«
Jesse machte ein paar Vorschläge, und ich tat so, als ob die Entscheidung wirklich eine Rolle spielen würde, während ich genau wusste, dass es nur ein Ablenkungsmanöver war. Und so wunderte es mich auch nicht, dass Jesse nach wenigen Filmminuten – soweit ich es in meinem verwirrten Zustand mitbekam, ging es um einen Polizisten, der mit seinem Diensthund die Rollen tauscht – den Blick vom Fernseher abwandte und mir tief in die Augen sah.
»Hey«, sagte er schließlich und zog einen Mundwinkel hoch.
»Hey«, antwortete ich, wobei es mir diesmal nicht gelang, meine Nervosität zu verbergen. Er schob mir eine Locke hinters Ohr, zeichnete mit dem Daumen meine Gesichtskonturen nach, legte den Kopf schräg und schloss die Augen.
Und dann küsste er mich.
Sobald unsere Lippen sich berührten, erkannte ich, dass Jesse genau wusste, was er tat. Das hatte nichts mit den schüchternen, zaghaften Küssen zu tun, wie ich sie bisher erlebt hatte, und mir stockte fast der Atem, als er mit seiner Zunge tief in meinen Mund eindrang. Ich versuchte mitzukommen, versuchte mir klarzumachen, dass es wirklich und wahrhaftig geschah. Ich erwiderte seinen Kuss und hoffte inständig, dass Jesse nicht merkte, wie unerfahren ich war. Doch falls er es merkte, schien es ihn jedenfalls nicht zu stören. Mein Herz raste und schmolz förmlich dahin. Jesse löste sich kurz von mir und schaute mir wieder in die Augen, während ich krampfhaft versuchte, durchzuatmen und meine Gedanken wenigstens so weit zu ordnen, dass sie nicht nur aus einer endlosen Wiederholung seines Namens bestanden.
»Tja«, bemerkte er, schob seinen Arm unter meine Hüfte und zog die Fernbedienung darunter hervor. Er grinste mich verschwörerisch an. »Den können wir doch ausschalten, oder?«
Ich lächelte zurück. »Wahrscheinlich.« Jesse deutete wieder auf den Fernseher, wo der brave Polizeibeamte gerade rief: »Hundeleben hin oder her, aber das geht gar nicht!« Der Ton brach ab, und es war plötzlich viel dunkler und stiller im Raum. Jetzt gab es nur noch Jesse und mich und den Regen, der gegen die Fensterscheiben prasselte.
»Na dann«, sagte er lächelnd, bevor er den Kopf senkte und mit den Lippen an meinem Hals herunterwanderte, sodass ich aufkeuchte und erschauerte, während ich Siobhan insgeheim dankte, dass sie mir den Rollkragenpullover ausgeredet hatte, den ich eigentlich anziehen wollte. Und ohne dass ich überhaupt merkte, wie es geschah, drückte er mich sanft ein Stück nach hinten, bis mein Kopf schließlich auf der Armlehne lag. Dann beugte Jesse sich über mich, und unsere Beine schlangen sich umeinander.
Er begann mich wieder zu küssen, während seine Hände sich unter meinen Pullover schoben, und ich zog scharf die Luft ein. »Was ist?«, fragte Jesse mit besorgtem Blick, richtete sich auf und rieb seine Hände aneinander. »Sind sie zu kalt?«
»Nein«, erwiderte ich, richtete mich ebenfalls ein Stück auf und betrachtete meine nackte Haut und den hochgeschobenen Pullover. Ganz sanft begann Jesse mit den Fingern über meinen Bauch zu streichen und schon war es wieder um mich geschehen. So weit war ich bisher noch nie gegangen – Küssen im Liegen war für mich eine ganz neue Erfahrung.
»Ist das okay?«, fragte Jesse und suchte meinen Blick. Seine Hände lagen zu beiden Seiten meines Brustkorbs, und mit den Daumen zeichnete er ganz langsame Kreise auf meine Haut. Ich schaute ihn an und zögerte einen Moment, ehe ich nickte. Es war nicht so, dass er aufhören sollte – aber es war immerhin völlig unbekanntes Gebiet für mich, wohin wir gerade vordrangen. Eddie hatte eine ganze Woche gebraucht, bis er den Mut fand, meine Hand zu halten. Als Jesses Hände wieder unter meinen Pullover glitten, gab ich mich ganz und gar dem Geschehen hin, seinen Händen auf meiner Haut und unseren immer leidenschaftlicheren Küssen, bis er mir schließlich den Pullover über den Kopf zog und ihn beiseitewarf. Dann wanderten seine Hände direkt zum Vorderverschluss meines BHs. Als ich erstarrte, lehnte sich Jesse zurück und runzelte die Stirn.
»Alles in Ordnung?«
»Es ist nur …« Ich schaute zur Treppe. Plötzlich war mir sehr bewusst, dass Jesses Eltern jeden Moment hereinkommen konnten. Und ich war mir nicht sicher, ob ich damit klarkam, wenn mich die Fosters – die mich beide kannten, seit ich fünf war – halb nackt auf ihrem Sofa vorfanden, während ich gerade ihren Sohn küsste. »Ähm … sind deine Eltern zu Hause?«
»Die schlafen oben«, sagte Jesse selbstsicher, doch sein Blick wanderte ebenfalls in Richtung Treppe.
Ich stemmte mich hoch, bis ich aufrecht saß, und ich hatte das Gefühl, dass mir das alles – was immer es gewesen war – zwischen den Fingern zerrann. Denn ich wusste genau, dass ich Jesse nicht einfach weiterküssen konnte, wenn ich dabei die ganze Zeit Angst hatte, dass seine Eltern uns erwischten.
»Weißt du was?«, schlug er vor, noch bevor ich etwas dazu sagen konnte. Lächelnd beugte er sich näher zu mir. »Ich hab ’ne Idee, wo wir hingehen können.« Er nickte in Richtung Tür, und ich hielt die Luft an, in der Hoffnung, dass er nicht sein Auto meinte. Doch er sagte nur: »Gästehaus.«
Dort war ich noch nie gewesen, aber ich hatte davon gehört. Es war der Grund, warum Jesse beim Versteckspielen in der Grundschule immer gewonnen hatte, bis Mike es herausfand. Ich nickte, und Jesse hielt mir die Hand hin, um mir vom Sofa aufzuhelfen. Ich wollte nach meinem Pullover greifen, doch er zog seinen schon aus, indem er nach hinten an den Kragen griff und ihn über den Kopf streifte. Er hielt ihn mir hin und ich zog ihn an. Dabei versuchte ich mir nicht anmerken zu lassen, wie ich seinen Geruch tief einatmete, der von der weichen grauen Kaschmirwolle ausging. »Ist das nicht zu kalt?«, fragte ich, während ich meine statisch aufgeladenen Haare glatt strich. Jesse hatte jetzt nur noch seine Jeans und ein weißes T-Shirt an, obwohl es in den vergangenen beiden Nächten Frost gehabt hatte.
»Ist schon okay.« Wieder hielt er mir die Hand hin, und meine Welt geriet ein kleines bisschen aus den Fugen, als wir gemeinsam zur Hintertür gingen, die zum Garten der Fosters führte. Doch als Jesse sie öffnete, wich ich einen Schritt zurück. Es regnete noch heftiger, und offenbar war es deutlich kälter geworden, seit ich angekommen war. Ich erschauerte und bemerkte einen Moment zu spät, dass ich meine Ballerinas vor dem Sofa vergessen hatte.
»Bereit für einen Sprint?«, fragte Jesse und drückte meine Hand.
»Warte mal«, sagte ich und machte einen Schritt Richtung Sofa. »Ich muss noch meine Schuhe holen.«
»Das passt schon«, entgegnete Jesse und zog mich zurück und dann näher zu sich heran. Er beugte sich zu mir herunter, küsste mich und hob mich dann hoch. »Ich hab dich.«
Ich stieß eine Mischung aus Kreischen und Lachen aus, und ehe ich auch nur die geringste Chance hatte, öffnete Jesse die Tür und trug mich hinaus in den Regen.
Ich schlang die Beine um seine Taille und er küsste mich im Gehen. Jesse blieb ganz kurz stehen und hielt mich mit beiden Armen umfasst, als wir uns im strömenden Regen erneut küssten. Durch sein T-Shirt konnte ich seinen Herzschlag spüren. Dann fasste Jesse nach meinen Beinen und schwang sie über seinen Arm – wann war er eigentlich so stark geworden? Er trug mich, als ob ich federleicht wäre, und rannte los, quer über die Wiese zum Gästehaus.
Es sah genauso aus wie das Haus der Fosters, nur im Kleinformat – mit einem Spitzdach aus Holz und mit großzügigen Glasfronten und mit einem Balkon im oberen Stock. Ich hatte erwartet, dass Jesse den Haupteingang benutzen würde, doch er trug mich zu der Treppe hinüber, die seitlich am Haus hinauf ins Obergeschoss führte, und setzte mich auf der untersten Stufe ab, allerdings ganz langsam und vorsichtig, wobei seine Hände an meinen Beinen entlang bis hinauf zur Taille glitten. »Nach dir«, sagte er, und ich konnte hören, dass ihm die Zähne klapperten. Jetzt, da wir uns nicht mehr küssten, spürte ich, wie kalt es war, und meine Füße fühlten sich ganz taub an. Ich lief die Treppe hinauf, Jesse folgte mir, ging dann voraus über den Balkon und öffnete die unverschlossene Tür zum Obergeschoss.
Drinnen schaltete er kein Licht an, sodass ich erst einmal blinzeln musste, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Es war ein großer, offener Raum. In der Mitte stand nur ein Doppelbett mit zwei Nachttischen, und seitlich schloss sich ein Badezimmer an, dessen Tür leicht geöffnet war. Küche und Wohnzimmer befanden sich vermutlich unten. Als mir richtig klar wurde, was das bedeutete (denn ein Bett, also ein richtiges Bett war doch etwas ganz anderes als ein Sofa), hatte Jesse die Tür hinter uns geschlossen und stand schon wieder dicht neben mir. Er küsste mich – was mir wahrscheinlich auf ewig wie ein Wunder vorkommen wird –, doch mittlerweile waren seine Lippen eiskalt, und seine Zähne klapperten jetzt wirklich laut.
»Vielleicht«, bemerkte er und zog sein – durch den Regen praktisch durchsichtiges – T-Shirt mit zwei Fingern ein Stück weg von seiner Haut, »sollten wir unsere nassen Klamotten einfach ausziehen?« Zunächst lachte ich darüber, aber dann fand ich es aus ganz praktischer Sicht gar keine schlechte Idee, denn meine Sachen waren ebenfalls völlig durchweicht und tropften auf den beigefarbenen Teppichboden.
Jesse schaute zu mir herüber, griff über seinen Kopf nach hinten und zog, ohne den Blick von mir zu wenden, sein T-Shirt aus. Ich musste mich kurz sammeln und mich regelrecht zwingen, nicht sofort seinen nackten Oberkörper zu berühren und über seinen Waschbrettbauch zu streichen. Er sah mich mit fragendem Blick an, nicht direkt provozierend, aber doch irgendwie herausfordernd. Ich stand vor ihm, zitternd, in seinem Pullover und mit tropfnassen Haaren, und begriff plötzlich, worauf das hier hinauslaufen würde. Ich befand mich in einem Raum, der hauptsächlich aus einem Bett bestand, zusammen mit einem Jungen, in den ich praktisch schon mein ganzes Leben lang verliebt war. Als Collegestudent hatte er vermutlich schon reichlich Erfahrung und würde bestimmt nicht erst nach ein paar Wochen den Mut zum Händchenhalten fassen. Er hatte mich geküsst und mich durch den Regen getragen. Natürlich könnte ich jetzt einen Rückzieher machen, denn alles, was bisher geschehen war, lag schon weit jenseits von allem, was ich mir für diesen Abend erträumt hatte. Ich könnte jetzt problemlos nach Hause fahren und noch monatelang beglückt an den heutigen Abend zurückdenken.
Oder ich könnte bleiben.
Also stand ich da, ziemlich überfordert mit der Entscheidung, ob ich mir lieber noch ein bisschen Zeit lassen sollte, um ihn dann irgendwann nächste Woche wiederzusehen. Plötzlich musste ich an den Jungen von vorhin denken, der mir von seiner Theorie von den Paralleluniversen erzählt hatte. Vielleicht gab es ja noch eine andere Version des heutigen Abends, in der Jesse mir vom Sofa aus zum Abschied zuwinkte, wo ich meine Jacke anzog und einfach nach Hause fuhr, um anschließend wie üblich an ihn zu denken und die jetzige Situation nicht einmal ansatzweise für vorstellbar zu halten? Was würde diese Charlie mir jetzt raten, während ich mit meiner Unentschlossenheit kämpfte angesichts der Chance, dass mein lang gehegter Traum gleich wahr werden könnte?
Ich holte tief Luft und sagte mir, dass ich es mir ja jederzeit anders überlegen konnte und dass das alles überhaupt nichts zu bedeuten hatte – obwohl ich nur allzu gut wusste, dass ich das ganz bestimmt nicht tun würde und dass es sehr wohl etwas zu bedeuten hatte. Ich zog Jesses Pullover über den Kopf, wobei er mich nicht aus den Augen ließ. Ich nickte.
Nachdem Jesse die Heizung des Gästehauses auf höchste Stufe aufgedreht hatte, krochen wir zusammen unter die Bettdecke, wo er mir aus meiner Jeans half und dann seine ebenfalls abstreifte. Wir lachten uns schlapp, wie erfroren wir beide am ganzen Körper waren. Als ich mit dem Fuß seine Wade berührte, schrie er auf und legte seine Hand auf mein Schlüsselbein, was mich wiederum zum Kreischen brachte. Doch dann begannen wir uns wieder zu küssen und schlangen unsere Beine und Füße umeinander. Mit den Händen erkundete ich seinen Hals, seine Brust, seine Beine und plötzlich war uns überhaupt nicht mehr kalt. Und so unbändig lachen mussten wir auch nicht mehr.
Während das alles geschah und ich nur noch seine Lippen und seine Hände spürte und außerdem die Stelle auf der linken Seite seines Körpers, wo er furchtbar kitzelig war, tauchte in meinem Kopf unwillkürlich ein Gedanke auf: Mike würde das überhaupt nicht gut finden.
Doch ich schob den Gedanken gleich wieder weg. Es war mir völlig egal, wie Mike das finden würde. Schließlich hatte er selbst dafür gesorgt, dass seine Meinung nichts mehr zählte. Indem er seit einem Jahr nicht mehr zu Hause war, gab er uns deutlich zu verstehen, dass er nicht mehr zur Familie gehören wollte. Mike war zwar Jesses bester Freund, und ich wusste natürlich, dass ich gerade eine unausgesprochene Grenze überschritt, aber meine anderen Geschwister hatten sich auch nicht immer daran gehalten.
Als Mike und ich noch jünger waren, lief bei Danny, Linnie und J.J. eine Art private Seifenoper mit dem Titel Affären unter Freunden, indem sie mit den Freunden der anderen anbändelten – meist mit katastrophalem Ausgang. Deshalb hielt ich meine Begeisterung für Jesse vor Mike geheim und erzählte auch meinen anderen Geschwistern nichts davon – nicht einmal Linnie, denn ich wusste genau, dass dieses Geheimnis irgendwann zu kostbar sein würde, um es für mich zu behalten. Wir fünf handelten mit solchen Informationen wie mit Sammelkarten, sie waren unsere besten Trümpfe. Und mir war natürlich klar, dass diese hier – ich so gut wie nackt, zusammen mit Mikes bestem Freund – von ungeheuer hohem Wert gewesen wäre.
»Alles in Ordnung?«, fragte Jesse, löste sich von mir und schaute zu mir herunter.
»Ja«, antwortete ich hastig und versuchte mich auf ihn zu konzentrieren, denn an meinen Bruder wollte ich jetzt ganz bestimmt nicht denken. »Alles prima.«
Lächelnd küsste er mich wieder, und dann strich er mir sanft die Haare aus der Stirn, sah mir tief in die Augen und fragte: »Bist du bereit?« Als ich nickte, beugte er sich hinunter zum Fußboden, auf den er seine Jeans geworfen hatte, und zog aus der Hosentasche seine Geldbörse.
Es folgte eine kurze Pause und kurz darauf ein gemurmeltes »Mist«. Ich schaute zu ihm hinüber und wusste nicht so recht, was los war. Ich traute mich nicht nachzufragen, weil das möglicherweise meinen Mangel an Erfahrung erst recht ans Licht bringen könnte.
»Hast du, ähm …?« Einen Moment zu spät merkte ich, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich diesen Satz beenden sollte, daher brach ich kurzerhand ab.
»Also, es ist so«, erklärte Jesse, während er die Beine wieder unter die Decke schwang, sich auf den Ellbogen stützte und mich ansah. »Ich dachte, ich hätte noch eins in meinem Geldbeutel – da war ich mir eigentlich ganz sicher. Aber …«
»Nichts gefunden?«, fragte ich, und Jesse schüttelte den Kopf. Ich wusste nicht genau, ob ich erleichtert oder enttäuscht sein sollte. Irgendwie empfand ich beides zugleich. Ich hörte, wie es in der Ferne donnerte und das Rauschen des Regens wieder stärker wurde.
»Ich könnte losfahren und welche kaufen«, schlug Jesse vor. »Und … Oh nein, Mist. Dazu bräuchte ich erst Starthilfe. Meine Batterie ist seit gestern Abend tot. Aber wir könnten dein Auto nehmen …« Doch als er es aussprach, klang es nur noch halbherzig. Offenbar ging es ihm genauso wie mir – der Zauber des Moments schwand dahin und löste sich auf.
»Oder vielleicht«, warf ich ein, »lieber ein andermal? Morgen zum Beispiel, oder so?« Dieser Gedanke gefiel mir immer besser, sobald ich ihn aussprach. Das würde mir genügend Zeit verschaffen, mit Siobhan darüber zu reden, ihre Meinung zu hören und noch einmal ganz nüchtern darüber nachzudenken – mit etwas Abstand von Jesse, in dessen Gegenwart mein Hirn offenbar nur noch bedingt funktionierte.
Seufzend schüttelte Jesse den Kopf. »Wir fahren morgen in Skiurlaub«, entgegnete er. »Und von dort aus geht’s für mich dann direkt zurück zum College.«
»Rutgers, oder?«, fragte ich so beiläufig wie möglich, damit er nicht heraushörte, dass sich diese Tatsache förmlich in mein Hirn eingebrannt hatte, seit Mike mir erzählt hatte, wohin Jesse zum Studium ging, und dass ich gelegentlich auf die College-Website schaute, um mir die überhaupt nicht gestellten Bilder der Studenten anzusehen, die rein zufällig allesamt Klamotten mit dem Logo der Hochschule tragen und lachend in der Bibliothek oder irgendwo auf dem Campus herumsitzen. Dabei suchte ich die fröhlichen Multikulti-Gruppen nach Jesse ab und stellte mir vor, wie er gerade mit einem Bücherstapel unter dem Arm an einem bestimmten Gebäude vorbeilief.
»Ja«, antwortete er und lächelte überrascht. »Gutes Gedächtnis.« Er drehte sich auf den Rücken und zog mich fester an sich, sodass ich ganz dicht neben ihm lag und mein Kopf auf seiner Brust ruhte. Mein linker Arm wurde dabei zwar total abgequetscht, aber wo hätte ich ihn sonst ablegen sollen? Außerdem war er im Moment ohnehin überflüssig. »Und bei dir so?«, fragte er als Nächstes. »Weißt du schon, wo du hingehst?«
Vorsichtig schüttelte ich den Kopf, damit er an Ort und Stelle liegen blieb. Ich hatte mich nirgends für eine frühe Zulassung beworben, sodass einige meiner Bewerbungen noch nicht einmal angekommen waren. »Noch nicht.«
Er lachte, was ich mehr fühlte als hörte, wie eine Art Grollen in seiner Brust. »Und wo willst du hin?«
Ich sah ihn an, und die Namen der für mich infrage kommenden Schulen schossen mir durch den Kopf. Dabei lautete die ehrliche Antwort auf Jesses Frage, dass ich eigentlich hierbleiben wollte, genau hier. Am allerliebsten würde ich nirgendwohin gehen. »Ich bin noch am Überlegen«, erwiderte ich und rückte ein Stück näher an ihn heran.
»Nichts dagegen einzuwenden«, sagte Jesse, streichelte meinen Kopf und spielte mit meinen Haaren.
Einen Moment lang schloss ich die Augen und versuchte mir alles genau einzuprägen, denn wenn ich erst wieder zu Hause in meinem Zimmer war, würde mir das alles hier vorkommen wie ein weit entfernter Traum – dass ich ausgezogen mit Jesse Foster im Bett lag, in seinem Arm, den Kopf auf seiner nackten Brust, sodass ich seinen Herzschlag hören konnte. Ich wollte nicht darüber nachdenken, wann ich ihn vielleicht wiedersah, was nächstes Jahr passieren und wo ich dann wohl sein würde. Ich wollte einfach nur, dass dieser Moment nie endete.
Ich öffnete die Augen und richtete mich ein Stück auf, um ihn erneut zu küssen. Er erwiderte meinen Kuss und zog mich an sich, während es draußen wieder zu regnen begann, noch viel heftiger als zuvor.
GRANT CENTRAL STATION
Freitag
Kapitel 1
Oder: Trau keinem, der so heißt wie irgendein Obst
Einen Tag vor der Hochzeit meiner Schwester schreckte ich frühmorgens hoch, als ob es irgendwo Alarm gegeben hätte. Mit wild hämmerndem Herzen sah ich mich in meinem Zimmer um und versuchte herauszufinden, was mich geweckt hatte. Ich war immer noch halb in meinem nächtlichen Traum. Darin kamen unter anderem Jesse Foster und mein Bruder vor, und irgendwie ging es um einen alten Cartoon namens Schoolhouse Rock!, den mir meine Schwester gezeigt hatte, als ich noch in die Grundschule ging …
Doch je angestrengter ich versuchte, meinen Traum im Gedächtnis zu behalten, desto schneller entschwand er. Schulterzuckend ließ ich mich wieder auf mein Kissen fallen, zog mir gähnend die Decke über den Kopf und schloss die Augen. Als ich schon fast wieder eingeschlafen war, begriff ich plötzlich, dass tatsächlich ein Alarm schrillte.
Von unten ertönte ein anhaltender Piepton, der sich anhörte wie die Alarmanlage, mit der unsere Eingangstür und der Küchenausgang gesichert waren. Eigentlich schalteten wir ihn nur ein, wenn wir verreisten – manchmal nicht einmal dann. Das Geräusch war selbst hier, im zweiten Stock, sehr laut, sodass es unten wahrscheinlich ohrenbetäubend war.
Ich griff nach meiner Brille, die auf dem Nachttisch lag, und beugte mich dann hinunter, um mein Handy vom Fußboden aufzuheben, wo es über Nacht geladen hatte. Ich scrollte durch die Gruppenchats, die allesamt aus Familienmitgliedern in unterschiedlicher Konstellation bestanden. Es gab sogar einen für uns alle, inklusive meinem Bruder Mike, wo allerdings schon seit anderthalb Jahren Schweigen herrschte. Ich öffnete die Gruppe, die ich in den vergangenen Tagen häufig genutzt hatte und zu der die Leute gehörten, die sich im Moment hier in unserem Haus befanden: meine Mutter, mein Vater, meine Schwester Linnie und ihr Verlobter Rodney.
Ich
Was ist das mit dem Alarm?
Ich wartete einen Moment und bekam dann nach und nach mehrere Antworten.
Mom
Wahrscheinlich stimmt irgendwas mit der Steuerung nicht – müsste gleich aufhören
Dad
Warum fragst du das per Handy? Kannst du nicht runterkommen und nachsehen? Könnte ja auch ein Einbrecher sein.
Linnie
IST es ein Einbrecher?
Dad
Nein
Dad
HÄTTE aber sein können
Dad
Und falls das Haus geplündert wird, sind Textnachrichten wahrscheinlich nicht die beste Strategie.
Rodney
Morgen, Charlie!
Als ich gerade antworten wollte, hörte der Alarm plötzlich auf, sodass mir mein Zimmer schlagartig extrem still vorkam.
Mom
Jetzt ist er aus.
Ich
Das höre ich. Also, ich hör ihn nicht mehr.
Mom
Kommst du runter? Dad hat Kaffee gekocht und Rodney holt gerade Donuts
Linnie
Moment mal, Charlie, wieso bist du eigentlich da? Fängt der Unterricht an der Stanwich High neuerdings später an?
Mom
Ich hab sie für heute entschuldigt
Ich
Mom hat mich entschuldigt
Linnie
Wieso denn?
Ich
Damit ich euch bei den Vorbereitungen helfen kann
Linnie
Und wieso besorgst du dann nicht die Donuts?
Rodney
Ich hab kein Problem damit!
Ich
Komme gleich runter.
Ich legte mein Handy auf die Bettdecke und reckte die Arme über den Kopf, während ich einen kurzen Zeitabgleich machte. Meine Schwester hatte recht: An einem normalen Freitag hätte ich jetzt gerade Pause und würde – in aller Ruhe – zu meinem Leistungskurs Geschichte gehen. Seit unsere College-Zusagen nach und nach eintrudelten, machten wir künftigen Absolventen uns viel weniger Stress, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.
Gestern Abend hatte ich Mom geschickt davon überzeugt, dass ich mich hier nützlich machen und Sachen erledigen könnte, die vor dem heutigen Probeessen in letzter Minute noch anfallen würden. Dabei versicherte ich ihr, dass in der Schule heute nichts Wichtiges anstand. Das stimmte allerdings nicht ganz, denn ich war Chefredakteurin der Schülerzeitung Pilgrim,und heute Nachmittag fand unsere wöchentliche Redaktionssitzung statt. Dabei wollten wir auch die Abschlussausgabe für dieses Schuljahr besprechen. Aber ich war mir sicher, dass meine Nachrichtenredakteurin Ali Rosen das für mich übernehmen konnte. Normalerweise verpasste ich nie eine Teambesprechung, aber heute Nachmittag würden alle meine Geschwister hier sein, und ich wollte lieber so viel Zeit wie möglich mit ihnen verbringen, statt mit Zach Ellison darüber zu streiten, wie lang seine Filmrezensionen sein durften.
Deshalb stand ich auf, schüttelte schnell Decke und Kissen auf und strich anschließend alles glatt. Dann sah ich mich in meinem Zimmer um und überlegte, ob es ordentlich genug war, falls Verwandte oder Brautjungfern später den Kopf hereinstecken sollten.
Meine Familie war schon vor meiner Geburt in dieses Haus gezogen, sodass es für mich das einzige Zuhause war, das ich kannte, während meine Geschwister sich (angeblich) noch an das davor erinnern konnten. Dieser Raum hier war schon immer mein Zimmer gewesen. Es war der kleinste im Dachgeschoss, wo sich alle vier Kinderzimmer befanden. Wohl unvermeidlich, wenn man das jüngste Kind war, aber es hat mich nie gestört. Es gab eine Dachschräge, unter die mein Bett perfekt passte, und außerdem war es nicht so zugig wie die Zimmer von Danny und J.J. Aber das Beste war, dass es eine Verbindung zu Linnies Zimmer gab, und zwar durch einen begehbaren Kleiderschrank, den wir beide nutzten, also perfekt, um Sachen von meiner Schwester zu stibitzen, gemeinsam Outfits auszusuchen oder einfach mit ihr auf dem Fußboden zu sitzen und unter den Kleiderbügeln zu quatschen und herumzualbern.
Ich befand den Zustand meines Zimmers für annehmbar, ging hinüber zu meiner Kommode, warf einen Blick in den Spiegel und fuhr mir mit der Bürste kurz durch die Haare. Wie alle meine Geschwister war ich ziemlich groß, gut eins fünfundsiebzig, hatte lange hellbraune Haare und eine leicht schiefe Nase, verursacht durch einen Trampolin-Unfall, als ich sechs war. Außerdem hatte ich als Einzige von uns grünbraune Augen, so als ob die Genlotterie beim letzten Kind einen Ausreißer produziert hätte. Meine Haarpracht, die mittlerweile eine Länge erreicht hatte, dass sie innerhalb kürzester Zeit verfilzte, ließ sich nur mühsam bändigen. Aber ich hatte mich so an die langen Haare gewöhnt, und ich wusste zwar, dass ich sie eigentlich schneiden lassen müsste, aber ich wusste auch, dass ich es wahrscheinlich nicht tun würde.
Ich streifte ein Sweatshirt über meinen Schlafanzug und war schon fast zur Tür hinaus, als mein Handy, das ich auf Vibration gestellt hatte, summte. Ich sah mich um und stellte dann fest, dass es versehentlich unter die Bettdecke geraten war. Ich zog es hervor und musste lächeln, als ich sah, dass mein Lieblingsbruder anrief.
»Hi, Danny.« Ich nahm das Telefon noch einmal kurz vom Ohr, um auf die Uhr zu sehen. »Noch ziemlich früh bei euch drüben.«
»Tja«, antwortete er gut gelaunt, »manche Leute müssen halt extra aus Kalifornien anreisen.«
»Du hättest auch schon gestern Abend kommen können.« Das hatte ich monatelang eingefordert, da mir ein einziges Wochenende mit meinen Geschwistern nicht annähernd reichte. Deshalb hatte ich versucht, alle davon zu überzeugen, schon am Dienstag oder Mittwoch zu kommen, damit wir ein bisschen Geschwisterzeit miteinander verbringen konnten, bevor die anderen Verwandten und die Gäste eintrafen. Doch nur Linnie und Rodney waren schon so früh angekommen. Sowohl Danny als auch J.J. mussten arbeiten und konnten nur am Freitag freinehmen.
»Jetzt fang nicht schon wieder damit an.« Ich konnte an seiner Stimme hören, dass er dabei lächelte.
»Moment mal«, warf ich erschrocken ein. »Wieso sitzt du nicht im Flieger?«
»Ich rufe aus dem Flieger an«, entgegnete er, und ich sah ihn plötzlich genau vor mir, auf dem Rollfeld in San Francisco und dann ganz entspannt auf seinem Platz in der ersten Klasse mit einem Kaffeebecher neben sich. »Schon gewusst? Man darf im Flieger telefonieren. Wir sind noch nicht gestartet und ich wollte mich kurz melden. Wie läuft’s denn so?«
»Bestens«, antwortete ich, ohne nachzudenken. »Echt genial, dass Linnie und Rodney wieder da sind.«
»Ich meine eigentlich, ob mit der Hochzeit alles okay läuft. Keine Katastrophe in letzter Minute?«
»Nein, alles gut. Clementine hat die Sache im Griff.«
»Dann bin ich ja froh, dass sie mein Geld wert ist.«
»Das solltest du unbedingt in deiner Rede erwähnen.«
Danny lachte. »Vielleicht mach ich das sogar.«
Clementine Lucas war die Hochzeitsplanerin von Linnie und Rodney. Danny hatte angeboten, die Kosten dafür zu übernehmen – als Verlobungsgeschenk, nachdem die beiden den Hochzeitstermin etwas überstürzt festgelegt hatten. Sie hatten sich vor zwei Jahren verlobt, mit dem Heiraten dann aber keine Eile, was bei uns für den Running Gag sorgte, dass mit ihrer Hochzeit wohl im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu rechnen sei. Sicher war für die beiden nur, dass die Feier in unserem Haus stattfinden sollte – davon hatte Linnie schon seit Kindertagen geträumt.
Rodney studierte im dritten Jahr Jura und wollte Anwalt werden, während Linnie an ihrem Masterabschluss in Denkmalpflege arbeitete, sodass dieses Frühjahr vermutlich nicht der beste Zeitpunkt für eine Hochzeitsfeier war, erst recht nicht für die eigene. Doch als meine Eltern uns mitteilten, dass sie das Haus verkaufen wollten, überschlugen sich die Ereignisse an der Hochzeitsfront plötzlich.
Mein Blick fiel auf den Kartonstapel, den ich vor meine Schranktür geschoben hatte, so als ob sich dadurch verdrängen ließe, warum sie hier standen. Eigentlich hätte ich längst anfangen müssen, mein Zimmer auszuräumen, denn unser Haus war inzwischen an Lily und Greg Pearson verkauft worden, die zusammen mit ihren drei schrecklich lauten Kindern einziehen würden, sobald vertraglich alles unter Dach und Fach war. Insgeheim hatte ich ja gehofft, dass sich kein Käufer finden und dass unser Haus monatelang vergeblich angeboten würde. Doch es überraschte mich nicht, dass es sich dann sehr schnell verkaufte. Denn ein Haus, das in einem der beliebtesten Comics des Landes vorkam, war schon etwas Besonderes.
In diesem ganzen Trubel war Clementine daher eine große Hilfe. Danny hatte sie über ein Start-up namens Pland gefunden, das seine Risikokapitalgesellschaft mitfinanzierte. Das Unternehmen nahm Hochzeitsplaner aus ganz Amerika unter Vertrag und vermittelte die Besten von ihnen an heiratswillige Paare. Abgesehen von Unstimmigkeiten über die Farbe der Servietten lief mit Clementine alles bestens.
»Ich kann’s gar nicht erwarten, mir heute Nachmittag alles anzusehen.«
»Bleibt es dabei, dass du um zwei ankommst?«
»So ist der Plan.« Danny räusperte sich. »Ich hab übrigens noch eine Überraschung für dich.«
Ich grinste und hatte schon eine Ahnung, was es sein könnte. »Einen Double-Double-Burger?«
Danny seufzte. »Ich hätte niemals mit dir zu In-N-Out gehen dürfen, als du hier warst.«
»Das heißt also Nein?«
»Das heißt, dass man Hamburger nicht sechs Stunden ohne Kühlung transportieren kann.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »In-N-Out könntest du immer haben, wenn du nächstes Jahr hier rüberkommen würdest.«
Ich lächelte und schaute unwillkürlich zu dem Stapel auf einer Ecke meines Schreibtischs – lauter bunt glänzende Mappen mit meinen College-Zusagen. Ich hatte mich an acht Hochschulen beworben und war an drei davon angenommen worden: an der Northwestern in einem Vorort von Chicago, am College of the West in einer Kleinstadt bei Los Angeles und hier in Stanwich, wo mein Vater unterrichtete. Vorige Woche hatte ich mich für Stanwich entschieden und es Danny noch vor meinen Eltern mitgeteilt. Schon lange versuchte er mich zu überreden, zu ihm an die Westküste zu ziehen. »Also ich denke ja, dass alle wichtigen Lebensentscheidungen anhand von Fastfood-Ketten getroffen werden sollten, von daher …«
»Schon klar.« Im Hintergrund hörte ich jetzt eine Ansage, in der dazu aufgefordert wurde, sich anzuschnallen und alle Gepäckfächer zu schließen. »Ich muss jetzt Schluss machen. Bis nachher, Chuck«, sagte er und nannte mich bei meinem Spitznamen, den nur er verwenden durfte.
»Moment mal«, sagte ich, weil mir gerade noch einfiel, dass er mir immer noch nicht verraten hatte, womit er mich überraschen wollte. »Danny …« Aber er hatte schon aufgelegt. Ich legte mein Handy auf die Kommode und ging hinüber zu meinem Schreibtisch. Dort schob ich die orangefarbene Mappe vom College of the West beiseite und nahm die leuchtend violette der Northwestern zur Hand.
Ich hatte eine Zusage von Medill bekommen, der Journalistenschule der Northwestern, wegen der ich mich überhaupt dort beworben hatte. Das hatte mir mein Beratungslehrer allerdings nicht geglaubt; er dachte, dass ich einfach nur dorthin gehen wollte, wo Mike studierte – was für mich jedoch ganz bestimmt kein Anreiz war, sondern eher ein Systemfehler. Ich blätterte die Medill-Broschüre durch, die sie mir zugeschickt hatten, und betrachtete die Hochglanzbilder von Studenten in der Nachrichtenredaktion, mögliche Praktika bei großen Medienunternehmen, Studienaufenthalte im Ausland … Ehe ich mich zu sehr darin vertiefte, klappte ich die Mappe wieder zu und nahm das Material vom Stanwich College zur Hand. Ich strich mit dem Finger über das Wappen der Schule. Seit mir meine Eltern mitgeteilt hatten, dass sie das Haus verkaufen würden, war die Northwestern für mich nicht mehr allzu erstrebenswert. Von hier wegzugehen war deutlich verlockender, wenn es ein Haus gab, wohin man heimkehren konnte. Plötzlich überforderte es mich, gleichzeitig mein Zuhause und meine Heimatstadt zu verlieren, weshalb ich immer mehr zu Stanwich tendierte. Ich war praktisch auf dem Campus aufgewachsen, und ich liebte ihn sehr – den von Bäumen gesäumten Hof, die Buntglasfenster in einigen Unterrichtsräumen und den legendären Frozen-Yogurt-Laden. Diese Option erschien mir zunehmend als die beste – ich würde etwas Neues anfangen, ohne alles Vertraute loszulassen. Außerdem hatte die Schule einen guten Ruf, und ich war mir sicher, dass es ganz toll und großartig werden würde.
Den anderen Einrichtungen hatte ich zwar noch nicht abgesagt, doch ich hatte meine Entscheidung getroffen. Auch wenn meine Eltern darüber wohl ein wenig erstaunt waren, würden sie sich schon an den Gedanken gewöhnen – und wenn die erste Rechnung für meine Studiengebühren fällig war, dürften sie froh sein über den Nachlass, den ich als Tochter eines Dozenten gewährt bekam.
Sobald der ganze Hochzeitsirrsinn vorbei war, wollte ich mich darum kümmern, was als Nächstes zu tun war: an der Northwestern und am College of the West absagen und klären, was für Stanwich an Zahlungen und Papierkram zu erledigen war. Aber daran mochte ich jetzt noch nicht denken – nicht an diesem Wochenende. Schließlich erwarteten mich unten meine Schwester und mein zukünftiger Schwager – und möglicherweise leckere Donuts.
Ich war schon fast zur Tür hinaus, als mein Handy wieder klingelte. Hastig griff ich danach in der Hoffnung auf einen Rückruf von Danny, erkannte auf dem Display jedoch das Profilbild meiner besten Freundin Siobhan Ann Hogan-Russo.
»Hey, Shove-on«, begrüßte ich sie und stellte mein Handy laut. So erklärte Siobhan anderen Leuten immer, wie ihr Name ausgesprochen wurde, denn die meisten rechneten nicht damit, dass ein b auch stumm sein konnte.
»Oh«, antwortete sie überrascht. »Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass du rangehst. Hast du jetzt nicht Geschichte?«
»Ich hab Mom überredet, mich zu entschuldigen. Ich bleib heute zu Hause, damit ich bei dem ganzen Hochzeitskram mithelfen kann.«
»Ich dachte, das macht alles Mandarine.«
Obwohl sie mich nicht sehen konnte, schüttelte ich den Kopf. »Du weißt genau, dass sie Clementine heißt. Du hast nur irgendwelche Vorurteile gegen sie.«
»Du kennst meine Devise«, entgegnete Siobhan. »Trau keinem, der so heißt wie irgendein Obst.« Ich seufzte. Diesen Spruch hatte ich schon viel zu oft gehört, und ich wusste nur allzu genau, mit welcher Pointe Siobhan gleich nachlegen würde. »Denn bei ihnen könnte was faul sein.«
»Schon klar, dass du das für witzig hältst«, erwiderte ich und hörte Siobhan am anderen Ende lachen. »Ist es aber nicht.«
»Mein Vater fand es witzig.«
»Welcher denn?«
»Ted. Steve versucht uns immer noch zu bequatschen, dass wir heute Abend zu irgend ’nem Alumni-Dinner mitkommen.«
Siobhan war schon seit Mittwoch mit ihren Vätern an der University of Michigan, wo sie nächstes Jahr ihr Studium anfangen wird. Im Gegensatz zu mir gab es bei ihr da keinerlei Fragen. Ihre Väter haben beide dort studiert und sich ein paar Jahre später bei einem Alumnitreffen kennengelernt. Im Haus der Familie Hogan-Russo hing gut sichtbar ein Foto von Siobhan als Säugling, auf dem sie einen Michigan-Strampler im typischen Blau-Gelb der Universität anhat. Es wurde wohl ernsthaft in Erwägung gezogen, sie Siobhan Ann Arbor Hogan-Russo zu nennen (in Ann Arbor befindet sich die University of Michigan), um ihre Chancen auf eine Zusage zu erhöhen. Aber zum Glück war das nicht nötig, denn sie bekam schon vorigen Dezember die Mitteilung, dass sie frühzeitig angenommen war.
»Wie ist der Campus denn so?«
»Fantastisch.« Siobhan seufzte beglückt. »Warte mal«, sagte sie plötzlich streng, als ob sie schlagartig aus ihrer Michigan-Seligkeit erwacht wäre. »Wieso schwänzt du denn heute? Steht nicht eure Redaktionssitzung an?«
»Ja«, antwortete ich, »aber das passt schon. Ali kriegt das hin.« Als am anderen Ende Schweigen herrschte, fügte ich hastig hinzu: »Sie will sowieso nächstes Jahr Chefredakteurin werden, da kann sie sich gleich daran gewöhnen, die Sitzungen zu leiten.« Siobhan sagte immer noch nichts, aber ich konnte mir ziemlich gut vorstellen, wie sie gerade aussah: die Arme verschränkt und eine Augenbraue hochgezogen. »Das geht in Ordnung, glaub mir.«
»Es ist echt immer das Gleiche mit dir.«
»Nein, überhaupt nicht. Was denn eigentlich?«
»Immer wenn deine Geschwister in der Stadt sind, ist alles andere für dich nicht mehr wichtig.«
Ich holte tief Luft, um zu widersprechen, ließ es dann jedoch bleiben, denn über dieses Thema haben Siobhan und ich uns schon oft gestritten – und ehrlich gesagt lag sie damit auch nicht völlig falsch. »Diesmal ist es ein bisschen anders, weil Linnie ja heiratet.«
»Echt jetzt?«, fragte Siobhan mit gespieltem Entsetzen. »Wieso hast du denn nichts davon gesagt?«
»Sio.«
»Ach nee, warte, du hast es mal erwähnt. Ungefähr alle drei Minuten.«
»Das wird total toll«, sagte ich mit Überzeugung. »Linnies Kleid ist wunderschön, und den Bildern von ihrer Frisur- und Make-up-Probe nach wird sie fantastisch aussehen. Also, lass dich überraschen.« Siobhan war auch zu der Feier eingeladen – immerhin kannte sie Linnie auch schon ewig. Sie würde morgen früh mit dem Flugzeug aus Michigan zurückkommen und hatte dann noch genügend Zeit, sich feierschick zu machen.
»Sind schon alle da?«, erkundigte sie sich. »Der ganze Zirkus komplett angereist?«
»Noch nicht ganz. Linnie und Rodney sind seit Mittwochabend da. Danny kommt heute Nachmittag, und J.J. …« Ich holte kurz Luft. »Endlich sind wir mal wieder alle zusammen.« Als ich das aussprach, wurde mir so warm ums Herz wie nach einem großen Schluck heißer Schokolade.
»Na ja, nicht ganz.«
Ich blinzelte verwundert. »Wie meinst du das?«
»Mike«, erwiderte Siobhan schlicht. »Mike fehlt ja wohl.«
»Den will eh keiner dabeihaben«, murmelte ich.
»Also Linnie schon, oder?«, bemerkte Siobhan. Ich ging wieder hinüber zu meinem Schreibtisch und schob die Stapel darauf zurecht, um mich abzulenken. »Hat sie ihn nicht eingeladen?«
»Na klar«, antwortete ich hastig und wollte am liebsten das Thema wechseln. »Aber er kommt halt nicht und das ist wahrscheinlich auch besser so.«
»Okay«, sagte Siobhan, und ich wusste, dass sie nicht weiter auf dem Thema herumreiten würde, obwohl sie anderer Meinung war. »Also, jetzt erzähl mal.« Ihr Tonfall klang jetzt ganz und gar geschäftsmäßig, genau wie früher, als wir fünf waren und Die Schöne und das Biest spielen wollten und zu klären hatten, wer Belle sein durfte und wer mit der Rolle der Teekanne vorliebnehmen musste. »Was ziehst du an, wenn GMA anrückt?«
Ich verzog das Gesicht. Das TV-Morgenmagazin Good Morning America wollte in zwei Tagen bei uns zu Hause ein Interview mit uns allen führen, weil die Comicserie meiner Mutter – Grant Central Station – nach fünfundzwanzig Jahren zu Ende ging. Und obwohl bis dahin nicht mehr viel Zeit war, war ich noch nicht dazu gekommen, mir zu überlegen, welches Outfit dafür passend war.
In Grant Central Station ging es um das Leben der Familie Grant, mit fünf Kindern, zwei Eltern und einem Hund – allerdings in einer fiktiven Version, denn in der Realität hießen wir ja auch Familie Grant. Die Serie erschien landesweit in vielen Zeitungen und sogar im Ausland. Es ging um eine große Familie und ihren Alltag – mit Arbeit, Affären, fiesen Lehrern und Geschwisterzoff. Im Laufe der Jahre hatte sie sich gewandelt, weg von allzu platten Witzen, hin zu eher Cartoon-artigen Illustrationen und allmählich auch zu ernsthafteren Themen. Der Humor war pointierter geworden und meine Mutter baute einen Handlungsstrang manchmal über mehrere Wochen aus. Und im Gegensatz zu den meisten Comics, in denen die Charaktere eher eindimensional ausfielen (Garfield hasste auf ewig den Montag und liebte Lasagne; Charlie Brown traf niemals den Football; Jason, Paige und Peter Fox blieben für immer in der fünften, neunten beziehungsweise elften Klasse), entwickelte sich Grant Central Station gewissermaßen in Echtzeit. Meine Geschwister und ich hatten jeweils ein Comic-Pendant, und die fiktionale Familie hielt Schritt mit ihren realen Vorbildern.
Als bekannt wurde, dass die Serie endet, folgte eine Flut von PR-Anfragen, woraufhin Mom wochenlang per Telefon und Mail Auskunft geben musste und mit dem Zug nach New York fuhr, um Fotoaufnahmen zu machen und Interviewaufzeichnungen. Aber die wirklich großen Events kamen erst jetzt, wo das Ende unmittelbar bevorstand, damit sie sich ganz authentisch dazu äußern konnte, nachdem es tatsächlich so weit war. In vielen Zeitungen gab es Retrospektiven, und das Pearce Museum in unserer Stadt zeigte eine ganze Ausstellung mit ihren Arbeiten. Deshalb hatten wir heute Abend dort noch einen Termin zur Eröffnung, bevor wir allesamt zum Probeessen weitermussten.
Der größte dieser ganzen öffentlichen Auftritte war jedoch Good Morning America am Sonntagmorgen – ein Live-Interview mit uns allen, das den Titel trug: »Die Familie hinter Grant Central Station.«
Als sich Linnie und Rodney auf einen Hochzeitstermin geeinigt hatten, legte meine Mutter fest, dass exakt an diesem Wochenende ihre Comicserie enden sollte, weil wir dann alle hier zusammen waren. Und offenbar war GMA besonders daran interessiert, einen Beitrag über uns zu machen, als sie erfuhren, dass wir alle da sein würden. Linnie und Rodney waren davon allerdings gar nicht begeistert, und J.J. hatte angemerkt, dass ein landesweit ausgestrahlter Fernsehauftritt am Tag nach der Hochzeitsfeier möglicherweise umbenannt werden müsste in »Grant-Central-Katerstimmung«. Ich war auf jeden Fall glücklich, dass wir uns von diesem Thema, das seit jeher unser Leben bestimmt hatte, gemeinsam verabschieden konnten.
»Ähm«, sagte ich nun zu Siobhan, um etwas Zeit zu gewinnen. »Klamotten?«
»Charlie.« Meine beste Freundin war hörbar ungehalten. »Jackson Goodman kommt am Sonntag zu euch nach Hause.«
»Das ist mir bewusst.«
»Jackson Goodman. Und du hast noch keinen Plan, was du anziehen willst?«, fragte Siobhan streng. Sie schaute jeden Morgen vor der Schule mit ihren Vätern Good Morning America, undJackson Goodman – den lässigen Moderator mit dem breiten Lächeln – himmelte sie geradezu an. Als sie hörte, dass er zu uns nach Hause kam, war sie völlig aus dem Häuschen und lud sich kurzerhand selbst mit dazu ein.
»Was hältst du davon, wenn du mich bei der Kleiderauswahl berätst?«
»Abgemacht. Und du machst mich dann mit Jackson bekannt. Deal?«
»Geht klar«, antwortete ich, obwohl ich nicht die leiseste Ahnung hatte, wie die ganze Sache am Sonntag laufen sollte.
Bei Siobhan im Hintergrund war jetzt Stimmengewirr zu hören. »Du, ich muss Schluss machen. Diese Veranstaltung für künftige Studis fängt gleich an.«
»Viel Spaß. Hail to the victorious.«
»Hail to the victors«, korrigierte Siobhan mich empört. »Kennst du die berühmte Hymne meiner Universität noch nicht auswendig?«
»Offenbar nicht. Äh, dann auf geht’s, Wolverine.«
»Wolverines«, sagte Siobhan ungehalten. »Das Maskottchen unseres Footballteams ist ja wohl kaum Hugh Jackman!«
»Ach, weißt du, in dem Fall hätte ich mich vielleicht sogar bei euch beworben.«
»Steve und Ted sind immer noch sauer auf dich deswegen, das weißt du hoffentlich.«
»Die können froh sein, dass ich mich nicht an der Ohio State beworben habe.«
Ich hörte, wie sie scharf die Luft einzog – was sie jedes Mal tat, wenn ich den traditionellen Rivalen der University of Michigan erwähnte, weshalb ich den Namen so oft wie möglich ins Spiel brachte. »Diese Bemerkung überhöre ich mal lieber großzügig.«
»Kluge Entscheidung.«
»Jetzt muss ich wirklich auflegen. Sag Linnie schon mal liebe Grüße von mir.«
»Mach ich. Bis morgen dann.« Ich beendete das Gespräch, öffnete anschließend meine Fotogalerie und scrollte durch die Bilder. Die mit meinen Geschwistern schaute ich mir genauer an, denn ich suchte nach einem, das uns alle zusammen zeigte.
Ich fand eins mit Linnie und Rodney von gestern, als wir bei Captain Pizza waren, um das Abendessen zu besorgen. Außerdem gab es eins mit Danny, J.J. und mir vor dem Weihnachtsbaum, auf dem Danny und ich hinter J.J. standen und über seinem Kopf Hasenohren zeigen. Linnie und Rodney waren nicht dabei, denn die hatten über Weihnachten Rodneys Eltern auf Hawaii besucht. Das nächste zeigte J.J., Linnie und mich zu Thanksgiving – Danny musste kurzfristig nach Shanghai fliegen, um ein Projekt vor dem Scheitern zu retten. Dann stieß ich auf ein Bild vom September: Danny und ich vor einem Café – er hatte mir als Überraschung ein Flugticket geschickt, mit dem ich für ein Wochenende zu ihm nach Kalifornien geflogen war. Außerdem entdeckte ich noch ein Foto vom letzten Sommer, als J.J. und ich versuchten, nur zu zweit Cards Against Humanity zu spielen – leider gescheitert.
Doch es gab keins von uns allen zusammen, und ich musste beim Durchsehen der Bilder feststellen, dass wir schon lange nicht mehr alle versammelt gewesen waren. Doch an diesem Wochenende war es endlich so weit. Drei Tage lang würden wir gemeinsam verbringen – hier zu Hause, in trauter Geschwisterrunde. Wir würden uns in der Küche treffen, Spiele machen, abwechselnd Bagels besorgen und einfach das Zusammensein genießen.
Ich hatte mich schon so lange darauf gefreut, und nun stand unser Treffen unmittelbar bevor. Ich konnte das Gemeinschaftsgefühl schon erahnen – als ob dann endlich alles wieder gut wäre. Ganz besonders deshalb, weil dieses Wochenende das letzte sein würde, das wir miteinander in diesem Haus verbrachten. Schon aus diesem Grund musste es perfekt sein. Dafür würde ich auf jeden Fall sorgen.
Ich eilte zur Tür hinaus und war schon auf der Treppe hinunter zur Küche, als der Alarm erneut losging.
Kapitel 2
Oder: Alles ist gut!!
»Hiya, Töchterlein«, sagte Dad lächelnd, als ich in die Küche kam. Er saß auf einem der Barhocker an der Kücheninsel und hatte einen Kaffeebecher in der Hand, den er zur Begrüßung hob. »Guten Morgen.«
»Schon wieder Alarm?«, fragte ich und warf einen Blick auf das Bedienfeld neben der Tür. Doch es war nichts zu hören und keins der Lämpchen leuchtete. Der Alarm war genauso abrupt wieder vorbei gewesen, wie er begonnen hatte, und als ich im Erdgeschoss ankam, herrschte wieder Stille.
»Deine Schwester schaut gleich mal nach«, sagte meine Mutter. Sie saß an unserem langen Esstisch aus Holz, vor sich eine Tasse Tee. »Sie vermutet, dass es an einem von den Fenstersensoren liegt.«
Ich nickte, dann stemmte ich mich hoch und setzte mich auf die Arbeitsfläche. Ich ließ den Blick schweifen. Die Küche war immer der Mittelpunkt des Hauses gewesen. Hier trafen wir uns, und hier schaute ich immer als Erstes nach, wenn ich jemanden von meinen Eltern oder Geschwistern suchte. Obwohl es ein recht großer Raum war – mit Kücheninsel und Barhockern auf der einen und dem Esstisch auf der anderen Seite, und dazu ein Bereich an der Tür mit Kleiderhaken für Jacken und mit einer Bank, wo man seine schmutzigen Stiefel ausziehen konnte, die meist etwas chaotisch darunter landeten –, fand ich die Küche schon immer gemütlich. Kurz musste ich daran denken, dass bald die schrecklichen Kinder von Lily und Greg Pearson hier herumrennen würden, und das Herz wurde mir schwer.
»Alles okay mit dir, mein Kind?«, fragte Dad, kam auf mich zu und öffnete den Küchenschrank. Vor vier Wochen war er noch bis obenhin voll gewesen mit bunt zusammengewürfelten Kaffeebechern und sonstigem Geschirr, das sich in fünfundzwanzig Jahren halt so angesammelt hatte. Doch jetzt war nur noch eine Handvoll davon übrig, die Überreste der Ausräumaktion meiner Eltern im Vorfeld des Hausverkaufs, als es einen riesigen Flohmarkt in unserem Vorgarten gab, dem ich mich strikt verweigert hatte. Als meine Eltern ahnten, dass ich vorhatte, potenzielle Käufer mit lautstarken Bemerkungen über Wanzen und gefälschte Antiquitäten zu verschrecken, hatten sie mich kurzerhand übers Wochenende zu Linnie und Rodney nach Boston geschickt.
»Alles gut«, antwortete ich hastig und lächelte ihn an. Ich deutete mit dem Kinn auf den Kaffeebecher, den er gerade abstellte. »Ist der für mich?«
»Sieht so aus«, sagte er und schenkte mir Kaffee ein und dazu genau die richtige Menge Milch. Dann reichte er mir augenzwinkernd den Becher.
Mein Vater sah wie immer ein wenig zerknittert aus und war vermutlich noch nicht allzu lange wach. Obwohl er heute nicht unterrichten musste – er war Botanikprofessor und Leiter der naturwissenschaftlichen Fakultät, wodurch er am Stanwich College so viel Einfluss hatte, dass er schon seit über zehn Jahren freitags keine Lehrveranstaltungen mehr halten musste –, trug er seine übliche Dienstkleidung: Cordhose und Hemd und darüber eine Strickjacke mit Ellbogenflicken. Seine Brille hatte er bis zum Haaransatz hochgeschoben, der mittlerweile nicht mehr nur grau meliert war, sondern fast vollkommen weiß.
»Hast du Hunger?«, fragte Mom. Sie hatte ihre blonden Locken mit einem Bleistift hochgesteckt und trug ihre Arbeitskleidung: einen weiten Pullover und eine schwarze Hose, obwohl sie schon seit sechs Wochen keine neuen Comics mehr zu zeichnen hatte – die Vorlaufzeit war immer recht lang, weil die Strips erst noch bearbeitet und farbig gestaltet wurden. So kannte sie das Ende von Grant Central Station schon seit Wochen, während wir anderen nicht die leiseste Ahnung hatten. Linnie wollte es unbedingt vorher wissen, aber mir war es lieber, wenn ich es erst in der Zeitung sehen und das Ende unserer Geschichte zeitgleich mit dem Rest der Welt erfahren würde. »Rodney müsste jeden Moment wieder da sein.«
»Also, der Fenstersensor ist es nicht«, verkündete meine Schwester, als sie aus dem Esszimmer in die Küche kam. Sie lächelte mich an. »Schön, dich zu sehen.«
Grinsend antwortete ich: »Ich dachte mir, ich sollte mal hier auftauchen.« Lachend nahm sich meine Schwester ebenfalls eine Tasse und schubste sie über die Arbeitsplatte zu meinem Vater, der sie aufhielt und ihr ebenfalls Kaffee einschenkte.
»Also, frohen Hochzeitsvorabend«, sagte ich und

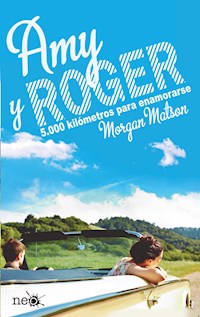















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











