
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj TB
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das wunderbare Chaos der ersten Liebe
Die Sommerferien stehen vor der Tür und Andie hat alles geplant: einen Sommerkurs an einer renommierten Uni als perfekte Vorbereitung auf das Medizinstudium. Kein Problem – mit ihren guten Noten und einem bekannten Politiker als Vater. Doch als ein Skandal ihren Vater zum Rücktritt zwingt und der „befreundete“ Rektor der Eliteuni seine Empfehlung zurückzieht, steht Andie zum ersten Mal in ihrem Leben ohne Plan da. So beginnt ein Sommer, in dem sie Dinge tut, die sie nie zuvor getan hat: Sie führt Hunde aus, verbringt Zeit mit ihrem Vater – und lässt den süßen Clark weiter in ihr Herz, als sie vorhatte. Aber kann das länger halten als einen Sommer?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
@ Meredith Zinner
DIE AUTORIN
Morgan Matson studierte Schreiben für junge Leser an der New School in New York. Road-Trips quer durchs Land sind ihre große Leidenschaft und sie hat schon drei Mal die USA durchreist … bis jetzt. Zurzeit lebt sie in Los Angeles.
Von Morgan Matson sind bei cbj erschienen:
Amy on the Summer Road (40132)
Vergiss den Sommer nicht (40181)
Dreizehn Wünsche für einen Sommer (40334)
Mehr zu cbj auf Instagram unter@hey_reader
Morgan Matson
Ein Sommer auf gut Glück
Aus dem Amerikanischenvon Franka Reinhart
Für Justin Chanda,meinen Lektor und Freund
Der Älteste sah im Feuerschein zu Tamsin hinüber und sagte: »Wenn Leute dir Geschichten erzählen, dann hör ihnen genau zu. Eigentlich laufen alle auf zwei Grundthemen hinaus. Jemand unternimmt eine lange Reise oder ein Fremder kommt in die Stadt.«
Das Feuer knackte und Tamsin dachte über diese Worte nach. »Aber kommt nicht manchmal auch beides vor?«
Der Älteste blickte sie lange an, als ob er etwas sähe, das ihr verborgen war. »Ja«, sagte er schließlich mit gravitätischer Stimme. »Manchmal ist das so, aber nur sehr selten.«
C. B. McCallister, Ein Krähenschwarm, Hightower & Jax, New York
1
Ich wackelte mit den Zehen in meinen viel zu engen Schuhen, zwang mich, gerade zu stehen, und versuchte, das Blitzlichtgewitter um mich herum so weit wie möglich zu ignorieren. Es wurde langsam Abend, doch draußen war es immer noch brütend heiß. Trotzdem trug ich einen knielangen Tweedrock und eine hochgeschlossene Bluse. Meine Haare waren vorher geföhnt und frisiert worden, dazu kamen Perlenohrringe und ein leichtes Make-up. Normalerweise sah ich an einem Mittwochnachmittag Anfang Juni nicht so aus, aber dieser Tag war auch alles andere als normal.
»Vielen Dank, dass Sie gekommen sind«, sagte mein Vater, der an einem improvisierten Rednerpult auf unserer Eingangsveranda stand. Er sah kurz auf seine Unterlagen, holte dann tief Luft und setzte zu seiner vorbereiteten Rede an. Ich kannte sie inzwischen auswendig, da ich sie mir auf Wunsch seines Stabs- und Strategiechefs Peter Wright so oft anhören musste, bis ich dabei nicht einmal mehr mit der Wimper zuckte – als ob ich über all das längst Bescheid wüsste und mich Dads Aussagen kein bisschen überraschten.
Während seine vertrauten Worte an mir vorbeirauschten, betrachtete ich blinzelnd das Pult. Wo kam es eigentlich her? Hatte Peter immer eins im Kofferraum seines SUVs verstaut, nur für alle Fälle?
»… bedauere ich es sehr, wenn die Menschen in Connecticut ein Stück weit ihr Vertrauen in mich verloren haben«, sagte mein Dad gerade und holte mich zurück in dem Moment. Ich schaute zu ihm hinüber und hoffte, dass ich nichts anderes ausstrahlte als die loyale Tochter, die treu an der Seite ihres Vaters stand. Denn etwas anderes würde die Geschichte, die ohnehin schon die Spitzenmeldung sämtlicher Nachrichtensendungen war, noch weiter aufbauschen.
Natürlich war mir klar, warum. Ein bekannter Kongressabgeordneter, einer der Stars seiner Partei, war plötzlich in einen Skandal verwickelt, der nicht nur seine Karriere, sondern auch die nächsten Wahlen völlig auf den Kopf zu stellen drohte. Die Medien überschlugen sich mit Schlagzeilen. Wenn es dabei um eine andere Person gegangen wäre, hätte ich nur schulterzuckend die Berichte gelesen und mir weiter keine Gedanken darüber gemacht. Doch da das Ganze hier bei uns zu Hause – in unserem Vorgarten, auf unserer Veranda – stattfand und meinen Vater betraf, war von dieser Abgeklärtheit natürlich keine Spur.
Mein Blick schweifte zu den zahllosen Reportern und Fotografen, die ihre unaufhörlich klickenden Kameras auf uns richteten und mir unbarmherzig klarmachten, dass jeder noch so kleine Augenblick von ihnen eingefangen wurde. Die Medien hatten ein untrügliches Gespür für Sensationen. Das konnte man deutlich am Gedränge vor unserem Haus und den vielen Übertragungswagen am Straßenrand erkennen. Seit die Nachricht bekannt geworden war, herrschte hier Hochbetrieb, wobei die Journalisten erst seit wenigen Stunden direkt bis zu unserem Haus vorgelassen wurden. Zuvor hatte sie der Wachposten daran gehindert, der die Einfahrt nach Stanwich Woods hütete – so hieß die Retortensiedlung in Stanwich, Connecticut, wo wir wohnten. Da der Wachmann normalerweise nichts weiter zu tun hatte, als Bewohner durchzuwinken und ansonsten Zeitschriften zu lesen, konnte ich mir lebhaft vorstellen, dass er alles andere als begeistert davon war, jetzt scharenweise Vertreter überregionaler Medien abzuwehren.
In den Schlagzeilen und Berichten ging es darum, dass mein Dad, einst aussichtsreicher Anwärter für das Amt des US-Vizepräsidenten, vor fünf Jahren seine Bewerbung überraschend zurückgezogen hatte. Nun wurde er für die nächsten Wahlen wieder als aussichtsreicher Vize-Kandidat gehandelt – oder sogar mehr. Die aktuelle Berichterstattung war jedoch vor allem von Häme geprägt und die Überschriften klangen deutlich schärfer als beim letzten Mal. Aufstrebender Kongressabgeordneter stürzt tief. Korruption im Kongress wird Starpolitiker zum Verhängnis. Walker bringt sich selbst zu Fall. Obwohl ich das Mediengeschehen von klein auf kannte, hatte es sich so noch nie angefühlt.
Mein Vater – der Abgeordnete des Repräsentantenhauses Alexander Walker – war seit meinem dritten Lebensjahr Kongressmitglied. Davor hatte er als Pflichtverteidiger gearbeitet, doch an diese Zeiten konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich kannte ihn nur als jemanden, der um die Gunst der Wähler werben, öffentlich Stellung beziehen und Wahlbezirke genau kennen musste. Die meisten Väter meiner Freunde hatten Jobs, bei denen sie irgendwann Feierabend hatten, doch das war bei meinem Dad nie der Fall. Sein Beruf war sein Leben und damit in gewisser Weise auch meins.
In meiner Kindheit war es noch nicht ganz so schlimm gewesen, aber in den letzten Jahren hatte sich vieles verändert. Schon seit geraumer Zeit gehörte ich praktisch mit zur Marke Alex Walker – als Tochter eines tüchtigen alleinerziehenden Vaters, der sich mit ganzer Kraft für die Bewohner von Connecticut einsetzte. Doch inzwischen stellte ich auch eine potenzielle Gefahr für ihn dar. Mir wurden immer wieder zahllose Beispiele von Politikerkindern vor Augen gehalten, die der Karriere ihrer Eltern geschadet oder sie zumindest bedroht hatten. Diese Vorfälle sollten mich daran erinnern, was ich unter allen Umständen zu unterlassen hatte. So durfte ich in der Öffentlichkeit oder in Hörweite der Medien keinesfalls Dinge äußern, die in irgendeiner Weise negativ interpretiert werden könnten. Ich durfte mich nicht in auch nur ansatzweise gewagten Outfits oder Situationen fotografieren lassen. In den sozialen Medien war ich zwar genauso unterwegs wie andere auch, nur wurden meine Konten von mehreren Praktikanten überwacht, und wenn ich etwas posten wollte, mussten sie es vorher freigeben. Mit dreizehn nahm ich an einer einwöchigen Medienschulung teil, und seitdem hielt ich mich meistens ziemlich eng an die Vorgaben und Texte, die für mich geprüft, entworfen und verfasst wurden. Bisher hatte ich meinem Vater oder seinem Team eigentlich noch nie Ärger gemacht.
Zumindest nicht bewusst. Einmal hatte ich bei einem Wahlkampftermin ohne nachzudenken meinen üblichen Iced Latte bestellt, was eine zweistündige Beratung seines Teams nach sich zog. Darauf folgte eine einstündige Besprechung mit mir, deren Tagesordnung ALEXANDRA lautete, obwohl mich kein Mensch so ansprach. Seit frühester Kindheit nannten mich alle nur Andie, weil ich damals den langen Namen, den meine Eltern mir gegeben hatten, partout nicht aussprechen konnte. Mehr als »Andra« brachte ich im zarten Alter von zwei Jahren noch nicht heraus, was dann irgendwann zu Andie wurde, und daran hatte sich bis heute – fünfzehn Jahre später – nichts geändert. Am Ende der Besprechung wurde entschieden, dass ich künftig auf geeisten, zuckerfreien Vanille-Latte mit Sojamilch für fünf Dollar verzichten musste, wenn die Presse in der Nähe war. Ich sollte nicht als versnobte Jugendliche angesehen werden, die das Geld zum Fenster hinauswarf, während es bei vielen Einwohnern von Connecticut kaum für das Nötigste reichte. Außerdem wollte man die Milchlobby nicht verärgern.
Und trotz alledem – obwohl wir seit Jahren übervorsichtig waren und auf kleinste Details achteten – waren wir nun heute Abend hier auf dieser Pressekonferenz. Das war eigentlich kaum zu begreifen. Allerdings hatten weder mein Vater noch ich etwas falsch gemacht, wie Peter gegenüber den Medienvertretern nicht müde wurde zu betonen. Die ganze Situation war entstanden, weil jemand aus seinem Büro (angeblich) Spendengelder, die für die Stiftung meines Vaters bestimmt waren, für dessen Wahlkampagne zweckentfremdet hatte. Als bei einer Revision festgestellt wurde, dass die Stiftung so gut wie pleite war, begannen einige Leute nachzuforschen. Und bevor ich das Ganze überhaupt begriffen hatte, war es schon zu der momentanen Lage gekommen.
Vor zwei Wochen sah mein Leben noch ganz normal aus. Mein Vater arbeitete wie üblich in Washington, für mich ging langsam das Schuljahr zu Ende, ich traf mich mit meinen Freundinnen und überlegte, wie ich am besten mit meinem Freund Zach Schluss machen könnte (bei den Schließfächern, direkt nachdem er sein Abschlusszeugnis bekommen hatte, kurz und schmerzhaft, so wie man ein Pflaster von der Haut abzieht). Vor zwei Wochen verlief mein Leben noch ganz nach Plan. Und nun war auf unserer Veranda ein Rednerpult aufgebaut.
Kurzzeitig fiel mein Blick auf eine Stelle, wo ein dickes Kabel auf dem Rasen lag und das Gras plattdrückte. Vor einem Monat hatten wir dort noch Werbefotos für Dads Herbstkampagne geschossen – mein Vater mit Sakko ohne Krawatte und ich in Rock und Kaschmirpullover. Zuvor war auf der Wiese Laub verteilt worden, um aus einem Maitag kurzerhand Oktober zu machen. Ich hatte nicht nachgefragt, ob man so etwas irgendwo fertig kaufen konnte oder ob ein Praktikant die Blätter von Hand eingefärbt hatte, weil ich es lieber gar nicht wissen wollte.
Das Shooting hatte den ganzen Tag gedauert. Erst wurden Fotos gemacht und dann noch Videos aufgenommen, wie mein Vater mit mir zusammen über den Rasen schlenderte, als ob das ganz normal wäre. Als ob wir uns vorher immer besonders schick anziehen würden, wenn wir mal eben plaudernd über die Wiese spazierten. Kurz vor Schluss hatte uns der Aufnahmeleiter seufzend angeschaut und gefragt: »Haben Sie denn keinen Hund oder so was?«
Mein Vater war wie immer mit seinem Blackberry beschäftigt gewesen, sodass es an mir war, lächelnd zu antworten: »Nein, wir sind nur zu zweit, ohne Hund.« Daraufhin nickte der Aufnahmeleiter nur und sagte etwas zu dem Mann, der den silbernen Reflektor hielt, der für das passende Licht sorgen sollte. Dann machten wir mit der nächsten Einstellung weiter, die uns als glückliche Kleinfamilie in Szene setzte.
Doch inzwischen war ich mir nicht mehr so sicher, ob die ganzen Werbematerialien mit Dads Wahlslogan TOWARD THE FUTURE jemals zum Einsatz kommen würden. Im Moment bezweifelte ich das sogar ganz stark.
»Ich möchte noch einmal betonen, dass ich von der Zweckentfremdung dieser Gelder keinerlei Kenntnis hatte«, sagte mein Dad gerade und holte mich erneut zurück in die Gegenwart. Seine Stimme klang jetzt besonders tief und seriös, und die Journalisten wurden ganz still, denn genau das interessierte sie. »Fakt ist jedoch, dass dieser Verstoß gegen die geltenden Regeln der Wahlkampffinanzierung von meinem Büro ausgegangen ist. Und da ich diesem Büro als Leiter vorstehe, muss ich dafür die Verantwortung übernehmen. Wie Sie bereits wissen, habe ich eine unabhängige Untersuchung beantragt, um sämtliche Vorgänge rückhaltlos aufzuklären. Ich habe meine Mitarbeiter angewiesen, in allen Belangen nach bestem Wissen zu kooperieren. Und solange diese Untersuchung andauert …«
An dieser Stelle holte er tief Luft und rieb mit dem Daumen über seinen Ehering. Das war so ein Tick von ihm, wenn er nervös war. Angeblich hatte er im ersten Jahr nach der Hochzeit vier Ringe verloren, weshalb meine Mutter irgendwann ein megateures Exemplar für ihn kaufte – in der Hoffnung, dass er darauf besser aufpasste. Das funktionierte auch, allerdings kontrollierte er seitdem ständig geistesabwesend, ob der Ring auch wirklich noch da war. Die Medien spielten gelegentlich darauf an, dass er ihn fünf Jahre danach immer noch trug, doch heute würde ihm vermutlich niemand aus der Reportermeute diese Frage zurufen. Es gab wesentlich sensationsträchtigere Themen auszuschlachten.
»Solange die Untersuchung andauert, werde ich mein Amt ruhen lassen. Ich bin der Auffassung, dass ich dies sowohl meinem Wahlbezirk als auch meinem Bundesstaat bis zum Abschluss der Untersuchung schuldig bin. Meine Bezüge spende ich dem Ovarialkrebs-Forschungsfond.«
Die Sache mit der Spende hatte ich vorher noch nicht gehört – im letzten Entwurf der Rede, den Peter mir vorgelesen hatte, kam sie nicht vor –, und ich bemühte mich, mir mein Erstaunen nicht anmerken zu lassen. Trotzdem fragte ich mich, ob sie diesen Punkt in letzter Minute noch ergänzt hatten oder ob sie der Ansicht waren, dass ich es nicht vorher hatte wissen müssen.
»Ich werde diese Unterbrechung meiner Arbeit im Kongress dazu nutzen, um mir darüber klar zu werden, wie es zu dieser Situation kommen konnte und um Zeit mit meiner Familie zu verbringen.« Dad sah zu mir herüber, und ich lächelte ihn genauso an, wie ich es heute Morgen mit Peter geübt hatte. Es sollte ermutigend, loyal und freundlich aussehen, durfte aber nicht zu fröhlich wirken. Ich wusste nicht, ob es mir richtig gelungen war, aber als Dad wieder nach vorn zur Presse schaute, dachte ich nur, wie absurd das ganze Theater eigentlich war, das wir hier auf unserer Veranda für die Medien inszenierten. »Diesmal werde ich im Anschluss keine Fragen beantworten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.«
Er wandte sich ab, doch die Reporter in unserem Vorgarten fingen trotzdem an, ihm Fragen zuzurufen. Ich ging auf meinen Dad zu, wie wir es vorher ebenfalls geprobt hatten, und er legte seinen Arm um meine Schultern, während jemand von innen unsere Eingangstür öffnete. Ich drehte mich kurz um und sah Peter, wie er routiniert vor die Menge trat und die Fragen zu beantworten begann, vor denen Dad sich gedrückt hatte.
Kaum waren wir drinnen, nahm mein Vater seinen Arm von meinen Schultern und ich ging ein Stück von ihm weg. Einer der Praktikanten, die Peter vorige Woche mitgebracht hatte, schloss sorgfältig die Tür hinter uns. Er nickte Dad zu und eilte dann aus dem Foyer. Die meisten Praktikanten – ich bemühte mich nie, mir ihre Namen zu merken, außer wenn einer besonders gut aussah – gingen ihm seit Bekanntwerden des Vorfalls aus dem Weg und wussten nicht genau, wie sie sich in seiner Gegenwart verhalten sollten. Normalerweise folgten sie ihm unablässig auf Schritt und Tritt und versuchten, so unverzichtbar wie möglich zu sein, um später eine feste Stelle zu bekommen. Doch jetzt benahmen sie sich, als ob mein Vater radioaktiv wäre und der bloße Kontakt zu ihm ihre Jobaussichten ruinieren könnte.
»Danke«, sagte Dad und räusperte sich. »Das war bestimmt nicht einfach für dich.«
Nur jahrelange Übung und Medientraining hielten mich davon ab, die Augen zu verdrehen. Als ob Dad sich je dafür interessiert hätte, was für mich einfach war. »Kein Problem.«
Er nickte und dann herrschte Schweigen zwischen uns. Erschrocken stellte ich fest, dass wir allein waren – ohne Peter oder ein ständig summendes Blackberry. Ich versuchte mich kurz zu erinnern, wann ich das letzte Mal Zeit mit Dad verbracht hatte – ohne dass wir dabei gespielt-locker vor einer Kamera posierten. Nach einer Weile fiel mir ein, dass es im Dezember gewesen sein musste, als wir zusammen zu einer nachweihnachtlichen Wohltätigkeitsveranstaltung gefahren waren. Er hatte versucht, mich über die Schule auszufragen, bis uns beiden schmerzlich klar geworden war, dass er keinen blassen Schimmer hatte, was bei mir gerade anstand. Nach ein paar Minuten hatten wir es aufgegeben und den Rest der Fahrt Nachrichten im Radio gehört.
Ich hob den Kopf und sah im Flur unser Spiegelbild. Erneut erschrak ich ein bisschen, als ich uns da so nebeneinander stehen sah. Ich hatte immer so aussehen wollen wie meine Mutter und in meiner Kindheit war das auch der Fall gewesen. Doch jetzt wurde ich meinem Vater mit jedem Jahr ähnlicher – das zeigte mir der Spiegel überdeutlich. Wir hatten beide Sommersprossen, kräftige kastanienfarbene Haare (eher braun als rot, außer wenn Licht darauf fiel), dichte dunkle Augenbrauen, die ich ständig in Form zupfen musste, die gleichen blauen Augen und dunklen Wimpern. Außerdem war ich genau wie er ziemlich groß und schlaksig, während meine Mutter eher klein und kurvig gewesen war und dazu blonde Locken und grüne Augen gehabt hatte. Ich wandte den Blick vom Spiegel ab und trat einen Schritt zurück. Als ich den Kopf wieder hob, zeigte das Spiegelbild nur noch Dad. Das fand ich deutlich angenehmer, als mit ihm zusammen in einen Rahmen gezwängt zu sein.
»Tja«, sagte Dad und griff in seine Jackentasche – höchstwahrscheinlich, um sein Blackberry herauszuholen. Doch plötzlich hielt er inne und ließ seine Hand wieder sinken, weil ihm offenbar einfiel, dass er es gar nicht bei sich trug. Peter hatte es ihm abgenommen, damit es nicht während der Pressekonferenz klingelte. Auch ich hatte mein Handy abgeben müssen, was wohl tatsächlich eine gute Idee war, denn meine drei besten Freundinnen neigten zu endlosen Gruppenchats. Selbst bei ausgeschaltetem Klingelton hätte mich das Vibrieren abgelenkt und vermutlich auch eine ganz eigene Sprache gesprochen – Laaaangweilige Pressekonferenz! Walkers Karriere ist ernsthaft in Gefahr und seine Tochter chattet. Mein Dad schob die Hände in die Hosentaschen und räusperte sich wieder. »Also, Andie. Diesen Sommer. Ich … äh …«
»Ich bin gar nicht da«, erinnerte ich ihn und fügte unendlich erleichtert hinzu: »Mein Sommerkurs geht übermorgen los.« Dad nickte und legte die Stirn in Falten, was mir eindeutig sagte, dass er keine Ahnung hatte, wovon ich redete, es aber nicht zugeben konnte. Trotzdem wollte er einen fürsorglichen und wissenden Eindruck machen. Das praktizierte er im Umgang mit politischen Gegnern und Wählern schon seit Jahren, und ich versuchte es mit Fassung zu tragen, dass er meine Sommerpläne nicht mehr auf dem Schirm hatte. »Das Young Scholars Program«, erklärte ich, um ihm aus seiner Verlegenheit zu helfen. »An der Johns Hopkins University.«
»Ach ja«, antwortete Dad. Sein Gesicht hellte sich auf, und ich erkannte, dass er sich tatsächlich erinnerte und nicht nur so tat, während er wartete, dass Peter ihm flüsternd auf die Sprünge half. »Natürlich.«
Dieses Programm an der Johns Hopkins gehörte zu den landesweit besten und richtete sich an Highschool-Schüler, die ein medizinisches Vorsemester am College anstrebten, Pre-med genannt. Meine Freundin Toby bezeichnete es allerdings immer als Pre-pre-med-med, was ich ihr versuchte auszureden, aber das bewirkte eher das Gegenteil. Bei diesem Sommerkurs wohnte man im Wohnheim direkt auf dem Campus, hatte vertiefenden Unterricht in Mathe und Naturwissenschaften und hospitierte bei älteren Studenten und Assistenzärzten in der Klinik. Seit ich denken konnte, wollte ich Ärztin werden. Den Medien erzählte ich immer die Geschichte, dass ich von Dad zum fünften Geburtstag ein Spielzeug-Stethoskop geschenkt bekommen hatte. Das stimmte zwar nicht, aber nachdem ich es oft genug erzählt hatte, glaubte ich langsam selbst daran. Bei meiner Bewerbung für das Programm war ich optimistisch gewesen, dass ich aufgrund meiner Noten einen Platz bekommen würde. Sie sahen in allen Fächern gut aus, besonders gut aber in Mathe und Naturwissenschaften – das war schon immer so. Und dass der ehemalige Rektor der Johns Hopkins University Dr. Daniel Rizzioli war, einer der größten Unterstützer meines Vaters, hatte auch nicht geschadet. Als er mir sein Empfehlungsschreiben überreichte, handgeschrieben auf edlem cremeweißem Briefpapier, wusste ich, dass ich den Platz sicherhatte.
Schon das ganze Jahr freute ich mich darauf, doch nach allem, was in letzter Zeit passiert war, zählte ich förmlich die Minuten bis zur Abreise. Mein Dad sollte mal ruhig hierbleiben und die ganze Sache regeln, und wenn ich dann im August wiederkam, war hoffentlich alles wieder im Lot. In zwei Tagen ging mich das alles hier jedenfalls erst einmal nichts mehr an. In achtundvierzig Stunden war ich hier weg. Ich würde in Baltimore mein Wohnheimzimmer beziehen und meine neue Mitbewohnerin Gina Flores kennenlernen – in der Hoffnung, dass ihr weitgehender Verzicht auf Satzzeichen in Kurznachrichten oder Mails nur ein Tick von ihr war und nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun hatte. Im Wohnheim würde ich mir zum x-ten Mal meinen Stundenplan durchlesen und in der Campus-Buchhandlung meine Bücher abholen. Während der Einführung würde ich dann hoffentlich einen süßen Typen als kleinen Sommerflirt entdecken. Aber das Allerwichtigste war, dass ich nicht hier sein musste.
»Bist du soweit fertig vorbereitet?«, erkundigte sich Dad, und ich fragte mich, ob das in seinen Ohren genauso seltsam klang wie in meinen – wie ein schlecht einstudierter Text, den er sich nicht richtig gemerkt hatte. »Ich meine … soll ich dich hinbringen?«
»Nein, danke«, wehrte ich hastig ab. Dass mein Vater mich bis auf den Campus brachte, womöglich noch mit einem CNN-Übertragungswagen im Schlepptau, war das Letzte, was ich brauchte. »Palmer fährt mich. Das haben wir schon ausgemacht.« Palmer Alden – eine von meinen drei besten Freundinnen – liebte Roadtrips über alles, und als sie mich dabei ertappte, wie ich Busverbindungen und Mitfahrgelegenheiten studierte, ergriff sie die Chance und fing sofort an, unsere Route zu planen, einschließlich Playlisten und Snackstops. Ihr Freund Tom wollte auch unbedingt mitkommen, weil das Gerücht kursierte, dass nächstes Schuljahr an unserer Schule das Musical Hairspray aufgeführt werden könnte. Und da die Handlung in Baltimore spielt, wollte er vor Ort schon ein bisschen recherchieren.
»Ah, sehr gut«, antwortete mein Dad. Offenbar hatte Peter draußen gerade eine Frage zu Ende beantwortet, denn plötzlich wurden die Stimmen aus der Journalistenschar lauter. Ich zuckte leicht zusammen und ging einen Schritt von der Tür weg.
»Also«, sagte ich und nickte in Richtung Küche, wo höchstwahrscheinlich mein Telefon lag. Nicht dass ich es gerade dringend brauchte, aber ich wollte das Ganze hier endlich hinter mir haben. Der ganze Tag war schon belastend genug, da mussten wir ihn nicht durch dieses peinliche Gespräch noch schlimmer machen. »Ich werd dann mal …«
»In Ordnung«, sagte Dad und bewegte seine Hand aus Gewohnheit wieder in Richtung Jackentasche, bevor es ihm wieder einfiel und er die Hand senkte. »Und ich sollte …« Er beendete den Satz nicht, sondern schaute ein bisschen ratlos zur Eingangstür. Plötzlich überkam mich ein Anfall von Mitgefühl für ihn. Schließlich hatte mein Vater sonst immer genug zu tun. Er war eigentlich permanent überlastet und sein Tag war manchmal im Minutentakt verplant. Dabei war er ständig von mehreren Mitarbeitern, Beratern, Praktikanten und Assistenten umgeben. Er war der Chef seines Teams, hatte alles im Griff und wurde respektiert. Und jetzt stand er plötzlich ohne sein BlackBerry in unserem Flur, während nur ein paar Schritte weiter die Medien ihn förmlich in der Luft zerrissen.
Doch obwohl er mir leidtat, wusste ich genau, dass ich nichts tun oder sagen konnte, was ihm helfen würde. Dad kümmerte sich um seine Probleme und ich mich um meine. Wir klärten sie selbst und behelligten den anderen nicht damit – so war das bei uns eben. Ich lächelte ihn kurz an und ging dann in Richtung Küche.
»Andie«, sagte er, als ich schon fast an der Küchentür war. »Ich …« Er sah mich einen Moment lang an, schob dann die Hände in die Hosentaschen und senkte den Blick. Er starrte auf den kratzfesten Holzfußboden, der immer noch so nagelneu aussah wie an dem Tag, als ich zum ersten Mal in diesem Haus war – als ob hier gar niemand wohnen würde. »Danke, dass du mir heute zur Seite gestanden hast. Ich weiß, das war nicht leicht. So was werde ich nicht wieder von dir verlangen, versprochen.«
Eine Erinnerung blitzte in mir auf – eine schnelle Abfolge von verschiedenen Bildern und Gefühlen. Ebenfalls eine Pressekonferenz, vor fünf Jahren. Die Hände meiner Mutter auf meinen Schultern, ihr fester Druck, während ich mich krampfhaft bemühte, im Blitzlicht der vielen Kamers nicht zu blinzeln. Wie sie sich kurz zuvor zu mir hinuntergebeugt und mir etwas zugeflüstert hatte, als wir hinter der Tür von Dads Abgeordnetenbüro standen. Dabei berührten die synthetischen Haare ihrer Perücke meine Wange und fühlten sich so ganz anders an als ihre weichen Naturlocken, die ich mir immer um die Finger gewickelt hatte, wenn ich durfte. »Und denk dran«, hatte sie leise gesagt, sodass nur ich es hören konnte, »wenn es zu dramatisch wird, was machst du dann?«
»Nein, Mom«, widersprach ich und musste mir dabei mühsam ein Grinsen verkneifen, »auf keinen Fall.«
»Doch«, antwortete sie und zupfte mein Kleid und mein Haarband zurecht. Dann fasste sie in ihre Haare und sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. »Wenn es uns zu viel wird und wir ein bisschen Ablenkung brauchen, reißt du sie einfach runter. Dann vergessen sie sofort, was sie Dad gerade fragen wollten.«
»Hör auf«, sagte ich, musste nun aber doch lächeln. Es ließ sich einfach nicht mehr unterdrücken. Als sie sich noch näher zu mir beugte, verging es mir jedoch wieder, denn mir wurde bewusst, wie schmal sie geworden war und wie gelblich ihre Haut aussah, obwohl sie sich sorgfältig geschminkt hatte. In ihrem Gesicht konnte ich die Adern erkennen, die wahrscheinlich jeder Mensch hat – nur dass sie normalerweise nicht so sichtbar waren wie bei ihr.
Die Pressekonferenz dauerte dann viel länger als erwartet, und meine Mutter ließ mich irgendwann mit meinem Dad allein, als er begann, über sie zu sprechen. Denn eigentlich ging es die ganze Zeit um sie, ihretwegen zog er sich als Anwärter auf den Posten des Vizepräsidenten zurück, obwohl alle wussten, dass er das Amt schon so gut wie innehatte. Er war der ideale Kandidat. Als ich ganz allein neben ihm stand, versuchte ich mit aller Macht nicht zu weinen, denn ich wusste genau, dass ansonsten mein tränenüberströmtes Gesicht am nächsten Tag sämtliche Titelseiten schmücken würde. Als die Pressekonferenz zu Ende war, hatte mich mein Dad umarmt und mir versprochen, dass es damit jetzt vorbei wäre und ich so etwas nie wieder machen müsste.
»Ach wirklich«, sagte ich jetzt in schärferem Tonfall, als ich eigentlich wollte. Dad blinzelte mich verwundert an, und ich hielt seinem Blick einen Moment lang stand, während ich mich fragte, ob er sich überhaupt an das letzte Mal erinnerte oder ob all seine Versprechen für ihn ineinander verschwammen und es nur ein weiteres war, das er nicht halten konnte. »Das hab ich nämlich schon mal gehört.«
Ich wollte nicht abwarten, ob er meine Anspielung verstand, weil ich sein gespielt verwundertes Gesicht vielleicht nicht noch einmal ertragen konnte – zumindest nicht in diesem Kontext. Deshalb nickte ich nur kurz und ging dann viel schneller als normal in die Küche, um das alles schleunigst hinter mir zu lassen. Plötzlich kam mir zum ersten Mal der Gedanke, dass Ratten eigentlich zu Unrecht dafür verachtet wurden, wenn sie ein sinkendes Schiff verließen. Denn indem sie flohen, solange es noch ging, bewiesen sie doch eigentlich nur ihre Klugheit. Sie sahen das drohende Unheil und brachten sich in Sicherheit. Genau wie ich.
*
PALMER
Andie!! Wie geht’s dir?
BRI
Siehst super aus auf CNN!
TOBY
Total super. Hast du das mit dem Lockenstab so hingekriegt? Was du mir übrigens schon vor Monaten zeigen wolltest?
BRI
Toby
TOBY
Was denn? Ich wollte doch nur sagen, dass sie toll aussah. Und ich das auch will.
PALMER
Wie kommst du klar?
In meinem Zimmer fühlte ich mich endlich sicher. Ich schaute auf mein Telefon und konnte wieder lächeln, zum allerersten Mal an diesem Tag. Es war tatsächlich eine gute Idee von Peter gewesen, mein Handy einzuziehen, denn dieser Chat hatte etwa um die Zeit begonnen, als mein Vater zum Schluss seiner Rede kam.
Mit dem Telefon in der Hand ging ich zu meinem Bett hinüber. Obwohl wir schon seit fünf Jahren in diesem Haus wohnten, hatte sich in meinem Zimmer seit unserem Einzug kaum etwas verändert. Es war von Profis eingerichtet worden, die jedoch sicher nicht wussten, dass es sich um ein Jugendzimmer handelte. Alles war in gedeckten Grau- und Beigetönen gehalten, dezent gemustert, und passte perfekt zusammen, wie aus dem Katalog. Selbst nach so langer Zeit fühlte ich mich hier manchmal immer noch wie im Hotel. Auf der Kommode hatte ich zwar meinen Schmuck, mein Schminkzeug und Bilderrahmen mit Fotos meiner Freunde deponiert und auf dem Stuhl in der Ecke lagen getragene Kleidungsstücke, aber abgesehen davon deutete in diesem Raum kaum etwas auf mich hin. Ich ließ mich auf das Bett fallen und machte es mir zwischen den Dekokissen bequem, da solche Gruppenchats manchmal Stunden dauern konnten.
Ich las die letzte Nachricht, die von Palmer, noch einmal und zögerte mit einer Antwort, obwohl mein Daumen schon über dem Display schwebte. Dann beugte ich meinen Kopf zum Fenster über dem Bett, das leicht geöffnet war, sodass die Stimmen von draußen zu mir hereindrangen. Ich schaute hinaus und sah, dass die Pressekonferenz offenbar zu Ende war. Leute liefen über den Rasen und Peter stand nicht mehr auf dem Podium.
Ich kehrte dem Geschehen draußen den Rücken und hoffte, dass alle wieder verschwunden sein würden, wenn ich das nächste Mal aus dem Fenster sah, und nur noch das plattgetretene Gras daran erinnerte, was sich hier vor Kurzem abgespielt hatte.
ICH
Ok bei mir.
PALMER
Echt?
BRI
ECHT?
TOBY
?
ICH
Total. Die Pressekonferenz hat genervt, aber das ist Dads Ding, nicht meins.
BRI
Hm
ICH
Was ist?
TOBY
Sie will sagen, dass sie das nicht glaubt.
PALMER
Woher weißt du das denn?
BRI
Toby hat recht. Ich glaub’s echt nicht. Können wir ja später klären.
ICH
Gibt nichts zu klären.
BRI
Doch, gibt’s wohl.
TOBY
Und wenn wir schon beim Klären sind, kannst du mir dann auch gleich das mit dem Lockenstab zeigen?
PALMER
Toby, ich dachte, wir wollten sie aufmuntern.
TOBY
MACH ich doch! Ich wollte sogar zu Andie rüberfahren und für sie da sein, aber der Wachmann am Tor hat mich nicht durchgelassen.
ICH
Was? Du durftest nicht rein?
TOBY
Nein! Da musste man auf irgendeiner Liste stehen, nationale Sicherheit, keine Ahnung.
ICH
Sorry, T. Sobald die Medien weg sind, müsste alles wieder normal laufen.
TOBY
Na ja, war schon nervig. Als ob ich jemand Fremdes wäre. Wir kennen uns doch schon ewig, Ronnie und ich.
PALMER
Er heißt Earl.
TOBY
Oh
PALMER
Egal.
Wir treffen uns auf jeden Fall heute Abend.
ICH
Ach so?
BRI
Yep. Das ist dringend nötig und wir haben es beschlossen.
TOBY
Genau. Das hab ich Ronnie auch gesagt.
PALMER
Earl
BRI
Heute steht eine Party an. Da gehen wir alle hin. Kannst du nach dem ganzen Zeug sicher gut gebrauchen.
Ich drehte mich um und schaute wieder aus dem Fenster, wo die Pressemeute sich längst nicht so schnell zerstreute, wie ich gehofft hatte. Etliche Reporter standen noch vor dem Haus und fassten vor der Kamera die Ereignisse noch einmal zusammen. Es sah nicht so aus, als ob ich hier so bald unbemerkt wegkommen würde.
ICH
Weiß nicht, ob das geht, Mädels.
TOBY
PALMER
Doch, das geht!
BRI
Mach dir keinen Kopf
PALMER
Wir kriegen das schon hin.
ICH
Aber die Presse ist immer noch hier. Wir müssten mich irgendwie heimlich hier rausschmuggeln … Keine Ahnung, ob das geht.
TOBY
Andie, bleib COOL. Wir haben einen Plan.
Während ich den letzten Satz mehrmals las, merkte ich, wie ich leicht nervös wurde. Es beunruhigte mich, dass mir offenbar niemand verraten wollte, wie dieser Plan aussah. Vor allem weil er von Toby stammte. Ich rückte noch ein Stück näher an mein Fenster heran und schob es etwas weiter auf, ohne dass mich jemand sah. Eine Reporterin stand wahrscheinlich in unmittelbarer Nähe, denn plötzlich klang ihre Stimme klar und deutlich zu mir herauf.
»Zuletzt stand der Kongressabgeordnete Walker vor fünf Jahren in vergleichbarer Weise im Licht der Öffentlichkeit, als er sich aufgrund der schweren Erkrankung seiner Frau unerwartet aus dem erfolglosen Präsidentschaftswahlkampf von Gouverneur Matthew Laughlin zurückzog, obwohl er als aussichtsreichster Anwärter für das Amt des Vizepräsidenten galt. Seine Frau Molly Walker starb sechs Wochen später an Eierstockkrebs. Es ist noch unklar, was diese jüngsten Ereignisse für die Zukunft des Politikers bedeuten …«
Ich knallte das Fenster zu, damit ich der Reporterin vor unserem Haus nicht länger zuhören musste, und nahm mein Handy wieder in die Hand.
ICH
Party klingt super.
Bin dabei.
2
»Okay«, hörte ich Palmer sagen, als der Wagen langsamer wurde und dann links abbog. »Wir sind fast da. Andie, alles klar bei dir?«
»Hmpf«, murmelte ich. »Könnte besser sein.« Ich lag zwischen den Sitzen am Boden von Palmers Minivan, unter einer Decke voller Staub und Katzenhaaren versteckt.
»Dauert echt nicht mehr lange«, versicherte mir Brie von oben, und etwas, das sich verdächtig nach Fuß anfühlte, klopfte mir auf die Schulter.
»Aber wir gehen lieber auf Nummer sicher«, hörte ich Toby sagen. Sie hatte gut reden, schließlich musste sie nicht die ganze Zeit krampfhaft vermeiden, durch die Nase zu atmen.
»Toby, muss ich hier nach rechts?«, fragte Palmer, während das Auto immer langsamer fuhr und schließlich anhielt.
»Nach Ardmore?«, meldete ich mich von unten zu Wort und nieste dann zweimal. »Da musst du links abbiegen und dann noch mal rechts.«
»Woher willst du das denn wissen?« Ein Zipfel meiner Decke wurde angehoben und ich sah Bri – oder zumindest ein Stück von ihr in Form großer brauner Augen und eines schrägen Ponys. »Du kannst doch gar nichts sehen.«
»Sie erzählt einfach irgendwas«, sagte Toby und die Decke wurde wieder runtergelassen.
»Guck doch auf die Karte«, rief ich unter der Decke hervor und bekam dann einen Hustenanfall, weil ich zu viel Staub eingeatmet hatte.
»Also …«, sagte Toby, gefolgt von einer langen Pause, in der sie wahrscheinlich auf ihrem Handy die Route überprüfte. »Es stimmt«, hörte ich sie dann sagen, was allerdings eher genervt als beeindruckt klang.
»Sag ich doch.« Ich hatte zwar nicht die gesamte Strecke seit der Abfahrt bei mir zu Hause mitverfolgt, aber manche Angewohnheiten ließen sich nicht so leicht abstellen, und ich wusste nun einmal gern, wo ich war und wie ich irgendwo hinkam. Deshalb fuhren mir auch immer alle hinterher, wenn wir mit mehreren Autos unterwegs waren.
»Los, fahr schnell im Kreis, um sie durcheinanderzubringen«, schlug Toby vor und ich hörte Brie lachen.
»Ich glaub nicht, dass die Party diesen Aufwand lohnt«, sagte ich, als der Wagen wie erwartet erst links abbog und dann noch einmal rechts. Schließlich verringerte sich das Tempo noch weiter, und es kam mir vor, als ob wir auf dem Seitenstreifen fuhren. Erstaunlich, wie viel man vom Boden aus mitbekam.
Wie sich herausstellte, stammte der Plan, wie ich zu dieser Party geschmuggelt werden sollte, von Palmer. Ihre Hartnäckigkeit beeindruckte mich schon ein bisschen. Palmer wohnte auch in Stanwich Woods, nur drei Häuser weiter. Nach der Pressekonferenz war sie ein bisschen herumspaziert, um die Lage auszukundschaften, und hatte gesehen, dass vor dem Tor zu unserer Wohnsiedlung noch mehrere Übertragungswagen standen, obwohl die Medien eigentlich längst weg sein sollten. Wahrscheinlich hofften sie auf ein bisschen Bonusmaterial.
Sie hatte mich zu Hause abgeholt und dann – unter der Decke verborgen – an den Medienfahrzeugen vorbeigeschleust. Obwohl ich ziemlich sicher war, dass uns niemand folgte, blieb ich auf dem Weg zu Toby und Bri weiter auf Tauchstation. Zum Glück konnten wir die beiden zusammen abholen – wie eigentlich fast immer. Wir vier waren eng befreundet, aber Toby und Bri waren wirklich supereng und praktisch unzertrennlich.
Nachdem wir sie eingesammelt hatten, fuhren wir zum Glück direkt weiter zur Party, denn viel länger hätte ich es unter der Decke nicht mehr ausgehalten. Obwohl ich darunter nur mühsam Luft bekam, war ich doch froh über diese Vorsichtsmaßnahme. Denn wenn die Öffentlichkeit erfahren hätte, dass ich nach dem Auftritt als verantwortungsvolle Tochter umgehend feiern ging, wäre das sicher nicht gut angekommen.
»Na klar lohnt sich die Party«, hörte ich Brie sagen und kurz darauf wurde meine Decke hochgerissen. Ich blinzelte und versuchte von dem ganzen Staub, der dadurch im Wagen herumwirbelte, nicht sofort einen Niesanfall zu bekommen.
»Luft«, seufzte ich dankbar, atmete tief durch und setzte mich auf. Neugierig sah ich mich um und versuchte zu erkennen, wo wir geparkt hatten und ob in der Nähe noch andere Autos standen. »Sind wir weit genug weg vom Haus?«
»Ja«, antwortete Palmer auf dem Fahrersitz und drehte sich zu mir um. Da es in Stanwich kaum Kriminalität, aber trotzdem reichlich Polizeikräfte gab, bestand deren Hauptbeschäftigung am Wochenende darin, Teenager-Partys aufzulösen. Und der wichtigste Hinweis auf solche Events waren massenhaft wild parkende Autos rund um eine Einfahrt. Deshalb war es üblich, dass man als Partygast sein Auto ein gutes Stück entfernt abstellte und zu Fuß zum jeweiligen Haus ging, um keinen Verdacht zu erregen. Ich parkte allerdings immer noch weiter weg als andere, um jedes Risiko garantiert auszuschließen. »Andie, ist schon okay. Mach dir keine Sorgen, sondern hab einfach einen netten Abend. Den kannst du nämlich gebrauchen.«
»Genau«, sagte Bri, die neben mir saß. »Das haben wir so beschlossen.«
»Stimmt«, pflichtete ihr Toby vom Beifahrersitz aus bei, während sie die Sonnenblende herunterzog, den Spiegel aufklappte und dabei ihr Schminkzeug aus der Tasche holte. Wir hatten schon vor Jahren herausgefunden, dass wir Toby nur dann vor Mitternacht aus dem Haus bekamen, wenn sie ihr Outfit nicht selbst aussuchte, sondern mehrere Varianten mitbrachte, über die wir dann im Auto abstimmten. Um Haare und Make-up kümmerte sie sich unterwegs. Palmer war allerdings dagegen, dass sie sich während der Fahrt die Augen schminkte, sodass wir hier wahrscheinlich noch eine Weile stehen würden.
»Was genau habt ihr beschlossen?«, fragte ich, wischte ein paar Fusseln von meiner Schulter und unterdrückte wieder ein Niesen.
»Dass wir heute Abend feiern gehen«, sagte Bri. »Und wir wollten …«
»… dass du dabei ist«, beendete Toby den Satz, während sie anfing ihre Wimpern zu tuschen. »Und zwar unbedingt.«
»Genau.« Bri nickte und Toby streckte eine Faust nach hinten, ohne den Blick vom Spiegel zu wenden. Ich schüttelte den Kopf, musste aber lächeln. Das war die typische B&T-Show, wie Palmer und ich es immer nannten. Bri und Toby waren seit dem Kindergarten beste Freundinnen und bildeten eine so feste Einheit, dass sie ständig verwechselt wurden, obwohl sie sich kein bisschen ähnlich sahen.
Sabrina Choudhury und Tobyhanna Mlynarczyk hatten mich am ersten Schultag der dritten Klasse angesprochen, als ich neu war, in der Pause ganz allein auf einer Bank saß und versuchte, ein seltsames Spiel mit einem großen Gummiball zu verstehen. Von der Canfield Prep, meiner bisherigen Schule, kannte ich das nicht. Der Wechsel war nötig geworden, nachdem eine Umfrage ergeben hatte, dass viele Leute – einschließlich der Lehrergewerkschaft – es nicht gut fanden, dass mein Vater seine Tochter auf eine Privatschule schickte. Ich fühlte mich so fremd wie in einem anderen Land, als sich plötzlich zwei Mädchen zu mir setzten, eine links und eine rechts. Schon damals waren Bri und Toby ständig im Doppelpack unterwegs. Sie diskutierten über meinen Kopf hinweg, welcher Sänger einer Boygroup der süßeste wäre, und forderten mich auf, ihren Streit zu schlichten. Offenbar entschied ich mich richtig – indem ich für Wade stimmte, den keine von beiden am tollsten fand – und von diesem Moment an waren wir Freundinnen. Mit Palmer freundete ich mich an, als ich mit zwölf in ihre Nähe zog. Vor Beginn der neunten Klasse überredete sie dann ihre Eltern, sie von der Stanwich Country Day ebenfalls auf die staatliche Highschool wechseln zu lassen. Als Palmer dort Toby und Bri kennenlernte, verstanden sie sich auf Anhieb und von da an gab es unsere Clique, und es war so, als ob sie von vornherein so gedacht gewesen war.
»Nett von euch«, sagte ich, griff nach Bris ausgestreckter Hand und zog mich daran vom Boden hoch. Ich setzte mich auf den Platz neben ihr, klopfte den Schmutz von meiner Jeans und war erleichtert, dass ich nichts Weißes angezogen hatte. »Aber ich sag euch, mir geht’s prima.«
»Glauben wir dir aber nicht«, widersprach Toby und sah mich im Spiegel an, während sie anfing ihre Lippen zu schminken.
»Kann ich mir den mal ausborgen?«, fragte ich, woraufhin Toby mir nickend ihren Lippenstift reichte. »Wisst ihr«, sagte ich und beugte mich über Toby hinweg, um einen Blick in den Spiegel zu erhaschen, »das Ganze hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Es geht nur meinen Dad was an und der wird die Sache schon regeln.«
»Und wenn er es nicht hinkriegt?«, fragte Palmer vorsichtig.
»Dann nimmt er halt einen von den Jobs in der Wirtschaft an, die er dauernd angeboten bekommt«, antwortete ich und versuchte mich auf meine Lippenkontur zu konzentrieren. »Oder er hält eine Zeit lang Vorträge oder arbeitet erst mal wieder als Anwalt und kandidiert dann später noch mal.« Dass mein Dad der Politik den Rücken kehrt, war nahezu unvorstellbar, denn sie war praktisch ein Teil von ihm. »Für mich ändert sich gar nichts. Ich fahre trotzdem zu meinem Sommerkurs, und wenn ich wiederkomme, ist der Fall erledigt.« Ich schob den Deckel auf den Lippenstift und gab ihn Toby zurück. »Können wir?«
»Okay«, sagte Toby und schloss den Reißverschluss ihrer Schminktasche. Wir stiegen aus dem Wagen, und ich schaute umher, um mich zu orientieren.
»Bei wem steigt das Ganze noch mal?«, wollte Toby wissen. Sie zupfte ihren Rock zurecht, den sie während der Fahrt angezogen hatte. Bei der Kleiderdebatte hatte sie meine durch die Decke gerufenen Hinweise ignoriert, obwohl ich auch ohne sie zu sehen genau wusste, um welche Teile es ging.
»Bei Kevin Castillo«, antwortete ich sofort. Das war meine erste Frage gewesen, als Palmer mir von ihrem Plan erzählt hatte. Ich war schon öfter dort auf Partys gewesen, was für mich ein klarer Vorteil war. In fremden Wohnungen musste ich immer erst mal Ausschau nach Notausgängen und Fluchtwegen halten, um im Ernstfall vorbereitet zu sein.
»Verspricht also super zu werden«, sagte Palmer und sah mich vielsagend an. »Erinnerst du dich noch an die Party bei ihm im März?«
»Vage«, antwortete ich und musste lächeln, als ich an die ausgedehnten Trinkspielrunden dachte, nach denen wir dann um vier Uhr morgens in einem Diner aufschlugen, wo wir Riesenportionen Pommes bestellten und viel zu laut lachten.
»Wo ist es denn nun?«, fragte Bri und ich deutete die Straße hinunter.
»Da lang«, sagte ich.
Palmer nickte. »500 Meter ungefähr.« Seufzend zog Toby ihre Absatzschuhe aus, beschwerte sich jedoch nicht. Wir wussten alle, was auf dem Spiel stand. Und heute Abend war es besonders wichtig, nicht erwischt zu werden.
Einmal hatte ich miterlebt, als es passierte. Das war in meinem ersten Jahr an der Highschool gewesen, als ich zum zweiten Mal überhaupt auf einer richtig coolen Party war und alles unfassbar toll und aufregend fand. Mitgenommen hatte uns Palmers Bruder Josh, der schon in die zwölfte Klasse ging. Seine Bedingung lautete, dass wir uns nicht kannten, falls sich jemand über die Anwesenheit von Neuntklässlern wie uns beschweren sollte. Ich trank gerade Bier aus einem der üblichen roten Plastikbecher (klarer Anfängerfehler, denn damals kannte ich die Tricks noch nicht, die später Standard bei Partys wurden), als das Licht von Rundumleuchten durch das Wohnzimmerfenster hereinfiel und alles in Rotblau tauchte. Einen Augenblick lang war die gesamte Partymeute wie erstarrt, ehe alles in Bewegung geriet und in sämtliche Himmelsrichtungen auseinanderstob – zum Auto oder irgendwie in Deckung, um keinesfalls erwischt zu werden. Zu meiner Aufregung über den Besuch einer derart angesagten Party kam in dem Moment noch die panische Angst vor der Polizei hinzu, sodass ich am ganzen Körper anfing zu zittern. Als Minderjährige auf einer Party mit Alkohol ertappt zu werden, wäre sehr, sehr problematisch für meinen Vater geworden.
Aber ich wurde nicht erwischt – sondern im letzten Moment aus der Gefahrenzone geholt. Diese kritische Situation hatte mir jedoch einen kapitalen Schrecken eingejagt. Meine Freundinnen wussten, dass ich nie auf eine allzu offensichtliche Party gehen würde, und wenn wir doch feiern gingen, hatte ich diverse Strategien, um nicht weiter aufzufallen. Selbst jetzt, als wir im Gänsemarsch am Straßenrand entlangliefen, waren meine Sinne geschärft, und ich kontrollierte, ob nicht zu viele parkende Autos herumstanden, dass uns niemand zu lange anstarrte und man uns nicht ansah, was wir vorhatten. Ich wollte mir lieber nicht vorstellen, was die Medien daraus machen würden, wenn sie mich – heute oder sonst irgendwann – auf einer Party erwischten. Das wäre ungefähr so, als wollte man einen Waldbrand mit Benzin löschen.
Nachdem wir eine Weile gelaufen waren, räusperte sich Toby. »Mädels«, sagte sie in feierlichem Tonfall. »Bei dieser Party heute Abend muss was passieren. Damit endlich der Bann gebrochen wird. Ich will nämlich nicht noch einen Sommer ohne Freund verbringen.«
»Ich assistiere dir«, sagte Palmer sofort. »Heute gehen wir es an.«
»Nein«, lehnte Toby entschieden ab. »Du bist ein für alle Mal gefeuert als Assistentin. Als du es das letzte Mal versucht hast, wollten sich alle Jungs nur mit dir verabreden und Tom war stinksauer auf mich.«
Palmer wollte protestieren, doch ich schüttelte den Kopf. »Da hat Toby schon recht, P.«
»Du kannst ja nichts dafür, dass du blond bist«, ergänzte Bri. Ich musste lachen, weil Palmers Gesichtsausdruck blitzschnell von leicht angesäuert zu ernsthaft verlegen mutierte. Palmer sah super aus, war sich dessen aber überhaupt nicht bewusst. Sie hatte lange und kräftige blonde Haare, die gegen Ende des Sommers noch deutlich heller sein würden. Sie war einen Kopf kleiner als ich und gertenschlank, obwohl sie uns alle unter den Tisch essen konnte. Außerdem lachte sie deutlich mehr als andere Leute. Wenn man Palmer kennenlernte, wollte man sofort mit ihr befreundet sein.
»Ich mach die Assistentin«, erklärte ich. »Wonach soll ich Ausschau halten? Stehst du immer noch auf so Fransenhaare?«
»Aussehen interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht«, sagte Toby sehnsuchtsvoll. »Mein Blick wandert durch den Raum, die Menge teilt sich, da steht er … und ich weiß, dass er es ist.« Bri, Palmer und ich sahen uns vielsagend an, doch niemand sagte etwas. Bei jeder von uns gab es Dinge, über die wir keine Witze machten, und bei Toby war es das Thema Liebe.
Sie hatte das Pech, mit einer Babysitterin aufgewachsen zu sein, die regelmäßig DVDs mit romantischen Komödien mitbrachte, wenn sie auf Toby aufpasste. Toby hatte diese Filme förmlich verschlungen und somit in viel zu zartem Alter mit angesehen, wie Julia Roberts ihren Deal mit Richard Gere aushandelte und dabei ihr Herz verlor. Und sie sah zu, wie Meg Ryan die Nase krauszog und dann in Tränen ausbrach und wie Bridget Jones auf der Suche nach Mark Darcy durch die verschneiten Londoner Straßen lief. Wenn Toby nicht dabei war, waren wir drei anderen uns vollkommen einig, dass diese Filme ihre Vorstellung von Romantik ein für alle Mal verdorben hatten. Sie rechnete fest damit, dass sie solche Szenen tatsächlich erleben würde, und stellte sich allen Ernstes die Liebe genau so vor. Sie wartete nur darauf, dass Jungs mit dem Ghettoblaster vor ihrem Fenster auftauchten und offenbarten, wie toll sie Toby fanden. Außerdem versuchte sie immer, Bri zu ihrem kühnen Sidekick zu machen – auch wenn sie das entschieden abstritt.
Ich habe immer wieder versucht ihr zu erklären, dass Romantik im echten Leben völlig anders aussieht als im Kino und dass es sinnlos ist, auf solche filmreifen Szenen zu hoffen. Dass es einfach nur darum geht, einen Jungen zu finden, mit dem man sich wohlfühlt, der gut küssen kann und witzig ist. Wir anderen hatten weniger unrealistische Erwartungen an die Liebe. Palmer und Tom waren so gut wie miteinander verheiratet und Bri hatte immer drei- bis viermonatige Affären mit älteren Mitschülern. Aber Toby rechnete fest mit dem großen Happy End, für das sie noch zum Flughafen hetzen musste, um jemandem in letzter Minute ihre Liebe zu gestehen. Aus genau diesem Grund, da war ich mir ganz sicher, hatte sie noch nie einen festen Freund gehabt. Denn sie fragte sich bei jedem Typen, ob er ihr Happy End war – was die Jungs natürlich regelmäßig ausflippen ließ.
»Hey … vielleicht solltest du dir nicht so viel Druck machen?«, fragte ich vorsichtig. »Amüsier dich doch einfach.«
»Du hast gut reden, Andie«, antwortete Toby höhnisch. »Du hast doch ständig einen Freund.«
»Im Moment nicht«, korrigierte sie Palmer.
»Aber meistens schon«, pflichtete Bri Toby wie üblich bei. »Mindestens 60 Prozent der Zeit, schätze ich mal.«
»Eher 75 Prozent«, meinte Toby.
»Der arme Zach«, sagte Palmer und seufzte übertrieben. »Den fand ich echt nett.«
»Wir sollten aufhören, uns ihre Namen zu merken«, schlug Bri mit todernstem Gesicht vor, woraufhin Toby grinste.
»Spitzenidee«, sagte sie. »Das macht alles viel einfacher. Dem nächsten verpass ich einfach nur einen Spitznamen.«
»Sehr witzig.« Ich versuchte ihr einen strengen Blick zuzuwerfen, gab es jedoch schnell auf, weil ich lachen musste. Eigentlich hatten sie ja recht. Nach meinen Trennungen stichelten sie meistens und nannten mich notorische Herzensbrecherin. Dabei war das gar keine Absicht, sondern entwickelte sich halt einfach so. Zuerst verliebte ich mich in jemanden, was meistens deutlich länger andauerte als die tatsächliche Pärchenphase. Währenddessen konnte ich an nichts anderes mehr denken und redete praktisch nur noch von ihm. Ich verbrachte beim Anziehen viel zu viel Zeit vor dem Spiegel, für den Fall, dass ich ihn zufällig traf. Dann waren wir richtig zusammen und ungefähr eine Woche lang lief es auch richtig super. Knutschen ohne Ende, Schmetterlinge im Bauch, Glückstaumel, Händchen halten und stundenlanges Reden – entweder live oder spätabends am Telefon. Doch sobald die dritte Woche kam, fing er an mehr zu wollen und ich wurde langsam nervös. Es wurde mir dann immer zu viel – körperlich oder emotional. Ich konnte auch nicht verstehen, warum Jungs dauernd mit mir über Gefühle reden wollten. Dazu waren doch meine Freundinnen da. Wieso war es nicht möglich, alles ein bisschen locker anzugehen? Entspannt, lustig und nicht mehr als Knutschen.
Jedenfalls waren offenbar nur drei Wochen bei mir drin. Wenn meine Freundinnen das erwähnten, führte ich immer meine Beziehung mit Travis Friedman an, die geschlagene fünf Wochen gehalten hatte, doch das zählte angeblich nicht, weil zwei Wochen davon Winterferien gewesen waren. Aber so war das bei mir eben und ich fand es okay. Wenn ich (oder er) dann Schluss machte, brauchte ich ein paar Wochen, um darüber hinwegzukommen, und musste mich dabei mit reichlich Mädchenpower-Musik und Eis trösten. Meistens dauerte es aber nicht lange, bis ich wieder für jemand Neues schwärmte und das Ganze von vorn losging. Für mich war das in Ordnung. Denn ehrlich gesagt konnte ich nicht ganz nachvollziehen, wozu aus einer Beziehung unter Jugendlichen etwas Ernstes werden sollte. Wir waren doch noch Schüler. Da sollte man es erst mal entspannt angehen lassen und erst am College oder an der Uni nach einer ernsthaften Beziehung Ausschau halten.
»Moment mal. Wieso hast du es denn plötzlich so eilig?«, fragte Palmer und drehte sich zu Toby um. »Was ist mit Wyatt?«
Toby schüttelte den Kopf. »Der ist noch nicht wieder da.«
»Vielleicht doch«, antwortete Bri. »Gestern hat er ein Bild gepostet, das aussah, als hätte er es hier in der Stadt geschossen.«
»Wie jetzt?«, rief Toby, blieb abrupt stehen – wobei sie fast eine Kollision verursachte – und fing an, in ihrer Tasche nach dem Handy zu wühlen. Hektisch wischte sie darauf herum. »Das hätte doch ganz oben in meiner Timeline stehen müssen! Warum habt ihr mir das nicht erzählt?«
»Ich hatte keine Ahnung«, sagte ich, hob die Hände und machte ein unschuldiges Gesicht.
Wyatt Miller wohnte im Internat in Massachusetts. Seine Familie lebte jedoch in Stanwich, sodass er die Sommerferien immer hier verbrachte. Wir hatten ihn voriges Jahr kennengelernt, als er am Strandimbiss jobbte, und irgendwann bekamen wir bei ihm Pommes und Getränke praktisch kostenlos. Wir freundeten uns an – Wyatt und mein Sommerflirt Nick verstanden sich bestens –, und es dauerte nicht lange, bis Toby sich heftig in ihn verliebte. Damals war er allerdings noch mit seiner Freundin aus dem Internat zusammen, sodass den Sommer über nichts passierte. Als Toby dann jedoch mitbekam, dass die beiden sich um den Valentinstag herum getrennt hatten, sah sie ihren großen Moment gekommen. Sie fragte ihn, ob er sie zum Abschlussball der Junior Highschool begleiten wollte, und war völlig aus dem Häuschen, als er zusagte – obwohl er immer wieder betonte, dass sie ein rein freundschaftliches Paar wären. Bei der anschließenden Party, auf der ich meinen Begleiter abservierte, weil der Ball total nervig war, hatten Toby und Wyatt ziemlich angeheitert herumgeknutscht. Toby war danach fest davon überzeugt gewesen, dass Wyatt echte Gefühle für sie hegte, obwohl wir ihr alle – erst behutsam und dann immer deutlicher – zu verstehen gaben, dass es vermutlich nur an der geballten Kombination von Alkohol und Schmusesongs lag. Toby hatte noch versucht, die Dinge am Laufen zu halten, nachdem Wyatt wieder im Internat war, aber Wyatt war wieder dazu übergegangen, sie so zu behandeln wie uns alle – rein platonisch.
»O mein Gott, ich glaube, ihr habt recht«, quiekte Tony mit jedem Wort einen Ton höher, während sie blinzelnd auf das im Dunkeln viel zu grelle Display schielte. »Wieso hat er sich denn nicht gemeldet? O mein Gott!«
»Psst«, machte ich und sah mich erschrocken um, weil ich keine unnötige Aufmerksamkeit erregen wollte.
Toby nickte und schaute wieder auf ihr Handy. »O mein Gott«, entfuhr es ihr wieder, diesmal allerdings im Flüsterton.
»Okay«, sagte Palmer und blieb vor einem weißen Haus stehen, das sich zum Glück kein bisschen von den anderen in der Umgebung unterschied – keinerlei Anzeichen für eine Party also. Nur wenn man genau auf die Musik hörte, die gedämpft von drinnen kam, wusste man Bescheid. »Alle bereit? Andie?« Ich nickte, griff in meine Tasche und reichte ihr meine drei viertel volle Flasche Cola light. »Besondere Wünsche?«
»Alles außer Brandy«, antwortete ich und verzog das Gesicht. »Die Mischung ging gar nicht.«
Palmer nickte und ging voran in Richtung Haustür. Den Gastgeber Kevin kannte ich nur flüchtig. Wir grüßten uns zwar in der Schule, aber unterhalten hatte ich mich noch nie mit ihm. Daher war ich froh, dass Palmer die Führung übernahm. Ich hörte Bri und Toby über irgendetwas lachen und folgte Palmer ins Haus. Drinnen sah alles aus wie immer bei Partys: Grüppchen standen herum oder hatten es sich auf dem Sofa bequem gemacht, und auf dem Couchtisch war eine ziemlich große Runde für ein Trinkspiel vorbereitet. In der Küche standen ein halb voller Standmixer und Unmengen von Flaschen und Cocktailshakern herum. Durch die offene Terrassentür konnte ich ein Bierfass sehen. Die Leute, die sich immer mit der Zigarette in den hintersten Gartenwinkel verdrückten, standen in ihrer üblichen Raucherrunde zusammen. Und in einer dunklen Wohnzimmerecke stand ein Pärchen so eng aneinander, dass es sicher nicht mehr lange dauerte, bis sie anfingen zu knutschen.
Palmer steuerte ohne Umwege die Alkoholvorräte an, während Toby und Bri nach draußen zum Bierfass gingen und ich mich drinnen genauer umsah. Obwohl ich ihm keine Nachricht geschrieben hatte, ahnte ich, dass er auch hier war. Ich hatte mitbekommen, dass er und seine letzte Freundin sich etwa zur gleichen Zeit getrennt hatten wie ich mich von Zach. Das hieß also, wir waren beide zur gleichen Zeit Single, was schon länger nicht mehr vorgekommen war. Ich wollte gerade meine Suche im Haus aufgeben und draußen nach ihm Ausschau halten, als ein Mädchen aus meinem Chemie-Leistungskurs zur Seite trat. Und da sah ich ihn, wie er gelangweilt am Küchentresen lehnte. Topher Fitzpatrick.
Mein Puls beschleunigte sich, wie immer, wenn ich ihn sah. Da er mich noch nicht entdeckt hatte, beobachtete ich ihn noch ein bisschen. Ein zierliches Mädchen, das ich nicht kannte, unterhielt sich mit ihm. Sie lachte ihn an, und er schenkte ihr ein Lächeln, das sie wahrscheinlich für echt hielt und als Einladung verstand, weiter mit ihm zu plaudern. Aber ich wusste genau, dass sie sich täuschte. Denn inzwischen kannte ich ihn besser als die meisten anderen.
Er hob kurz den Kopf und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Da entdeckte er mich. Ich sah ihn nur kurz an, wusste aber sofort, dass dieser Abend sich für mich in eine angenehme Richtung entwickelte.
»Hier«, sagte Palmer, die mit der zugeschraubten Colaflasche neben mir auftauchte. »Rum. Mein Privatmix für dich.«
»Danke«, antwortete ich und nahm die Flasche lächelnd entgegen. Das war die einzige Form, in der ich mir Partydrinks zugestand. Falls irgendwo Bilder von diesem Abend gepostet wurden, sah man mich darauf nur mit einer Flasche Cola light in der Hand. Ich wusste nur allzu genau, dass schon ein mit dem Handyfoto geschossenes Profilbild von irgendwem ausreichte, um in den Medien krasse Wellen zu schlagen, wenn ich darauf im Hintergrund mit einem Bier oder sonstigem undefinierbarem Getränk zu sehen war. Ich schraubte den Deckel auf, trank einen großen Schluck und spürte schnell die Wirkung des Rums.
»Oh, schau mal, wer da ist«, sagte Palmer, als ihr Blick in Richtung Küche fiel. Seufzend sah sie mich an. »Andie.«
»Ich weiß.« Topher unterhielt sich immer noch mit dem zierlichen Mädchen und trank dabei aus einer Spriteflasche, die garantiert nicht nur Sprite enthielt. Schließlich hatte er mir solche Tricks beigebracht.
»Was ist denn?«, fragte Toby, die sich mit einem Bier, das hauptsächlich aus Schaum bestand, zu uns gesellte. Toby war noch nie gut im Bierzapfen gewesen. Sie verfolgte Palmers Blick und sah dann zu mir. »Kommt der Joker wieder zum Einsatz?«
»Hör schon auf«, sagte ich.
»Du weißt, dass wir das nicht gutheißen«, verkündete Palmer mit gespielter Strenge.
Ich nickte. »Ist notiert.« Ich hatte es schon vor Jahren aufgegeben, Topher ihnen gegenüber zu verteidigen. Er konnte wirklich charmant sein, wenn er wollte. Nur wenn meine Freundinnen dabei waren, hatte er nie Lust dazu.
»Nicht wir, Palmer, nur du«, korrigierte Toby und trank einen Schluck Bier. »Ich finde es ja total romantisch. Wie Harry und Sally, die umeinander herumschleichen, bis sie sich endlich ihre wahren Gefühle gestehen können.«
Palmer schüttelte den Kopf. »Ich glaub nicht, dass zwischen den beiden so was läuft.«
»Was weißt du denn schon?«, gab Toby zurück.
»Eins auf jeden Fall, nämlich dass du Bierschaum an der Nase hast«, konterte Palmer.
»Mist«, murmelte Toby und wischte ihn ab.
»Was ist denn los?«, fragte Bri, die nun auch mit einem Becher in der Hand zu uns geschlendert kam. Sie schaute in die Richtung, in die Toby mit dem Kinn zeigte, und sah mich dann kopfschüttelnd an. »Andie.«
»Sie haben schon alles gesagt«, antwortete ich und schwenkte meine Colaflasche kurz, ehe ich wieder einen Schluck daraus trank.
»Hey, Assistentin«, ermahnte mich Toby und schlug mir auf den Arm. »Du vernachlässigst deinen Job.«
»Okay, okay«, sagte ich und fing an, mich nach einem Kandidaten umzusehen, mit dem ich selbst noch nichts hatte, den Toby nicht blöd fand und der nicht schon mit uns in der Grundschule war. »Ich brauch noch einen Moment.«
»Palmer Alden!« Kevin Castillo, der Gastgeber höchstpersönlich, kam aus dem Esszimmer auf uns zu, hielt lässig seine Hand hoch und Palmer schlug schwungvoll dagegen. »Super, dass ihr kommen konntet.«
Palmer nickte in Richtung Tisch, wo die Trinkspieler anscheinend gerade pausierten. »Alles klar?«
»Ich werde hier gerade fertiggemacht«, stöhnte er. »Wollt ihr mir helfen? Bri?«, sagte er zu Toby. »Oder Toby?«, fragte er an Bri gewandt.
»Umgekehrt«, korrigierte ich ihn und trank wieder einen Schluck aus meiner Flasche.
Kevin runzelte die Stirn. »Echt jetzt?« Er zeigte wieder auf Bri. »Sie heißt nicht Toby?«
»Ich bin Toby«, sagte Toby leicht genervt. So etwas kam gar nicht selten vor, obwohl Bri groß und gertenschlank war und Toby eher klein und ziemlich kurvenreich. Außerdem hatte Bri lange und glatte schwarze Haare, während Toby ständig versuchte, ihre roten Locken zu glätten, was gelegentlich in einem Desaster endete. Wenn man so oft zusammenhing, wurde man offenbar trotzdem verwechselt, obwohl man sich kein bisschen ähnlich sah und im Übrigen auch komplett verschieden tickte.
»Wir sollten einen Kombinamen einführen«, schlug Bri vor und zog eine Augenbraue hoch. »Tobri. Dann könnten wir immer beide antworten.«
»Das eröffnet so einiges an Möglichkeiten«, bestätigte Toby. »Du könntest zum Beispiel für mich Geschichte machen und mir eine tolle Zeugnisnote bescheren, und ich geh für dich zu Mathe, dann würdest du in Tests nicht immer so schlecht abschneiden.«
»Tausche Sport gegen Mathe, dann bin ich dabei«, schlug Bri vor.
»Und auf Partys würden alle Jungs auf mich fliegen«, ergänzte Toby mit einem Seitenblick zu Kevin Castillo, der ganz rot im Gesicht wurde. Auch wenn Bri das immer peinlich war, wenn man sie darauf ansprach, dass sie so hübsch war – wir hatten uns längst daran gewöhnt, dass Jungs ziemlich auf sie standen. »Gefällt mir.«
»Super Plan.«
»Also, Deal.«


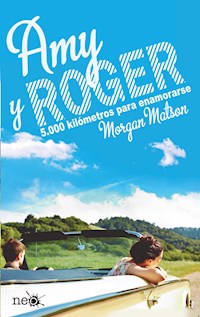


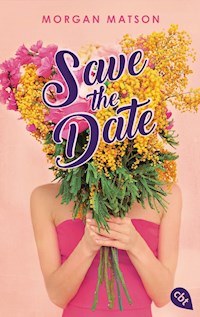











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











