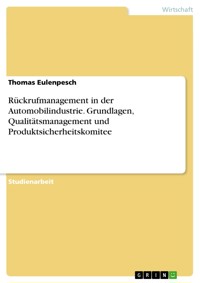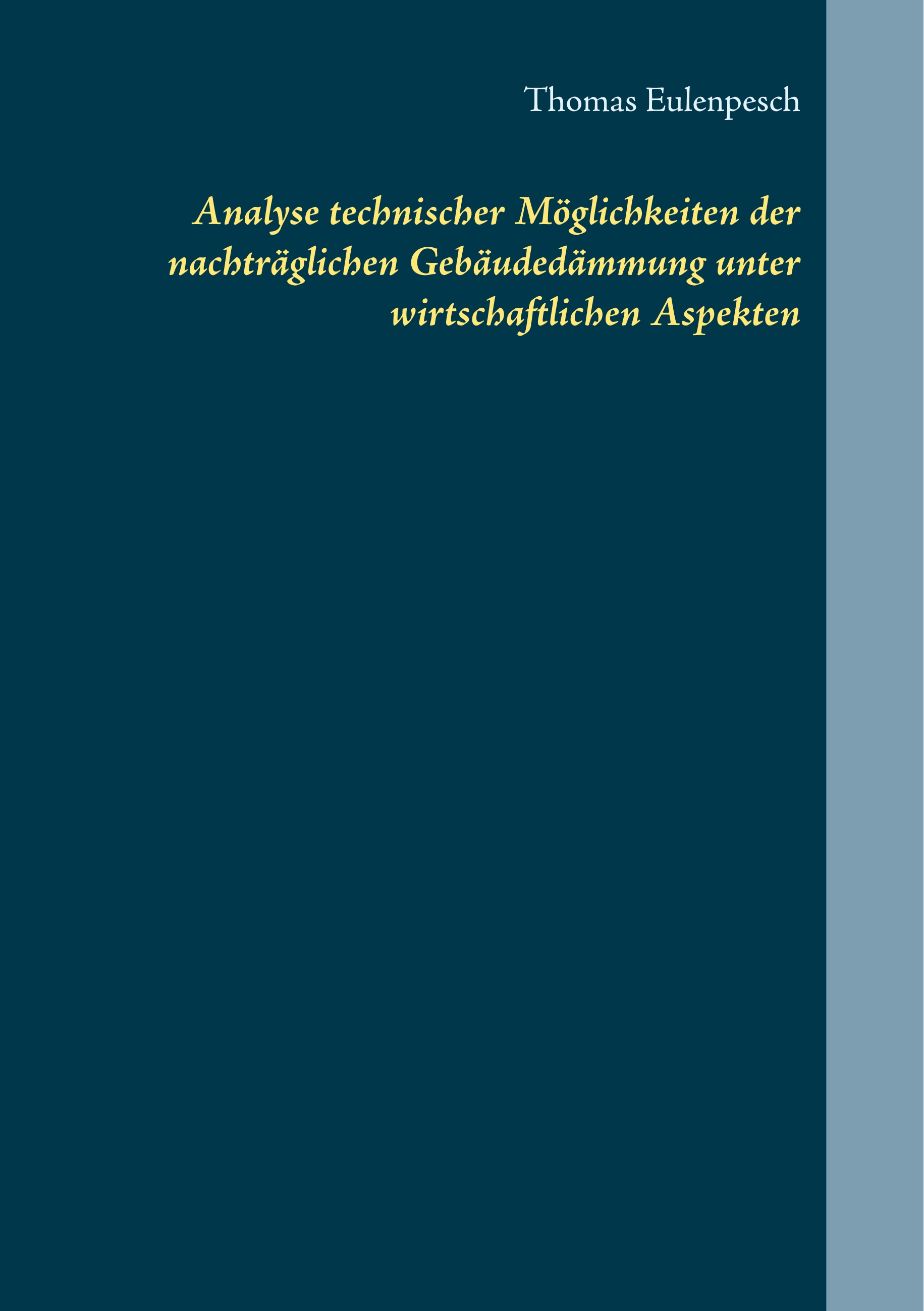
Analyse technischer Möglichkeiten der nachträglichen Gebäudedämmung unter wirtschaftlichen Aspekten E-Book
Thomas Eulenpesch
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit erfolgte eine Untersuchung verschiedener Verfahren der nachträglichen Gebäudedämmung. Hierbei wurde unter anderem untersucht, welchen Nutzen der jeweilige Gebäudeeigentümer erzielen kann und welche Kosten durch die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen entstehen. Zunächst wurden ausgewählte Methoden der nachträglichen Gebäudedämmung sowie die rechtlichen Vorgaben betrachtet. Anschließend erfolgte einer Analyse verschiedener Bauteile unter Berücksichtigung der sogenannten Einblasdämmung. Diese Erkenntnisse wurden anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse vertiefend betrachtet und ausgewertet. Zusätzlich wurde verdeutlicht, welche Maßnahmen neben der nachträglichen Gebäudedämmung noch umgesetzt werden können, um eine zusätzliche Reduktion des Energieverbrauchs im Gebäude zu erreichen. Die Erkenntnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit zeigen auf, dass auch vergleichsweise kostengünstige und minimalinvasive Maßnahmen wie die Einblasdämmung zu einer starken Reduktion des Energieverbrauchs beitragen können. Somit könnten auch eine Vielzahl von Gebäuden kostengünstig energetisch aufgewertet werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Ben
Wenn du durch eine harte Zeit gehst und alles gegen dich zu sein scheint, wenn
du das Gefühl hast, es nicht mehr eine Minute länger zu ertragen, GIB NICHT AUF,
weil dies die Zeit und der Ort ist, wo sich die Richtung ändert.
Rumi (persischer Dichter, 1207–1273)
INHALTSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Zusammenfassung
1
Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Theoretische Grundlagen
1.3 Methodik
2
Theoretische Grundlagen
2.1 Technische Aspekte bei der Gebäudedämmung
2.1.1 Bauphysikalische Grundlagen
2.1.2 Dämmstoffe: Verwendung und Zulassung
2.1.3 Gebäudedämmung und Brandschutz
2.2 Die Energieeinsparverordnung
2.2.1 Grundlagen der EnEV
2.2.2 Energieeinsparung und Energiebilanzierung nach EnEV
2.3 Der Klimawandel
2.4 Klimaschutzziele der Bundesrepublik
3
Gebäudedämmung im Bestand
3.1 Anforderungen der EnEV an Bestandsgebäude
3.2 Fördermaßnahmen
3.3 Energetische Modernisierungsmaßnahmen
3.4 Aspekte der Nachhaltigkeit
4
Ausgewählte Methoden der nachträglichen Gebäudedämmung
4.1 Vorgehängte hinterlüftete Fassade
4.2 Dämmung mittels expandiertem Polystyrol
4.3 Mineralwolle
4.4 Einblasdämmung
4.5 Ausgewählte ökologische Dämmstoffe als Einblasdämmung
4.5.1 Holzfasern
4.5.2 Zellulose
4.5.3 Stroh
4.5.4 Recycling-Produkte
5
Einblasdämmung als Verfahren zur nachträglichen Gebäudedämmung
5.1 Dämmung der obersten Geschossdecke
5.2 Dämmung der Außenwände
5.3 Dämmung des Fußbodens im Erdgeschoss (Kellerdecke)
6
Kosten-Nutzen-Analyse
6.1 Kosten der nachträglichen Gebäudedämmung (Wirtschaftliche Betrachtung)
6.1.1 Musterbeispiel: Nachträgliche Kerndämmung eines zweischaligen Mauerwerks
6.1.2 Auswertung nachträgliche Gebäudedämmung
6.2 Energieeinsparung durch die nachträgliche Gebäudedämmung (Ökologische Betrachtung)
6.3 Ökonomische und ökologische Betrachtung unter Berücksichtigung des Primärenergieinhalt
7
Weitere Reduktion des Energieverbrauchs in Kombination mit weiteren Maßnahmen
8
Diskussion
8.1 Gewonnenen Erkenntnisse
8.2 Limitationen der Arbeit
8.3 Fazit
9
Literaturverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Energieeinsatz bei der Dämmstoffherstellung, Eigene Abbildung, Datenquelle: (VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH, 2016, S. 11ff).
Abbildung 2: Schematischer Aufbau einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade (DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, 2017, S. 8)
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Herstellung von expandiertem Polystyrol (EPS) (Fouad, 2015, S. 85)
Abbildung 4: Herstellung von Steinwollprodukten (DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, 2017)
Abbildung 5: Anwendungstypen Einblasdämmung (Holzmann, Wangelin, & Bruns, 2012, S. 121f)
Abbildung 7: Dämmung des Hohlraums bei Kehlbalkenlagen mit einem Einblasdämmstoff (Paschko, Mehr als Mindestwärmeschutz: Nachträgliche Dämmung oberster Geschossdecken, 2018, S. 35)
Abbildung 8: Schematischer Aufbau einer Aufständerung mittels Holzkreuzen, Dachlatten und Holzplatten (Hans Hiltscher Einblasdämmung, o. J.)
Abbildung 9: Gefüllter Dämmsack mit Abstandslatte (Paschko & Paschko, 2013, S. 31)
Abbildung 10: Nutzung der Einblasdämmung in der Sprühklebetechnik (DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, 2017, S. 17).
Abbildung 11: Kostenentwicklung für 20 Jahre ohne Dämmung und mit Dämmung (begehbar) zum Erreichen der EnEV- Anforderungen (U=0,24 W/m2K) und Passivhausstandard (U=0,1 W/m2K) (Paschko, 2018, S. 36)
Abbildung 12: Wärmekostenentwicklung über 30 Jahre bei einer durchschnittlichen Energiepreisinflation (Durchschnittswert Baden-Württemberg 1996 bis 2013) Datenquelle: (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019)
Abbildung 13: Kostenentwicklung nachträgliche Dämmung der oberen Geschossdecke (Betrachtungszeitraum: 2018-2029)
Abbildung 14: Kostenentwicklung nachträgliche Kerndämmung (Betrachtungszeitraum: 2018-2029)
Abbildung 15: Nachträgliche Dämmung der Kellerdecke (Betrachtungszeitraum: 2018-2029)
Abbildung 16: CO2 Reduktion bei einer Wärmedämmung mittels EPS in den Stärken 8, 12 und 20 cm (Dunkelberg & Weiß, 2016, S. 34)
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Förderung mittels KfW 430 Programm (Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2018, S. 2)
Tabelle 2: Tilungszuschuss beim KfW Kredit 151/152 (Kreditanstalt für Wiederaufbau, 2018, S. 8f)
Tabelle 3: Anwendungsbereiche Fillrock KD und Fillrock RG von ROCKWOOL (DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG, 2017, S. 10)
Tabelle 4: Beispielhafte Wirtschaftlichkeitsberechnung der Kerndämmung eines zweischaligen Mauerwerks
Tabelle 5: Übersicht Datenbasis
Tabelle 6: Rahmendaten der Auswertung nachträglicher Gebäudedämmung mittels Einblasdämmung
Tabelle 7: Dämmung der obersten Geschossdecke
Tabelle 8: Nachträgliche Kerndämmung
Tabelle 9: Nachträgliche Dämmung der Kellerdecke
Tabelle 10: Vergleich Dämmstoffdicken, -kosten und des Primärenergieinhaltes unter Berücksichtigung der EnEV und KfW-Vorgaben (Datenquelle: (Institut für preisoptimierte energetische Gebäudemodernisierung GmbH, o. J.))
ZUSAMMENFASSUNG
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit erfolgte eine Untersuchung verschiedener Verfahren der nachträglichen Gebäudedämmung. Hierbei wurde unter anderem untersucht, welchen Nutzen der jeweilige Gebäudeeigentümer erzielen kann und welche Kosten durch die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen entstehen.
Zunächst wurden ausgewählte Methoden der nachträglichen Gebäudedämmung sowie die rechtlichen Vorgaben betrachtet. Anschließend erfolgte einer Analyse verschiedener Bauteile unter Berücksichtigung der sogenannten Einblasdämmung. Diese Erkenntnisse wurden anhand einer Kosten-Nutzen-Analyse vertiefend betrachtet und ausgewertet.
Zusätzlich wurde verdeutlicht, welche Maßnahmen neben der nachträglichen Gebäudedämmung noch umgesetzt werden können, um eine zusätzliche Reduktion des Energieverbrauchs im Gebäude zu erreichen. Die Erkenntnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit zeigen auf, dass auch vergleichsweise kostengünstige und minimalinvasive Maßnahmen wie die Einblasdämmung zu einer starken Reduktion des Energieverbrauchs beitragen können. Somit könnten auch eine Vielzahl von Gebäuden kostengünstig energetisch aufgewertet werden.
1
EINLEITUNG
1.1 PROBLEMSTELLUNG
Etwa 70 Prozent der Bestandsimmobilien, die vor 1979 gebaut wurden, befinden sich in einem energetisch nicht modernisierten Zustand und entsprechen somit nicht den heutigen Anforderungen an Energieeffizienz und Wohnkomfort (Reisbeck & Schöne, 2017, S. 373). Fehlende Dämmung an Dach und Außenwand (Hertel, et al., 2009, S. 150ff), alte Fenster und Anlagentechnik, der rund 13 Millionen Häuser führen zu einem Einsparpotential von rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs der deutschen Privathaushalte (Weis, 2015, S. 31ff).
Wird der durchschnittliche Heizwärmebedarf eines Einfamilienhauses (145 Quadratmeter Wohnfläche) in Höhe von ca. 160 kWh/m2a (Preuß & Schöne, 2010, S. 487)mit dem Bedarf einer nach dem Stand der Technik modernisierten Immobilie in Höhe von 100 kWh/m2a ins Verhältnis gesetzt, ergibt sich bei derzeitigen Brennstoffkosten von 0,07 EUR/kWh ein jährliches Einsparpotential von rund 600 EUR, was bei einem Bestand von 13 Millionen Häusern ein Volumen in Höhe von rund 7,8 Milliarden EUR bedeuten würde. Im Vergleich dazu liegt das Einsparpotenzial bei öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern und Schulen bei jährlich über 20 Milliarden EUR (Reisbeck & Schöne, 2017, S. 3). Die energetische Sanierung von Bestandsimmobilien birgt demzufolge ein großes Einsparpotential, welches die Bauherren langfristig finanziell entlastet und dabei gleichzeitig positiv zum Klimaschutz beiträgt (Riekmann, 2015, S. 98) (Barbey, 2012, S. 204). Auf der anderen Seite müssen hierfür auch hohe Investitionen in den privaten Haushalten getätigt werden, sodass hierbei auch die Kosten-Nutzen-Relation zu beachten ist.
Heutzutage wird oftmals der Fokus auf eine nachträgliche Gebäudedämmung mittels Dämmmaterialien wie Styropor gelegt. Diese Materialien sind jedoch in jüngster Zeit durch Brandkatastrophen in Verruf geraten (Geburtig, 2012, S. 48). Ein weiterer Nachteil dieser Materialien ist, dass diese aus Erdöl gewonnen werden und ein signifikanter Energieaufwand benötigt wird, um derartige Dämmmaterialien zu produzieren (Weizsäcker, von, Lindenberger, & Höffler, 2016, S. 285). Bei einer Betrachtung unterschiedlicher Literaturquellen wird jedoch deutlich, dass diesbezüglich keine einheitliche Meinung existiert. Denn unter anderem ergibt sich bei EPS ein Anteil an nicht erneuerbaren Primärenergie (PENRT) von 1.590 MJ (Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), 2015, S. 8). Dieser muss entsprechend mit der erzielten Einsparung von Wärmeenergie verglichen werden, sodass sich eine energetische Amortisationszeit von wenigen Monaten ergibt. Somit würde eine Betrachtung unter Berücksichtigung der energetischen Amortisationszeit zu einer deutlich abweichenden Schlussfolgerung führen, als bei einer Betrachtung lediglich bezogen auf die Menge und Art der eingesetzten Rohstoffe.
Zeitgleich wird bei der nachträglichen Dämmung oftmals nicht berücksichtigt, dass Hohlschichten im Mauerwerk vorhanden sind, sodass die Wirkung der nachträglichen Gebäudedämmung Ihre Wirkung nicht, beziehungsweise nicht vollständig entfalten kann (Drewer, Nachträgliche Kerndämmung von Hohlwänden, 2017, S. 144). Hierbei sind jedoch auch regionale Unterschiede zu berücksichtigen. Da beispielsweise in Süddeutschland eher monolithisch gebaut wird, sind derartige Holschichten primär in Norddeutschland vorzufinden. Bei einer Gesamtbetrachtung des Wohngebäudebestandes in Deutschland ist zu erkennen, dass ein Anteil von 30% der Wohngebäude über zweischalige Mauerwerke verfügt (Sprengard, Trembl, & Holm, 2014, S. 182). Somit ist hier ein großes Potential für eine nachträgliche Kerndämmung gegeben.
In vielen Gebäuden besteht jedoch die Möglichkeit, diese Hohlschichten mittels Einblasdämmung aufzufüllen und somit in eine kostengünstige Gebäudedämmung umzusetzen. Während für ein Wärmedämmverbundsystem Kosten von rund 100 €/m2 entstehen liegen die Kosten bei einer Hohlschichtdämmung primär meist nur bei 20 €/m2. Somit wird eine ressourcenschonende Gebäudedämmung ermöglicht und der Energiebedarf der Gebäude reduziert. Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es, darzustellen, in wieweit eine nachträgliche Gebäudedämmung dazu beitragen kann, die Energiekosten für die Verbraucher und zeitgleich den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Hierbei wird insbesondere auch auf die CO2-Bilanz einer nachträglichen Gebäudedämmung eingegangen.
Ziel der Arbeit:
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit soll analysiert werden, ob die Nutzung von Einblasdämmung zur Dämmung von Außenwänden sowie zur Dämmung von Boden- und Deckenplatten als energetische Sanierungsmethode dazu beitragen kann, die Ziele der Bundesregierung hinsichtlich des Klimaschutzplans zu erreichen und zeitgleich eine positive Auswirkung auf die Privathaushalte hat.
Bei einer Betrachtung bisheriger wissenschaftlicher Veröffentlichungen wird in diesem Kontext deutlich, dass zwar primär die technischen Aspekte der Durchführung von derartigen Modernisierungsmaßnahmen betrachtet worden sind, jedoch die ökonomischen Auswirkungen nicht hinreichend berücksichtigt worden sind. Daher ist es Ziel dieser Arbeit, eine Brücke zwischen den technischen Aspekten und den ökonomischen Aspekten herzustellen und zeitgleich zu überprüfen, ob hierdurch ein positiver Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen entstehen kann.
1.2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Bei älteren Gebäuden entweicht oftmals viel Wärme durch Außenwände, Fenster, Keller und Dach. Diese Wärmeverluste können durch eine nachträgliche Gebäudedämmung minimiert werden. Gleichzeitig ist eine Steigerung des Wohnkomforts sowie eine Reduktion der Energiekosten möglich. Sofern die Außenwände nicht oder nicht ausreichend gedämmt sind, kann in den Wintermonaten ein Gefühl der Unbehaglichkeit auftreten und ein erhöhter Wärmeverlust auftreten. Da die Wandflächen einen Anteil von rund 25% am gesamten Wärmeverlust eines Gebäudes darstellen ist es stets empfehlenswert ein Gebäude nachträglich zu dämmen.
Oftmals wird hierzu ein sogenanntes Wärmedämmverbundsystem eingesetzt. Ein derartiges System besteht aus Dämmstoff, der mittels Kleber auf die vorhandene Außenwand aufgebracht wird. Zur Stabilisierung und Windsogsicherung werden die Platten üblicherweise zusätzlich mit sogenannten Dübeln befestigt. Auf den Dämmstoff wird zunächst ein Armierungsmörtel und ein Armierungsgewebe aufgebracht, um mögliche Temperaturspannungen auszugleichen und eine Basis für den Oberputz herzustellen. Alternativ zum Oberputz können auch Klinkerriemchen genutzt werden.
Viele ältere Häuser, vorwiegend in Norddeutschland, bestehen jedoch aus einem sogenannten zweischaligen Mauerwerk. Hierbei existiert zu meinen das innere Mauerwerk und auf der Außenseite mit einem Abstand von ca. 5-10 cm ein zweites Mauerwerk, üblicherweise in Form von Klinkersteinen. Seit den 1960er Jahren besteht die Möglichkeit der nachträglichen Wärmedämmung eines zweischaligen Mauerwerks. Hierfür ist es notwendig geeigneten Dämmstoff in die Hohlschicht einzublasen. Dennoch wird dieses Verfahren bisher vergleichsweise selten angewandt.
Bei der sogenannten Einblasdämmung werden üblicherweise Löcher in die Außenwand gebohrt und durch diese wird Dämmstoff in den Hohlraum eingeblasen. Dies stellt im Vergleich zu anderen Verfahren wie beispielsweise der Montage eines Wärmedämmverbundsystems eine kostengünstigere Maßnahme dar und führt nahezu zu einem vergleichbaren Effekt. Jedoch muss beachtet werden, dass derartige Wärmedämmungen nur von Fachunternehmen, die über die notwendigen Geräte und über das notwendige Fachwissen verfügen.
Aber auch im Allgemeinen ist es notwendig die Auswahl einer Wärmedämmung mit großem Sachverstand und gründlicher Planung vorzunehmen, um spätere Mängel zu vermeiden. Beispielsweise können durch den alleinigen Austausch von Fenstern ohne nachträgliche Dämmung der Außenwände Schimmel- und Feuchteschäden entstehen im Gegensatz dazu ist eine nachträgliche Gebäudedämmung ohne den Austausch von Fenstern in Bezug auf Schimmel- und Feuchteschäden relativ unproblematisch. Daher muss stets ein geeignetes Maßnahmenpaket ausgearbeitet werden.
Insbesondere in Räumlichkeiten, die dauerhaft beheizt werden rechnen sich derartige Maßnahmen. Dennoch sollten angrenzende Räumlichkeiten, die nicht beheizt werden und beispielsweise nur als Abstellfläche genutzt werden unbeachtet bleiben. Denn durch eine fehlende Wärmedämmung können bei der Gesamtbetrachtung des Gebäudes erhöhte Heizkosten entstehen. Fehlende Wärmedämmmaßnahmen innerhalb des Gebäudes führen zwar üblicherweise nicht zu Schäden, könnten jedoch in Bezug auf den Energieverbrauch zu deutlich höheren Kosten im Vergleich zu gedämmten Bauteilen führen. Ausnahme bilden Innendämmungen, denn diese können zu einer stärkeren Auskühlung der angrenzenden Bauteile und dadurch zu einer Schimmelbildung führen. Hier sollte immer gut geplant und fachgerecht ausgeführt werden.
Bereits vergleichsweise geringe Maßnahmen wie die Dämmung einer Hohlsicht von 4 cm oder auch ein Wärmedämmverbundsystem mit wenigen Zentimetern Stärke, wie es in den 1970er Jahren verwendet worden ist führen bereits zu einer deutlichen Energieeinsparung. Auch wenn hierdurch bereits ein gewisses Potenzial unter wirtschaftlichen Aspekten ausgeschöpft ist, sollte stets über weitere Maßnahmen nachgedacht werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn vorhandene Außenwände beispielsweise durch einen beschädigten Putz saniert werden müssen.
Hingegen muss bei älteren Dämmungen von Dächern darauf geachtet werden, dass diese meist nicht lückenlos ausgeführt worden sind. Somit wird hierdurch keine ausreichende Luftdichtheit gewährleistet, sodass unnötig Wärme aus dem Gebäude heraustransportiert wird. Daher ist insbesondere in diesem Bereich eine nachträgliche Gebäudedämmung empfehlenswert, um die Behaglichkeit zu steigern und Energiekosten zu senken.
1.3 METHODIK
Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit sollen verschiedene Bauvorhaben ausgewertet werden und verschiedene Dämmverfahren hinsichtlich ihrer Kosten und der damit verbundenen Energieeinsparung ausgewertet werden. Dabei wir auf die Daten von mehr als 1.500 Bauvorhaben bei denen eine oder mehrere Maßnahmen der nachträglichen Gebäudedämmung angewandt worden sind ausgewertet. Ziel ist es, zu ermittelt, in welchem Zeitraum die getätigten Investitionen durch die eingesparte Energie kompensiert werden können.
2
THEORETISCHE GRUNDLAGEN
2.1 TECHNISCHE ASPEKTE BEI DER GEBÄUDEDÄMMUNG
2.1.1 Bauphysikalische Grundlagen
Mit der Dämmung von Gebäuden sollen gewisse Ziele erreicht werden, sodass auch bauphysikalische Aspekte berücksichtigt werden müssen. Insbesondere soll eine ausgeprägte thermische Behaglichkeit und ein niedriger Heizenergiebedarf erreicht werden. Darüber hinaus sollen Kondensationsprobleme und insbesondere der daraus resultierenden mögliche Schimmelbefall vermieden werden (Wosnitza & Hilgers, 2012, S. 229).
In der heutigen Zeit wird ein zunehmender Fokus auf eine möglichst luftdichte Gebäudehülle gelegt. Dies führt auch dazu, dass der natürliche Luftaustausch im Vergleich zu einem Altbau deutlich geringer ausfällt. Somit müssen durch geeignete Maßnahmen beispielsweise die Luftwechselraten erhöht werden, um negative Auswirkungen wie beispielsweise eine Schimmelbildung zu verhindern (Wosnitza & Hilgers, 2012, S. 235ff).
Der Einsatz von Dämmstoffen ist primär mit dem Ziel verbunden, einen bestmöglichen Wärmeschutz zu erreichen. Dies bezieht sich dabei einerseits auf den Wärmeschutz im Winter aber auch auf den Hitzeschutz im Sommer, bei dem eine übermäßige Aufheizung der Gebäude vermieden werden soll. Darüber hinaus tragen Dämmstoffe auf zu einem verbesserten Schallschutz bei (Joos, 2004, S. 66).
Darüber hinaus trägt eine effektive und effiziente Gebäudedämmung dazu bei, dass der Bedarf an Energie für die Beheizung im Winter beziehungsweise für die Klimatisierung im Sommer kleiner wird. Dadurch verringert sich ebenfalls die Emission von Kohlendioxid, insbesondere bei der Nutzung von fossilen Energieträgern zur Beheizung der Räumlichkeiten (Joos, 2004, S. 66).
Entsprechend ist zu erkennen, dass die Wärmedämmung von Gebäuden einen großen Einfluss auf die Nutzbarkeit des jeweiligen Gebäudes ausüben kann. Dies bezieht sich dabei insbesondere auch auf Aspekte wie eine komfortable Nutzung des Gebäudes.
2.1.2 Dämmstoffe: Verwendung und Zulassung
Bei der Nutzung von Dämmstoffen zur Dämmung von Gebäuden müssen bestimmte Vorschriften eingehalten werden. Ziel ist es unter anderem, sicherzustellen, dass durch die Maßnahme der Wärmedämmung keine Schäden am Gebäude hervorgerufen werden und sich keine negativen Auswirkungen für Nutzer und Anlieger wie beispielsweise durch herunterfallende Dämmstoffe ergeben.
Auch muss berücksichtigt werden, dass die Dämmstoffe nicht für jeden Verwendungszweck geeignet sind. Dementsprechend muss bei der Planung bereits auf die Auswahl geeigneter Dämmstoffe geachtet werden. Da die Hersteller die angebotenen Dämmstoffe üblicherweise durch unabhängige Stellen prüfen lassen,