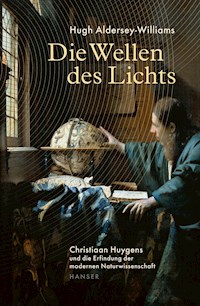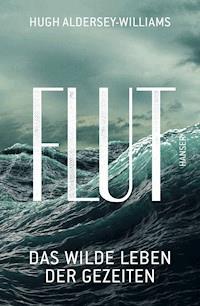Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Unser Körper: Wir sprechen ständig über ihn. Er inspiriert uns zu großer Kunst, er beschäftigt die Wissenschaft, und die spannendsten Geschichten drehen sich um ihn. Er ist der Quell aller Vergnügungen. Doch erst wenn wir krank werden, wird uns das komplizierte Gebilde aus Fleisch, Knochen und Flüssigkeiten wirklich bewusst. Auf der Suche nach Kulturgeschichten vom Körper begibt sich Hugh Aldersey-Williams auf einen Streifzug durch Naturwissenschaft, Kunst, Literatur und Alltag. Das Buch des Bestsellerautors aus Großbritannien ist eine Schatzkammer überraschender Fakten und Anekdoten – über die Physiologie der Engel, elektrische Knochen und den wahren Sitz der Seele: in der Leber.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugh Aldersey-Williams
ANATOMIEN
Kulturgeschichten vom menschlichen Körper
Aus dem Englischen von Christophe Fricker
Titel der Originalausgabe:
Anatomies. The Human Body, Its Parts and the Stories They Tell
London: Viking 2013
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Copyright © Hugh Aldersey-Williams, 2013
The moral right of the author has been asserted.
First published in Great Britain in the English language by Penguin Books Ltd.
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© 2013 Carl Hanser Verlag München
Internet: http://www.hanser-literaturverlage.de
Herstellung: Thomas Gerhardy
Redaktion: Andy Hahnemann
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich nach der Originalvorlage von Penguin Books Ltd.
Photographs © Shutterstock.com. Design and illustration: mecob.org
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (Buch) 978-3-446-43671-8
ISBN (E-Book) 978-3-446-43639-8
Für Moira
Inhalt
Einleitung
Prolog: Die Anatomie
Teil 1: Das Ganze
Ein Atlas des Körpers
Fleisch
Knochen
Teil 2: Die Teile
Die begehrtesten Stücke
Kopf
Gesicht
Gehirn
Herz
Blut
Ohren
Augen
Magen
Hände
Geschlechtsorgane
Füße
Haut
Teil 3: Die Zukunft
Zu neuen Ufern
Nachwort: Die Heimkehr
Danksagung
Liste der Abbildungen
Literaturhinweise
Die kleinen Arme und die Beine,
Die Augen und die Hände, es sind meine,
Die roten Wangen, Anfang meines Lebens,
Wo wart ihr nur? Und welch Gewebe
Verhüllte euch vor meinem Blick so lange?
In welcher Schlucht war meine neue Zunge?
Aus The Salutation von Thomas Traherne (1637–1674)
Einleitung
Irgendwann im Leben kommt der Moment, in dem wir begreifen, dass wir nicht ewig leben werden. Das ist eine ganz selbstverständliche Einsicht – und doch widerspricht sie unseren grundlegendsten Empfindungen. Es ist ein Schock.
Seien wir ehrlich. Ihrem Geist fällt es überhaupt nicht schwer, sich ein ewiges Leben vorzustellen. Einfach weitermachen wie bisher, warum auch nicht? Der Kopf hat damit kein Problem – nur unser Körper. Er funktioniert irgendwann nicht mehr reibungslos. Er beschäftigt sich immer mehr mit sich selbst, meldet sich immer öfter, teilt Ihnen seine Kümmernisse und Bedürfnisse mit: Denk doch auch mal an mich! Hört mir denn gar keiner zu? Hör auf, das tut weh! Oder: Ich muss mal. Dann antwortet Ihr Geist verschlafen: „Was, jetzt? Es ist drei Uhr morgens.“ – „Ja, jetzt!“
In der Schule war für mich nach der achten Klasse mit Biologie Schluss, obwohl ich gerade langsam anfing, mich für die Naturwissenschaften zu interessieren. Alle zwei Wochen eine Unterrichtseinheit und dann gar keine mehr, heute kommt es mir sträflich vor, dass so etwas überhaupt möglich war – nicht nur weil damals längst klar war, dass Biologie das naturwissenschaftliche Fachgebiet war, auf dem am meisten zu entdecken war, sondern weil jeder von uns der Eigentümer und Betreiber eines menschlichen Körpers ist. Und die beste Zeit, etwas über ihn zu lernen, ist doch sicher die Schulzeit. Ich wurde also mit diesem komplexen biologischen Organismus, über den ich fast gar nichts wusste und den ich mit etwas Glück noch ungefähr siebzig Jahre lenken und beleben sollte, alleingelassen.
Infolge dieser Bildungslücke und meiner geistigen Trägheit fällt mir auf die Bitte um einen Klogang um drei Uhr morgens keine gescheite Antwort ein. Ich habe keine Ahnung, wie meine Blase funktioniert oder warum sie heute offenbar anders funktioniert als früher, als ich jünger war. Und Sie wissen das vielleicht auch nicht so genau.
Ich stelle mir mit Müh und Not eine Art wasserdichten Ballon vor, der voll wird und dann ausgeleert werden muss und der sich irgendwo in meinem Unterleib befindet. Genauere Informationen müsste ich in einem der Lehrbücher für Biologiestudenten nachschlagen – das sind Bücher wie Betonplatten voller mehrfarbiger, aber langweiliger Illustrationen. Ich durchsuche das Register nach dem Begriff „Blase“. Er fehlt. Offenbar muss ich meine einfache Frage erst einmal in eine spezielle Fachsprache übersetzen. Nach kurzem Nachdenken wende ich mich dem „H“ zu, in der Hoffnung, dort auf „Harnorgane“ zu stoßen.
Schließlich erfahre ich, dass die Harnblase ein dehnbarer, aus dünnen Muskelschichten bestehender Behälter ist. Innen ist die Harnblase mit einer Schleimhaut versehen, sodass sie wasserdicht ist. Wenn sie voll ist, bläht sie sich bis zur Größe und Form einer riesigen Avocado auf. Sie enthält dann gut einen halben Liter Urin (oder einen ganzen Liter, wenn man einem anderen Lehrbuch Glauben schenkt). Das beigefügte Röntgenbild, das als Pyelogramm bezeichnet wird (muss ich dieses Wort wirklich kennen?), zeigt mithilfe eines künstlich zugeführten Kontrastmittels, wo im Körper sich das Harnsystem befindet. Vor mir liegt ein knolliger Hohlraum, der unten an der Wirbelsäule sitzt und von den Beckenknochen gehalten wird. Als dünne Striche gehen die beiden Harnleiter ab, die auf ihrem Weg zu den Nieren hoch das Rückgrat umfangen. Beide teilen sich erst in zwei, dann in fünf und schließlich in noch viel mehr dünnere Kanäle, die in die Tiefen der Nieren führen, etwa auf der Höhe der untersten Rippe. Das Bild ist eigentlich ganz schön, es sieht aus wie zwei langstielige Iris-Blumen in einer zwiebelförmigen Vase.
Die Harnleiter sind Muskelschläuche, die den von den Nieren produzierten Urin in die Blase drücken. Wenn die Blase sich füllt, werden Dehnungsrezeptoren in der Muskelwand stimuliert. Diese senden Signale an das Gehirn, wo sie als Aufforderung zum Wasserlassen interpretiert werden.
Na ja, irgendwie so. In Wirklichkeit ist das System allerdings schlauer. Die Blase testet mit ihren ersten Signalen erst einmal, ob Sie überhaupt aufpassen. Das Gehirn verschickt als Antwort auf eine solche Neuigkeit eine Nachricht, die die Blase anweist, ihre Muskeln ein bisschen zu verkürzen, womit der Druck auf die Flüssigkeit steigt. Damit will der Körper prüfen, ob die Muskeln, die in entspanntem Zustand den Abfluss des Urins ermöglichen, noch etwas länger durchhalten. Im Klartext: Das Gehirn fragt die Blase, ob sie es ernst meint. Wenn die Blase signalisiert, dass sie geblufft hat, instruiert das Gehirn die Muskeln der Blasenwand, sich wieder zu entspannen und zu warten, bis noch etwas mehr Urin da ist. Das spielt sich alles ab, während Sie schlafen, sodass Sie erst geweckt werden, wenn es wirklich sein muss. Es ist wie beim Snooze-Knopf Ihres Weckers.
In den Lehrbüchern steht kaum etwas davon, dass dieses bemerkenswerte System schon in den mittleren Lebensjahren nicht mehr richtig funktioniert. Ich versuche, es mir zu erklären. Vielleicht zieht sich die Blase zusammen und muss deshalb öfter geleert werden. Oder sie weitet sich und die Dehnungsrezeptoren werden häufiger beansprucht. Vielleicht werden die Dehnungsrezeptoren selbst sensibler. Vielleicht funktioniert die Nervenverbindung zwischen Gehirn und Blase nicht mehr so gut und verschickt Falschmeldungen. Vielleicht gerät ein alterndes Gehirn in Panik und geht lieber auf Nummer sicher. Man könnte sich noch mehr Gründe vorstellen. Ich bitte schließlich einen befreundeten Arzt, mir die Sache zu erklären. „Ich habe auch schon versucht, das herauszufinden“, sagt er, aber er habe inzwischen selbst mehr Fragen als Antworten. Schließlich legt er meine Bitte einem Urologen vor. Ich erfahre, dass man im Alter einfach im Schlaf mehr Urin produziert. Das ist, gelinde gesagt, eine unbequeme Wahrheit.
Mir kommt es absurd vor, dass ich so aufwendige Recherchen anstellen muss, nur um etwas über eine ganz banale Körperfunktion herauszufinden. Dabei habe ich noch kompliziertere Fragen. Ist die Blase einfach eine „Tasche“ oder nicht doch etwas Spezielleres? Ist sie ein Organ? Was zeichnet ein Organ aus? Wo fangen Organe an, wo hören sie auf? Medizinstudenten kaufen sich gern ein Plastikskelett und ein Plastikmodell des Körpers mit bunten, herausnehmbaren Organen. Ist der Körper wirklich so? Oder sind die Organe kulturelle Erfindungen, Behälter für bestimmte Vorstellungen, die wir uns vom Leben machen, und gar nicht so sehr biologische Gegebenheiten? Ist es überhaupt sinnvoll, von Körperteilen zu sprechen? Wem scheint das sinnvoll? Und wenn es sinnvoll sein sollte, ist dann der Körper nur die Summe seiner Teile oder noch mehr? Immerhin dachte Aristoteles gerade an den menschlichen Körper, als er in seiner Metaphysik die längst überstrapazierte Redewendung „mehr als die Summe seiner Teile“ prägte. Und wenn der Körper wirklich mehr als die Summe seiner Teile ist, was ist dann dieses Mehr?
Mit Anatomien will ich meine lückenhafte biologische Bildung aufbessern und Antworten auf diese Fragen finden. Wie so viele Menschen weiß ich erbärmlich wenig darüber, wie mein Körper funktioniert – oder manchmal auch nicht funktioniert. Die es wissen, die Ärzte, wollen ihr Wissen offenbar für sich behalten und hüten ihre Arkana mithilfe langer Wörter, allzu simpler Erklärungen und den berühmten unleserlichen Rezepten.
Der menschliche Körper ist natürlich ein schwieriges Thema. Womöglich weil er uns so nahe ist. Er wird immer wieder als Wunder der Natur bezeichnet – und doch ziehen wir es vor, dieses Wunder nicht allzu genau zu beobachten. Wenn alles in Ordnung ist, ignorieren wir ihn. Das soll wohl so sein, denn immerhin verbringt auch kein anderes Tier seine Zeit damit, über seine Gesundheit nachzudenken. Ist er uns also egal, solange er keine Scherereien macht? Nein, denn oft schämen wir uns für unsere Körper, oft sind sie uns peinlich.
Zugleich werden wir mit Körperbildern bombardiert. Immer sind es Körper, die perfekter sind als unser eigener. Sie sehen besser aus (Supermodels) und sind leistungsfähiger (Superhelden), auch wenn sie eigentlich das Gleiche wie wir tun. Diese Stellvertreter erinnern uns daran, dass unser Körper ein Teil der Welt ist. Durch unseren Körper nehmen wir die Welt wahr und gehen mit ihr um. An unseren Körpern erkennt man uns.
Trotzdem bereiten unsere Körper uns Sorgen. Wir verstecken sie unter Kleidern. Wir lenken durch Schmuck, Frisuren, durch ein Sammelsurium von Posen und Gesten, durch Stimme und Mimik von ihm ab, bis all das unsere Identität ausmacht. Dank der modernen Medizintechnologie treiben wir es mit diesen Manipulationen immer weiter. Vom Gehirnjogging bis zur Brustvergrößerung wollen wir Geist, Persönlichkeit, Gesicht und Körper verändern. Das tun wir natürlich schon seit Langem – heutzutage fügen wir der langen Geschichte psychologischer und physischer Zurichtungen nur ein weiteres Kapitel hinzu. Die Vorstellung des Körpers als Leinwand ist nicht neu. Nur gab es noch nie so viele Maler.
Machen wir uns einmal klar, wie es um die Medizin steht, also die Wissenschaft, die unsere körperliche Gesundheit erhalten oder wiederherstellen soll. Die meisten Naturwissenschaften haben Respekt vor der Geschichte. Viele Forscher verweisen vielleicht nur selten auf die Vergangenheit ihrer Disziplin oder kennen selbst wichtige Persönlichkeiten oder Daten nicht, aber sie sind sich bewusst, dass heutige Entdeckungen ohne die früheren Leistungen nicht möglich wären. Wir stehen auf den Schultern von Riesen. Die Geschichte der Humanbiologie und -medizin verspotten wir dagegen gern. Wir amüsieren uns darüber, dass man früher einmal versuchte, von der Schädelform auf die Persönlichkeit zu schließen. Wir lachen über absurde und schmerzvolle Behandlungsmethoden, etwa die Vorstellung, dass man Keuchhusten mit Feldmauskuchen heilen könnte. Wir lachen, und zwar aus Angst. Wir haben Angst um den verletzlichen, letztlich unverfügbaren menschlichen Körper – unseren menschlichen Körper.
Inzwischen geht die Wissenschaft neue Wege – in die Tiefe. Wir gewöhnen uns langsam daran, dass wir über unsere Körper am meisten lernen, wenn wir ganz nah heranzoomen und Zellen, Gene, DNA und Proteine erkunden, die uns zu dem machen, was wir sind. Der Schlüssel zu den Funktionen und den Fehlfunktionen des Körpers – den Krankheiten –, so heißt es, liege in den Codes und Sequenzen, seinen chemischen Reaktionen und elektrischen Signalen.
Diese hoch spezialisierte Forschung ist spannend – ihre Perspektive jedoch auch ein wenig einseitig. Sie beschreibt einen Menschen als Effekt der Buchstaben- oder Zahlencodes, die die Forschung ans Licht gebracht hat. Sicher ist eine solche Beschreibung nützlich – aber sie ist nicht das, was mich interessiert. Als Gattung haben wir in den letzten zehntausend Jahren ganz gut ohne sie gelebt. Wir sehen uns selbst anders. Natürlich ist es wichtig zu wissen, dass der Mensch einen Chromosomensatz besitzt, den man Genom nennt und der über 20000 Gene enthält, von denen jedes als DNA-Sequenz beschreibbar ist, und dass jede Körperzelle jedes Gen enthält. Aber dieses Wissen kann älteres Wissen nicht ersetzen: dass der Körper ein Herz besitzt, zwei Augen, 206 Knochen und einen Nabel. Es kommt zu diesem Wissen hinzu. Mit seinen vielen spezialisierten Einzelheiten geht es an den wichtigen Tatsachen des Lebens vorbei. Wir erfahren dadurch nicht, was uns wirklich ausmacht.
„Erkenne dich selbst“, lautete die berühmte Inschrift auf dem Tempel des Orakels von Delphi im antiken Griechenland. Doch trotz all unserer wissenschaftlichen Leistungen wissen wir über uns selbst, vor allem über unser körperliches Selbst, immer weniger. Vielleicht ist die Suche nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sogar zum Ersatz für körperliche Erfahrungen geworden. Eine Studie ergab kürzlich, dass es an amerikanischen Universitäten unter den Studentinnen und Studenten der Biologie und anderer Naturwissenschaften mehr Jungfrauen gibt als in allen anderen Fächern (die wenigsten gibt es bei Kunst- und Ethnologiestudenten).
Eine derartige Verschiebung ist besonders unter Medizinern zu beobachten. Überall drängen sich die Einzelheiten in den Vordergrund. Das Bewusstsein von der Ganzheit des Körpers ist verloren gegangen, weil die Wissenschaft immer spezialisierter wird und im Körper nur noch Teile, ja isolierte Teile sieht. Die Vermittlung der Grundlagen von Genetik, Molekularbiologie, Pharmakologie, Epidemiologie und Gesundheitswirtschaft hat die Lehre von der Anatomie an den Rand gedrängt, die doch Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Jahren im Zentrum des Medizinstudiums stand. Um 1900 erhielt ein Medizinstudent ungefähr 500 Stunden Anatomieunterricht, in denen der ganze Körper abgehandelt wurde. Heute liegt die Zahl um zwei Drittel niedriger. Mehr und mehr findet dieser Unterricht nicht mehr an Fleisch und Blut statt, sondern anhand von digitalen Bildern.
Man nimmt den Körper einfach so hin. Der Laie nimmt an, dass die Ärzte alles wissen, was sie über Bau und Funktion des Körpers wissen müssen, und dass wir auch so schon irgendwie klarkommen. Ich bin kein Mediziner und versuche, mich von Krankenhäusern fernzuhalten. Bevor ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, hatte ich noch nie einen aufgeschnittenen Körper gesehen. Fast scheint es, als hätte es jemand bewusst so eingerichtet, dass wir möglichst dumm bleiben. Dann hinterfragen wir die Entscheidungen der Ärzte nicht. Dann fragen wir nicht, was mit uns eigentlich los ist, wenn wir krank werden und wenn wir sterben.
Trotzdem: Kopf hoch! Als einzige Gattung haben wir die wunderbare und furchtbare Fähigkeit zur Selbstreflexion. Warum sollten wir sie nicht nutzen, um uns mit unserem sterblichen Fleisch auszusöhnen?
Mit Anatomien will ich das auf meine Weise versuchen. Wie bei einem kulturgeschichtlich so reichen Thema wie dem Körper zu erwarten, beziehe ich mich nicht nur auf frühere und aktuelle Erkenntnisse der Medizin, sondern auch auf das, was Philosophen, Schriftsteller und Künstler über Körper und Körperteile gedacht haben. Der Körper ist keine bloße Sache – weder auf dem Seziertisch noch beim Aktzeichnen. Er lebt oder hat zumindest einmal gelebt. Ich widme mich deshalb dem aktiven Körper, der sich bewegt, der etwas tut und der Gedanken und Gefühle ausdrückt – etwas, das ebenso wichtig ist wie unsere Gene. Doch keine Sorge. Mit Beschreibungen der Fehlleistungen meines eigenen Körpers verschone ich Sie. Um es mit einem verfälschten Montaigne-Zitat zu sagen: „So bin ich selber, Leser, nicht der Inhalt meines Buches.“
Die Kapitel von Anatomien behandeln jeweils einen wichtigen Körperteil. Damit ergibt sich eine bestimmte Struktur, doch werden die einzelnen Kapitel auf weit mehr als nur den jeweiligen Körperteil eingehen. Wenn wir an einen Körperteil denken, an die inneren Organe und an äußerlich sichtbare Merkmale, greifen wir in der Regel nicht auf Vorstellungen zurück, die von der modernen Naturwissenschaft oder der Medizin geprägt worden sind, sondern von der Kultur, die unseren Körperteilen schon seit Langem bestimmte Symbole und Bedeutungen zugeordnet hat. Um diese Bedeutungen zu entdecken, müssen wir den Körper berühren, ihn anschauen und auf ihn hören, zu lange haben wir nur abstrakt über ihn nachgedacht, sodass wir ihn gar nicht mehr so genau kennen.
Besonders verbreitet ist zum Beispiel die Vorstellung, im Herzen wohne die Liebe. „Komm, nimm dich eines wunden Herzens an“, schrieb etwa der englische Dichter Robert Herrick vor vierhundert Jahren in einem großartigen Gedicht über die unerwiderte Liebe. Hat das heute etwas zu bedeuten? Dem Einzelhandel ist es wichtig – allein in Großbritannien setzt er zum Valentinstag über zwei Milliarden Pfund um. Auf Millionen von Grußkarten steht das Herz als Symbol der Liebe. Auf seinem pulsierenden Rhythmus beruht unser Vergnügen an jambischer Dichtung und den Beats der Rockmusik.
Lange sagte man, das Auge halte im Moment des Todes das letzte Bild fest. Wurde diese irrige Auffassung je korrigiert? Wenn ja, kann es noch nicht lange her sein. Noch 1888 fotografierte die Londoner Polizei die Augen von Mary Jane Kelly, eines vermeintlichen Opfers von Jack the Ripper, weil sie hoffte, das Bild des Täters in ihnen entdecken zu können.
Das ist ein Beispiel für frühe Versuche, unseren menschlichen Körper zu verstehen und mit ihm klarzukommen. Die moderne Medizin wird durch sie oft stärker geprägt, als sie sich das eingesteht. Beim Blut zum Beispiel. In den Fragebögen, die ein potenzieller Blutspender ausfüllen muss, spiegeln sich heute noch uralte Tabus und Ideale der Blutreinheit eines Stammes. Auch unsere Einstellung gegenüber der Organspende wird durch kulturelle Vorurteile geprägt. Die meisten Spender oder Angehörigen, die die Organentnahme einschränken möchten, denken an Herz und Augen, weil sie sich das Herz als den Wesenskern eines Menschen und die Augen als Fenster zur Seele vorstellen.
Aus der Kunst erfahren wir manches über den Körper, was uns Medizin und Biologie verschweigen. Der Kopf ist ein so wichtiger Körperteil, dass er für den ganzen Körper einstehen kann. Das sieht man daran, dass Bildhauer Büsten erschaffen oder dass das Passbild nur den Kopf zeigt. Wie wäre es, wenn nur die Nase für einen Menschen stehen sollte? In Nikolai Gogols Kurzgeschichte Die Nase verabschiedet sich eine Nase von ihrem Träger und geht in St. Petersburg spazieren. Ihr nasal benachteiligter Ex-Besitzer verfolgt sie. Die Satire spielt damit, dass die Nase sich die gesellschaftlichen Ambitionen ihres Besitzers zu eigen macht. Gogol stellt uns vor die Frage, warum bestimmte Körperteile die Identität eines Menschen verkörpern und andere nicht. Vor allem erinnert er uns daran, dass der Körper und seine Teile bei genauerer Betrachtung lustig sind, vielleicht sogar lächerlich.
Auch ohne den Rest des Körpers können sich Organe oder Teile von ihnen auf besorgniserregende Weise vermehren und eigenartige neue Möglichkeiten entwickeln. In Gargantua und Pantagruel beschreibt Rabelais eine Stadtmauer aus Vulven. „Ich habe bemerkt, daß die Venusmäulchen der Weiber hierzulande viel wohlfeiler sind als die Steine“, stellt Pantagruels Begleiter Panurge fest. „Man müßte also daraus die Mauern aufrichten, und zwar in schönster architektonischer Ordnung: die ganz großen unten, die mittelgroßen, wie ein Eselsrücken spitz zulaufend, in der Mitte und die ganz kleinen oben.“ Ein um 1600 gegen Ende ihrer Regierungszeit angefertigtes Porträt von Königin Elisabeth I. stellt sie mit einem Kleid voller Augen und Ohren dar, als Oberhaupt eines allwissenden Staates. Der Künstler Marcus Harvey erregte Aufsehen mit einem überdimensionalen Porträt der Kindermörderin Myra Hindley, das er aus verkleinerten Abdrücken von Kinderhänden zusammensetzte. Für das Werk benutzte er eine in den Medien während des Prozesses häufig gezeigte Fotografie. Stand ihr das Böse ins Gesicht geschrieben? Und hat eine Kinderhand etwas Unschuldiges? Durfte man beides zusammenbringen?
In diesem Buch geht es um unsere Körper, ihre Teile und ihre Bedeutungen. Und es geht um die Grenzen des Körpers und unsere Versuche, diese zu erweitern – wohl zu keinem Zeitpunkt haben wir das so nachdrücklich versucht wie heute. Statt „erweitern“ sollte ich wohl „verschieben“ sagen, denn wir mögen zwar glauben, dass wir die Grenzen des Menschen immer weiter nach außen verschieben, doch treten wir von Zeit zu Zeit auch einen taktischen Rückzug an. Dann verschieben wir die Grenzen in die andere Richtung. Wir glauben gerne an unsere Allmacht, möchten aber unsere Schmerzempfindlichkeit nicht allzu sehr auf die Probe stellen und unseren Geruchs- oder Tastsinn am liebsten gar nicht gebrauchen. Wir wollen möglichst lange leben – oder einfach dem Tod ein Schnippchen schlagen? Wir träumen davon, dass es eines Tages möglich sein wird, unseren Körpern zu entkommen und transformiert und dematerialisiert weiterzuexistieren – die jüngsten oder angekündigten Fortschritte der Biomedizin scheinen in diese Richtung zu weisen. Tatsächlich aber fantasieren wir darüber schon immer.
Zentral ist auch die Vorstellung von unserem Körper als Territorium, das wir entdecken, erschließen und erobern können. Diese mächtige Metapher gab es schon immer, in Shakespeares Dramen und in dem Spielfilm Die phantastische Reise von 1966, in dem eine Crew verkleinerter Menschen durch den Körper eines Mannes reist, um sein Leben zu retten. So funktioniert schließlich Wissenschaft: Nachdem ein neuer Bereich entdeckt wird, teilt man ihn auf und steckt im Namen neuer Spezialdisziplinen seine Herrschaftsgebiete ab. Das hat, wenn ich das so sagen darf, etwas sehr Männliches, zumal wenn es um den weiblichen Körper geht.
Während meiner Arbeit fiel mir irgendwann an meiner Leseliste etwas auf. Viele der Bücher spielten auf Inseln: Robinson Crusoe interessierte mich wegen seines alles entscheidenden Fußabdrucks, Gullivers Reisen wegen der Maßstabsveränderungen, Taipi wegen der Tätowierungen und der Kannibalen, Die Insel des Dr. Moreau wegen der Vivisektion und der menschlich-tierischen Mischwesen. Woran lag das? Die Bevölkerung einer Insel ist isoliert. Die Menschen dort sind fast so etwas wie eine eigene kleine Menschheit und bieten sich anders als die Mehrheitsbevölkerung in der Heimat in gewisser Weise als anthropologische Studienobjekte an. Inselgesellschaften lassen sich eine Zeit lang wie in einem Experiment beobachten und kontrollieren. Allerdings nicht für immer. Der Held entkommt irgendwann und berichtet von seinen Abenteuern (oder auch nicht, wie im Falle von Dr. Moreaus Besucher, der Amnesie vorschützt, weil das Gesehene so unglaublich war). John Donne erinnerte uns dann auch in seinen berühmten Meditationen daran: „Kein Mensch ist eine Insel, ganz für sich allein; jeder ist Teil eines Erdteils, Teil eines Ganzen.“
Auf fiktiven Inseln können wir nicht nur die Natur des Menschen an sich untersuchen, sondern auch die Identität eines Einzelnen. Der Körper und seine Teile sind mehr oder weniger gründlich erkundet worden, und doch sind wir immer noch auf der Suche nach diesem ganz besonderen Ort, dem Sitz der Seele oder des Selbst. Im Mittelalter wurde das Herz oft nicht mit dem Rest des Körpers begraben, weil man dachte, in ihm sei der Sitz der Seele. In der Renaissance sah man das differenzierter. Nun suchte man die Seele in den Proportionen des Körpers. Der Körper als Mikrokosmos spiegelte den Makrokosmos des geordneten Universums genau wider. Die Idealkörper und Anatomien von Leonardo da Vincis vitruvianischer Figur bis zu Rembrandts Vivisektionsgemälden zeugen von dieser Idee. Mit dem naturwissenschaftlichen Fortschritt lebte auch die Suche nach dem genauen Sitz der Seele wieder auf. Man kaprizierte sich auf den Kopf, denn Physiognomen lasen die Identität eines Menschen an seinem Gesichtsausdruck und Phrenologen an der Schädelform ab. Heute schauen wir auf die von Magnetresonanztomografen produzierten Bilder des Gehirns und glauben, wir kämen dadurch unserem Selbst näher. Unsere Sehnsucht nach einer sichtbaren Verkörperung ist offenbar groß.
Wir wollen das Selbst sehen, weil die heutige Gesellschaft den Individualismus zelebriert und weil wir spüren, dass das Selbst so vielen Manipulationsversuchen ausgesetzt ist wie nie zuvor. Wir wissen, dass unsere Identität – auf psychologischem, physischem, chemischem oder technologischem Weg – bewusst verändert werden kann, etwa durch Selbsthilfebücher, Schönheitsoperationen, bewusstseinsverändernde Drogen oder im Kontext virtueller Realität. Noch werden wir Zeuge der ersten, zaghaften Schritte. In Zukunft wird es wohl leichter und wahrscheinlich auch normaler, das Äußere und die Gene zu manipulieren. Dadurch wird, was ein Bioethiker einst „das natürliche Selbst“ nannte, aufgebrochen.
Der menschliche Körper existiert heute in einer spannenden und auch verstörenden Umbruchszeit. Wir führen ihn uns ständig vor Augen und sind mit ihm unzufrieden. Die Biologie macht uns große Versprechungen. Doch wie schön wir auch sind, wie leistungsfähig wir auch werden mögen, wie lang wir auch leben – wir können nicht aus unserer Haut. Womöglich können wir die heutigen Probleme meistern, indem wir lernen, den menschlichen Körper als Ort ständiger Neuerfindung zu betrachten.
Eine Hürde auf dem Weg zu einem besseren Verständnis unserer Körper sind die vielen griechischen und lateinischen Fachbegriffe, die auch die Ärzte in ihrem Studium pauken mussten. Einige glauben, diese Wörter seien notwendig, um einem internationalen kommunikativen Standard zu genügen, vergleichbar mit einer Messe, die auf Latein gesungen wird. Ich habe da meine Zweifel. Daher versuche ich, in diesem Buch solche Wörter zu vermeiden, auch weil sie mich am Anfang selbst verwirrt haben. Ich werde nicht „anterior“ sagen, wenn ich „vorne“ sagen kann, und statt „Femur“ lieber „Oberschenkelknochen“. Ich will die Teile unseres Körpers nicht in einer Sprache beschreiben, die wir nicht sprechen.
Und jetzt muss ich mich leider entschuldigen. Die Blase ruft.
Prolog: Die Anatomie
Um wen geht es eigentlich auf diesem Bild?
Ich befinde mich im Mauritshuis, einer der beeindruckendsten Sammlungen niederländischer Kunst. Das Gebäude ist ein wundervoller kleiner Palast am See im Zentrum von Den Haag. Eben sah ich Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring. Das Gemälde ist so wahnsinnig schön, dass es mich richtig aufgewühlt hat. Zwei Räume weiter stehe ich nun vor Rembrandts Anatomie des Dr. Tulp.
Mit diesem Gemälde schaffte er den Durchbruch. 1631 kam Rembrandt im Alter von 25 Jahren nach Amsterdam und suchte Arbeit als Porträtmaler. Das gelang ihm beinahe sofort, da Nicolaes Tulp, der Praelector Anatomiae der Amsterdamer Chirurgengilde, den jungen Künstler um ein Porträt seiner selbst im Kreise seiner Kollegen bat. Der Auftrag muss Rembrandts Erwartungen übertroffen haben und stellte ihn vor mehrere große Herausforderungen: Er musste nicht nur einen Menschen malen, sondern eine ganze Gruppe, er musste die Individualität jedes Einzelnen treffen und doch die Erwartungen erfüllen, die man im 17.Jahrhundert an ein Gruppenporträt stellte. Und als er den Auftrag annahm, wird sich Rembrandt auch gefragt haben, ob ihm das Bild eine Gelegenheit bieten würde, die großen Fragen des Daseins zu thematisieren.
Das Bild ist riesig. Es zeigt die sieben Männer, die Dr. Tulp genau zuhören, beinah in Lebensgröße. Tulp selbst sitzt auf seinem Sessel fast wie auf einem hohen Thron und erklärt ihnen eine bestimmte Einzelheit der menschlichen Anatomie. Und doch geht es in dem Gemälde nicht so offenkundig um Dr. Tulp wie bei Vermeer um das Mädchen. Der Titel ergab sich erst später. Es handelt sich um ein Genrebild, das eine Gruppe beruflich erfolgreicher Chirurgen zeigt. Sie sehen aus, als würden sie gerade unterrichtet, dabei wissen sie ungefähr so viel wie Dr. Tulp selbst. Er kann ihnen wenig beibringen. Geht es also um die Gruppe als Ganze? Immerhin haben die Porträtierten das Gemälde gemeinsam bezahlt und sofort nach Fertigstellung in ihrem Gildenhaus aufgehängt.
Diese Herren mit ihren roten Wangen und den extravaganten Kragen stehen aber ebenfalls nicht im Mittelpunkt. Im Zentrum steht, für uns wie für Rembrandt, der Tote, der auf dem Seziertisch liegt und um den sich die Chirurgen versammelt haben.
Er ist, oder war, Adriaan Adriaanszoon, genannt ’t Kint. „Das Kind“ war 28 Jahre alt und einschlägig bekannt aufgrund einer Reihe von Tätlichkeiten und Diebstählen, die er in den neun Jahren zuvor begangen hatte. Im Winter 1631/32 versuchte er, in Amsterdam den Mantel eines Mannes zu stehlen. Zu seinem Unglück wehrte der Mann sich, und Adriaanszoon wurde gefasst. Er kam vor Gericht und wurde zum Tod durch den Strang verurteilt. Anschließend war der Körper zu sezieren. Diese ungewöhnliche Strafe für besonders schwere Vergehen sollte Tätern und ihren Familien die letzte Hoffnung nehmen, dass der Körper bei der Wiederkunft Christi auferstehen würde. Drei Tage später, am 31.Januar 1632, wurde seine Leiche von einem der am Hafen stehenden Galgen abgenommen und zur letzten Bestrafung in das städtische Anatomietheater gebracht.
Im 17.Jahrhundert war das Sezieren ein Spektakel. Es konnte nur stattfinden, wenn ein frischer Körper zur Verfügung stand, meist also nach der Exekution eines Kriminellen. Möglich war das nur im Winter, wenn die Kälte den Körper lange genug vor der Verwesung bewahrte, dass der Totengeruch noch erträglich war. Viele Stadtbewohner ließen sich, nicht zuletzt aus Genugtuung über die harsche Bestrafung, diese Anlässe nicht entgehen. Erst sah man sich das Hängen an, und dann folgte man dem Toten an den Seziertisch, um sich zu überzeugen, dass er auch wirklich erledigt war. Anwesend waren also wissbegierige Chirurgen und Ärzte, Vertreter der Obrigkeit, die sich überzeugen wollten, dass der Gerechtigkeit genüge getan wurde, und andere Schaulustige. Der Eintritt kostete sechs oder sieben Stuiver (etwa ein Drittel eines Guldens, also mehr als der Eintritt ins Schauspielhaus).
Auch bei kaltem Wetter stellten diese seltenen Anlässe einen Angriff auf die Sinne dar. Es wurden Räucherstäbchen verbrannt, um den Geruch erträglich zu machen. Es gab Musik, Speisen, Bier und Wein. Das herrliche Frontispiz im berühmtesten Anatomielehrbuch der Renaissance, Andreas Vesalius’ siebenbändigem Werk De humani corporis fabrica (Über den Bau des menschlichen Körpers) von 1543, zeigt inmitten einer aufgewühlten Menge einen Hund und einen Affen. Wenn alles vorbei war und alle Teile des Körpers vom Tisch in den Abfalleimer gewandert waren, beliefen sich die Einnahmen auf 200 Gulden. Davon wurden der Henker bezahlt und ein Festmahl für die Gildenmitglieder veranstaltet. Mit einem Fackelzug ging ein solcher Tag zu Ende.
Rembrandt zeigt uns Adriaanszoons auf dem Tisch liegenden Körper Füße voran und perspektivisch verkürzt. Auf seine nackte Brust fällt viel Licht. Auf dem Gemälde ist er von Kopf bis Fuß etwa 120 cm lang. Auch wenn man die Perspektive berücksichtigt, die den Kriminellen zu einem stämmigen Zwerg zusammenstaucht, erscheint er im Vergleich zu den schwarz gekleideten Chirurgen massig, groß und muskulös. Das Gesicht liegt teilweise im Schatten, wir können es aber deutlich erkennen. Es scheint sogar, als sei der Kopf etwas angehoben, um uns diese überraschende Intimität zu ermöglichen. Seinen Hals, auf dem die Schlinge des Henkers ihre Spuren hinterlassen haben muss, sehen wir allerdings nicht. Im Unterschied zu den rosigen Wangen der Chirurgen ist Adriaanszoons Haut graugrünlich bleich. Rembrandt mischte seinen Farben etwas Rußschwarz bei, um diesen aschenen Ton zu erzeugen. Joshua Reynolds notierte 1781 in seinem Reisetagebuch über das Bild: „Realistischer kann totes Fleisch nicht dargestellt werden.“
Und doch ist das Gemälde fiktiv. Bei einer normalen anatomischen Sektion öffnet der Praelector zuerst den Unterleib des Toten, um die wichtigsten Organe und die am schlimmsten stinkenden Teile des Verdauungstrakts freizulegen und rasch zu entfernen. Rembrandt zeigt uns stattdessen Adriaanszoons heilen Rumpf. Nur vom linken Unterarm wurde die Haut abgezogen, sodass wir Muskeln und Sehnen sehen. Rembrandt und Tulp haben sich entschieden, uns die sezierte Hand des Straftäters zu zeigen. Warum diese Geschichtsfälschung?
Vieles spricht dafür, dass Rembrandt dabei war, als man ’t Kint nach und nach zerlegte. Vielleicht hat er vor der Sektion ein paar Skizzen von Adriaanszoons Körper anfertigen können. Möglich ist, dass er Unterarm und Hand erst später nach einem anderen Körper zeichnete. Oder er malte diese Körperteile in seinem Atelier, denn dort lagerten, wie ein Besucher 1669, kurz vor Rembrandts Tod, feststellte, „vier Arme und Beine mit abgezogener Haut, wie Vesalius sie zeigt“. Möglicherweise gehörte die rechte Hand auf dem Bild gar nicht zum selben Körper. Adriaanszoons rechte Hand war unter Umständen bereits als Strafe für frühere Verbrechen entfernt worden, und Rembrandt könnte sie nach einem anderen Modell gemalt haben. Röntgenbilder lassen vermuten, dass der rechte Arm auf dem Bild zunächst ein Stumpf war, und nach Meinung von Experten sind die manikürten Finger „sicher nicht die eines Diebes“.
Der Schein trügt also auf Rembrandts frühem Meisterwerk. Um zum Gegenstand des Gemäldes werden zu können, musste Adriaanszoons Körper zwei unliebsame Prozeduren über sich ergehen lassen: Erst wurde er von einem Arzt auseinandergenommen, dann wie Frankensteins Monster von einem Maler wieder zusammengesetzt. Beides war erst möglich, seit der Körper als etwas wahrgenommen wurde, was man wie eine Abstellkammer oder eine Schatztruhe öffnen kann – eine Ansammlung und ein Behältnis wundersamer und erstaunlicher Teile.
Zwischen der Veröffentlichung von Vesalius’ anatomischer Abhandlung 1543 und Rembrandts Gemälde von 1632 war die menschliche Anatomie ein Modethema. Mit der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1453 durch die Osmanen gelangte das medizinische Wissen aus Arabien und der Antike nach Europa. Und auch das Verbot, Leichen zu öffnen, war inzwischen gelockert worden. Papst und weltliche Herrscher gestatteten die Sektion der Körper von Hingerichteten zu medizinischen Zwecken. Nun konnte man alles auseinandernehmen und „anatomisieren“, physisch und philosophisch. John Donne bekannte in seinen Devotions: „Ich habe meine eigene Anatomie aufgeschnitten.“ Der depressive Robert Burton publizierte seine Anatomie der Melancholie. William Shakespeares König Lear rief verzweifelt aus: „Dann sollen sie Regan den Leib aufschneiden und sehn, was um ihr Herz herum wächst.“
Keine Universität mit einer medizinischen Fakultät, die etwas auf sich hielt, kam mehr ohne Anatomietheater aus. In protestantischen Gegenden baute man viele Kapellen zu solchen Theatern um, was nicht unbedingt anzeigt, dass eine atheistische Wissenschaft an die Stelle der Religion tritt, aber doch, dass die Kirchen die neuen Methoden akzeptierten. Auch in Leiden, wo Rembrandt aufwuchs und Tulp studierte, wurde 1596 ein Anatomietheater eingerichtet, das beide mit Sicherheit kannten. Im Boerhaave Museum mitten in der Stadt befindet sich heute eine schöne Rekonstruktion. Der Rundbau mit seinen steilen Rängen sollte möglichst vielen Zuschauern erlauben, der auf einem drehbaren Tisch in der Mitte vorgenommenen Sektion beizuwohnen. Ausgeschmückt wurde das Leidener Theater mit Skeletten, darunter einem menschlichen Reiter auf einem Pferdeskelett, das auf hohen Stelzen stand. Die makabre Dekoration ist noch auf einer Radierung aus dem 17.Jahrhundert zu sehen. Das Publikum auf diesem Bild besteht zum Teil aus Gerippen, die Banderolen mit Aufschriften wie „MEMENTO MORI“ und „NOSCE TE IPSUM“ halten. Das 1619 in Amsterdam eingerichtete Theater, in dem Tulp als Arzt tätig war, sah ähnlich aus. Das Theater gibt es schon lange nicht mehr, aber seine Aufschrift „THEATRUM ANATOMICUM“ hängt noch über dem Eingang zu einem der Türme des Antoniustores – der heutigen „Waag“ –, wo es sich einmal befand.
Doktor Tulp war Pionier und führendes Mitglied einer angesehenen Berufsgruppe – und er hatte hart dafür gearbeitet. Der Sohn eines calvinistischen Tuchhändlers schrieb sich als Nicolaes oder Claes Pieterszoon an der Leidener Universität ein. Er schloss eine medizinische Ausbildung ab, promovierte über die Cholera und kehrte in seine Heimatstadt Amsterdam zurück, um dort eine Praxis zu eröffnen. Er war kein Facharzt für Anatomie, sondern Allgemeinarzt und konnte daher sowohl Medikamente verschreiben als auch Operationen vornehmen. Einige Jahre bevor die aus der Türkei eingeführte Tulpe in der niederländischen Republik eine landesweite Manie wurde und schließlich die erste ökonomische Blase auslöste, machte er sie zu seinem Symbol und platzierte sie an seinem Haus und auf seinem Wappen. Er wählte sogar seinen Namen dementsprechend: Von nun an war er der erfolgreiche Doktor Tulip. 1628 stieg er zum Praelector der Chirurgengilde auf. Im Januar 1631 führte er seine erste öffentliche Sektion durch. Rembrandts Gemälde zeigt den beinah Vierzigjährigen, der inzwischen zum Ratsherrn gewählt worden war, ein Jahr später auf der Höhe seiner Macht und seines Ansehens bei seiner zweiten anatomischen Vorführung.
Tulps Persönlichkeit ist auch der Schlüssel zum Verständnis des Gemäldes. Denn natürlich ist es nicht einfach ein Gruppenbild. Die Gesichter der versammelten Chirurgen strahlen in der Januarkälte großes Selbstbewusstsein aus. Wie ein gezeichnetes Daumenkino lassen sie sich von links nach rechts lesen: Sie drücken eine Folge von Zuständen aus, vom einfachen Beschauen über die intellektuelle Durchdringung bis zu so etwas wie göttlicher Erleuchtung. Tulp selbst glüht im Lichte seiner religiösen Überzeugungen. Rembrandts Inszenierung lässt ihn metaphysische wie wissenschaftliche Wahrheiten verkünden. Dazu passt auch die Betonung der Hand. Der Mensch kann noch so geschickt und gewandt, erfinderisch und gewitzt sein, als Chirurg, Maler oder Taschendieb, sterben muss er trotzdem. Der Mensch ist lebendig und sterblich. Er erschafft und er ist von Gott erschaffen.
Damit auch wirklich jeder versteht, worum es geht, zeigt der hinterste Chirurg auf die Leiche und schaut uns direkt, fast anklagend, an. Haben wir unsere Lektion auch wirklich gelernt?
Der erste sezierte Körper, den ich sehen sollte, überraschte mich. Es war eine Frau. Anatomische Texte beschäftigen sich meist mit Männern, weil einerseits Anatomen und Chirurgen und andererseits auch die Delinquenten meist Männer waren. Zwar standen der frühen Medizin nie genug Körper zur Verfügung, doch unter denen, die zugänglich waren, gehörten überdurchschnittlich viele zur Gruppe der gesunden jungen Männer. Illustrierte anatomische Texte strotzen geradezu vor muskulösen männlichen Jugendlichen.
Es blieb nicht bei der einen Überraschung. Die vor mir liegende Frau starb offenbar in hohem Alter. Ihre Haut war gipsfarben, wie ein Hühnchen, das zu lange im Gefrierfach gelegen hatte. Der größte Schock war, dass ihr Kopf aufgeschnitten war, und zwar nicht, wie man das erwarten würde, am Hals, sondern durch das Kinn, weil man die Zähne und den Rest des Kopfes für weitere Studien zurücklegen wollte. Übrig war also fast nur der Unterkieferknochen.
Nun liegt sie in einem offenen Leichensack auf einem der zwölf Stahltische im Sektionssaal der Oxforder medizinischen Fakultät. Der Saal ist weiß und hell erleuchtet durch das schwache, durch längliche Fenster einströmende Sonnenlicht und fluoreszierende Lampen. Das einzig Unmoderne sind die Skelette, die zwischen den Tischen an Gestellen baumeln. Später sehe ich mir das Foto eines Sektionssaals aus dem 19.Jahrhundert an, und dort gab es die gleiche Abfolge von Tischen und Skeletten. Die Tische waren aus Holz und die Körper in Leinentücher gehüllt, aber sonst hat sich nicht viel verändert.
Anwesend bin ich auf Einladung der Ruskin School, an der Zeichnen und Bildende Kunst gelehrt werden. Um mich herum stehen Kunststudenten im ersten Semester. Ruskin ist heute die einzige Kunstschule in England, die ihre Studenten zum Zeichnen in die Anatomie schickt. Früher gehörte das auf den Lehrplan jedes angehenden Malers. Ich folge also eher Rembrandts Fußstapfen als Doktor Tulps.
Wer zeichnen will, muss sehen lernen. Auch ich will versuchen zu zeichnen, was ich sehe. Unsere Dozentin, Sarah Simblet, ist Künstlerin und Wissenschaftlerin. In ihrer Doktorarbeit analysierte sie die Wechselbeziehungen zwischen dem Zeichnen und dem Sezieren, die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen Stift und Skalpell. Sie ist an diesem kalten Januartag hierher geradelt, ihre Wangen glühen wie die von Doktor Tulp und seinen Chirurgenkollegen.
Sarah erklärt, dass die Körper, die wir zeichnen werden, von der örtlichen Bevölkerung stammen und der medizinischen Forschung zur Verfügung gestellt wurden. (Die Körper von ehemaligen Mitgliedern der medizinischen Fakultät werden an andere Orte versandt, um den eigenen Kollegen unliebsame Überraschungen zu ersparen.) Das hat Vorteile – wie das Geschlechtergleichgewicht. Allerdings gehören die meisten Körper jetzt Menschen, die an Altersschwäche gestorben sind. Viele jung Verstorbene werden obduziert, sodass ihre Körper später nicht mehr „nutzbar“ sind.
Wir ziehen uns weiße Kittel und Gummihandschuhe an. Sarah versichert uns, dass alles, was wir sehen, „absolut unbeweglich“ ist und dass wir nichts berühren müssen. Die Spannung steigt. Zwei Studenten reden sich spaßeshalber als „Herr Doktor“ an. Eine Studentin fragt sich laut, ob sie auf das Mittagessen hätte verzichten sollen.
Um uns Schritt für Schritt auf unsere Aufgabe vorzubereiten, zeigt uns Sarah zunächst eine Kiste voller Knochen. Die Studenten haben sich anhand von Skeletten schon mit den Grundzügen der Anatomie vertraut gemacht, aber die meisten haben hier zum ersten Mal mit echten Körperteilen zu tun. „Bedienen Sie sich“, sagt sie und nimmt sich selbst ein paar heraus. Sie hält ein Schulterblatt hoch, das so dünn ist, dass man hindurchschauen kann, und zeigt uns an den Kanten der größeren Knochen, wo früher Muskeln ansetzten. Ich hatte schon früher Knochen in der Hand gehabt, bin aber auch jetzt wieder erstaunt, wie leicht sie sind.
Dann betreten wir den eigentlichen Sektionssaal. Auf den Tischen am Fenster liegen ganze Körper, die schon weitgehend von Studenten der Chirurgie seziert wurden. Auf den übrigen Tischen liegt eine Vielzahl von Rümpfen und Gliedmaßen, von denen teils die Haut, teils auch Unterhautgewebe weggeschnitten wurde. Dabei handelt es sich um sogenannte Prosektionen, also die durch einen Dozenten vorgenommene Entfernung wichtiger Körperteile zur Unterrichtung derjenigen Studenten, die nicht selbst das Messer ansetzen.
Auf dem ersten Tisch, um den herum wir uns sammeln, liegt die alte Frau. Ihre Haut ist so angeschnitten, dass man sie von der Brust lösen kann, wodurch eine dünne Schicht gelben Fettgewebes zum Vorschein kommt. Wir sehen die Muskeln, die die Brüste mit den Rippen verbinden. Aus den Muskeln werden Sehnen. Sarah zeigt uns, dass die Sehnen „so eine schöne, silbrige Anmutung“ besitzen. Rippen und Brustbein wurden sorgfältig aus dem Rest des Skeletts freigesägt. Mit der Begeisterung einer Lehrerin wischt sich Sarah die blonden Haare aus dem Gesicht – vielleicht hätte sie sich eher einen Zopf machen sollen? – und schaut in die Brusthöhle. „Da haben wir ja Glück dieses Jahr“, freut sie sich. „Das sieht doch gut aus.“ Sie hebt die Lunge der Frau heraus, den rechten Flügel mit den drei Lappen, den linken mit zweien. Das schwammartige Gewebe ist bläulich. Die Frau kommt also vom Lande. (Stadtlungen sind schwarz, wie ich beim Besuch einer innenstädtischen Londoner Uniklinik feststellen werde.) Mit beiden Händen hält Sarah die Lunge hoch und zeigt uns, wie die beiden Flügel wie die Teile eines Abgusses zusammenkommen, wobei ein Hohlraum für das Herz frei bleibt. Dann zieht sie den Herzbeutel – eine becherartige Membran, die das Herz an Ort und Stelle hält – zurück, und wir sehen das Herz.
Auch der zweite Körper ist der einer Frau. Sie ist stämmiger. Durch die Dämpfe der Flüssigkeit, die die sezierten Körperteile vor der Verwesung schützen soll, dringt der dünne, ranzige Geruch, den die langsame Oxidation von Körperfett freisetzt. (Wirklich fettleibige Menschen werden nicht seziert, weil das Fett aus anatomischer Sicht reiner Abfall ist und seine Entsorgung zu viel Aufwand bereitet.) Ihre Lungen sind hoch in die Brust verschoben, was womöglich auf eine Krankheit schließen lässt, vielleicht auf eine vergrößerte Leber, aber auch eine ganz natürliche Variation sein könnte.
Der dritte Körper gehört einem Mann. Auf seinem rechten Arm erkennt man eine Tätowierung, ein Herz und ein Schwert. Er hat noch sein Brusthaar. Ich merke, wie es mir wegen dieser Identitätsmerkmale deutlich schwerer fällt, seinen Körper als seelenlose Leiche zu betrachten. Sein Fleisch scheint dunkler als das der Frauen, weil sein Blut nicht richtig abfloss. Er ist füllig, daher hatte sein Herz sich vergrößert, um weiterhin Blut durch die verstopften Arterien pumpen zu können.
Beim Anblick der Körper fällt mir auf, dass die wichtigen Organe so geformt sind, dass sie gut nebeneinanderpassen. Diese Passgenauigkeit könnte zu Rückschlüssen auf eine bewusste Gestaltung verleiten, und nach Meinung früher Anatomen wie sicher auch Doktor Tulp waren sie ein Indiz für Gottes Schöpfungstätigkeit. Meine anfängliche naive Frage, ob es Organe gebe oder ob sie kulturelle Erfindungen seien, scheint beantwortet. Die Organe sehen jeweils verschieden aus und unterscheiden sich von anderem Gewebe. Sie besitzen eine jeweils charakteristische Farbe, Stofflichkeit und Dichte. Wie bei den Plastikmodellen kann ich sie nacheinander herausnehmen und wieder zurücklegen. Es ist ein befriedigendes Gefühl, eine Leber unter dem Zwerchfell hindurchzuschieben oder einen Lungenflügel hinter das Herz zu drücken, da das jeweilige Organ sich wieder so feucht in seine Höhle schmiegt wie früher im Leben. Nach einigen weiteren Körpern wird mir klar, dass sich Menschen innerlich mindestens ebenso sehr unterscheiden wie äußerlich. Unter der Haut sind wir nicht identisch. In der inneren Morphologie gibt es große Unterschiede, die – könnte man sie in der äußeren Welt wahrnehmen – bestimmt für Kommentare, Missmut, Ekel oder Diskriminierung sorgen würden. Im Inneren bemerkt sie nicht einmal ihr Eigentümer. Was sagt uns das über unser Menschsein?
Die Prosektionen sind ein Sammelsurium: ein paar Herzen, ein wie die Türen eines Schranks geöffneter Brustkorb, eine grünliche Gallenblase, Nieren, die durch ihre Harnleiter mit der Blase verbunden sind, ein Uterus mit Eierstöcken und Eileiter. Der Darm ist nicht, wie in Comics, eine Kette von Würsten, er wird von einem feinen Netz von Blutgefäßen durchzogen. In einem Herzen erinnert ein Plastikröhrchen an eine frühere Operation. Ein Schädel wurde entlang der Nähte gesprengt, an denen sich die beiden Teile in der frühsten Entwicklungsphase verbunden haben. Man tut dies, indem man den Schädel mit trockenen Erbsen füllt und diese dann in Wasser tränkt, sodass sie sich vollsaugen, vergrößern und die Schädelteile langsam auseinanderschieben. Einige Prosektionen liegen seit Jahren hier. Präserviert sind sie in einem flüssigen Gemisch aus Alkohol, Formaldehyd und Wasser, das einen scharfen Geruch erzeugt, der einem noch nach Stunden in den Kleidern hängt. Das Muskelgewebe ist faltiger als das der sezierten Körper. Mit Schrecken stelle ich fest, dass das Fleisch wie langsam gegartes Tierfleisch aussieht. Ein Stück Rückenmark befindet sich seit 150 Jahren hier – sorgfältiger könnte man es auch heutzutage kaum präparieren.
In den acht Stunden ihres Kurses behandelt Sarah einen Körperteil nach dem anderen: Schulter und Arm, Unterarm und Hand, Rumpf usw. In der zweiten Woche geht es um Kopf und Hals. In einem Tank befinden sich etwa ein Dutzend Köpfe, und jeder von uns wählt einen aus. Ein alter Mann mit spitzem Kinn und weichen, weißen Stoppelhaaren besitzt eine zur Seite gebogene römische Nase. Seine Zunge schaut etwas heraus. Das Gesicht ist ausdrucksstark und erinnert mich an das eines gotischen Wasserspeiers. Aus einem anderen Kopf wurden das Gehirn und das Fleisch um die Augen entfernt, sodass die Augäpfel völlig frei im Schädel zu hängen scheinen. Der Kopf eines anderen Mannes wurde der Länge nach aufgeschnitten, einschließlich des roten Schnurrbarts. Auch von seinem halben Gesicht lässt sich ohne Weiteres auf sein früheres Aussehen schließen, und ich beginne darüber nachzudenken, welche Bedeutung die Symmetrie für den menschlichen Kopf und den Körper hat.
Am menschlichen Kopf lernt sich das Zeichnen wunderbar. Zum einen sind die Formen schwierig. Und dann sind da noch die Charakterspuren im Gesicht. Es gilt, aus dem toten Fleisch Lebendiges heraufzubeschwören. Das ist eine Herausforderung, vielleicht sogar die Pflicht eines Künstlers: sein Motiv von den Toten zu erwecken. Die vielen Einzelheiten lassen sich nicht alle darstellen. Der Künstler muss vor allem vereinfachen. Was soll man zeigen, was weglassen? Was genau will man eigentlich zeichnen? Geht es um eine leblose Kuriosität, um eine Allegorie menschlicher Eitelkeit, um eine wissenschaftlich präzise Illustration?
Sobald die Studenten zu zeichnen beginnen, verstummt das Witzeln. Ich habe mir einen flach auf dem Tisch liegenden Kopf mit Schultern herausgesucht. Das Gesicht ist weitgehend intakt und leicht von mir abgewandt. Haut, Fett und einige Wangenmuskeln fehlen, der Hals wurde so bearbeitet, dass viele Blutgefäße und Sehnen freiliegen. Ich versuche zu zeichnen, was ich zu sehen glaube, und beginne mit der Kopfform, in die ich wichtige Details einfüge, nicht zuletzt die dramatische Kante, an der entlang die Haut weggeschnitten wurde. Mein Ziel ist die genaue Abbildung, und ich hoffe, dass sich die Teile irgendwann zu einem Ganzen fügen werden, aber das passiert nicht. Dieser Kopf mit seinem Gewirr von Sehnen, Muskeln und Röhren wirkt hoffnungslos entstellt. Mit den organischen Konturen kommen meine freihändigen Bleistiftstriche noch einigermaßen zurecht. Das telefonförmige Nasenloch gelingt mir. Aber das komplexe Auf und Ab der Oberflächen und die verschiedenen Texturen von Haut, Fleisch und Knochen machen mir zu schaffen.
Die Studenten zeichnen besser und vor allem schneller als ich. Also beschließe ich, rascher, spontaner vorzugehen. Ich probiere es mit weicheren Stiften. Am Ende bin ich enttäuscht, wenn auch nicht überrascht. Ich sehe mir an, was die Studenten zuwege gebracht haben. Einige Zeichnungen spiegeln schlicht ein profundes Desinteresse an allen Fragen der menschlichen Anatomie wider, bei anderen ist ein gewisser Enthusiasmus zu spüren. Mich beeindrucken die Bandbreite ihrer Techniken und die Auswahl schwieriger, kaum zu meisternder Motive. Einer zeichnete das Schädelinnere und deutete mit ausdrucksvollen Schraffuren den Wechsel von Hell und Dunkel in den Höhlungen an. Ein anderer betonte jede Schleife und Windung einer Prosektion, besonders die Aorta, und erschuf so eine fast abstrakte Komposition. Auf diesen Gedanken wäre ich beim besten Willen nicht gekommen.
Körperteile sind durch und durch komplexe Gebilde. Nirgendwo gibt es besonders leicht oder besonders schwer zu zeichnende Teile. Mir fällt alles schwer – nicht zuletzt, weil der Kontrast zwischen organischer Form und regelmäßiger Geometrie fehlt, der auf einem Stillleben durch die Obstschale oder eine auf dem Tisch liegende Pfeife zustande kommt.
„Na, das ist doch erkennbar“, kommentiert Sarah meine Versuche diplomatisch, nachdem ich schon aufgegeben habe. Sie hat dieselben Köpfe gezeichnet (und gleichzeitig noch ihre Studenten betreut) und kennt sie so gut wie die Gesichter ihrer besten Freunde. Als Künstlerin hat sie sich mittlerweile eher der Botanik zugewandt. Ihre Tintenzeichnungen von Bäumen sind sichtlich auf das Knochenartige aus, auf Äste, die zu dunklen, fingernden Zweigen werden, und die Stämme erinnern an Knorpel und Knöchel. Die thematische Veränderung war für sie lehrreich. „Mich überrascht immer wieder, wie viele Fehler Zeichnungen von Körpern in bekannten Büchern enthalten“, sagt sie. „Bei Pflanzen kommt so was nicht vor. Weil wir bei ihnen nicht automatisch annehmen, dass wir sie bereits gut kennen.“
Der Körper, das sind wir selbst, und wir kennen ihn lange nicht so gut, wie wir denken. Selbst der berühmte Vesalius machte Fehler, und darüber, ob Rembrandts sezierte Hand des kriminellen ’t Kint korrekt ist, streiten sich die Geister. Sarah erzählt mir, dass Leonardo da Vinci die Herzklappen so präzise zeichnete, wie es erst im 20.Jahrhundert wieder gelang, doch selbst bei ihm hatte der Herzbeutel ein kleines Loch, durch das die Lebenskraft in den Körper fließen sollte.
Meine Beschreibung der Zeichenstunde im Sektionssaal klingt wohl dramatischer, als diese eigentlich war. Natürlich haben die rollbaren Eimer etwas Schockierendes, auf denen ganz einfach „Hände“ und „Arme“ steht und in denen sich tatsächlich ein Haufen Hände und Arme befinden, die so seziert sind, dass sich eine bestimmte anatomische Einzelheit an ihnen vorführen lässt. Ein paar strecken sich aus dem Wasser heraus, in dem sie konserviert werden. Schauerlich, kein Zweifel, aber man muss sich die Umgebung mitdenken, das helle Licht, die blitzsauberen Oberflächen, den Geruch von Reinigungsmitteln und auch die Stille, die automatisch entsteht, wenn wir mit toten Körpern arbeiten.
Was waren das wohl für Leute? Sie stifteten ihre Körper „der Wissenschaft“ – wussten sie, dass man sie zeichnen würde? Hätte es ihnen etwas ausgemacht? Die jungen Künstler lernen ihr Handwerk so, wie sie wollen. Es sind keine Medizinstudenten, aber der Körper gehört auch nicht der Medizin allein. Auch die Künstler stehen in der ehrenwerten Tradition derer, die uns zwingen, uns mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen.
Bei Autopsien denken wir gern an Fernsehserien und Thriller. Da gibt es den rauen, aufgekratzten, unter Druck stehenden Ermittler, der unbedingt den Mörder finden muss. Und den Pathologen, der dem toten Körper den entscheidenden Hinweis entlockt – methodisch, ungerührt, stillvergnügt. Der Pathologe besitzt stets die nötige kritische Distanz, um das Verbrechen aufklären zu können. Aber dass wir einen toten Körper gezielt untersuchen, nur um herauszufinden, woran er gestorben ist oder welche Krankheiten er hatte, ist eine recht neue Entwicklung. „Autopsie“ bedeutet wörtlich: mit eigenen Augen sehen. Mit dem Öffnen von Leichen hat das Wort etwas zu tun, seit im alten Griechenland die ersten anatomischen Studien der westlichen Welt stattfanden und man sich freute, Organe und andere Körperteile mit eigenen Augen sehen zu können.
Was wir mit eigenen Augen sehen, ist allerdings immer der Körper eines anderen. Auf dem frommen Schild im anatomischen Theater steht zwar „NOSCE TE IPSUM“ – Erkenne dich selbst. Aber streng genommen können wir niemals unser eigenes Inneres ans Licht zerren. Vielleicht können wir sogar gerade aufgrund dieser Unmöglichkeit an unsere Unsterblichkeit glauben. Wir können nicht sehen, wie wir sind, weder innerlich (weil wir erst tot sein müssten) noch äußerlich (weil wir aus unserem Körper nicht herauskönnen). Also müssen wir uns damit begnügen, andere Körper in der Annahme anzuschauen, dass sie wie unser eigener sind. Das ist ein großer Schritt. Nicht nur unsere eigene Sterblichkeit müssen wir akzeptieren, sondern auch die grundlegende Einheit des Menschengeschlechts.
Mit der Hilfe eines privilegierten Spezialisten, der uns über die Schulter schaut und die Sehenswürdigkeiten zeigt, kann freilich jeder von uns eine Autopsie durchführen. Wie wir sehen werden, haben nicht nur Ärzte, sondern auch Philosophen, Künstler und Schriftsteller uns einige Wahrheiten über den Körper mitzuteilen.
Doch alles der Reihe nach. Zur Orientierung brauchen wir zuerst eine Karte.
TEIL 1: DAS GANZE
Ein Atlas des Körpers
Während eines Griechenlandurlaubs wies mich ein Fährschiffer auf den Berg Kimomeni hin, der auf dem Festland gegenüber der pittoresken Insel Poros liegt. Kimomeni bedeutet „schlafende Frau“, und sobald man das weiß, kann man in der Hügelkette tatsächlich nur noch diese Form sehen, vor allem abends, wenn die Sonne im Sinken begriffen ist, die Konturen klar hervortreten – und der Retsina-Pegel steigt. Die Gesichtszüge sind gut erkennbar, die Brüste ragen in den Himmel, der Bauch unterhalb der Rippen ist flach. Die Beine sind angewinkelt, sodass das Knie einen neuen Gipfel formt. Das ist natürlich eine Touristenfalle, aber andererseits sehen die Hügel eben so aus. Die schlafende Frau ist älter als die Akropolis. Schon die alten Griechen haben die Reisenden auf sie aufmerksam gemacht – vielleicht hat sogar der aus dem fünfzig Kilometer entfernten Athen stammende Plato die Schlafende einmal erwähnt.
Schlafende Frauen gibt es auch in Thailand, in Mexiko und andernorts, manche mehr, manche weniger überzeugend. Die schottischen Papshügel ähneln angeblich, wie so viele andere, weiblichen Brüsten. Einzelne Felsen vergleicht man auch mit mythischen Gestalten, zum Beispiel Lots Weib. In den kalifornischen Bergen liegt Homer’s Brow, Homers Stirn. Wer sich die Karte einer auch nur einigermaßen abwechslungsreichen Gegend vornimmt, entdeckt ganz sicher irgendetwas, was nach einem Teil des menschlichen Körpers benannt ist. Anatomisch-geografische Vergleiche florieren auch im Zeitalter der exakten Kartografie und der Luftaufnahmen: Die „Hand von Michigan“ ist der fäustlingsförmige Teil jenes US-Bundesstaates, der sich nordwärts zwischen den Michigan- und den Huronsee schiebt.