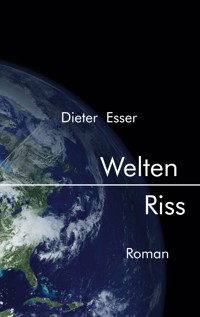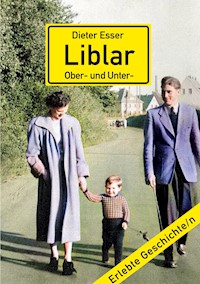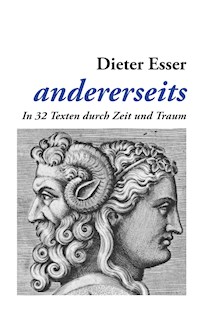
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Essers Geschichten führen den Leser durch verschiedene Zeiten und geographische Räume in neue, "unerhörte Begebenheiten", wie Goethe einmal sagte. "Georg reist" - aber wohin reist er wirklich? Warten die vier Personen tatsächlich auf die "Fähre", die sie ans andere Ufer bringen soll? Was wäre passiert, wenn Abraham seinen Sohn Isaak nicht hätte opfern wollen? Was macht Odysseus in Cincinnati, was Bertolt Brecht im Himmel? Einfühlsam, aber auch irritierend und in überraschenden Wendungen zeigt der Autor das Leben von Menschen, die von "Amors Pfeilen" getroffen werden, die aus der Partnerschaft in Einsamkeit und aus der Einsamkeit in Partnerschaft flüchten, nimmt den Leser mit auf Ausflüge durch erstaunliche Vergangenheiten und zukünftige Zeiten. Ja, so war es und so ist es, könnte man meinen, aber ... andererseits.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen ehemaligen Schülern, die gerne Kürzeres lesen
“Dat miezde jeht donevve!”
Das Meiste geht daneben!
Therese Weishaar, Großmutter des Autors, als sie in strömendem Regen zur Kirche eilte. Und vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, ist mehr als nur der Regen gemeint.
“Denn was sind Geschichten? Man kann sagen, zierliche Nötigungen der Wirklichkeit, Farbe zu bekennen.”
Siegfried Lenz
Inhalt
I. In unserer Zeit
Ab-ge-macht
Georg reist
Heinrich
Die Fähre
Vereins-Heim. Etwas später
Jakobs Weg
Reisefinanzierung
Lukas 1, 2, 3, 4
Amors Pfeile
Es gibt Schlimmeres
Happy Birthday Birthday Birthday
Onze Lieve Vrouwe
Daamnterren
Zimmer 16
Romea und Julio
II. In jener Zeit
Die Hochzeit zu Kana
Abraham und Isaak
Ent-Schluss
Hinter der Pforte des Himmels
Das hölzerne Pferd
Der Hirte Paris
Dädalus und Ikarus
Aus den Tagebüchern des Odysseus
III. In ferner Zeit
Der neue GZK
Tele-Phon
IV. Für übermorgen
Life is a Kleinstadt-Blues
Emotion‘s Eleven
The Jeremiade of Alfred
Seven Poems
Haiku-Miniaturen
Kevins Protest
Generalstreik
I
In unserer Zeit
Ab-ge-macht
An einem sonnigen Sonntag im Juni saßen Emily und Johannes am Frühstückstisch. „Was machen wir heute?“ fragte Emily. Johannes blickte von seiner Sonntagszeitung auf. „Mmh“, war alles, was er angesichts dieser immer wiederkehrenden Sonntagsfrage herausbrachte.
In veränderter Satzstellung würde sie jetzt sagen: „Was wir am Sonntag machen …?“
Sie sagte es.
Johannes wandte sich an seinen Schöpfer: Lieber Herr Autor, sagte er, warum muss ich immer Vorschläge machen, obwohl sie längst beschlossen hat, zum vierhundertsiebenundzwanzigsten Mal zum Trödelmarkt zu gehen? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Schlag ihr den Trödelmarkt in Elchingen vor und dein Tag ist gerettet, inklusive Sex heute Abend.
„Ist nicht heute Trödelmarkt in Elchingen?“ fragte er hinterhältig.
„Ach ja“, sagte Emily und gab sich größte Mühe, überrascht zu wirken.
„Tolle Idee, da können wir ja mal nach Bilderrahmen Ausschau halten – für meine Acrylbilder.“
Kaum etwas interessierte Johannes noch weniger als Emilys Versuche in Acryl.
Immer noch besser als Seidenmalerei, warf der Autor ein. Komm, gib ihr ein gutes Gefühl!
„Natürlich, Schatz. Für dein Wolkenbild brauchen wir etwas Klassisches, vielleicht sogar etwas Antikes.“
„Findest du? Ich glaube ein moderner Rahmen passt besser zu den Farben.“
„Na ja, wenn du meinst. Wir können es ja ausprobieren. Am besten, wir nehmen die Bilder mit und schauen mal, ob …“
Herrgott, lass Montag werden, dachte Johannes. Emily aber war Feuer und Flamme: „Das machen wir. Ich hol sie eben.“
Sie stand auf, obwohl ihr Milchkaffee zu erkalten drohte, und begab sich auf die Suche.
Kannst du sie nicht einfach die Treppe runterfallen lassen? fragte Johannes den Autor verzweifelt. Die Antwort: Dann ist die Geschichte zu schnell zu Ende; aber ich könnte dir auf andere Weise helfen. – Wie das? – Wie wär’s damit: Einer der Trödelhändler macht ihr schöne Augen, sie trifft sich heimlich mit ihm, dann brennt sie mit ihm durch und du könntest in Frieden – Na, ich weiß nicht, maulte Johannes, aber das mit dem Frieden, den ich dann haben werde, das klingt gut.
Emily rief aus dem Flur: „Mit wem sprichst du da, Schatz?“
„Ich? Ich habe mit niemandem gesprochen.“
Damit gab sie sich zufrieden. Zwei Acrylbilder hatte sie gefunden: Wolken und Berge im Sonnenlicht.
„Ich weiß nicht, wo die Meereswellen sind“, sagte sie resigniert.
Johannes wusste es. Er hatte die Meereswellen langsam und vorsichtig entsorgt. Sie waren scheußlich. Ohne Tiefe, ohne Kontraste. Ein paar blauweiße Acrylflecken, mit einem Stofftuch betupft, gezogen – schwupp, fertig waren die perfekten Wellen.
Der Autor drängte zur Eile.
„Dann lass uns los!“ sagte Johannes.
Er lobte den Autor für die Doppeldeutigkeit seines letzten Satzes. – Lass mich mal machen, lieber Protagonist. Doch Johannes war ungehalten: Dann lass uns schnell in Elchingen ankommen. Nicht wieder diese überflüssigen Passagen: Zunächst nahmen sie die Landstraße, die sich über die Hügel schlängelte … Die Sonne schien unbarmherzig vom Himmel. Von wo denn sonst? Also, mach’s kurz. Der Autor war einverstanden.
Emily freute sich, als sie an der Ortseinfahrt von Elchingen ankamen.
„Du, park doch hier vorne, dann gehen wir ein Stück zu Fuß“, schlug sie vor. Sie parkten hier vorne und gingen ein Stück zu Fuß.
Johannes ließ Emily ihre Bilder selber tragen. Am Eingang des Trödels bot ein etwa sechzigjähriger Althippie Vinylplatten und Poster an. Er drehte sich gerade eine Zigarette.
Warum eine Selbstgedrehte? Voll das Klischee! Doch der Schöpfer blieb hart.
Der Händler grüßte kaum und befeuchtete die Klebekante seiner selbstgedrehten Zigarette behutsam mit der Zunge. Dann rollte er geschickt das weiße Papier und heraus kam eine geradezu perfekte Zigarette. Er nestelte in seinem verwaschenen Leinenjacket.
Bitte nicht noch mehr Klischee! bettelte Johannes. Fehlt nur noch, dass er kein Feuerzeug …
Er zog eine Schachtel Streichhölzer hervor, setzte sich auf den Hocker vor dem Aristide-Briand-Poster, zündete das Produkt seiner Fingerfertigkeit an und nahm einen genussvollen Zug.
Es reicht, lieber Schöpfer! Jetzt nicht noch Qualmwölkchen, die sich scheinbar mühelos zum Himmel bewegten.
Die Qualmwölkchen bewegten sich scheinbar mühelos zum Himmel, bevor sie sich verflüchtigten.
Okay. Ich weiß. Jetzt kommt der unvermeidliche Kaffee.
Er drehte sich nach links, griff den Kaffeebecher, der schon bessere Tage gesehen hatte, und nahm einen Schluck.
Können wir bitte weiter? Ich hasse diese Stereotypen.
Die beiden gingen weiter. Emily war aufgrund der aufgerollten Acrylbilder, die sie vorsichtig mit beiden Händen umfasste, …
Gottseidank!
… nicht in der Lage, etwas von den dargebotenen Waren zu betasten oder gar aufzunehmen.
Bitte, Schöpfer, nicht!!!
„Halt mal eben“, sagte sie mit einem Lächeln, „ich möchte mir diesen Kerzenständer ansehen.“
Johannes wusste, dass es sinnlos wäre, ihr klarzumachen, dass sie genau das eben auch schon tun konnte: ansehen. Nein, er kannte das Ritual: Ansehen, anfassen, hochheben, drehen, kaufen. Das heißt, kaufen musste Johannes. Ob sich der Urheber dieser Zeilen noch an sein Versprechen erinnert, ging es Johannes durch den Kopf.
Johannes bat um eine Plastiktüte, in die er den Kerzenständer stecken konnte. Emily nahm ihm die Acrylbildrollen ab und händigte ihm den Kerzenständer in der Plastiktüte aus. Es war Johannes nicht unbemerkt geblieben, wie der Händler seine Frau anstarrte. War Emily verlegen? Nein, sie schaute dem Händler direkt in die Augen.
Johannes wandte sich ab und ging zum nächsten Stand. Im Augenwinkel sah er, wie der Händler Emily eine Visitenkarte hinhielt, die sie begierig entgegennahm. Sie studierte die Karte aufmerksam, etwas länger, als die wenigen Worte es erfordert hätten. Dann schaute sie den Händler freundlich an und sagte ein paar Worte, die Johannes nicht verstand, weil er mittlerweile schon zwei Stände weiter stand. Hier gab es Bücher und Zeitschriften: Der Erste Weltkrieg in Bildern, Marquis de Sade, eine angegraute Ausgabe des SPIEGEL lag oben: Mauerbau in Berlin.
Winter. Es war Sonntag. Johannes hatte sich einen Kaffee gekocht. Die Sonntagszeitung wartete. Mit Wehmut und Erleichterung erinnerte er sich an die vergangenen Monate. Er hatte Emily sogar geholfen, ihre Farbtuben, Pinsel, Leinwände und eine neue Staffelei im Transporter des Händlers zu verstauen.
Danke, lieber Schöpferautor. Komm bitte zu einem friedlichen Ende.
Er setzte sich an den Tisch, schob die Kaffeetasse ein wenig zur Seite, schlug die Zeitung auf. Dann schaute er auf die Küchenwand und betrachtete eine Weile das Bild in dem klassisch-antiken Rahmen: „Wolken“.
Georg reist
„Was würdest du uns empfehlen, Georg? Wir fahren nach Venedig, aber wir wollen nicht mehr als drei Tage in der Stadt verbringen.“
„Habt ihr ein Auto da?“
„Nein, wir fliegen nach Venedig und haben drei Nächte gebucht. Für die restlichen vier Tage suchen wir noch was.“
„Gut, dann nehmt den Zug nach Triest. Ihr müsst zuerst von Venedig Santa Lucia mit der Bahn nach Mestre, 10–15 Minuten etwa. Dann steigt ihr um und fahrt in zweieinhalb Stunden über Treviso, Conegliano, Udine und Gorizia bis Triest. Alte KuK-Stadt, italienisch, österreichisch und schon mit einem Hauch von Balkan. Slowenien und Kroatien sind nur einen Steinwurf entfernt.“
Lisa und Hans bedankten sich höflich bei Georg.
Auf Georg konnte man sich verlassen. Er kannte alle Ecken Europas von Norwegen bis Griechenland, von Polen bis Portugal, obwohl er nur so eine kleine Postagentur betrieb. Alle staunten über seine Kenntnisse.
Irland? Kein Problem. Georg erzählte voller Stolz von The Burren, von Galway, von Connemara. Er kannte Fischer in Mayo im äußersten Nordwesten Irlands, wusste, wo man günstige Bed&Breakfast-Unterkünfte findet. Er war ein gefragter Berater, man traf ihn meist abends in seinem Stammlokal. Vor Reisen, aber auch, nachdem die Reisenden seinen Ratschlägen gefolgt und wieder wohlbehalten aus Asturien, Andalusien, Montenegro, Albanien oder Süditalien zurückgekehrt waren.
Georg war unverheiratet. Mit seinen 48 Jahren hielt er es auch für angebracht, sich lieber Reisezielen zu widmen statt eine Beziehung einzugehen.
Wie er sich verständige in all den Ländern, die er bereist hatte, hatten ihn Ratsuchende gelegentlich gefragt.
Meistens mit Englisch, aber für Spanien, Italien oder den Balkan müsse man sich schon ein wenig mit den Landessprachen beschäftigen, pflegte Georg dann zu antworten.
Das leuchtete den Fragern natürlich ein und es kam eine gewisse Bewunderung für den Mann aus der Postagentur auf, der meist etwas altmodisch gekleidet war. Sobald es warm genug war, trug er Flechtsandalen, die so aus der Mode waren, dass sie schon wieder als originell durchgehen konnten. Ein wenig aus der Mode, aber korrekt war er gekleidet, wenn er seine Kunden bediente. Ob er gemerkt hat, dass der eine oder der andere heimlich über den grünen Pollunder oder die dünne hellblaue Strickjacke spottete, die so gar nicht zu der pflichtgemäß umgebundenen roten Krawatte passte?
Was Reisen anbetraf, wusste er einfach Bescheid: Apulien? Unbedingt nach Lecce. Und natürlich das Bodenmosaik in der Kirche von Otranto.
Asturien? Nein, bloß nicht den Jakobsweg. Weiter südlich über Burgos von Süden zu den Picos de Europa.
Portugal? Unbedingt Porto, aber dann den Douro entlang mit der Eisenbahn. Zwei bis drei Stunden für maximal 14 Euro.
Mindestens viermal im Jahr war Georg nicht in seiner Postagentur. Und jeder wusste: Er wird wohl wieder unterwegs sein. Mit Billigflug, Bus und Bahn. Natürlich außerhalb der Saison. Im „Goldenen Reh“ hatte er nur anklingen lassen, dass er sich sehr für Schottland interessiere. Vermutlich war er also in Schottland und könnte bei seiner Rückkehr wieder herrliche Geschichten erzählen. Von Tälern und Flüssen, von Wäldern, kleinen Dörfern, Whiskydestillerien und schottischer Küche. Geheimtipps. Er würde allen wieder nützliche Tipps geben können.
Als Georg den Eifel-Express in Blankenheimwald verließ, trug er einen riesigen Rucksack, der offensichtlich schwer war, was man daran erkannte, dass er ihn auf dem Weg zum Bus, der ihn nach Blankenheim brachte, mehrmals absetzen musste.
Im Gasthof „Rose“ begrüßte ihn der Wirt mit der Freundlichkeit, die man einem Stammgast entgegen bringt:
„Einzelzimmer für 24 Euro mit Frühstück, wie immer?“
„Ja, natürlich.“
„Also wieder Zimmer 4 mit Blick auf die Burg?“
„Ja, das wäre schön.“
Georg pflegte nur kürzere Spaziergänge zu machen. Den Rest des Tages vertiefte er sich in seine Literatur. Und so hätte ein Beobachter aus seinem Heimatort den Postagentur-Inhaber Georg Schneider, 48, an einem Tisch in der Wirtsstube sitzen sehen können, vor sich einen Stapel von bunten Prospekten, Landkarten und Reiseführern.
„Oh, geht’s diesmal nach Schottland?“ fragte der Wirt, der ihm sein alkoholfreies Weizen brachte.
„Ja, in zwei Wochen. Hirschsaison in den Highlands.“
„Zum Wohl!“
Georg drehte den Schottlandführer herum. Es sollte nicht jeder sehen, was er da las, am Ende würde er noch in ein Gespräch verwickelt werden. Außerdem las er gerade einen neuen Führer über Madeira, das war ihm wichtiger.
Dann kam sein Schnitzel.
Am vierten Tag erst griff er zu einem der vier Schottlandführer und war fasziniert von den herrlichen Bildern. Nachts träumte er vom Eileen Donan Castle und von der Isle of Skye. Er hörte sich im Schlaf reden, wie er einem seiner Bekannten die Sehenswürdigkeiten Edinburghs schmackhaft machte.
Als er morgens aufwachte, schaute er gedankenverloren auf Burg Blankenheim. Eigentlich schade, dachte er, vielleicht sollte ich es doch irgendwann einmal wagen, durch Europa zu reisen.
Heinrich
Er kochte Kaffee. Den kräftigen mit 80% Arabica. Herr Gruber, das wusste Heinrich, trank ihn am liebsten. Und immer schwarz.
Noch zehn Minuten. Gruber hatte sich noch nie verspätet. Heinrich stellte zwei Tassen auf den Couchtisch. Den hatte seine Mutter erworben. Aus dem Katalog. Vieles kam damals aus dem Katalog: Unterwäsche, Socken, Geschirr. Heinrich war zwölf, als der Couchtisch kam. Mutter war glücklich. Heinrich freute sich für sie, ohne recht zu wissen warum.
Wenn er sich bemühte, sah er noch jetzt, fünfzig Jahre nach Eintreffen des Couchtisches, die Gegenstände, die Mutter auf dem Tisch arrangiert hatte: die Kerze auf dem Deckchen, die Illustrierte und die kleine Etagere mit den drei nach unten größer werdenden Glasschalen, auf denen Gebäck platziert war. Oben das feine, in der Mitte Schokokekse, unten gröbere Plätzchen. Das Ganze erinnerte ihn an ein Gedicht Conrad Ferdinand Meyers. Hieß es nicht „Römischer Brunnen“? Wäre das Gebäck flüssig gewesen, hätte es von oben nach unten strömen können …
Es klingelte. Herr Gruber. Heinrich eilte, so schnell wie es sein Rheuma zuließ, zur Haustür und öffnete.
Wie bei jedem seiner vorigen Besuche grüßte Herr Gruber von der Alten Dresdner Versicherung mit einem geradezu übertrieben freundlichen Lächeln. Heinrich trat zur Seite, ließ Gruber vorangehen. Er kannte den Weg ins Wohnzimmer. Gruber nahm im Sessel Platz. Beim letzten Besuch war es um „die Hausrat“ gegangen. Ja, Gruber sagte immer „die Hausrat“, was Heinrich, den Belesenen, den Sprachgewandten amüsierte.
„Ich habe uns einen Kaffee gemacht.“
„Das ist sehr freundlich von Ihnen.“
„Milch und Zucker nehmen Sie ja nicht.“
„Nein, richtig, immer schwarz.“
„Ich hole eben die Kanne.“
Während Heinrich in die kleine Küche ging, war er schon in Erwartung dessen, was Gruber beim Einschenken des Kaffees sagen würde: Schwarz wie die Nacht. Er würde es wieder sagen. Heinrich nahm die Kanne, trug sie vorsichtig ins Wohnzimmer und goss ein.
„Schwarz wie die Nacht“, sagte Gruber.
Dann ließ sich Heinrich auf der Couch nieder. Auf dem Couchtisch lag ein Prospekt der ECO-Versicherung. Heinrich nahm ihn vorsichtig und steckte ihn in den Zeitungsständer neben der Couch. Sicher hatte Gruber bemerkt, dass Heinrich auch von anderen Versicherungsgesellschaften Angebote einholte. Was Gruber nicht wusste, war, dass Heinrich Besucher von acht Versicherungsgesellschaften empfing, von fünf Mobilfunkanbietern und zahlreichen anderen Dienstleistern. Seit dem Tode seiner Mutter empfing er sie. Fast täglich.
„Vielen Dank.“
„Gern, und wie geht es Ihnen, Herr Gruber?“
„Viel zu tun in letzter Zeit, wegen den Sturmschäden.“
Wegen der Sturmschäden, korrigierte Heinrich stumm.
„Und selbst?“
„Kann nicht klagen. Die Kälte setzt meinem Rheuma zu.“
„Dafür sehen Sie aber blendend aus.“
„Ich mache ja auch täglich meine Übungen.“
„Also wegen der Sterbeversicherung. Was hatten Sie sich da vorgestellt?“
„Ach, wissen Sie, Herr Gruber, man muss weiterdenken.“
„Da sagen Sie was. Ich jedenfalls möchte nicht, dass meine Tochter, andere Verwandte oder auch nur die Gemeinde hier im Falle meines Ablebens für mich aufkommen muss.“
„Sehr weitsichtig von Ihnen!“
„Haben Sie Kinder, Herr Gruber?“
„Ja, eine Tochter. Sie studiert.“
„Und was?“
„Sozialpädagogik.“
„Haben Sie guten Kontakt zu ihr?“
„Na ja, sie besucht uns gelegentlich. Und telefoniert manchmal mit meiner Frau. Sie wissen ja, wie das ist.“
„Nein.“
„Na ja, sie nabeln sich ab, die Kinder.“
„Auch so, ja, Abnabeln, das geht nur ganz oder gar nicht.“
„Und in welcher Höhe wollen Sie sich absichern?“
„Ich dachte an Zwanzigtausend.“
„Das ist gut. Wenn man bedenkt, was allein ein Sarg …“
„Trinken Sie doch Ihren Kaffee. Er wird ja ganz kalt.“
Widerwillig griff Herr Gruber zu seiner Tasse und nahm einen Schluck.
„Wie heißt denn Ihre Tochter?“
„Ja, mh, Marie.“
„Schöner Name, klassischer Name.“
„Haben wir uns auch gedacht.“
Gruber beugte sich noch einmal vor, nahm die Tasse, führte sie vorsichtig zum Mund und trank, nicht ohne Heinrich über den Tassenrand zu fixieren.
Die Standuhr zeigte zehn vor elf.
„Unser Dona-eis-pacem-Programm deckt alle Kosten ab, inklusive Trauerredner. Oder bevorzugen Sie eine christliche …“
„Wäre mir schon lieber. Ich habe den Kontakt zur Kirche zwar fast völlig eingestellt, seit bekannt wurde, dass es Pfarrer gibt, die …“
„Schreckliche Geschichten, da stimme ich Ihnen zu.“
„Sind Sie denn religiös, Herr Gruber?“
„Wir haben kirchlich geheiratet und Marie natürlich taufen lassen.“
„Natürlich.“
Ein stechender Schmerz stellte sich ein, als Heinrich nach der Kaffeekanne griff. Er ließ sich nichts anmerken und schenkte nach.
Heinrich behielt die Zeit im Auge. Um dreizehn Uhr wollte jemand von der Hannover-Pro kommen. Um fünfzehn Uhr die sympathische Frau Teitinger von der Koblenz-Mayener. Arme Frau. Hatte Jura studiert, sich beim Praktikum in ihren Chef verliebt, von dem sie schwanger wurde. Natürlich hatte er sie verlassen, zahlte aber regelmäßig Unterhalt. Dann hatte sie das Studium aufgegeben, zwei Jahre als Pharmareferentin gearbeitet, was sie aber wegen des kleinen Sohnes nicht durchgehalten hatte. Die Tagesmutter verschlang einen großen Teil des Gehalts. Wenn man bedenkt, dass gerade die ersten Jahre eine Kindes …
„Dann wären wir also soweit klar.“
Oh, Gruber war ja noch da. Heinrich bedankte sich für den Besuch, wünschte Herrn Gruber alles Gute. Gruber irritierte es, als Heinrich ihn bat, seine Tochter von ihm zu grüßen, nahm seine dünne Aktentasche, zwängte sich an Heinrich vorbei durch den engen Hausflur, stieg die sechs Stufen des Hauseingangs hinab, drehte sich noch einmal um, doch Heinrich hatte die Haustür schon geschlossen.
Heute noch zwei Besuche. Und morgen die Mobilfunkanbieter. Der Rest des Kaffees war mittlerweile ganz kalt.
Die Fähre
Dunkel schob sich der Fluss am Ufer vorbei, um nach wenigen Metern in die Tiefe der Nacht einzutauchen. Ein gegenüberliegendes Ufer war nicht zu erkennen. Oder doch? War das Dunkel noch der Fluss oder schon die Umrisse des anderen Ufers?
Jedenfalls musste die Fähre bald kommen.
Der junge Mann sah nicht gut aus. Dem Manager, der schon eine geraume Weile am Fluss stand, waren sofort beim Eintreffen des jungen Mannes Narben im Gesicht aufgefallen. Er selbst hatte seit Jahren in verantwortungsvoller Position die Geschicke von Hartmann&Söhne geleitet. Und sich nie geschont. Seine Familie hatte er wenig gesehen, doch immer gut für sie gesorgt. Und als seine Tochter Isabella ihr Studium in Heidelberg aufgenommen hatte, war er da nicht persönlich zu den Immobilienmaklern gefahren? Ja, er hatte Isabella die Zweizimmerwohnung gekauft. Geschenkt.
Immer wieder betrachtete er die Narben des jungen Mannes. Trotz der Dunkelheit erkannte er, dass sie noch recht frisch waren. Sollte er fragen? Zu indiskret.
Der junge Mann kam ihm zuvor: „Wann ist die Fähre denn rüber?“
Der Manager sagte: „Das muss schon eine Weile her sein. Ich warte auch schon eine Zeitlang, dass sie zurückkommt.“
Ein Priester, der etwas abseits stand, kam näher und nahm an dem beginnenden Gespräch teil: „Sie fährt regelmäßig. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber ich weiß, sie kommt regelmäßig.“
Nun stellte sich der Manager vor: „Mein Name ist Andresen. Paul Andresen.“ Fast hätte er noch den Firmennamen hinterhergeschoben. Aber das war jetzt nicht mehr wichtig.
Langes Schweigen.
Der junge Mann beendete die Stille: „Ein wenig Warten macht doch nichts. Was bedeutet schon das Warten hier auf die Länge des Lebens.“
„Sehr klug“, warf der Priester ein, „warten wir nicht alle unser ganzes Leben?“
Eine junge Frau kam, wie aus dem Nichts, und schaute sich unsicher um.
„Kommen Sie doch näher!“ forderte der Priester sie auf, „wir warten gemeinsam auf die Fähre.“
„Ich nehme an, Sie wollen auch rüber?“ Es war Andresen, der diese Worte sprach. Dann fragte er die junge Frau: „Haben Sie sich um die Fährzeiten gekümmert? Wir warten nämlich schon länger.“
„Wir wollen alle hinüber“, sagte der Priester, „kommen Sie. Gemeinsam wartet es sich leichter.“
Jetzt erst, nachdem sie sich erneut lange umgeschaut hatte, sagte sie:
„Vielleicht ist das gar nicht die Anlegestelle.“
Der Priester zeigte auf Spuren am Ufer: „Sehen Sie doch! Die sind ganz sicher von der Fähre! Wenn sie anlegt und die Leute aufnimmt.“
Alle versuchten, in der Dunkelheit die Spuren zu erkennen, doch auch der junge Mann war skeptisch: „Das könnten auch andere Spuren sein. Vielleicht gibt es an anderen Stellen weitere Fähren. Ich heiße übrigens Niederhaus, Sven Niederhaus.“
„Seyfert“, stellte sich der Priester vor.
Alle schauten erwartungsvoll auf die sehr blasse junge Frau. Sie verstand sofort und nannte ihren Namen: „Katharina Rogoff.“
„Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor,“ rief Andresen, „was machen die nur so lange auf der anderen Seite? Und müsste man nicht etwas hören? Wenigstens dumpf?“
Es war Seyfert, der ihn belehrte: „Sehen Sie sich doch um. Die Dunkelheit, der Nebel. Das dämpft doch jedes Geräusch. Jetzt habt doch mal Vertrauen. Die Fähre kommt.“
„Wo?“ riefen Sven und Andresen fast gleichzeitig. „Ich meine, sie wird kommen“, korrigierte sich der Priester.
Nun machte Andresen einen Vorschlag: „Solange wir hier warten, könnten wir uns doch hier niederlassen und uns die Zeit mit Gesprächen vertreiben. Es kann ja vielleicht noch etwas dauern.“
Katharina schien sich unwohl zu fühlen: „Warten, warten, warten. Ich habe mein ganzes Leben gewartet. Auf irgendetwas. Und auf irgendjemanden. Ich muss auf die andere Seite. Vielleicht ist es dort besser.“
„Ganz sicher ist es dort besser“, sagte Seyfert.
Andresen und Sven hatten sich auf einem morschen Baumstamm niedergelassen, auch Seyfert suchte sich einen Platz. Nur Katharina blieb stehen.
Der Priester, bemüht, das Gespräch in Gang zu halten, sagte: „Jeder könnte doch etwas aus seinem Leben erzählen. Heiteres oder Ernstes. Egal. Wir sind ja jetzt so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft.“ Er schaute Sven an. „Herr Niederhaus, fangen Sie doch einfach an.“
„Ich weiß nicht. Ja, okay. Ich liebe Autos und mit Freunden tune ich die.“
„Tunen?“ fragte der Priester.
„Ja, wir optimieren Autos, machen sie schneller, verändern die Karosserie und so.“
„Ist das nicht gefährlich? Und Sie, Herr Andresen? Darf ich Paul sagen? Nennen Sie mich einfach Jakob“, sagte der Priester.
„Nun ja“, begann Andresen, „ich habe mein Leben einer Firma gewidmet …“
„Ich auch!“ unterbrach ihn der Priester und lachte über seinen Scherz.
Andresen fuhr fort: „Ich habe zu wenig auf meine Familie und meine Gesundheit geachtet. Oft hatte ich eien Schmerz in der Brust.“
Sven fragte nach: „Und jetzt? Spüren Sie den Schmerz noch?“
„Überhaupt nicht. Merkwürdig.“
Katharina kam näher. Nach kurzem Zögern setzte sie sich neben Sven auf den Baumstamm und hörte aufmerksam zu. Dann stockte das Gespräch eine Weile.
„War da was?“ rief Sven, „die Fähre?“
„Ich glaube, wir sind falsch hier“, sagte Andresen, „Herr Sey…, Jakob, was meinen Sie?“
Jakob war stiller geworden. Er wartete schon lange auf die Fähre. Der Magenkrebs fiel ihm ein, die Chemotherapien. Er musste hinüber, auch wenn er noch lange warten müsste. Dort drüben warteten doch alle auf ihn.
Isabella war schon am Vortag aus Heidelberg angereist, trotz der anstehenden Klausur, als ihre Mutter sie angerufen hatte. Nun stand sie da und schaute in die Öffnung hinab. Sie warf die Rose auf den Sarg und entfernte sich langsam. Weinend.
Vereins-Heim. Etwas später
Der alte Mann ging langsam. Erinnerte sich. Hier stand das Vereinsheim. Er grübelte: Verein und Heim. Man traf sich zum Feiern. Man trank. Likör die Frauen. Pils und Wacholder die Männer.
Hinter der Eingangstür ein schwerer Vorhang, dick wie drei Pferdedecken, an den Rändern mit kräftigem schwarzen Leder gesäumt. Erst wenn man diesen Vorhang – Windfang? – Schleuse?, der die eine Welt von der anderen trennte, zur Seite geschoben hatte, betrat man den Schankraum.
Da saßen sie stets an Wochentagen, die Grubenarbeiter, ihre Kehlen rau, ihre Gesichter und Hände nicht ganz sauber, denn auch Kernseife hatte es nicht vermocht, den kleinen, feinen Kohlenstaub zu entfernen. Ihre Gesichter zeigten schon damals die Sorge um das Sterben ihrer Grube und ihrer Brikettfabrik.
Und da saß Tandoris Doof. Er war nicht „doof“, sondern „taub“, was im rheinischen Dialekt dasselbe bedeutete. Tandori war eben taub und nicht stumm. Wenn er, sagen wir „sprach“, klang die Bestellung wie „No ai Biea“. Als junger Mann hatte der Alte das erheiternd gefunden und er erinnerte sich, wie oft Tandoris Doof nachgeäfft wurde.