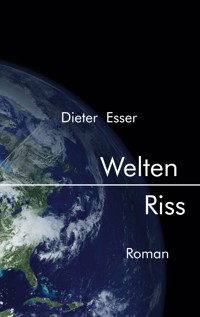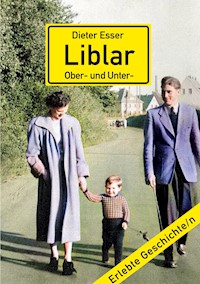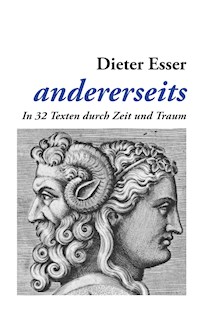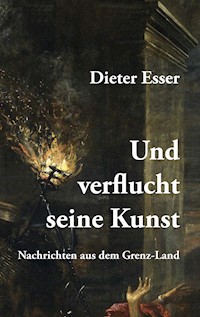
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Machen wir uns nichts vor: Egal, was da vorgefallen ist, Spontanheilung, ein dummer Zufall oder", hier wurde der Chefarzt wieder lauter und unbeherrschter, "wenn die Eltern gegenüber diesen Zeitungsleuten von einem Wunder sprechen, dann ist das ihre Sache! Wenn aber ein Kollege so einem Unsinn zustimmt und der Presse etwas von einer Wunderheilung erzählt, dann ist das Verrat! Ich sage: Verrat! Verrat an der Medizin. An der Wissenschaft. Am gesunden Menschenverstand." Ein junger Arzt, Matthias Beckerts, will der medizinisch nicht erklärbaren Heilung eines Mädchens mit starken Verbrennungen auf eigene Faust nachgehen und macht seltsame Entdeckungen. Wer ist außer ihm noch auf der Suche nach dem Geheimnis? Welche Rolle spielt der heilige Lorenz? Wer ist Pater Abelardus? Beckerts begibt sich auf eine erstaunliche, aber nicht ungefährliche Reise in ein Grenz-Land.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Eric und Roman
Was bildet gegenwärtig die Grundlinie deiner Existenz?
Anton Tschechov, Krankenzimmer Nr. 6
Temer si dee di sole quelle cose C´hanno potenza di fare altrui male…
Furcht soll man nur vor solchen Dingen hegen, Die mit der Macht begabt sind, uns zu schaden…
Dante, Göttliche Komödie, Inferno, zweiter Gesang
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I: Das Treffen
Kapitel II: Die Begegnung
Kapitel III: Ex Maria Virgine
Kapitel IV: Die Befragung
Kapitel V: Der geistige Berater
Kapitel VI: Der Träumer
Kapitel VII: Das Leben
Kapitel VIII: Der andere
Kapitel IX: Das Andere
Kapitel X: Enthüllung
Kapitel XI: Erklärung
Kapitel XII: Ikarus
Kapitel XIII: Die Frage
Kapitel XIV: Die Rückkehr
Kapitel XV: Vor-Fall
I
Das Treffen
„…sie schauen und staunen und glauben, Götter zu sehen…“
Noch wenige Augenblicke. Wie ernst war es? Matthias Beckerts nahm die Ovid-Übersetzung, in der er während des Nachtdienstes gelesen hatte. Die verbleibende Zeit bis zum Beginn der Besprechung gestattete es ihm nicht, ein ihm weniger bekanntes Kapitel zu beginnen, also schlug er das achte Kapitel auf, suchte nach dem Flug des Ikarus und las:
Dann unterweist er den Sohn: „Mein Ikarus, lass dich ermahnen! Halte die Mitte der Bahn. Denn fliegst du zu tief, dann beschwert die Welle die Federn; zu hoch, dann wird die Glut sie versengen. Zwischen beidem dein Flug! Und schaue du nicht auf Bootes, nicht auf den Bären und nicht aufs gezückte Schwert des Orion. Ich sei dir Führer allein!“ So gab er die Richte dem Flug und passte den Schultern an das unvertraute Gefieder. Während er schafft und mahnt, benetzt sich die Wange des Greises, zittert des Vaters Hand. Er küsst sein Söhnchen - es sollte niemals wieder geschehn.
Beckerts stockte und ließ das Buch auf den Schoß sinken. Oft schon hatte er dieses Kapitel gelesen. Und jedes Mal stockte er an dieser Stelle. Jedes Mal. Dann war er für einen kurzen Augenblick Daedalus, für einen kurzen Moment aber auch Ikarus. Er steigerte sich in die Tragik hinein, so dass er sich zwingen musste, weiter zu lesen, um nicht fortgerissen zu werden. Gefühl. Wie ein Kind wünschte er sich dann, Ikarus noch einmal warnen zu können, und zwar noch eindringlicher. Und wie ein Kind hoffte er auch dieses Mal, der Flug des Ikarus möge doch anders enden.
Er las weiter:
… und dann, vom Fittich erhoben, fliegt er voraus voller Sorg um den zarten Gefährten, dem Vogel gleich, der von hohem Nest seine Jungen lockt in die Lüfte, mahnt ihn zu folgen und zeigt gefahrvolle Kunst; seine eignen Flügel rührt er und blickt zurück auf die seines Sohnes. Wer sie erblickt, ein Fischer vielleicht, der mit schwankender Rute angelt, ein Hirte, gelehnt auf den Stab, auf die Sterzen gestützt, ein Pflüger, sie schauen und staunen und glauben Götter zu sehen, da durch den Äther sie nahn. Schon liegt zur Linken der Juno heiliges Samos, liegt im Rücken Delos und Paros, rechts schon Lebinthus erscheint und das honigreiche Calymne, als der Knabe beginnt, sich des kühnen Flugs zu freuen, als er den Führer verlässt und im Drang, sich zum Himmel zu heben, höher den Weg sich wählt. Da erweicht der näheren Sonne zehrende Glut das duftende Wachs, die Fesseln der Federn. Hingeschmolzen das Wachs; er rührt die nackenden Arme, kann, seiner Ruder beraubt, keine Lüfte mehr fassen. Und seinen Mund, der „Vater“ noch ruft, verschlingen die funkelnden Wogen der blauen Flut, die seinen Namen erhalten. „Ikarus!“ ruft er, „wo bist du? Wo soll in der Welt ich dich suchen? Ikarus!“ - rufend sieht er im Wasser treiben die Federn und verflucht seine Kunst.
So nah am Ziel, dachte Matthias Beckerts. Seine weiteren Gedanken waren die gleichen wie immer, wenn er dieses Kapitel las. Wenn Daedalus nicht seinen Schüler getötet hätte, wäre er nicht nach Kreta zu König Minos verbannt worden. Er hätte als Künstler und Techniker ein angenehmes, kreatives Leben in Athen führen können, geachtet als der große Ingenieur. Sein Sohn hätte stolz auf ihn sein können und hätte versucht, es ihm gleichzutun. Wenn Daedalus nicht diese ebenso absurde wie geniale Idee gehabt hätte, die Insel fliegend zu verlassen, würde sein Sohn noch leben.
Es klopfte an der Tür. Kollege Wiesenhütter steckte seinen Kopf herein.
„Gehen Sie mit, Beckerts? Oder sind Sie wieder in Gedanken?“ fragte er.
Beckerts mochte Wiesenhütter nicht. Noch weniger mochte er es, gerade von ihm auf eine Schwäche gestoßen zu werden, die er schon als Kind hatte und die ihn schon in der Schule zum Träumer abgestempelt hatte.
„Was lesen wir denn da?“
Wie Beckerts ihn verachtete! Was sollte das heißen: Wir?
„Ich komme“, sagte Beckerts ruhig.
Er schloss das Buch und legte es mit der Rückseite nach oben auf seinen Schreibtisch. Wenn ihn sein Gefühl nicht täuschte, brauchte er nicht zu befürchten, dass Wiesenhütter darauf bestand, eine Antwort zu bekommen. Nicht etwa, weil er bemerkt hätte, dass Beckerts keine große Lust verspürte, ihm über seine Lektüre Auskunft zu geben, sondern deswegen, weil Wiesenhütters Form der Kommunikation aus Floskeln, Worthülsen und Smalltalk bestand, man also gar kein echtes Interesse zu unterstellen brauchte.
Beckerts stand auf, löschte das Licht der Schreibtischlampe und ging auf die Tür zu, die Wiesenhütter ihm aufhielt. Wie ein Lakai benimmt der sich, dachte Beckerts. Die Uhr über der Tür zeigte auf kurz vor zehn. Es roch nach Salmiak. Der Fußboden glänzte. Beckerts wusste, dass er den Weg zum Besprechungszimmer neben Wiesenhütter nicht schweigend hinter sich bringen könnte, wie es ihm am liebsten gewesen wäre. Wie lange würde es dauern, bis Wiesenhütter wieder redete? Noch vier Sekunden? Noch zehn? Würden sie wortlos bis zu den im Flur abgestellten Betten kommen? Oder gar bis zur Glastür am Ende des Flurs?
„Wissen Sie, was Bode von uns will?“ fragte Wiesenhütter. Acht Sekunden waren vergangen.
„Keine Ahnung.“
„C 3 war doch erst gestern Nachmittag. Vielleicht geht es wieder um die Neubesetzung in der Inneren.“
„Ich weiß es nicht.“ Matthias Beckerts schaute verzweifelt in Richtung D 4, wo Chefarzt Bode sie erwartete. Nur noch wenige Meter. Bitte keine weiteren Fragen mehr, Wiesenhütter. Lass mich einfach in Ruhe. Bitte.
Wiesenhütter, Dr. Josef Wiesenhütter, Mitglied des Stadtrates, des Pfarrgemeinderates, des Kirchenchores („soweit es meine Zeit erlaubt“), des Komitees zur Pflege der Stadt Monschau und natürlich des Eifelvereins. Als er sich den Kollegen Wiesenhütter in Wanderschuhen und mit einem knorrigen Stock in den Ardennen wandernd vorstellte, hätte Beckerts fast gelacht, was er aber unterließ, um weiteren Fragen vorzubeugen. Nein, er hielt nicht viel von diesem Wiesenhütter. Und dennoch glaubte er, ein solches Gefühl wie Ablehnung stehe ihm nicht zu, weshalb er sich sagte, er respektiere Wiesenhütter als erfahrenen Kollegen, schließlich war dieser mit seinen 52 Jahren fast 15 Jahre älter als er.
Als Wiesenhütter die Tür des Besprechungszimmers - für seine Verhältnisse behutsam - öffnete, hörten sie Bode bereits erregt sprechen. Waren sie zu spät? Jedenfalls waren Beckerts und sein Begleiter die letzten, was mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ohne eine hämische Bemerkung Bodes abgehen würde. Aber vielleicht, ging Beckerts durch den Kopf, war Wiesenhütter wegen seiner zahlreichen Tätigkeiten in Monschau so wichtig, dass Bode es nicht wagen würde, ihn zu kritisieren. Tatsächlich blieb jeder Kommentar aus.
Wiesenhütter nahm neben Teirich Platz, während Beckerts den einzigen noch freien Stuhl nahm, neben Kollegin Luthe, die ihn freundlich anlächelte.
Der Chefarzt fuhr unbeeindruckt mit seiner Ansprache fort: „Und solchen Unfug auch noch in der Öffentlichkeit zu vertreten! Ich sage: in der Öffentlichkeit! Das nenne ich Schädigung unseres Rufes, Schädigung des guten Rufes unseres Hauses. Wir sind Ärzte, meine Herren, Ärzte mit wissenschaftlicher Ausbildung!“
Beckerts war erstaunt, dass Bode Kollegin Luthe offensichtlich ignoriert hatte, konzentrierte seine Aufmerksamkeit aber mehr auf das bizarre Mienenspiel seines Vorgesetzten. Nie zuvor hatte er ihn so unbeherrscht und unruhig gesehen und nie zuvor waren alle Ärzte, ob sie gerade Dienst hatten wie er selbst oder ob sie zu Hause mit den letzten Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt waren, zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengerufen worden.
Beckerts blickte sich unauffällig um: Teirich saß wie üblich mit hochrotem Kopf da, weniger wegen Bodes Ansprache als aufgrund seiner Hypertonie. Frau Dr. Luthe schaute wie unbeteiligt in den leicht verschneiten Park. Dr. Arandi nickte zustimmend, obwohl ihm die Anstrengung anzusehen war, den gesamten Inhalt der Rede zu verstehen. Nur Wiesenhütter, Hattingberg und Geissmann schienen aufmerksam zuzuhören.
Besonders Kollege Hattingberg gab offenbar auf jedes Wort des Chefarztes Acht. Aber warum hörte Hattingberg so aufmerksam zu, als Bode zum wiederholten Mal von Verantwortung sprach, vom „selbstlosen Einsatz im Dienste des Kranken“, von Wissenschaft und dann wieder von Verantwortung.
Dieser verschlossene, in sich ruhende, stets freundliche, aber in seiner Freundlichkeit unverbindliche und distanzierte Dr. Alfred Hattingberg aus Tübingen oder Reutlingen sah es wohl als seine Pflicht an, als die Pflicht eines Oberarztes, ein gewisses Interesse zu zeigen, wenn sein Chefarzt mit zitternder Oberlippe etwas vorzubringen hatte, dessen Hintergrund Beckerts nach wie vor ziemlich unklar war.
Aber schon sprach Bode einen Kollegen gezielt an, Dr. Geissmann, und Beckerts verstand, weshalb Geissmann aufmerksam zuhörte. Denn der Vorfall, der Gegenstand der Zusammenkunft war, hatte sich offenbar sozusagen unter der Verantwortung dieses Kollegen zugetragen oder zumindest unter seiner Verantwortung seinen Anfang genommen.
„Kollege Geissmann“, fuhr Bode fort, „was Sie dem Krankenhaus als Einrichtung und mir persönlich - ich möchte unterstellen - ohne böse Absicht angetan haben, ist ir-re-pa-ra-bel!“ Beckerts zerlegte, ähnlich wie es sein Chefarzt es ihm suggerierte, das Adjektiv „irreparabel“ in seine Bestandteile: Präfix, Stamm, Suffix. Das hält den Geist wach, dachte er.
„Sie als Arzt und ich als derjenige, der hier für alles die Verantwortung trägt…“
Warum, dachte Beckerts, liebt Bode nur so sehr das Wort „Verantwortung“? Zugleich ertappte er sich dabei, wie er auch dieses Wort in seine Bestandteile zerlegte: „Ver“ - Präfix, „ant“ - entspricht „ent“ im Sinne von „entgegen“, „wort“ - gebundenes Morphem, kein Problem, „ung“ - Suffix. Du bist albern, sagte Beckerts sich, reiß dich zusammen.
„Herr Bode!“ unterbrach eine resolute Stimme, „wenn Sie es für erforderlich halten, uns hier zu haben, und den Kollegen Geissmann vor uns allen zurecht weisen, nehme ich an, dass Sie auch ein gewisses Interesse daran haben, dass wir wissen, worum es geht. Ich jedenfalls, also, könnten Sie also bitte…“ Es war, zur Verwunderung Beckerts, Frau Dr. Elisabeth Luthe, die um Aufklärung bat.
„Wollte ich gerade tun, verehrte Frau Luthe, aber ich gebe zu, angenommen zu haben, Sie alle wüssten bereits bestens Bescheid. Die Presse hat doch … aber egal, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, auch wenn mir eigentlich, … also gut: Vor vierzehn Tagen wurde die kleine Susanne Hofmann oder Hoffmann, na, wie alt wird sie sein, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, bei uns eingeliefert. Schwere Verbrennungen, Verbrühungen, genauer gesagt heißes Fett einer Friteuse, vom Herd gekippt. Bauch, Beine, heißes Fett, na ja, Sie können sich das vorstellen. Wir haben alles getan, um ihr die Schmerzen zu nehmen, das Kind schrie wie vom Teufel besessen. Kollege Geissmann gab ihr eine starke Beruhigungsspritze, na ja, Sie wissen schon. Ruhe für ein paar Stunden und so weiter. Dann erneut starke Schmerzen bis zum Morgen, wieder eine Spritze und so weiter. Die Verbrennungen waren so schwer, dass wir überlegten, das Kind nach Ludwigshafen zu fliegen. Und natürlich von Anfang an Betaisodona, Fettgaze, na ja, Sie wissen schon, was man halt so macht in solchen Fällen.“
Geissmann rutschte nervös in seinem Sessel hin und her, er schien etwas sagen zu wollen. Aber Dr. Bode ließ ihm keine Gelegenheit.
„Dann sind die Eltern, die natürlich ununterbrochen bei dem Kind waren oder, wenn sie nicht am Bett standen, im Flur Panik und Entsetzen verbreiteten, ja, was wollte ich sagen? Ja, die Eltern haben dann jemanden kommen lassen, Panikreaktion vermutlich. Eine Frau ist gekommen, Namen habe ich vergessen, die in dem gleichen Dorf wohnt wie das Kind. Diese Frau soll sich dem Kind genähert haben - Geissmann war wohl dabei - und ein paar Worte zu dem Kind gesprochen und einiges gemurmelt haben.“
Geissmann nickte und wollte offenbar selbst berichten, aber schon setzte der Chefarzt seine Darstellung fort.
„Also hören Sie jetzt bitte genau zu: Die Patientin soll noch während des Besuches der Frau aus Kalterherberg eingeschlafen sein, vier Stunden fest geschlafen haben und beim Aufwachen soll sie ruhig und…“, der Gesichtsausdruck Dr. Bodes verzog sich zu einem Grinsen, „schmerzfrei gewesen sein.“ Er lachte und setzte noch einmal nach: „Ja, Herr Kollege Geissmann hat es mehrfach bestätigt: schmerz-frei!“ Es widerte Matthias Beckerts an, wie Bode das letzte Wort zu einem fast viersilbigen „schme-erz-fe-rei“ zerdehnte. „Machen wir uns nichts vor: Egal, was da vorgefallen ist, Spontanheilung, ein dummer Zufall oder …“, hier wurde er wieder lauter und unbeherrschter, „wenn die Eltern gegenüber diesen Zeitungsleuten von einem Wunder sprechen, dann ist das ihre Sache! Wenn aber ein Kollege so einem Unsinn zustimmt und der Presse etwas von einer Wunderheilung erzählt, dann ist das Verrat! Ich sage: Verrat! Verrat an der Medizin. An der Wissenschaft. Am gesunden Menschenverstand.“
Jetzt wandte sich Bode direkt an Geissmann: „Soll ich Ihnen vorlesen, was das Grenzland-Echo schreibt? Wollen Sie es hören?“
Matthias Beckerts wusste, dass Bode aus dem Artikel zitieren würde, ganz gleich, wie Geissmanns Antwort ausfallen würde.
„Ich kenne den Artikel“, sagte Geissmann, jetzt erstaunlich ruhig, und schwieg dann wieder, was den Kreis der Ärzte noch mehr irritierte.
Wie Beckerts vermutet hatte, blieb Chefarzt Dr. Heinrich Bode völlig unbeeindruckt von Geissmanns Reaktion. Er hielt, als ob das schon ein Beweis sei, die Ausgabe des Grenzland-Echos in die Luft und schlug, als wolle er den Artikel wie eine lästige Fliege vertreiben, immer wieder mit seinen zurückschnellenden Fingern gegen das Papier. Da er wohl sah, dass dies eine ungeeignete Methode war, das Geschriebene ungeschrieben und das Geschehene ungeschehen zu machen, versuchte er durch ein paar Zitatfetzen etwas Druck abzulassen:
„Hier steht es: Wie selbst der erfahrene Arzt Dr. Ulrich Geissmann und so weiter, und hier: In dreizehn Jahren Krankenhauserfahrung ist mir eine solche Wunderheilung noch nie und hier: Unsere ärztliche Kunst war ratlos, da muss eine andere Kraft am Werk gewesen sein, wie Dr. Geissmann weiter sagte.“ Bode ließ die Zeitung sinken und blickte wie ein trauriges Kind in die Runde. Er suchte, so schien es Matthias Beckerts, nach Unterstützung, nach Signalen der Entrüstung. Aber schaute er ausgerechnet ihn an, den unerfahrensten und jüngsten in der Runde? Wollte er von ihm eine Stellungnahme, ob er an den „Schwindel“ glaube?
Es ärgerte Beckerts, wie Bode seinen Kollegen der Lächerlichkeit preisgeben wollte. Hatte Geissmann nicht nur wiedergegeben, was er tatsächlich beobachtet hatte? Wie hätte er wohl selbst reagiert, wenn er an diesem Tag Dienst gehabt hätte? Was mag dahinter stecken? Viele Fragen schossen Beckerts durch den Kopf, als er versuchte, auf die Frage seines Chefs zu reagieren. Natürlich widerspreche der Vorfall allen ärztlichen Erfahrungen, natürlich dürfe man dem Fall nicht so viel Gewicht geben, vielleicht sei die Angelegenheit gar nicht eindeutig zu klären, aber er verstehe die Erregung des Chefarztes, dessen Krankenhaus …
Was Beckerts auch sagte, er ärgerte sich, überhaupt geantwortet zu haben. Ohne mit jemandem zu sprechen, ging er sofort nach Ende der Besprechung zum Haupteingang des Monschauer Krankenhauses.
Die große Eingangshalle war weihnachtlich geschmückt, wie jedes Jahr in der Zeit, und in einer Art Glaskasten direkt rechts neben der Eingangshalle hingen Rauchschwaden in der Luft, denn hier war der einzige Ort, an dem mit Duldung des Krankenhauses die Gesunden, die Kranken und Genesenden rauchen durften. Eine dem ärztlichen Zugriff entzogene Insel der Seligen in einem Meer der Krankheit, des Sterblichen, des Hinfälligen, dachte Beckerts, ein Ort, an dem den Göttern des Irrationalen geopfert wurde: Bier wurde hier getrunken, aber vor allem geraucht, viel geraucht.
Der Dunst der zahllosen Zigaretten stieg nach oben und verflüchtigte sich, wenn die automatische Eingangstür mit neuen Besuchern auch einen kleinen Windstoß einließ. Hier, so schien es Beckerts, rauchte man gegen die Krankheit an, hier herrschte der Mensch in seiner Leidenschaftlichkeit. Vielleicht, dachte er, als er zum Eingang strebte, hat ein kluger Kopf aus diesem Grund den Raucher-Bereich „Halle des Volkes“ genannt.
„Tach, Herr Doktor“, rief es Beckerts entgegen und er erwiderte die Fröhlichkeit des Grußes so gut, wie er konnte. Doch bei allem Verständnis für die private Leidenschaft des Kranken, der ihn gegrüßt hatte, irritierte es ihn sehr, dass der „Herzinfarkt aus Steckenborn“, um den er sich so intensiv bemüht hatte, offenbar schon wieder in die Reihe der Rauchenden strebte, Patienten, deren gestreifte Morgenmäntel bei Beckerts Assoziationen an Gefangene weckten.
Er war keiner von ihnen, dachte Beckerts, er gehörte auf die andere Seite des Acheron, des schwarzen Flusses, der die Grenze zum Reich der Toten bildete, wie sonst könnte er jetzt über die Schwelle des Krankenhauses gehen, wie es ihm beliebte.
Es machte Beckerts Spaß, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, so absurd sie manchmal auch waren. Alles war ihm recht, wenn es ihn nur erheiterte, ablenkte von der Zusammenkunft bei Bode. Und so skandierte er, als er den alten Toni geschäftig an der Rezeption arbeiten sah, wo er vor einer Menge von Knöpfen und leuchtenden Tasten saß, den Telefonhörer in der Rechten haltend, während seine rechte Hand suchend über den Knöpfen hin- und herschwebte: „Heiliger Antonius, hilf mir suchen! Heiliger Antonius, hilf mir suchen!“
Er kam sich recht albern vor, auch als er im Eingang - oder war es der Ausgang? Eine Definitionsfrage, egal - mit Pater Pedro, dem Krankenhausseelsorger, zusammenstieß und unhörbar dessen Spitznamen „Speedy Gonzales“ vor sich her sagte. Respektlos, dieser Spitzname, dachte Beckerts, immerhin war Pater Juan Gonzales Alvarez ein würdiger Mann der Kirche, ein wirklicher Grenzgänger zwischen drinnen und draußen, der - und deswegen trug er seinen Spitznamen - mit der letzten Ölung oder Krankensalbung immer schneller war als der Tod. Die Eingangstür schloss sich, Beckerts atmete klare Luft.
II
Die Begegnung
„Halte die Mitte der Bahn!“
Den Weg von Monschau hinauf nach Kalterherberg hatte er in den drei Jahren, die er schon im Krankenhaus unter Bode arbeitete, erst ein einziges Mal genommen. Ann-Christin, eine Soziologie-Studentin, die er aus seiner Kölner Zeit kannte, hatte ihn begleitet und ihm damals zu verstehen gegeben, das sie jemand anderen kennengelernt hätte und so weiter. Das übliche Gerede: „Wir wollen Freunde bleiben“. Warum also hätte er noch einmal nach Kalterherberg fahren sollen?
In zahlreichen Kurven windet sich die Straße, als wolle sie einen anderen Ort erreichen, bis eine höhere Gewalt sie gleichsam zurück biegt und nach endlosem Biegen und Loslassen mit dem Ortseingang verbindet.
Dann wehrt sich die Straße nicht mehr, sondern führt gerade durch den Ort, wie beruhigt, bezwungen.
Hätte jemand Beckerts gefragt, er hätte es wohl kaum zugegeben, dass er nicht nur der wundersam verschneiten Landschaft wegen, nicht nur wegen der für das Hohe Venn charakteristischen Hecken nach Kalterherberg gekommen war.
Was hätte er auch sagen sollen? Er müsse einer merkwürdigen Sache nachgehen? Hier oben in Kalterherberg müsse es Leute geben, die anders heilen als die Ärzte da unten? Wissen sie, wer hier aus dem Ort die kleine Susanne Hofmann geheilt hat? Oder doch wenigstens von den Schmerzen befreit?
Er stellte seinen graublauen Golf am Hotel Hirsch ab und ging, der Straße folgend, auf die kleine Grenzstation zu, die noch heute die Grenze nach Belgien markiert, obwohl es doch schon lange keine Kontrollen mehr gab. Einen Moment dachte er über das Schild nach, das am Parkplatz vor dem Hotel Hirsch angebracht war: Nur für Gäste. Sind wir nicht alle Gäste, Gäste auf Erden, wie es in dem alten Kirchenlied heißt: Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh / mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu.
Die Grenzstation erschien Matthias Beckerts wie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Hier kochte kein Zöllner mehr Kaffee, früher, ging ihm durch den Kopf, früher hätte er sich bei dem Zöllner vielleicht verdächtig gemacht, weil er lachend über die Grenze ging, da er an die biblische Gleichsetzung von Zöllner und Sünder denken musste.
Seit einigen Tagen, vielleicht sogar seit jenem Vorgang um den Kollegen Geissmann, hatte Matthias Beckerts ein ihm etwas fremd gewordenes Gefühl wieder entdeckt, eine willkommene Ahnung, dass sein Leben mehr bieten könne als Arbeit und Ruhe, als das Krankenhaus mit Bode als Chef und seine recht bescheidene Dachwohnung mit Blick auf die Kirche Mariä Geburt. Eine Leichtigkeit hatte ihn ergriffen, die ihm in dem Maße bislang unbekannt war. Er ließ sich treiben, ging viel zu Fuß, vor allem im Dunkeln. Oder verfiel er zusehends dem Leichtsinn, einer gewissen Leichtfertigkeit?
Der Weg führte ins Belgische hinein an ein paar schlichten, soliden Häusern vorbei, leicht ansteigend. Seine Erziehung war darauf angelegt gewesen, ihn zu einem rationalen und funktionierenden Wesen zu machen. Brachte er deswegen keine dauerhafte Beziehung zu einer Frau zustande? Aber nein, rief ihn die Ratio zur Ordnung, es ist dein Beruf, Matthias, dein fantastischer, aufopferungsvoller Beruf. Welche Frau würde das schon …?
Matthias Beckerts wollte sich einfach nicht eingestehen, dass vielleicht doch vor allem an ihm selbst liegen mochte, wenn seine Freundinnen ihn nach wenigen Wochen als „zu anstrengend“ oder als „zu langweilig“ bezeichneten. Nein, diese Frauen konnten nicht recht haben, so schlecht konnte er nicht sein.
Es fing an zu schneien. Ha, dachte er, die wirbelnden Flocken habe ich mit meinem Wirrwarr an Gedanken in Gang gesetzt, eine Vorstellung, die ihn lachen ließ. Aber konnte er einfach weiter gehen? Sollte er sich nicht lieber umdrehen, um zu schauen, ob ihn jemand beobachtete? Wenn es auch keine Zöllner mehr gab, die sein Lachen im Schneefall hätten beargwöhnen können, so doch vielleicht ein Waldarbeiter? Ein Wanderer? Kehr um, sagte er sich, geh wieder auf die andere Seite, Matthias, zurück auf die andere Seite.
Er drehte sich um und ging im inzwischen dichten Schneefall wieder zurück. Kein Zollbeamter lächelte ihm zu, kein Passant schaute ihn misstrauisch an, als wollte er sagen: Schon wieder zurück? Angst? Kein Ziel? Keine Kraft? Keine Lust?