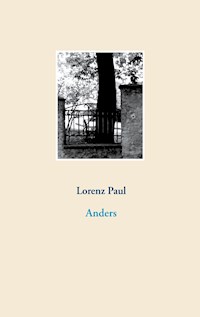
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Familie Schmidtke & Co
- Sprache: Deutsch
"Erinnerung kommt ja immer mit. Erinnerung bleibt nicht in der Vergangenheit. Sie bleibt nicht dort, wo sie hingehört. Und wenn man sie irgendwann wieder vor Augen hat, ist man über ihre Wirklichkeit erstaunt." "Du hast keine Chance oder es ist deine einzige Chance. Wenn du die nicht wahrnimmst, wirst du vielleicht nie wieder eine bekommen. Andere sehen dich nämlich anders, als du dich selbst. Und wenn du diese Chance nicht annimmst, werden sie dich sehen, wie du dich gesehen hast. Und dann bist du du und bleibst immer du. Dann wirst du nie ein anderer, jedenfalls nicht in deinen eigenen Augen. Und dass man sich in seinen eigenen Augen verändert, muss auch mal sein." "Ich schlief wenig, manchmal gar nicht. Ich lief bis zum Morgengrauen durch die Stadt und blieb bis zum Nachmittag im Bett liegen. Ich versuchte zu begreifen, was glücklich macht und verstand nicht, dass das andere sein sollen. Andere sollen glücklich machen, während man sich selbst nicht glücklich machen kann. So ist das vielleicht." "Vielleicht ist die Tragödie des Lebens die, dass man nicht weiß, welcher Tag der letzte sein wird."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
PrologErster Teil: Die AnderenZweiter Teil: Ein PaarDritter Teil: MartinVierter Teil: Noch ein PaarFünter Teil: Der RestEpilogProlog
Ich hatte Kopfschmerzen heute Morgen. Wie an jedem Morgen im letzten Jahr. Ich zog mich an und verließ die Wohnung. Am S-Bahnhof holte ich mir einen Kaffee aus dem Automaten. Schwarz mit Zucker. Ich trank ihn während der Fahrt und hatte bald Magenschmerzen. Wenigstens keine mehr am oder im Kopf, dachte ich. An der Endstation suchte ich den nächstgelegenen Weg, der in ein Waldstück führte und erleichterte mich vom Kaffee. Danach verlagerten sich die Schmerzen wieder nach oben.
Das Wäldchen immerhin war ganz schön. Es war niemand unterwegs, meine ich. Das ist das wichtigste. Ich erreichte einen See und ging am Ufer entlang, bis ich auf die Terrasse eines Restaurants stieß. Es war ein Ausflugslokal, welches leer stand. Vielleicht weil im Osten inzwischen viel leer steht. Vielleicht aber auch, weil Herbst ist. Ein paar Stühle hatte noch niemand weggeräumt. Ich setzte mich eine Weile.
Als ich irgendwann wieder weiter ging, kam ich in eine Siedlung, wo sich die Menschen in ihren Häusern und hinter Vorhängen verschanzt hatten. Dann war ich zurück am Bahnhof.
Auf der Heimfahrt schlief ich ein, erwachte aber rechtzeitig. Ich trottete die Dominicusstraße hoch, bog rechts ab und kam wieder nach Hause. Im Fahrstuhl lehnte ich mich an die Wand und zählte langsam bis fünf, bis die Tür sich wieder auseinanderschob. Ich schloss meine Wohnungstür auf, zog im Flur den Anorak aus und schmiss ihn in eine Ecke. Dann ging ich ins Bad, öffnete den Hahn und ließ kaltes Wasser über meine Unterarme laufen. Dabei schloss ich die Augen. Als ich sie wieder öffnete, sah ich in den Spiegel. Sah mich im Spiegel. Sah mir in die Augen. Wenn man sich selbst sieht, ist es manchmal so, dass man nicht weiß, dass man das wirklich selbst ist. Man hat von sich ja immer einen anderen Eindruck als andere. Emily hatte einmal gesagt, dass sie meine Augen mag. Man könne sich in ihnen verlieren. Ich hatte vorher nie gehört, dass ich besondere Augen hätte. Aber danach hatte sie auch gelacht. Erinnerungen sind nichts Gutes. Zu viele sind auf jeden Fall nicht gut.
Ich ging zurück ins Zimmer und sah auf die beiden Matratzen vor der Wand. Dann drehte ich mich zur Balkontür, ließ sie aber geschlossen. Ich blickte hinaus auf die beiden Kirchtürme, die hinter dem Friedhof aufragen und sah auf die Gräber hinab, die wie schlichte Blumenbeete wirkten. Man könnte so etwas auch mal anlegen, ohne dass darunter Leichen liegen, dachte ich. Jeder kriegt ein Stückchen und kann es bepflanzen. Mit Blumen, mit Sträuchern, mit was weiß ich. Vielleicht sollte jeder von Geburt an sein eigenes Grab haben, um das er sich kümmern kann, bis er darin liegt. Ich werde mich mal verbrennen lassen, wenn es so weit ist, glaube ich.
Schließlich drehte ich mich um, streckte mich auf den Matratzen aus und war eingeschlafen, wie ich merkte, als das Telefon klingelte. Eigentlich klingelte es nie. Jedenfalls nicht mehr in den letzten Jahren. Ich hätte es längst abmelden können und bereute, dass ich es noch nicht getan hatte. Ich griff nach dem Hörer. Es war Martin.
In einer Nacht vor einem Jahr war er von zu Hause losgegangen.
Erster Teil: Die Anderen
1
Ich war an einem Sonntag von zu Hause losgegangen. Morgens vor sechs Uhr. Mein Vater stand früh auf. Also musste ich noch früher losgehen. Aber er stand immer früh auf. Ob sonntags oder an einem anderen Tag. Das war egal.
Ich nahm meinen Rucksack, öffnete leise die Zimmertür, schlich mich hinaus und schloss die Tür wieder vorsichtig. Behutsam ging ich die Treppe hinab. Unten im Flur neben der Treppe gab es eine Tür, die zur Straße hinausführte. Aber sie war immer verschlossen. Also schlich ich in die Küche. Von dort ging es durch einen kleinen Flur über eine Steintreppe auf den Hof hinaus. Diesen Weg nahmen wir immer, denn diese Tür war nie verschlossen.
Allerdings zögerte ich im Flur kurz. Ich zog aus der Brusttasche meines Anoraks die Brille, setzte sie auf und klemmte mir mit den Bügeln ein paar Locken hinter den Ohren ein. Ich zog die Haare wieder hervor und zog dann auch an meinem Hosenbund, weil Hosen immer rutschen, aber ich Gürtel nicht mag. Sie nehmen Luft weg. Schließlich sah ich an mir herab, sah meine Halbschuhe, an denen Matsch der letzten Tage hing und schüttelte den Kopf. Zweifel kamen. Waren wieder da. Wurden stärker. Gleich würde mein Vater in die Küche kommen und mich aufhalten. Nicht, weil er etwas sagen würde, gesprochen haben wir kaum miteinander. In den letzten Monaten sogar noch weniger. Auch wenn ich vorher nicht geglaubt hätte, dass das möglich war. Ich weiß nicht, ob er mich so überzeugen wollte oder ob es zumindest ein Versuch in diese Richtung war. Ich weiß nicht, ob er damit überhaupt etwas bezwecken wollte. In seiner Gegenwart jedenfalls, von Angesicht zu Angesicht, wollte ich das Haus nicht verlassen.
Ich öffnete die Tür. Ein Septembermorgen. Feuchte Luft. Mein Atem sichtbar. Ich schloss die Tür wieder und griff in die rechte Hosentasche nach dem Schlüssel. Aber ich ignorierte den Briefkasten und ließ den Schlüssel, wo er war. Endgültigkeit muss nicht bewiesen werden. Endgültigkeit beweist sich selbst.
Ich lief die Steinstufen hinab und über den Hof zum Eingangstor. Dahinter begann ich zu rennen. Ein Stück die Straße hinauf, nach rechts zur Hauptstraße und von dort über das Feld hoch bis zur Umgehungsstraße. Der Bus kam schon, aber ich erreichte ihn noch. Eine halbe Stunde lang klapperte er die Dörfer ab. Nach Kirchthal kommt Wiesenthal, dann Oberthal und Unterthal. Meine Gemeinde. Unsere Gemeinde. Eine Gemeinde, wie es Hunderte in Deutschland gibt. Vielleicht auch Tausende überall, wenn es so etwas wie Gemeinden überall gibt. Schließlich stand ich auf dem Bahnsteig.
Zu Beginn des Sommers hatte ich meinen Eltern gesagt, dass ich nach Berlin gehe. Kurz nach dem Abendessen, als noch keiner die Küche verlassen hatte. Vorher, während des letzten Schuljahres, hatte meine Mutter ein paar Mal gefragt, was ich tun wolle. Ich hatte immer mit den Schultern gezuckt. Vermutlich hatten sie etwas geahnt. Aber weil wir nie viel miteinander geredet haben, weiß ich auch nicht, ob sie untereinander darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht mal genau, ob sie überhaupt miteinander geredet haben. Es gab aber auch nicht viel zu bereden. Jeder machte seinen Job. Daher funktionierte das Leben miteinander. Dann muss man nicht viel reden. Das ist gut so, finde ich. Das habe ich gelernt und mitgenommen. Wenn etwas funktioniert, muss man nicht reden. Geredet wird, wo es nicht funktioniert. Da, wo es nicht stimmt.
Der Zug kam pünktlich und fuhr pünktlich weiter. Ich fand ein leeres Abteil.
Vielleicht hätte ich gar nicht sagen sollen, dass ich ging. Dann wäre ich eben weg gewesen, ohne dass sie wussten, wo. Meine Mutter stand links zwischen Herd und Spüle, mein Vater gerade vor mir an der Tür, die zum Flur hinaus führte. Ich saß am Tisch und sie starrten auf mich herab, als hätte ich gesagt ... Ich weiß nicht, ob ich noch etwas Schlimmeres hätte sagen können ... Nichts wäre eben besser gewesen.
Unser Haus war alt. Ein Fachwerkhaus mit Balken, von denen man immer glauben musste, dass sie bald durchbrechen. Der Fußboden bestand aus rauen Dielen, die sich wellten. Unzählige Splitter hatte ich mir als Kind in die Füße gerammt. Die Zimmer konnten nie richtig beheizt werden. Beim Essen hatten meine Mutter und ich oft nebeneinander vor dem Herd gesessen. Aber danach hatte jeder immer schnell die Küche verlassen, um sich im eigenen Zimmer aufzuwärmen. Egal ob im Winter oder im Sommer. Manchmal dachte ich, dass die Mauern die Kälte des Winters gespeichert hätten, um sie im Sommer wieder abzugeben. Aber in dem Moment war es irgendwie noch kälter als ohnehin schon. Dass jemand so etwas ausstrahlen und ein anderer fühlen kann, erstaunte mich. Mein Vater sah mich nicht mehr an und ging. Meine Mutter begann mit dem Abwasch.
Ich wartete.
„Warum? Du kannst hier wohnen, hier studieren? Was willst du dort? Eingesperrt? Eingemauert?“
„Mal etwas anderes sehen“, sagte ich.
Sie starrte ins Abwaschbecken, erwiderte nichts mehr. Auch danach nicht. Drei Monate lang. Wenn wir redeten, gab es dieses Thema nicht.
Der Zug fuhr in den letzten Bahnhof vor der Grenze ein. Bremsen quietschten, Menschen riefen. Bald ertönte ein Pfiff und der Zug rollte wieder an. Einige Minuten später drängte sich eine Frau in mein Abteil. Alt, um die siebzig, schätzte ich, und schwarz gekleidet.
„Ist bei Ihnen noch Platz?“ fragte sie stotternd.
Ich nickte.
Sie setzte sich mir schräg gegenüber, sortierte ihre Taschen und holte dann Wolle und Nadeln aus einer heraus. Aber erst als Kontrolleure und Grenzbeamte routiniert in unsere Fahrscheine und Ausweise geblickt hatten und wieder verschwunden waren, ebbte ihr Zittern ab und es gelang ihr zu stricken. Dass Menschen es geschafft haben, dass die einen wegen anderen zittern, dass sie zu stottern beginnen und Schweißausbrüche bekommen, verstehe ich nicht. Aber scheinbar brauchen sie Autoritäten. Sie brauchen andere, zu denen sie aufsehen und vor denen sie Ehrfurcht haben können. Was ich einsehe, ist, dass man manchmal den Mund halten muss. Sonst wären dreizehn Schuljahre auch umsonst gewesen. Aber ich sehe es ein, weil es sinnlos ist. Weil ich, wenn ich mich anders verhielte, nichts ändern würde.
Zum Glück schlief ich ein und erwachte erst wieder, als der Zug still stand. Noch einmal Kontrollen. Dann rollten wir langsam über die Grenze und durch Berlin. Viel mehr als Wald war aber nicht zu sehen und als ich erste Häuser und Straßenzüge erkannte, waren wir schon fast da. Zoologischer Garten. Die Alte war längst aufgestanden und hinausgeeilt. Ich wartete, bis der Zug endgültig hielt und blickte zum Fenster hinaus auf den Bahnsteig, auf ein Durcheinander namenloser Gesichter, auf sich reckende Köpfe, auf hastige Winker und auf welche, die sich gefunden hatten und in die Arme nahmen. Über die Lautsprecher ertönte ein Willkommensgruß.
Auch ich erhob mich und verließ das Abteil. Vor der Waggontür traf ich gleich wieder auf meine Begleiterin, die mit ihren Taschen dort stehen geblieben war. In einer Hand hielt sie ein Tuch und winkte. Ich wartete auf dem letzten Absatz der Stufen, bis ein Mädchen kam. Schwarzhaarig, vielleicht fünfzehn. Sie sagte: „Mama wartet am Taxi.“
Ich folgte ihnen in Richtung der Treppen, folgte ihnen im Halbdunklen hinab in die Halle, ging an beschmierten Mauern entlang, an vergammelten Plakaten vorüber und an obskuren Gestalten. Der nächste Willkommensgruß ertönte. Unten in der Halle verlor ich die beiden aus den Augen und lief so schnell es ging zur linken Seite hinaus auf die Straße. Hinter der Tür blieb ich gleich wieder stehen und atmete durch. Feuchte, schwere Herbstluft, geschwängert mit Abgasen von Autos und Bussen. Ich hielt die Luft kurz an und atmete dann noch einmal durch. Schließlich zog ich meinen Kragen hoch und trat unter dem Vordach hervor. Links hinter der Reihe wartender Taxen sah ich die Umzäunung des Zoos und das kahle Geäst der Bäume des Tiergartens. Daneben ein Hochhaus, weiter rechts Geschäfte, ein Kino und die Gedächtniskirche. Es begann zu regnen. Die Gläser meiner Brille beschlugen und ein Schleier setzte sich vor meine Augen. Eine Weile ließ ich es so, ließ mich berieseln. Alles sah wie in der Erinnerung aus. Erinnerung kommt ja immer mit. Erinnerung bleibt nicht in der Vergangenheit. Sie bleibt nicht dort, wo sie hingehört. Und wenn man sie irgendwann wieder vor Augen hat, ist man über ihre Wirklichkeit erstaunt. Ich zog schließlich die Kapuze des Anoraks über den Kopf, nahm die Brille ab und putzte sie. Dann griff ich in meine Jackentasche und hielt mich an dem Zettel fest, auf dem die Adresse meiner Wohnung stand.
2
Während unserer Klassenfahrt im Frühjahr hatte ich U-Bahn fahren hassen gelernt. Als ich auf dem Bahnsteig stand und die voll besetzten Wagen sah, hatte sich das Bild eines Gefängnisses vor mir aufgebaut. Die Absurdität, dass Menschen von Menschen weggesperrt werden, beklemmte mich. Und auch, dass Menschen bestimmen, wann Menschen wieder frei gelassen werden. Bis heute ist es so geblieben. Auf einem U-Bahnhof fühle ich mich einer Ohnmacht nahe, wenn ich auch noch nie ohnmächtig geworden bin. Vielleicht ist also das Gefühl vor einer Ohnmacht ein ganz anderes und was ich auf einem U-Bahnhof fühle eben auch.
Ich ging an den Treppen zum Untergrund vorbei zu einer Bushaltestelle und sah mir etliche Pläne an. Aber ich hatte keine Idee, welcher Bus der richtige sein könnte, wartete daher, bis der erste vorfuhr und fragte den Fahrer.
„Bis Urania“, sagte er. „Dann umsteigen.“
Also fuhr ich bis Urania. Was auch immer das war.
Als ich ausstieg, stand ich auf einer Kreuzung, an der die Martin-Luther-Straße abzweigte. Ich wusste, sie führte in Richtung meiner Wohnung. So wartete ich nicht auf den nächsten Bus, sondern ging los. Erst am Big Sexyland vorbei, dann an einem Bettenhaus vorüber. Ich überquerte die Hohenstaufen- und die Grunewaldstraße und sah dahinter auf der linken Straßenseite einen Park und auf meiner Seite das Rathaus. Davor, auf dem John-F.-Kennedy-Platz, blieb ich stehen.
Es dämmerte oder es wirkte durch den wolkenverhangenen Himmel so. Noch immer fiel ein leichter Regen, solch ein Regen, bei dem man nicht glaubt, dass es etwas ausmacht. Aber wenn man seine Sachen auszieht, ist alles klamm.
Gegenüber war eine Häuserreihe. Die Frontseite eines Blocks, eine Seite eines Karrees. Jedes Haus vier Stockwerke hoch. In jedem unten ein Geschäft. Ein Restaurant, eine Bäckerei, ein Zeitschriftenladen, ein Optiker. Im Eckhaus an der nächsten Kreuzung, wo die Dominicusstraße beginnt und die Belziger Straße abzweigt, sah ich ein Bestattungsinstitut und davor eine Säule mit einer Uhr. Beide Zeiger deuteten auf die vier.
Ich überquerte die Martin-Luther-Straße, lief am Bestatter vorbei und auf der rechten Seite in die Belziger Straße hinein. Hier war wenig Verkehr, aber Autos parkten dicht an dicht entlang des Bürgersteigs. Ich erreichte das Eingangstor eines Friedhofs. Zwei Meter hoch, aus Metall, grün angestrichen und verschlossen. Die Mauer des Friedhofs zog sich etwa hundert Meter weiter die Straße entlang. Dahinter schien ein weiterer Park zu sein. Auf der anderen Straßenseite war ein Neubau mit niedrigen Fenstern und zweimal fünf Balkons übereinander, die nicht an der Fassade klebten, sondern in die Mauern eingelassen waren. Das Haus war hellblau angestrichen, die Balkons dunkler. Sie waren also, wie auch die Rahmen der Fenster, farblich abgesetzt. Unten befand sich ein Restaurant mit zwei Fenstern, die bis zur Erde reichten. Rechts daneben war der Hauseingang, links der Eingang zur Gaststätte, über dem ein unbeleuchtetes Schild hing: „Dolce Vita“. Ich konnte aber nicht hineinsehen, jedenfalls nichts erkennen. Das Haus hatte die Nummer 66.
Die Nummer 68 links daneben war ein dunkelbrauner älterer Bau. Im Parterre befand sich eine Apotheke. Die darüber liegenden Wohnungen hatten großen Fenster und ebenfalls in die Mauern eingelassene Balkons. Auf der rechten Seite von Nummer 66 befand sich kein Haus. Vielleicht war es weggebombt und der Platz nicht wieder bebaut worden. Gebrauchte Autos standen aufgereiht hinter einem Zaun. Jedes war mit einem roten Aufkleber versehen, welcher in der Windschutzscheibe hing und Informationen preisgab, die ein Autofahrer wohl braucht. „Autohandel Manfred Zeiss“ stand in blauen Buchstaben auf einem weißen Plakat, das am Zaun befestigt war.
Ich ging hinüber, ging zur Eingangstür von Nummer 66. Ich sah auf die Klingeln und auf die Namensschilder neben der Zahl, die die Etage angab. Es waren jeweils drei. Bornin, Müller, Wichmann in der ersten Etage. Darüber Graf, Blau, Herwick. Und so weiter. Ganz oben, in der fünften Etage, las ich Fitz und Stein. Das dritte Schild war nicht beschriftet.
„Melde dich bei Lisa Stein“, hatte der Vermieter gesagt. „Oder im Restaurant.“
Ich drückte den Knopf. Nichts passierte. Ich drückte ein zweites Mal. Immer noch nichts. Also ging ich vor zum Restaurant, öffnete die Tür, blieb aber erst einmal im Eingangsbereich stehen. Lediglich zwei Kerzen brannten auf dem Tresen gleich hinter dem Eingang auf der linken Seite. Über dem Tresen hingen dichte Rauchschwaden. Darunter saßen zwei Männer in schmutzigen Hemden und Arbeiterhosen auf Barhockern. Beide hatten kurze Haare, strähnig und klebrig, einer blond, der andere etwas dunkler. Sie starrten auf einen Fernseher.
Ich ging rechts an ihnen vorüber und an den Tischen entlang, die in drei mal vier Reihen standen. Ein Pärchen saß an einem dieser Tische. Ich wählte den Platz hinten rechts, von wo aus der Raum zu überblicken war. Das Pärchen besprach etwas Wichtiges. So sah es jedenfalls aus. Ihre Köpfe steckten dicht zusammen und ihre Stirne berührten sich fast. Später fiel mir ein, dass es Eva Glockenmann war, die an dem Tag, als ich ankam, dort saß. Manchmal fällt einem so etwas ein und auch, dass man nie weiß, mit wem man mal zu tun haben wird. Und wenn es dann passiert, dass man miteinander zu tun hat, merkt man, dass man sich schon oft gesehen hat. Allerdings hatte ich mit Eva später nie etwas zu tun, außer dass wir manchmal zusammen an einem Tisch saßen. Das passierte dann wegen Lisa, denn wir beide hatten mit Lisa zu tun. Auf alle Fälle schienen Eva und ihr Begleiter mich genau so wenig zu bemerken wie die beiden am Tresen.
Ich sah mich um. Auf den Tischen lagen dunkelblaue Decken und feuchte Bierdeckel steckten in Halterungen. Hinter dem Tresen ganz rechts befand sich die Tür zur Küche. Sie war angelehnt. Neben der Tür stand auf einem Regal der Fernseher, auf den die Thekenbrüder starrten. Ein Autorennen wurde gezeigt. Ich zog meinen Anorak aus, hängte ihn über die Stuhllehne und wartete.
Plötzlich rief einer der beiden: „Emily! Kundschaft!“ Seine Stimme war heiser und ebbte beträchtlich ab. Die letzte Silbe kostete ihn viel Kraft.
Sofort wurde die Küchentür geöffnet. Licht viel auf den Tresen. Emily kam. Sie blickte sich um, sah mich, blieb aber erst einmal stehen. Sie fummelte in der linken Ecke am Tresen unterhalb einiger Schränke herum. Und mit einem Mal war das Dolce Vita erleuchtet. Einzelne Strahler zielten senkrecht auf die Tische. Fast grell. Aber schnell drehte Emily am Dimmer, bis es fast wieder so schummerig wie zuvor war. Dann ging sie um die Theke herum.
Ihr dunkles, beinahe schwarzes Haar reichte ihr bis knapp über die Schultern. Es war gelockt. Sie hatte eine rote Bluse an und um die Hüfte eine weiße Schürze gebunden. Darunter trug sie blaue Jeans. Auf ihrem Weg zu mir rückte sie Stühle gerade und zupfte einige Tischdecken zurecht. Emilys Haut war hell, fast bleich und sie hatte blassgrüne, große Augen, darüber dünne Brauen, die sie emporhob, als sie vor mir stehen blieb. „Was kann ich dir bringen?“ fragte sie. „Essen gibt es erst ab sechs Uhr.“ Sie sprach leise, aber auffallend deutlich.
„Danke“, erwiderte ich, schaute zu ihr auf, dann zur Seite, dann wieder hoch.
Emily zog die Augenbrauen noch einmal oben.
„Ein Wasser bitte“, sagte ich.
Sie drehte sich, ging zum Tresen und kam sogleich mit einem Glas Wasser zurück.
Als sie wieder vor mir stand, sagte ich: „Ich suche Lisa Stein.“
Sie lächelte. Gepflegte kleine Zähne blitzten auf.
„Lisa kommt sicherlich gleich. Sie schaut hier immer vorbei, bevor sie hochgeht.“
Dann drehte Emily sich erneut um. Und ich blickte ihr wieder hinterher. Die beiden Männer an der Theke begannen, auf sie einzureden. Ich verstand jedoch nichts. Die Motoren aus dem Fernseher lärmten zu sehr.
Ein paar Minuten später wurde die Eingangstür geöffnet. So heftig, dass sie gegen einen Stuhl schepperte, der dahinter stand. Der Stuhl fiel um, gleichzeitig trat Lisa ein. Ich wusste natürlich nicht sicher, dass sie es war. Aber manchmal hat man eine Ahnung. Sie schaute kurz, warum es gepoltert hatte, ließ den Stuhl liegen und ging gleich zu den Männern am Tresen. Sie drückte beiden einen Kuss auf die Wange, drängte sich zwischen sie, schüttelte ihr blondes Haar, warf den Kopf in den Nacken und rief: „Was gibts neues?“
„Sonne is uff“, johlte der Blonde. Ein tiefes Lachen schloss sich an und ging in einen Husten über.
Lisa klopfte ihm auf die Schulter. „Ach Müllerchen!“ lachte sie. „Du hast doch immer schon genug Sonne, bevor ich da bin.“
„Macht ja nischt. Kannst aber trotzdem bleiben.“ Er rückte einen Hocker weiter.
Lisa setzte sich. „Gibst du mir einen Kaffee, Emily? Und schalte diesen verfluchten Fernseher aus.“
Emily drehte den Ton ab und deutete in meine Richtung. „Da wartet jemand auf dich.“
Lisa drehte sich und sah mit zusammengekniffenen Augen zu mir herüber. „Wer bist du?“ rief sie.
Kurz zuckte ich und wollte aufstehen, entschloss mich dann aber sitzen zu bleiben und erwiderte: „Ich komme wegen der Wohnung.“
Sie griff sich an die Stirn. „Ach, das habe ich vergessen.“ Sie sprang auf und lief mit kurzen Schritten zu mir herüber.
Trotz ihrer Schuhe mit Absätzen war sie klein. Ein blauer Rock verdeckte zu wenig ihrer Beine. Die gelbe Bluse darüber war zu eng. Oder der Busen darunter zu groß.
„Du heißt Anders nicht?“ fragte sie und setzte sich mir gegenüber.
Ich sah in ihr pausbäckiges Gesicht und auf die geröteten Wangen. „Ja“, nickte ich. „Gabriel.“
„Und woher kommst du?“
„Hessen.“
Sie lachte. „Ein Landsmann. Willkommen. Ich bin aus Frankfurt.“
Emily kam dazu, stellte vor Lisa eine Tasse Kaffee ab und sah mich dann an.
„Ich wusste davon nichts“, sagte sie. „Ich dachte, du bist ein Freund von Lisa.“ Sie räusperte sich. „Du bekommst natürlich was zu essen, wenn du willst.“
Ich bedankte mich. Und vermutlich lächelte ich. „Später gerne.“
„Ja“, sagte Lisa beinahe entschuldigend. „Ich wollte dir neulich erzählen, dass ein Neuer oben in die Wohnung zieht. Aber die Arbeit, du weißt ja ...“
„Ja, ja, so ist sie“, lachte Emily kurz. Dann blickte sie mich an. Einen Moment länger und wieder ernst. Zu ernst, fand ich beinahe. Schließlich drehte sie sich und verschwand in der Küche.
„Ach ja!“ entfuhr es Lisa.
Ich drehte mich weg von Emilys Rücken hin zu Lisa.
Sie sah noch auf die Küchentür, besann sich aber gleich, schaute mich an und sagte: „Gehen wir nach oben. Ich zeige dir die Wohnung.“
3
Wir verließen die Kneipe und gingen über die Straße zum Hauseingang. Davor blieb Lisa stehen, drehte sich umher und benahm sich, als wären ihr die Straße, das Haus und alles andere unbekannt. Mit beiden Armen zeigte sie zurück in Richtung der Kneipe: „Durch die Küche kommst du auch in den Hausflur. Aber Walter will das nicht.“
Dann drückte sie mir eine Mappe in die Hände, kramte in ihrer Tasche, zog einen Schlüssel hervor und schloss die Tür auf. Im Hausflur redete sie weiter: „Wir wohnen ganz oben. Emily und Walter direkt über der Kneipe.“ Sie zeigte nach links auf die Tür, die zur Kneipenküche führte. „Auf jeder Etage sind drei Wohnungen. Zwischen uns wohnt Frau Fitz, unsere Rentnerin. Wenn du etwas brauchst, fragst du bei ihr nach. Oder bei Emily und Walter.“
Sie ließ die Treppen weiter rechts außer acht, drückte den Fahrstuhlknopf und ging voraus, als die Tür sich öffnete. Ich folgte ihr, obwohl ein Fahrstuhl einer U-Bahn zu sehr ähnelt. Drinnen lehnte ich mich an eine Wand. Ich blickte zu Boden und auf Lisas Beine. Zwar schön gebräunt, nicht mal diese Solariumsbräune, aber kräftig und etwas faltig, runzlig, knittrig. Zu viel Haut für zu wenig Knochen und Gewebe und was auch immer darunter ist.
Der Fahrstuhl hielt wieder. Die Tür ging auf. Ich sah hoch und auf eine dunkelblau gestrichene Wohnungstür gerade vor mir. Eine weitere rechts, die dritte links.
„Dort links ist deine Wohnung“, sagte Lisa. „In der Mitte wohnt Frau Fitz und rechts ich.“
Ich nickte.
Lisa schloss die Tür zu ihrer Wohnung auf. „Ich muss deinen Schlüssel holen.“ Sie verschwand.
Ich sah einen quadratischen Flur, einen großen Spiegel gegenüber des Eingangs und eine Tür weiter rechts.
Lisa kam zurück, überreichte mir einen Schlüssel und sagte: „Mach du.“
Ich öffnete die Tür zu meiner Wohnung, ließ aber Lisa vorangehen.
Der Flur ebenso quadratisch wie ihrer. Weiß gestrichen, ein einzelner Haken an einer Wand. Der Durchgang zum Zimmer etwas nach links versetzt. Gleich dahinter die Tür zum Bad. Im Zimmer gegenüber des Eingangs eine Fensterfront. Fast die gesamte Wand entlang. Die Tür zum Balkon ganz links, davor ein Durchgang zur Küche. Vor den Fenstern ein Tisch mit zwei Stühlen. An der rechten Wand ein schmales Bett. Gleich rechts neben dem Eingang ein Schrank. Alle Wände mit weißer Raufaser tapeziert.
Lisa stellte sich in die Mitte des Zimmers. „Zufrieden?“ fragte sie.
Ich blieb stumm, zuckte mit den Schultern und nahm die Brille ab.
„Ich finde es ja langweilig, aber du wolltest eine möblierte Wohnung. Mehr gibt es dann nicht. Komm, ich zeige dir die Küche.“ Sie stellte sich in den Durchgang. „Hier sind Herd, Kühlschrank, Spüle, Schränke. Vermutlich brauchst du das alles gar nicht. Ich esse auch immer unten bei Emily und Walter.“
Ich legte meinen Rucksack in der Mitte des Zimmers ab und setzte mich ich an den Tisch.
Lisa blieb stehen. „Dir gefällt es?“
Ich nickte und sagte: „Ich habe mir dreißig Quadratmeter kleiner vorgestellt.“
„Ja, das ist aber auch nicht so wichtig“, erwiderte sie. „Wir sind oft unten. Viele aus dem Haus, meine ich. Du wirst sie kennenlernen.“
„Ja?“
„Natürlich. Ein paar sind immer unten. Wollen wir uns gleich wieder treffen? Dann stelle ich sie dir vor.“
Ich erhob mich und ging zum Fenster. Ich sah auf den Friedhof hinaus und auf die zwei Kirchtürme dahinter. Einer eckig und grau, an einen Schornstein erinnernd, der andere rund und rosa mit einer Haube aus grünen Ziegelsteinen.
„Erinnert an zu Hause“, sagte ich.
„Der Friedhof?“ fragte Lisa und lachte etwas unsicher.
„Mein Vater ist Pfarrer“, sagte ich und wandte mich wieder um.
„Das wird Emily freuen. Ihre Eltern liegen dort begraben. Morgens geht sie immer hinüber. Und jeden Sonntag geht sie in die Kirche.“
„Und du?“ fragte ich.
„Na, ich gehe ganz bestimmt nicht in die Kirche. Ich verstehe das auch nicht, genau so wenig wie Walter ... aber ... na ja.“ Sie zuckte fröhlich mit den Schultern.
„Walter ist Emilys Freund?“ fragte ich nach.
„Ja“, erwiderte Lisa. Dann nickte sie ein paarmal mit dem Kopf und ergänzte: „Ich habe sie zusammengebracht.“
Dass man durch einfache Fragen Vertrauen gewinnen kann, finde ich immer wieder erstaunlich. Dabei ist es auch egal, ob man aus Höflichkeit oder aus Interesse fragt.
„Und ihnen gehört die Kneipe?“
„Walter hat sie gepachtet“, erwiderte Lisa und nach einer Pause fügte sie an: „Am Donnerstag werden die beiden heiraten, aber das ist eine seltsame Geschichte.“
Sie sah mich einen Moment lang an, dann war das Vertrauen weg. Sie lachte: „Das sollte unter uns bleiben.“
„Okay.“
„Aber Emily würde sich bestimmt freuen, wenn du am Donnerstag dabei bist.“
„Okay“, wiederholte ich.
„Vielleicht willst du jetzt mal alleine sein?“ Lisa lachte wieder, aber dieses Mal künstlich. „Ich warte unten. Wenn du Hunger bekommst, essen wir zusammen.“ Sie verließ meine Wohnung.
Ich zuckte zusammen, als die Tür zuschlug. Dann war es still. Ich blieb eine Weile stehen. Es war anders, als ich erwartet hatte. Es erinnerte an die Abende in meinem Zimmer zu Hause. Schließlich ging ich auf den Balkon und sah über den Friedhof zum daneben gelegenen Park und zurück. Vom Rathaus her läutete es sechsmal.
Ich wollte raus. Ich wollte genauer sehen, was ich sah. Ich nahm meinen Schlüssel, meinen Anorak und die Treppen. Unten angekommen lief ich nach links bis zur nächsten Ecke. Gegenüber war der Park, nach links zweigte die Gothaer Straße ab. Ich ging sie entlang. Buchen standen am Rand zwischen parkenden Autos und Bürgersteig. Links Häuser und beleuchtete Wohnungen, ihre Bewohner allerdings hinter Gardinen versteckt. Rechts ein altes Backsteingemäuer, ein stillgelegtes Busdepot, wie ich irgendwann herausfand. Laternen im Abstand von fünfzig Metern beleuchteten den Bürgersteig. Aber nicht hell, sondern angemessen. Alles still. Alles ruhig. Kaum Menschen unterwegs.
Ich erreichte die Wartburgstraße und überquerte sie. Ich lief ein paar Meter weiter bis zum Eingangstor eines Spielplatzes, bog ab und stand im Sand. Vor mir sah ich einen seltsamen Stein. Rund, zwei Meter hoch und mit einem Loch an der Seite. Rechts war ein Gerüst mit einem Netz. Als ob Kinder Spinnen wären. Dahinter stand eine Seilbahn, wobei das, wo man sich dranhängt, fehlte, oder ich sah es in der Dämmerung nicht. Ein weiteres Tor führte hinunter vom Spielplatz und hinein in den Park, der von der anderen Seite von der Martin-Luther-Straße begrenzt wurde. Ein mit Kieselsteinen ausgelegter Weg führte um eine Rasenfläche. Am Rand Gebüsch und Bäume, links Kastanien in einer Anhäufung, einige Birken auf dem Rasen und ein Baum, keine Ahnung, was für einer, in der Mitte. Martin und Gero erzählten mir später, dass man ihn den Elefantenbaum nannte. Alle Kinder, alle Jugendlichen, die hier wohnten und zu Hause waren, wussten das.
4
Ich ging den gleichen Weg zurück und sah schon, als ich in die Belziger Straße einbog, das Kneipenlicht auf die Straße fallen. Ich ging bis zum Eingang vor, sah nicht durch die Fenster, sondern öffnete gleich die Tür. Rauch schlug mir entgegen. Dunst, fast schon Nebel, umfing mich. Ich nahm das nie wieder so wahr. Wahrscheinlich, weil es immer so war. Am ersten Tag aber wirkte der Qualm so massiv, dass ich erst nach Sekunden die Theke wahrnahm. An ihr standen und drängelten sich Männer. Klein, groß, dick, glatzköpfig, bärtig, in Mänteln oder aufgeknöpften Hemden, gestikulierend, eifrig nickend und mit erhitzten Gesichtern. Ich schloss die Tür.
Links hinter der Theke stand Walter. Eher klein. Kurzes, dichtes, schwarzes Haar. Die Stirn frei und flach. Buschige Augenbrauen, ebenso dunkel wie das Haar. Die Augen huschten hin und her. Flink und listig. Kantige Nase. Ohren, nicht vom Haar verdeckt, mit einer seltsamen Wölbung nach innen. Er war unrasiert und trug einen Schnauzer, hatte beharrte Arme und einen kräftigen Bauch. Wirklich kräftig, nicht dick. Darüber trug er ein ärmelloses, ausgewaschenes rötliches T-Shirt und unterhalb des Bauches eine schmutzige Schürze. Mitte Vierzig vom Aussehen her, in Wahrheit Mitte dreißig.
Walter zapfte Bier, ohne zu beachten, wann ein Glas gefüllt war. Die Augen bewegten sich immerfort nur von einem, der vor ihm stand, zum nächsten. Ein Automat, dachte ich. Er wusste wie eingetrichtert, wann ein Glas gefüllt war, zog es weg, schob das nächste hinterher. Eine Reihe von zehn Gläsern. Am Ende wieder von vorne. Dann aber in kürzeren Abständen.
Ich blickte in den Raum. Jeder zweite Tisch war besetzt. Meistens von Pärchen. An einem Tisch räkelten sich Kinder auf Stühlen, von den Erwachsenen abgeschoben. Zwei Männer, auffallend, weil sie Anzüge und Krawatten trugen, stützten ihre Köpfe auf ihren Händen ab.
Ich ging zwei Schritte zum Tresen und lehnte mich, um Halt zu haben, gegen ihn. Walter hatte mich noch nicht bemerkt, jedenfalls noch nicht in meine Richtung geblickt. Auch Lisa und Emily, die am anderen Ende des Tresens standen, sahen mich nicht. Sie winkten nicht und kamen nicht auf mich zu. Es schien, als ob ich in der Männerriege, die sich zwischen uns befand, aufging. Aber ich stand nur kurz dort, als schon einige ihren Thekenplatz verließen. Sie gingen an mir vorüber und hinaus, ohne zu bezahlen und ohne dass Walter ihnen hinterher sah. Gleichzeitig verstummte die Unterhaltung der Übriggebliebenen. Ich blickte weiter zu Lisa und Emily hinüber, aber sie immer noch nicht zu mir. Dann entspannte sich nach und nach das Wirrwarr oder vielleicht entspannte auch ich mich einfach. Alles Gerede von den Tischen vereinheitlichte sich zu einem Gemurmel und ich verstand plötzlich, was Emily und Lisa sprachen.
„Er hat nur einen Rucksack dabei?“ fragte Emily.
Lisa nickte. „Ich habe ihn nicht gefragt, ob er noch etwas schicken lässt. Aber ich glaube nicht.“
„Was denkst du?“
„Nett. Ich bin damals genauso hierher gekommen. Ich werde meine Hilfe anbieten, damit er sich zurechtfindet.“
Emilys Antwort verstand ich nicht. Aber Lisa sah sie daraufhin böse an und stemmte die Hände in die Hüften. Dann lachte sie jedoch los. „Ich glaube nicht, dass er so ein Typ ist.“
Emily schüttelte den Kopf und erwiderte: „Das sagst du immer.“
„Egal“, lachte Lisa. „Ich will mir nur Mühe geben, dass es ihm gefällt. Denk an seinen Vorgänger.“
„Lieber nicht.“
„Siehst du.“ Wieder lachte Lisa. „Deswegen müssen wir nett zu ihm sein.“
„Und du eben auf deine Art.“
Ich ließ den Tresen los und bemerkte, dass sich meine rechte Hand in der Hosentasche zu einer Faust geballt hatte. Ich ging schnell hinaus.
Frische Luft. Die Bedeutung davon hatte sich gerade geändert. Ich hatte jetzt erst überhaupt eine Ahnung, dass es sie gab. Vorher hatte ich es immer albern gefunden, wenn jemand sagte, er gehe mal an die frische Luft oder er müsse frische Luft schnappen. Ich wollte bis zehn zählen und dann wieder hineingehen. Aber ein unbekanntes, jedoch gutes Gefühl breitete sich in mir aus. Ich vergaß das Zählen und besann mich. Ich stand auf einer Straße vor einer Kneipe in Berlin. Einen Sinn musste das haben.
Also drehte ich mich, öffnete erneut die Tür und ging wieder in die Kneipe. Wieder bemerkte es keiner oder ich nicht, dass es jemand bemerkte. Ich schlenderte zu Lisa und Emily. Die Hände in den Hosentaschen.
Emily sah mich zuerst und lächelte.
Daraufhin drehte sich Lisa um. „Und?“ fragte sie. „Alles okay?“
Ich nickte.
Sie drehte sich zur Theke und rief hinüber: „Walter! Das ist Gabriel, mein neuer Nachbar.“
Walter spülte Gläser und hatte beide Hände bis zu den Ellenbogen im Becken versenkt. Irgendwann nickte er. Aber er sah nicht auf. Spülwasser war interessanter. Als er das letzte Glas aus dem Becken gefischt und abgestellt hatte, trocknete er seine Hände an der Schürze. Danach schlurfte er zwei Schritte in unsere Richtung, hob langsam den rechten Arm und streckte seine Hand über den Tresen gerade auf mich zu. Dabei sah er dann auf. Zwar behäbig, aber immerhin. Und er sagte sogar etwas, murmelte „Grüß dich“ oder etwas Ähnliches.
Ich blickte zurück, blickte kurz in seine dunklen Augen und erwiderte den Händedruck. Aber mehr lagen meine Finger gequetscht in seiner Hand. Um etwas zu sagen, sagte ich: „Freut mich.“
„Na, dann freu dich“, erwiderte er, lachte kurz in sich hinein und ging zum Zapfhahn zurück.
Es gibt Menschen, die sind anders.
„Was möchtest du trinken?“ fragte mich Emily.
Ich sah zu ihr. „Wasser?“
„Nein“, erwiderte Lisa. „Wir trinken Rotwein. Auf deine Ankunft.“
Sie nahm meine Hand und zog mich zu dem Tisch, an dem ich vor ein paar Stunden gewartet hatte. Kaum saßen wir, forderte Lisa mich auf: „Schau mal in die Karte. Heute musst du nicht bezahlen. Das ist immer so, wenn jemand neu ins Haus zieht.“
Ich blätterte. Aber Emily kam schnell vorbei und Lisa bestellte etwas. Also nahm ich das gleiche.
Dann saßen wir da. Natürlich saßen wir ja schon einen Moment. Jetzt aber, ohne etwas zu tun zu haben. Lisa sah mich an. Ich zurück. Dann lachte sie, zog ihr Jackett aus und lehnte sich mit den Ellenbogen auf den Tisch. „Was wirst du studieren?“ fragte sie.
Lisa hatte mit ihrem Lachen Erfolg. Wenn sie lachte, zeigten sich gleichmäßige und gepflegte Zähne. Außerdem wirkte ihr langes blondes Haar. Es kündigte ihr Erscheinen bereits von Weitem an. Auch ihr Busen wirkte, denn auch er war schon von Weitem zu erkennen. Lisa war reizvoll und wollte es sein, aber sie war durchschaubar. Allerdings kann auch das Durchschaubare reizvoll sein, denn auch das muss erst bewiesen werden.
Ihre Augen hingegen waren unauffällig. Mit ihrem Blick konnte Lisa nichts erreichen. Jedenfalls nicht bei mir. Ihrem Blick konnte ich mühelos standhalten. Obwohl jemandem in die Augen zu schauen sonst nicht meine Sache ist.
Ich antwortete: „Deutsch und Geschichte.“
Sie lachte: „Damit habe ich auch angefangen. Ich wollte Lehrerin werden. Das war noch in Frankfurt. Aber nach zwei Jahren habe ich meine Koffer gepackt und bin hierher gezogen. Ich wollte mal weg.“
Wahrscheinlich hätte sie auch so weiter erzählt, aber aus Höflichkeit fragte ich: „Und?“
„Mit dem Studium habe ich hier nicht weitergemacht. Ich musste erst mal Geld verdienen.“
Sie lachte nicht mehr, sie strahlte. Dabei öffnete sie ihren Mund weiter als nötig, wodurch die Augen schmaler wurden. Die Lachfalten drückten sie sozusagen zusammen.
Mir fiel Nadja ein. Sie war zwar nicht blond wie Lisa, sondern dunkelhaarig. Aber sie hatte solch schmale Augen. Schmalere Augen als alle anderen. Und viel dunklere als alle anderen. Es lag daran, dass sie aus Korea kam, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwo aus Asien. Vor unserer Konfirmation, nach so einer Stunde zur Vorbereitung dafür, hatte sie mich angesprochen. Sie bat mich, mich mal besuchen zu dürfen. Ein paar Jungs staunten, denn Nadja war beliebt. Aber plötzlich wollte sie mich besuchen. Den Pfarrerssohn, den, der immer alleine nach Hause ging. Dass mein Vater Pfarrer war, war wirklich der Grund. Zuerst jedenfalls. Ich könnte ihr am besten erklären, was am Tag der Konfirmation passiert, sagte sie. Mir fiel nicht ein, warum ich absagen sollte. Also kam sie und wir saßen irgendwann nachmittags auf meinem Bett. Draußen war es noch hell. Ich wusste nicht, was ich erklären sollte, fragte mich, wozu wir Unterricht hatten und blätterte in einem Ordner, während Nadja immer näher rückte. Dann nahm sie mir den Ordner aus der Hand und warf ihn zur Seite auf den Boden. Blätter lösten sich aus der Verankerung. Als ich aufsah, in Richtung ihres Gesichts, drückte sie ihres gegen meines. Also hauptsächlich ihre Lippen auf meine. Es ist wohl ein Reflex, dass man erst mal die Augen schließt. Aber es dauerte lange. Deswegen machte ich die Augen wieder auf und sie irgendwann auch. Sie sah mich erst noch ein bisschen erwartungsvoll an, dann erstaunt. Schließlich lachte sie: „Du musst die Augen schließen.“ Dass ich das getan hatte, verschwieg ich. Als sie wieder näher kam, schloss ich die Augen ganz schnell und fühlte erneut ihre Lippen auf meinen. Und dann, einen Moment war ich mir unsicher, spürte ich ihre Zunge, die versuchte, meine Lippen zu trennen. Ich ließ es zu. Sie fuchtelte zwischen meinen Zähnen herum und ich machte mit. Vielleicht hatte ich am Ende auch ein bisschen Spaß. In der Erinnerung scheint es mir jedenfalls so. Aber irgendwie auch nicht so viel, dass ich es wiederholen musste. Jedenfalls nicht mit Nadja. Sie kam noch ein- oder zweimal vorbei. Allerdings war sie mir immer wieder fremd. Ich setzte mich dann lieber auf einen Stuhl und gab meinen Ordner nicht aus der Hand.
Ich fragte Lisa: „Was machst du jetzt?“
„Ich gebe Nachhilfeunterricht. Darüber habe ich auch Emily kennengelernt. Außerdem schreibe ich für verschiedene Zeitschriften.“
Sie beugte sich nach vorne und stütze die Arme auf den Tisch. Es war nicht zu vermeiden, dass ich in ihren Ausschnitt sah. Aber Emily brachte das Essen. Pause für einen Moment. Allerdings aß ich nicht viel.
Nach Nadja hatte ich manchmal ein Mädchen gesehen, an das ich anschließend ein paar Tage lang dachte. Wenn eine neu auf der Schule war oder wenn ich mal in die Stadt fuhr und eines sah. Ich dachte über Nähe nach. Über Zusammensein. Es gibt aber Grenzen, die man nur in Gedanken überschreitet. Nicht in der Realität. Und Grenzen gibt es nicht umsonst.
Nach dem Essen trank ich mein Glas in einem Schluck aus.
Lisa leerte ihr Glas ebenso schnell und sah mich wieder an.
„Wenn du morgen zur Uni gehst, könnte ich dich begleiten“, sagte sie. „Ich habe frei.“
Dann sackte sie zusammen und sah mich von unten herauf an. Ihr Busen lag auf dem Tisch.
Ich nickte und schob den Teller von mir fort. In Richtung ihrer Brüste.
Sie lehnte sich zurück.
Dann kam Emily und räumte die Teller zusammen. Aber sie zögerte und sah mich an. „Hat Lisa dir gesagt, dass du am Donnerstag hier sein sollst?“
Ich hob die Schultern, blickte kurz zu ihr auf, dann hinüber zu Lisa.
„Walter und ich heiraten“, fuhr Emily fort. Sie begann, mit einem Lappen über den Tisch zu wischen. „Ich würde mich freuen, wenn du kommst.“ Sie lächelte kurz. Dann rief jemand nach ihr und sie verschwand.
„Ich wusste doch, dass sie dich mag“, stellte Lisa fest. Dann hob sie die Arme, streckte sich, griff an den Kragen ihrer Bluse, zog ihn nach unten und rüttelte daran.
Ich sah die Spitzen ihres BHs und den Ansatz ihrer Brüste.
Plötzlich lachte sie: „Ich möchte ja nur, dass sie glücklich ist.“
„Ist sie doch“, sagte ich.
„Ach“, sagte Lisa betrübt. Oder auch nur gespielt betrübt. „Solange sie es für richtig hält, muss ich das auch tun.“
„Ja“, sagte ich, um etwas gesagt zu sagen. Dann lehnte ich mich zurück, denn ich erahnte, dass der Abend überstanden war.
Schließlich stand Lisa auch auf und sagte: „Ich helfe jetzt noch in der Küche.“
Ich blieb allein, wurde müde und rutschte auf meinem Stuhl abwärts. Ich stützte meine Ellenbogen auf den Tisch und legte meinen Kopf oder vielmehr das Kinn auf die Hände, um Halt zu finden. Ich sah die Menschen an, die auch nicht anders als die aus meinem Dorf waren. Manche modisch und schick gekleidet, manche in Alltagsklamotten. Der Mann bestellte, die Frau lachte, sie tranken Wein, aßen, gingen wieder. Manche unterhielten sich mit Emily. Man kannte sich.
Später fielen mir die Augen zu. Mein Kopf knickte aus der Armhalterung zur Seite. Ich schreckte hoch und setzte mich wieder aufrecht, hielt aber nur wenige Minuten durch, bis ich erneut auf dem Stuhl hinabrutschte.
Irgendwann stand Emily neben mir. Sie lächelte und sagte: „Du solltest ins Bett gehen.“
Ich stimmte zu.
5
Man schläft nicht immer gleich. Manchmal träumt man wirr und hat am Morgen das Gefühl, gar nicht geschlafen zu haben. Manchmal ist der Schlaf aber auch tief und traumlos. So wie meiner an diesem Tag. Als ich aufwachte, wusste ich nicht, wo ich war. Ich erschrak und strengte mich an. Ich überlegte, wo zum Teufel ich mich befand. Ich starrte gegen eine kahle Wand rechts von mir, drehte mich und sah einen Tisch, zwei Stühle und meinen Rucksack auf dem Boden. Da dämmerte es. Die Orientierung kam. Ich drehte mich auf den Rücken.
Dicke Regentropfen prasselten gegen die Fensterscheibe. Ich knüllte das Kissen zusammen und stopfte es unter den Kopf. Ich suchte zwei an der Scheibe parallel laufende Tropfen und beobachtete, wie sie bis zum Rahmen hinabrollten. Mal langsam und von irgendetwas aufgehalten, dann schnell. Schließlich verschwanden sie. Dann suchte ich neue und verfolgte, wie ihr Rennen bis zum Rahmen verlief.
Die Uhr vom Rathaus oder von einer Kirche schlug neunmal. Oder vielmehr deren Glocken. Ich schlug meine Decke beiseite und stand unentschlossen neben dem Bett, als es klingelte. Ich kannte keine Türklingel. Zuhause gab es so etwas nicht. Da war die Tür immer offen. Die, die kamen, wussten das. Und meine Mutter hielt sich ja immer in der Küche oder auf dem Hof auf. Niemand konnte unser Haus betreten, ohne gleich auf meine Mutter zu stoßen.
Es klingelte noch einmal.
Ich sah an mir herab, sah ein weißes T-Shirt und blaue Shorts. Ich ging zur Tür und öffnete sie.
Lisa stand vor mir. „Du schläfst noch?“
„Bin gleich fertig“, sagte ich und ging ins Zimmer zurück.
„Aber du erinnerst dich, dass wir verabredet sind?“ fragte sie fröhlich und folgte mir.
Ich setzte mich erst mal zurück aufs Bett und rieb mir die Augen. Blaue Kreise kamen und verschwanden.
Dann sah ich Lisa. Schwarze Wollmütze, unter der die blonden Haare hervorschauten. Weißer Rollkragenpullover, beigefarbener kurzer Rock. Schwarze Stiefel bis zu den Knien und ein schwarzer Ledermantel, der über ihrem Arm lag. Ein angenehmer Duft umgab sie.
„Fünf Minuten“, sagte ich, ging ins Badezimmer, drehte den Wasserhahn auf, hielt eine Hand darunter und zog sie gleich wieder weg.
„Emily hat erzählt, dass du unten eingeschlafen bist“, rief Lisa.
Ich entsann mich verschwommen. Aber nicht an den Weg in die Wohnung und ins Bett. Verschenkte Zeit, wenn es nicht möglich ist, sich an sie zu erinnern. Obwohl diese Zustände vielleicht auch die besten sind.
„Der Tag war anstrengend“, sagte ich, als ich zurück ins Zimmer kam. Dann zog ich Hose, Pullover, Schuhe und Jacke vom Vortag an.
„Los“, sagte Lisa. „Wir holen uns dann in der Uni einen Kaffee.“
Wir liefen über den Platz vor dem Rathaus und bogen dahinter in die Salzburger Straße ein. Lisa hatte einen Schirm aufgespannt und sich bei mir eingehakt.
„Wir fahren ungefähr eine halbe Stunde bis zur Uni“, erklärte sie. „Einmal müssen wir umsteigen.“
Am Bayerischen Platz gingen wir in den Untergrund. Der Bahnsteig war breit und hell erleuchtet. Die Wartenden verteilten sich. Es war okay. Aber dann kam die Bahn und Lisa stürmte als erste zu einer Tür. „Komm“, rief sie. „Der Zug ist schon voll.“
„Vielleicht ist der nächste leerer“, sagte ich.
„Bestimmt nicht“, erwiderte sie und zog mich mit sich.
Hinter uns war kein Platz mehr. Trotzdem fanden einige noch einen und drängten uns weiter ins Innere. Als die Türen geschlossen wurden, nutzte einer auch noch den letzten Spalt. Mütter und Kinder mit Schulranzen saßen auf den Bänken. Hausfrauen mit Einkaufstüten daneben. Bürokraten in Anzügen standen herum. Und Arbeiter in Blaumännern. Einer mit einer Flasche Bier in der Hand. Ein Junge mit Fahrrad neben ihm. Irgendwo schrie ein Baby. Nach drei Stationen schubste Lisa mich wieder hinaus.
Treppen hoch. Nächste Bahn. Darin viele, die uns ähnelten. Nüchtern betrachtet. Außenstehende würden das sagen. Ich fühlte mich keineswegs zugehörig.
„Bist du schon eingeschrieben?“ fragte Lisa.
Ich verneinte.
„Aber eine Zusage hast du?“
Ich schüttelte den Kopf.
Lisa stand dicht neben mir. Ihr Parfüm wehte in meine Nase. Hinter ihr lehnte in einer Ecke eine Studentin. Schwarzhaarig. Dunkle Augen. Helle Haut. Etwa mein Alter. Sie las in einem Hefter, blickte aber immer wieder auf. An der nächsten Station stieg ihr Freund ein, drängelte sich an uns vorbei, küsste sie auf die Wange und auf den Mund. Dann hielten sie sich an den Händen, flüsterten einander in die Ohren und sahen sich in die Augen.
Die U-Bahn verließ den Tunnel und fuhr im Freien weiter.
Ich konnte nicht wegsehen. Vielleicht Neid. Aber nicht wegen des Erlebens. Vielmehr Neid auf das Wissen, was es bedeutet und was es ausmacht. Intimität, Nähe. Ich wollte wissen, ohne teilen zu müssen. Nur für mich. Wahrscheinlich wegen der Grenze. Es ist ja möglich, dass es sich ohne Grenzen besser lebt.
Wir stiegen aus. Lisa hakte sich wieder unter, führte mich in das Hauptgebäude, suchte ein Büro auf und kaufte ein Verzeichnis mit Informationen zu allen Veranstaltungen. Ich blieb auf dem Flur stehen. Ein ewig langer Flur, wie man sagt. Ein Ende nicht in Sicht. Ich sah mich um. Gänge verliefen nach beiden Seiten und von dort aus weitere Flure und Gänge. Sprich ein Labyrinth. Ein paar Türen gab es auch und eine Treppe, die zu einer weiteren Etage führte. Um mich herum Hunderte in meinem Alter. Sie wussten, wo es lang ging, schwirrten und schwatzten.
Lisa kam zurück und steuerte uns zielsicher ins Café.
Ein großer rechteckiger Raum. Rechts eine Theke. Darauf Kaffeekannen oder Automaten, so eine Mischung. Oben drückt man, vorher sollte unten eine Tasse stehen. Milch und Zucker extra. Am Ende der Theke zahlen.
Der Raum war fast leer. Wir setzten uns auf die linke Seite vor die Fenster.
Lisa blätterte im Verzeichnis. „Deutsch, Geschichte“, sagte sie leise. Also mehr zu sich selbst.
Ich trank.
„Du hast Glück. Geschichte, da kannst du dich noch einschreiben. Nächste Woche sind Einführungen. Das ist wichtig. Deutsch, da hättest du dich bewerben müssen. Aber Vorlesungen kannst du besuchen.“ Sie sah auf.
Ich hielt meine Tasse fest, sah aus dem Fenster, dann zum Eingang, dann zu Lisa.
„Interessiert dich das eigentlich?“
Ich nickte und fragte: „Wo muss ich mich einschreiben?“
„Das muss in diesem Gebäude sein.“
„Dann mache ich das nachher.“
Lisa lachte. „Sicher?“
Ich lehnte mich zurück. „Ja.“
Sie schien zufrieden.
Also fragte ich: „Vielleicht kommst du mal mit?“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich fange nicht noch mal von vorne an.“
„Warum nicht? Deswegen bist du doch auch hierher gekommen.“
„Ach Gott. Wie lange ist das her?“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich habe studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst anfangen sollte. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe.“
Mir fiel nichts ein. Also erwiderte ich auch nichts.
„Und du?“ fragte Lisa. „Bist du wirklich wegen des Studiums hergekommen?“
Ich sah sie an. Überlegte. Und entschloss mich, ehrlich zu sein.
„Wir haben unsere Abschlussfahrt hierher gemacht“, sagte ich. „Im Frühjahr. Und eine Freundin sagte, dass sie sich nicht vorstellen könnte, hier zu leben.“
Lisa sah mich fragend an.
„Es hatte keiner mitbekommen“, ergänzte ich. „Und sie hat es auch nur so dahin gesagt. Aber mir gefiel die Überlegung.“
Ich sah Lisa an.
Und sie zurück.
Möglicherweise gab es noch eine zweite Lisa. Eine, die anders war. Eine, die Interesse an mehr hatte. Die Erfahrungen gemacht hatte, die vor mir lagen. Ganz ähnliche, aber vergessen. Vielleicht war sie nah daran, sich zu erinnern. Und ich nah an ihr. Aber wenn es so war, danach war es nicht mehr oft so.
„Was erhoffst du dir davon?“ fragte sie.
„Nichts. Wahrscheinlich geht es nur darum zu verstehen.“
Sie sah mich an und schüttelte den Kopf, sagte aber trotzdem: „Wenn sich etwas ergibt, kannst du es ja mal erzählen.“
„Vielleicht verstehst du es dann nicht so wie ich“, erwiderte ich.
Lisa lachte einfach nur.
Wir tranken einen Schluck.
Danach nahm sie meine Hand, hielt sie über dem Tisch fest und sagte: „Du sollst wissen, dass ich mich gerne mit dir treffen und mit dir reden möchte. Weißt du, in der Redaktion rede ich über die Arbeit, mit Emily rede ich über ihre Sorgen und mit Walter gibt es eigentlich keine Unterhaltungen.“
Ich nickte.
Dann stand sie auf, beugte sich wieder herab und umarmte mich.
„Ich lasse dich mal allein. Wenn du willst, sehen wir uns heute Abend.“
6





























