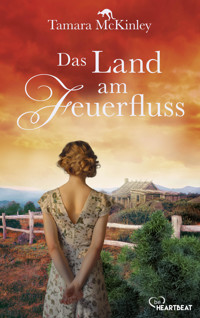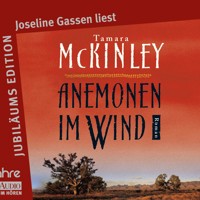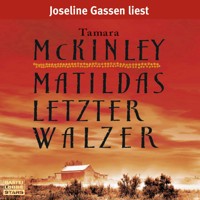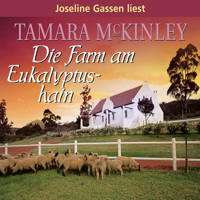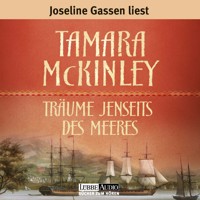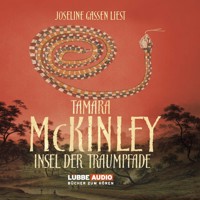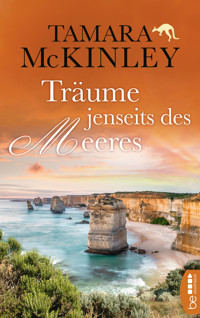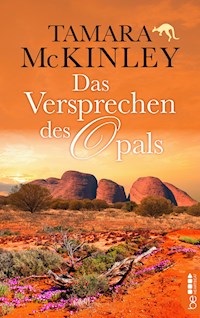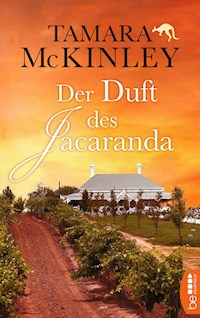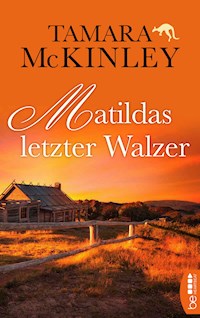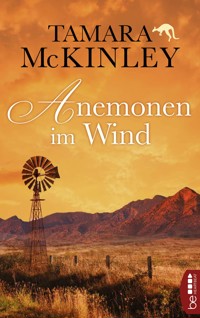
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großer Australien-Roman für alle Fans von Di Morrissey, Patricia Shaw und Elizabeth Haran
Ellie hat keinen Zweifel: Sie wird Joe wiedersehen, der ihr einst die Ehe versprach. Voller Hoffnung ersehnt die junge Frau Joes Rückkehr aus dem Krieg und kämpft mutig um das Überleben auf einer einsamen Farm in der Wildnis Australiens. Erst als Charlie, Joes Zwillingsbruder, schwer verwundet von der Front zurückkommt, wird ihr Glaube an ein Glück mit Joe erschüttert. Ellie ist hin und her gerissen zwischen ihrer Treue zu Joe und der Zuneigung zu Charlie - einem Mann, der schon immer besitzen wollte, was seinem Bruder gehört ...
Weitere Romane von Tamara McKinley bei beHEARTBEAT: Der Duft des Jacaranda. Die Farm am Eukalyptushain. Matildas letzter Walzer.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Motto
PROLOG 1936
EINS: VIERUNDDREISSIG JAHRE SPÄTER
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
EPILOG
Weitere Titel der Autorin
Das Land am Feuerfluss
Das Lied des Regenpfeifers
Das Versprechen des Opals
Der Duft des Jacaranda
Der Himmel über Tasmanien
Der Zauber von Savannah Winds
Die Farm am Eukalyptushain
Insel der Traumpfade
Jene Tage voller Träume
Legenden der Traumzeit
Matildas letzter Walzer
Sehnsucht nach Skye
Träume jenseits des Meeres
Über dieses Buch
Ein großer Australien-Roman für alle Fans von Di Morrissey, Patricia Shaw und Elizabeth Haran
Ellie hat keinen Zweifel: Sie wird Joe wiedersehen, der ihr einst die Ehe versprach. Voller Hoffnung ersehnt die junge Frau Joes Rückkehr aus dem Krieg und kämpft mutig um das Überleben auf einer einsamen Farm in der Wildnis Australiens. Erst als Charlie, Joes Zwillingsbruder, schwer verwundet von der Front zurückkommt, wird ihr Glaube an ein Glück mit Joe erschüttert. Ellie ist hin und her gerissen zwischen ihrer Treue zu Joe und der Zuneigung zu Charlie – einem Mann, der schon immer besitzen wollte, was seinem Bruder gehört …
Über die Autorin
Tamara McKinley wurde in Australien geboren und verbrachte ihre Kindheit im Outback des fünften Kontinents. Heute lebt sie an der Südküste Englands, aber die Sehnsucht treibt sie stets zurück in das weite, wilde Land, dessen Farben und Düfte sie in ihren Büchern heraufbeschwört. Mit ihren großen Australien-Romanen hat sie sich eine weltweite Fangemeinde erobert.
Homepage der Autorin: http://www.tamaramckinley.co.uk/.
Tamara McKinley
Anemonen im Wind
Aus dem australischen Englisch von Rainer Schmidt
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2002 by Tamara McKinley
Titel der englischen Originalausgabe: »Windflowers«
Originalverlag: Piatkus Books Ltd.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2002/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung von Motiven © Shutterstock: kwest | Barnaby Chambers | artpritsadee
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-8042-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
WIDMUNG
Dieses Buch ist den Menschen gewidmet, die ich auf meinen Reisen durch Australien getroffen habe. Ohne sie hätte ich niemals die Herzlichkeit und die echten Farben des Outback erfahren:
Charlie und seiner Frau vom Blue Gum Cafe danke ich für das tolle Frühstück. Der Manager des Charleville Hotel und seine Gäste steuerten zahlreiche Anekdoten bei und erlaubten mir einen tiefen Einblick in das Leben inmitten der Wildnis. Den Besitzern der Gowrie Station Dank für ihre Gastfreundschaft, für den Tee aus dem Feldkessel und das in der Asche gebackene Brot. Dank der Jondaryan Woolshed Historical Museum and Park Association konnte ich die glorreichen Tage der Vergangenheit erleben, in der die Wolle noch eine königliche Rolle spielte. Und last, not least danke ich dem kleinen Jungen, der mich zu dieser Geschichte inspirierte. Ich kannte deinen Namen nicht, aber dein Bild lebte noch lange in mir fort, nachdem wir Abschied genommen hatten.
MOTTO
I dreamed that I wandered by the way,
Bare winter suddenly was changed to spring.
There grew pied wind-flowers and violets
Daisies, those pearled Arcturi of the earth,
The constellated flower that never sets.
P.B.Shelley 1792–1822
Mich träumte, dass, als ich so für mich ging,
Aus kahlem Winter plötzlich Frühling ward.
Da wuchsen bunte Anemonen, Veilchen
Und Tausendschön, die irdischen Arcturi, perlenweiß,
Ein Blumensternbild, das nie untergeht.
PROLOG1936
Sydneys Domain mit ihrem Schmutz und Staub lag fast ein Jahr hinter ihnen, als Ellie und ihr Vater in Richtung Norden nach Gregory Downs ritten. Der Pfad schlängelte sich durch die leere Ebene wie ein blutrotes Band, das im Hitzedunst verschwand, und lockte sie immer weiter ins Unbekannte. Aber da sie nun Geld in den Taschen und Reitpferde hatten, kamen sie endlich leichter voran als in den Monaten, in denen sie zu Fuß auf den Wallaby-Pfaden gewandert waren.
Sie ritten auf der langen Strecke nach Cloncurry, als Ellie bemerkte, dass sich hinter ihnen dicke Wolken am Horizont auftürmten. »Sieht nach einem Unwetter aus«, warnte sie. »Wir sollten uns lieber eingraben, bevor es uns erreicht.«
Ihr Vater John drehte sich um und warf einen Blick auf die Wolken, die an einem seltsam gelben Himmel brodelten. »Sollten’s eigentlich bis Cloncurry schaffen, ehe es losgeht.«
Ellie runzelte die Stirn. »Das schaffen wir nicht«, sagte sie mit Entschiedenheit. »Bis nach Curry sind’s noch mindestens zwei Tagesritte, und so lange wird das Unwetter nicht auf sich warten lassen.«
»Wir müssen’s probieren.« John straffte die Zügel und lächelte sie mit gespielter Munterkeit an. »Wenn es so aussieht, als ob wir es nicht schaffen, müssen wir uns einen Unterschlupf suchen und das Wetter über uns wegziehen lassen.«
Ellie schaute ihrem gut aussehenden Vater ins Gesicht, und die Verzweiflung über seinen Mangel an Vernunft lastete schwer auf ihr. Es waren nur noch wenige Wochen bis zu ihrem vierzehnten Geburtstag, und dennoch war er anscheinend entschlossen, sie wie ein Kind zu behandeln. Sie hatte von den schrecklichen Unwettern gehört, die es hier mitten in der Wildnis gab, und sie wusste, dass er ebenso viel Angst hatte wie sie. Wenn er es nur zugeben würde!, dachte sie erbost. Wenn er nur ausnahmsweise einmal auf mich hören wollte, dann könnten wir vielleicht lebendig hier rauskommen.
»Wo denn genau?«, fragte sie in scharfem Ton. »Hier draußen gibt es keinen Berg, kein Tal und keinen Felsen, und vielleicht haben wir nicht mal mehr genug Zeit, um uns hier einzugraben.« Ihr Blick wanderte über die trostlose Umgebung. Der steinige Pfad war unter der wirbelnden Staubschicht hart wie Beton, und die wenigen versengten Bäume, die schwarz in der Hitze standen, boten nur wenig Schutz. Die Berge lagen wie Murmeln als Schemen in weiter Ferne.
»Wir finden schon was«, sagte er in seiner typischen Sturheit.
Ellies braune Augen unter den zerzausten Fransen ihres flachsfarbenen Haars musterten ihn ernst. »Wir sollten sofort anfangen zu graben, wenn wir noch eine Chance haben wollen. Staubstürme sind mörderisch, und wir sollten sie ernst nehmen.«
Kalte Entschlossenheit stand in Johns Augen. »Du hast auf dem Viehtreck nach Longreach zu viele Horrorgeschichten aus dem Outback gehört«, fuhr er sie an. »Du bist vielleicht dreizehn und gehst so allmählich auf die fünfundvierzig zu, aber du weißt noch längst nicht alles.«
Ellie rutschte im Sattel hin und her und schaute sich zum düsteren Horizont um. Der Wind wechselte die Richtung, aber deshalb wurde ihr nicht wohler. Der schwarze Treiber, Snowy White, hatte sie vor den tückischen Naturgewalten gewarnt. Der Aborigine hatte nur allzu eindringlich beschrieben, wie sie ahnungslose Reisende in falscher Sicherheit wiegten, bevor sie ihre schrecklichen Kräfte entfesselten.
John Freeman zog sich den Hut tiefer über die dunklen Augen. »Wir reiten weiter«, sagte er mit einer Entschlossenheit, die keinen Widerspruch duldete. »Der Sturm ist meilenweit weg, und wie es aussieht, ändert er die Richtung.« Er lenkte den Grauschimmel auf den breiten Steinpfad, der am nördlichen Horizont verschwand, und stieß dem Pferd die Fersen in die Flanken. »Also los!«
»Gefällt mir nicht, wie das aussieht«, sagte Ellie halsstarrig und trieb Clipper zum Trab. »Wang Lee hat mir von einem Kumpel erzählt, der in so was reingeraten ist. Starb so schnell, dass ihm keiner mehr helfen konnte. Lunge voller Staub. Wang Lee sagt, der Tod kann hier draußen in Sekundenschnelle kommen.« Sie schnippte mit den Fingern. »Einfach so.«
»Hör endlich auf mit deinem Chinesen, und reite!« John klatschte mit dem Zügel und trieb sein Pferd zu einem schwerfälligen Trab, und Ellie folgte ihm widerstrebend mit einem letzten Blick zum Horizont in ihrem Rücken.
»Es wird Zeit, dass du aufhörst, auf chinesische Köche und schwarze Viehtreiber zu hören, und zur Abwechslung mal ein bisschen Vertrauen zu mir zeigst«, grollte er. »Ich bin vielleicht ein Kerl aus der Großstadt, aber ich habe uns ohne fremden Rat bis hierher gebracht und werde es auch noch zu deiner Tante Aurelia schaffen.«
Ellie schwieg, denn sie wusste, dass ihr Vater in seinem Stolz gekränkt war. Es hatte jetzt keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren. Der lange Weg von Sydney hierher war eine Strapaze für sie beide gewesen, aber für einen Mann, der nichts über das Outback wusste und die Verantwortung für seine Tochter zu tragen hatte, war es sicher besonders hart gewesen. Sie hatten sich mühsam mit Almosen und Wohlfahrtshilfe über Wasser halten können; Arbeit war schwer zu finden gewesen, und sie wusste, dass ihr Vater kurz vor dem Zusammenbruch gestanden hatte, als die Gowrie-Farm sie endlich für den alljährlichen Viehtrieb nach Longreach angeheuert hatte. Ellie zog sich die Hutkrempe tiefer ins Gesicht, um sich vor dem grellen Sonnenlicht zu schützen, und die nächsten zwei Stunden ritten sie in bedrückendem Schweigen weiter.
Der Himmel verdunkelte sich, aber der Wind hatte nachgelassen, und eine gespenstische Stille umgab sie, eine bedrohliche Ruhe, in der man keinen Vogel singen, ja, nicht einmal Grillen zirpen oder Fliegen summen hörte. Ellie konnte ihre Befürchtungen nicht länger für sich behalten. »Das Unwetter kommt näher, Dad«, sagte sie mit einer Gefasstheit, die den Aufruhr in ihrem Innern nicht erahnen ließ. »Lass uns lieber da drüben Schutz suchen.« Sie zeigte nach Westen, wo ein Vulkanausbruch in grauer Vorzeit Felsen und Canyons geschaffen hatte. Die blauen und roten Berge waren uralte Monolithe, auf denen fast nichts wuchs, und die Erde ringsum war von tiefen Spalten und rasiermesserscharfen Hindernissen aus Stein und Geröll übersät. Ellie fröstelte trotz der erstickenden Hitze, denn sie wusste, es würde viel Mut erfordern, in diese tief verschatteten, unheimlichen Canyons einzudringen.
John schüttelte den Kopf. »Zu gefährlich«, sagte er knapp. »Die Pferde werden sich die Beine brechen. Wir reiten noch ein Stückchen weiter und sehen, ob’s flacher wird. Vielleicht finden wir auf der anderen Seite Schutz.«
Unruhig beobachtete Ellie das nahende Unwetter. »Dazu bleibt keine Zeit!«, rief sie. »Lass uns lieber sofort was suchen.«
»Du tust, was ich dir sage, verdammt!«, erwiderte er schroff. »Du machst ein Drama aus allem, genau wie deine Mutter. Beweg dich!«
Ellie biss sich auf die Unterlippe, um eine zornige Erwiderung zu unterdrücken. Sie hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit Alicia, und es war unfair von Dad, diesen Vergleich anzustellen. Aber wenn sie hier keinen Unterschlupf fanden, würde der Sturm sie in offenem Gelände überfallen. »Ich bin kein verdammtes Kind mehr, Dad!«, schrie sie. »Warum kannst du nicht ausnahmsweise mal auf mich hören?«
John saß kerzengerade im Sattel, als er davonritt, den Blick starr auf den leeren Horizont gerichtet. Er gab keine Antwort. Ließ nicht einmal erkennen, dass er sie gehört hatte.
Die Hitze war drückend, die Stille endlos, als sie die Vulkanberge hinter sich ließen und weiter hinaus in die Ebene ritten. Ellie warf John besorgte Blicke zu. Ihre Angst wuchs. Wie konnte sie ihrem Vater beibringen, dass seine Entscheidung falsch war? Dass er auf sie hören und schon vor zwei Stunden in den Canyons hätte Schutz suchen sollen? Denn hier draußen war nichts – nicht einmal ein Schatten. Aber seine sture Entschlossenheit, die Zügel in der Hand zu behalten, war ihr in den letzten Monaten nur allzu vertraut geworden. Ellie wusste, dass sein Stolz ihm nicht erlauben würde, nun nachzugeben. Er wollte verdammt sein, wenn er sich von einer lächerlichen Kleinigkeit wie einem Staubsturm aufhalten ließe – auch wenn sie beide darin umkommen würden.
Der Vormittag ging dahin. Ellie musste ihren Hut festhalten, als der Wind zunahm. Sie vergrub das Kinn im Kragen, und ihre Augen wurden zu schmalen Schlitzen, denn der Staub wirbelte jetzt um sie herum. Der Wind blies von hinten und trieb sie immer weiter auf den öden Horizont zu. Schließlich zügelte Ellie ihr verängstigtes Pony und bot dem Schrecken, der sie verfolgte, die Stirn. Der Himmel war ockergelb von Gewitterwolken, die sich heranwälzten. Heulend wie ein Dingo, fegte der Wind über die Ebene heran und warf alles nieder, was ihm im Wege stand. Bäume wurden entwurzelt und himmelwärts geworfen wie Streichhölzer. Spinnifex-Gras wirbelte über die Ebene, und der Staub hing wie ein mächtiger Vorhang im Süden und verdeckte alles, was dahinter lag. Sie waren in großer Bedrängnis, und es gab kein Entkommen.
Ellie hatte Mühe, Clipper zu beruhigen. Die Zügel fest umklammernd, stopfte sie ihren Hut tief in die Tasche ihres Overalls und duckte sich dicht an den Hals des Pferdes, weil der Wind sie aus dem Sattel zu heben drohte.
»Runter von der Straße!«, brüllte John durch das Heulen des Windes. »Eingraben!« Er packte ihre Zügel und zerrte das störrische Pony in eine flache Mulde am Rande des holprigen Wegs. Es war nicht mehr als ein Graben, den das ablaufende Wasser während der Regenzeit im Laufe der Jahre geformt hatte, aber ein anderer Schutz fand sich nicht. Sie glitten aus dem Sattel und bemühten sich, ihre scheuenden, sich aufbäumenden Pferde zu beruhigen, während die Staubschleier heranrasten und mit dämonischem Geheul über sie herfielen.
Ellies Schrei verlor sich in dem Tosen. Es hob sie von den Füßen, entriss ihr Clippers Zügel, die ihr Rettungsanker gewesen waren, und schleuderte sie wie eine Lumpenpuppe in den Mahlstrom. Sie fühlte Johns Hand, die sich an ihren Overall krallte; verzweifelt umklammerte er ihre Taille, und der Wind zerrte von hinten an ihnen. Dann war Ellie in seinen Armen, und er presste sie fest an seine Brust, zu stolperndem Lauf getrieben. Mit knochenbrecherischer Wucht, die Ellie den Atem nahm, wurden sie zu Boden geworfen und über das Geröll geschoben. Das wütende Heulen gellte Ellie in den Ohren und betäubte ihre Sinne. Staub blendete sie und drohte sie zu ersticken; er kroch in Nase und Augen und knirschte auf der Zunge. Entsetzt klammerte Ellie sich an den Vater, der irgendeinen Halt in der Erde zu finden suchte.
Ellie hatte jedes Gefühl für Zeit und Richtung verloren, als sie von ihm auf den Boden gedrückt wurde. Mit fest geschlossenen Augen vergrub sie das Gesicht in seiner Jacke und rang nach Atem. Sie spürte das Vibrieren seiner Stimme in seinem Körper, aber der Sturm peitschte seine Worte davon, und die ganze Welt drang auf sie ein, dunkel und erfüllt von beißendem, erstickendem Staub. Felsbrocken wankten, rollten und prallten gegen Ellie, bevor sie verschwanden. Steine flogen, schnell und tödlich wie Gewehrkugeln. Sträucher verhakten sich für einen Augenblick an den beiden Reisenden und wurden dann fortgewirbelt in die Finsternis. Äste und Zweige peitschten vorüber, und Dornen zerrten an Kleidern und Haut wie die Klauen wilder Tiere. Der heulende Dämon des Sturms schien entschlossen, Ellie und John in Besitz zu nehmen. Er riss an ihren Haaren und Kleidern und stieß sie immer weiter über den rauen Boden. Zum ersten Mal in ihrem Leben fing Ellie an zu beten.
Joe und Charlie hatten sich von den Männern auf der Farm Wila Wila verabschiedet und waren jetzt auf dem Weg nach Osten, nach Richmond. Sie hatten gehört, dass ein Rinderzüchter Leute brauchte, um seine Herde an die Küste zu treiben, und die Gelegenheit, zum ersten Mal das Meer zu sehen, war eine verlockende Aussicht für die siebzehnjährigen Zwillinge. Die langen Monate der Wanderschaft, in denen sie auf hartem Boden geschlafen und von der Wohlfahrt gelebt hatten, waren vorüber. Der aufregende Wildpferdeauftrieb auf Wila Wila hatte ihnen Reittiere verschafft, und sie hatten saubere Kleider und Geld in den Taschen. Kein Wunder, dass das Adrenalin in ihren Adern rauschte.
Joe strich mit der Hand über seine Bartstoppeln. Er war dunkelhaarig, und sein Bart wuchs schneller als der von Charlie. Das Jucken war ihm unangenehm. Lächelnd schaute er hinüber zu seinem Zwillingsbruder mit den hellen Stoppeln am Kinn und dem blonden Haar, das lockig über den Kragen fiel. »Schätze, es wird Zeit, dass wir uns mal rasieren und die Haare schneiden«, sagte er. »Sehen ja aus wie zwei Landstreicher.«
Charlie lachte. »Die Zeiten sind vorbei, Alter. Ich denke, die Mädchen werden nur so anbeißen, wenn wir nach Richmond kommen.« Seine blauen Augen funkelten, und das ansteckende Lachen offenbarte kräftige, ebenmäßige Zähne und eine Andeutung von trockenen Falten an Mund- und Augenwinkeln. »Das ist das wahre Leben, was?«
Joe grinste. »Ganz recht, Alter.« Sie hatten einen weiten Weg hinter sich, seit sie die baufällige Hütte zu Hause in Lorraine verlassen hatten. Einen weiten Weg seit jenen trostlosen Jahren der Armut und des Leids, die ihre Eltern unter die Erde und die Farm in die Hände der Bank gebracht hatten.
Satan lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf sich, und Joe kämpfte mit den Zügeln, als der Kastanienbraune es sich in den Kopf setzte, gegen das Gebiss aufzubegehren. Auf Wila Wila hatte Joe den Hengst eingeritten, aber der Braune war noch wild genug, um unter den anderen Pferden Aufregung zu stiften. Deshalb hatte Joe sich dafür entschieden, ihn zu reiten. Die lange Reise nach Richmond würde ihnen Gelegenheit geben, einander kennen zu lernen und einen Kompromiss zu finden. Satan kaute noch immer auf dem Zaumzeug und versuchte Joe die Arme aus den Schultern zu reißen, aber Joe wusste: Dem Pferd war klar, dass es besiegt war, und das war nur eine symbolische Demonstration seines Grolls.
»Du solltest ihn mir mal überlassen«, sagte Charlie, und der abwägende Blick seiner blauen Augen wanderte über das sattbraune Fell und den stolzen Kopf des Tieres. »Ich würde ihm schon zeigen, wer der Boss ist.«
Joes Handgelenke schmerzten allmählich vom Straffen der Zügel, und seine Geduld ging zu Ende. Charlie hatte von Anfang an ein Auge auf Satan geworfen. Offensichtlich hatte er Joe noch nicht verziehen, dass der das Glück gehabt hatte, dafür belohnt zu werden, dass er den Hengst zugeritten hatte.
»Satan gehört mir«, sagte Joe mit Nachdruck. »Er wird sich bald beruhigen.«
Charlie zog sich die Hutkrempe ins Gesicht und raffte die Zügel zusammen. »Lass uns reiten. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns.« Er gab seinem Tier die Sporen, und der schwarze Wallach flog im Galopp über die Ebene, gefolgt von den anderen Pferden.
Satan schüttelte den Kopf, blähte die Nüstern, sträubte sich gegen das Gebiss und wollte die Verfolgung aufnehmen. Joe ließ nicht locker und straffte weiterhin die Zügel, um das Tempo gleichmäßig zu halten. Bis Richmond hatten sie noch mindestens eine Woche zu reiten, und es hatte keinen Sinn, wenn Satan sich jetzt verausgabte. Joe runzelte die Stirn, als ein heißer Wind über die Ebene strich und an seinem Hemd zerrte, bevor er mit unheilvoller Plötzlichkeit erstarb. Joe schaute sich um und sah dicke violette Gewitterwolken am sepiafarbenen Himmel; ein dunkler Vorhang, der von Süden heraufwehte, drohte die Sonne zu verdunkeln. Einsame Bäume standen wie starre Monumente vor dem seltsam gelben Licht, und die Berge brüteten in der Ferne vor dem, was da heranstürmte, dumpf vor sich hin. »Verflucht!«, murmelte Joe. »Da steht uns was Schönes bevor.«
Charlie war schon weit voraus, seine Pferdeherde wirbelte eine große rote Staubwolke auf, aber Joe wusste, dass er bald langsamer werden würde, wenn er erst gemerkt hätte, was da am Horizont heraufzog. Joe ließ seine Pferde traben, und Satan hörte auf, gegen das Gebiss zu kämpfen, als die Zügel lockerer wurden. Die anderen Tiere witterten das nahende Unwetter und griffen weiter aus. Joe sah, dass sein Bruder Halt machte, um sich umzuschauen.
»Da drüben«, schrie Joe und deutete auf eine Gruppe von Felsen. »Eingraben!« Seine Stimme wehte über die Ebene und hallte durch die sonderbare Stille, die den nahenden Sturm ankündigte, während sie hastig in Deckung gingen.
Die Felsen ragten aus der Erde empor, ein steiles, zerklüftetes Gestein von kahlem Rot und Schwarz. Büsche klammerten sich an die Hänge, und hier und da lugten Grasbüschel hervor, aber im Ganzen war das Gelände so öde wie die Ebene. Der Schieferboden war glitschig. Düstere Felsüberhänge warfen lange Schatten.
»Hier durch!« Joe übernahm das Kommando. Er deutete auf einen tief beschatteten Canyon zwischen den Felsen. Es herrschte gespenstische Stille. Ein bedrohlicher Himmel wölbte sich über ihnen, und die Welt versank im Zwielicht.
Die Jungen stiegen ab, und die Pferde suchten sich auf dem schlüpfrigen Schiefer ihren Weg. Das Echo des Hufschlags hallte durch die Stille. Joe führte die Tiere durch die schmale Schlucht und lockte sie den Hang hinauf zu einer Höhle – wie es schien, der einzige Zufluchtsort meilenweit. Sie hatten Glück gehabt, erkannte er, denn der Höhleneingang lag auf der Seite, die dem Unwetter abgewandt war.
Der Eingang zur Höhle war gewaltig. Die Jungen führten die Pferde tiefer in die Dunkelheit. Die Spuren winziger Pfoten verriet ihnen, dass schon andere Tiere hier Unterschlupf gefunden hatten, und der Gestank von Guano und das Rascheln und Quieken über ihnen offenbarte eine Kolonie Fledermäuse. Hastig legten Joe und Charlie den Pferden Fußfesseln an, und sie schlangen die Zügel um eine dicke Felssäule inmitten der Höhle.
Charlie riss ein Streichholz an und spähte in die tanzende Dunkelheit. »Sieht so aus, als waren die schwarzen Jungs als Erste hier«, sagte er leise, als der matte Lichtschein auf alte Malereien an der Höhlenwand fiel. »Wie groß, schätzt du, ist sie wohl?«
Joe zuckte die Achseln und begann Satan abzureiben. Das mächtige Tier zitterte und bekam Schweißausbrüche, als das Rauschen des nahenden Sturms durch die Höhle hallte. »Groß genug, um uns Schutz zu bieten, aber wir sollten die Pferde lieber im Auge behalten. Sie könnten den ganzen Laden zum Einsturz bringen, wenn sie zu heftig an dem Pfeiler zerren.«
Charlie drehte eine Zigarette. »Die kommen schon klar«, sagte er in seiner nüchternen Art. »Wildpferde sind an Stürme gewöhnt.«
»Draußen im Freien vielleicht«, antwortete Joe. »Schätze, es wird ihnen aber nicht gefallen, hier eingesperrt zu sein.« Er zog den Tieren die Satteldecken über die Augen, tätschelte sie beruhigend, überprüfte die Fußfesseln und ging dann zu Charlie, der im Höhleneingang stand.
Sie setzten sich hin, rauchten gemeinsam die Zigarette und beobachteten, wie Blitze zur Erde zuckten. »Irgendein armes Schwein kriegt’s da drüben richtig ab«, sagte Joe und beobachtete den Staubvorhang, der im Süden über die Ebene wirbelte. »Verdammt, da fliegen ganze Bäume durch die Gegend. Würde ich nicht gern reingeraten.«
Charlie rauchte den Rest der Zigarette. »Tja, wir können von Glück sagen, dass wir dieses Plätzchen gefunden haben.« Grinsend schnippte er den Stummel hinaus und sah zu, wie er fortgeweht wurde. »Aber da reinzugeraten, dagegen hätte ich nichts. Kannst du dir vorstellen, wie das rauscht? Muss beinahe wie fliegen sein.«
Joe zog eine dunkle Braue hoch. »Ja, genau«, sagte er gedehnt, und seine Stimme troff von Sarkasmus. »Du hast manchmal verdammt blöde Einfälle, Charlie. Musst ja verrückt sein, wenn du glaubst, so was könnte Spaß machen.« Er betrachtete das Profil seines Bruders, die glänzenden Augen, dessen Verzückung. Es war nicht zu leugnen: Charlie hatte sein Glück immer auf die Probe gestellt. Er kannte anscheinend überhaupt keine Angst, hatte keinen echten Sinn für Gefahr. Genau genommen, dachte Joe grinsend, ist Vernunft ein Fremdwort für ihn.
Der Wind heulte wie ein Dämon durch die Tunnel der Höhle und ließ die gehobbelten Pferde nervös tänzeln. Satan verdrehte die Augen, dass man das Weiße sah, und legte die Ohren flach an den Kopf; er schnaubte mit geblähten Nüstern und scharrte mit den Hufen. Joe ging hinüber, um ihn und die anderen zu beruhigen; er strich ihnen mit den Händen sanft über den bebenden Widerrist. Auch wenn es Wildpferde waren, die Tiere hatten Angst, und er wusste, bei der kleinsten Gelegenheit wären sie auf und davon.
Der Wind nahm zu; kreischend fuhr er durch die Canyons und trieb Steine, Bäume und Gras vor sich her, während Staubfahnen wie tanzende Derwische über die Erde wirbelten und sich in einer beißenden, blendend roten Wolke herabsenkten, um das spärliche Licht vollends zu verdunkeln und jeden Spalt zu füllen. Joe ließ sich von Charlies Aufregung anstecken. Zusammen standen sie im Höhleneingang, die Arme zum brodelnden Himmel gestreckt – fast, als wollten sie den Sturm herausfordern, zu kommen und sie zu holen.
»Siehst du?«, brüllte Charlie, als sein Hut nach hinten flog und sein blondes Haar das Gesicht peitschte. »Hab dir gesagt, es ist ein Kracher!«
Joe wollte eben zustimmen, als der Sturm unvermittelt die Richtung wechselte und ihn beinahe umgeworfen und auf den Grund des Canyons geschleudert hätte. Er packte Charlie am Hemd und zog ihn in die Höhle. »Verdammt, das war knapp. Halt dich lieber zurück, bevor es dich wegbläst.«
Charlies blaue Augen leuchteten vor Aufregung. »Und wenn schon«, schrie er, riss sich los und lief zurück zum Höhleneingang. »Ich hab noch nie den Wind geritten!«
Joe packte Charlie beim Arm und riss ihn vom Rand zurück. »Sei kein verdammter Narr!«, rief er. Er zerrte ihn in den Windschatten eines Felsens und kauerte sich neben ihn.
Charlie stieß ihn mit dem Ellenbogen von sich. »Du verstehst keinen Spaß mehr«, maulte er. »Ist doch nur ein Sturm.«
Joe machte sich nicht die Mühe zu antworten. Charlie würde auf vernünftige Argumente nicht hören – nicht, wenn er so war wie jetzt.
Der Sturm rüttelte an den Außenwänden ihres Verstecks, raste mit wütendem Geheul gegen sie an und erschütterte die Erde. Innerhalb weniger Augenblicke war es unmöglich, zu sprechen oder etwas zu sehen, denn wieder änderte der Sturm die Richtung und wirbelte Staub und Dunkelheit in ihren Unterschlupf, als sei er entschlossen, die Brüder aufzustöbern. Die beiden saßen da, das Kinn auf die Knie gestützt, die Arme fest um den Kopf geschlungen, die Nase vergraben, die Augen fest geschlossen, als sich die falsche Nacht herabsenkte. Das Schreien des Windes und der Pferde verwehte wie ein Echo, und der Staubsturm rannte gegen den Höhleneingang an, prallte von den Wänden ab und strömte mit einem dumpfen Stöhnen durch die Tunnelgänge im Innern des Berges, die er wie von Stoßwellen erzittern ließ.
Die Jungen kauerten sich Wärme suchend aneinander. Beide empfanden die gleiche Mischung aus Furcht und Erregung. Die schreckliche Faszination des Sturms ließ Joe erschaudern. Er war nicht gerade stolz auf seine Angst, aber er wusste, sie entsprang dem Bewusstsein, dass das Leben kostbar war und er dies gern überstehen wollte, um die Zukunft zu erleben, die sie geplant hatten. Zugleich wusste er, dass Charlie das Schicksal herausfordern und der Gefahr trotzig entgegentreten würde, wenn er Gelegenheit dazu bekäme. Sie mochten Zwillinge sein, aber sie waren sehr verschieden, und manchmal fürchtete Joe die beinahe gleichgültige Einstellung seines Bruders zum Leben weit mehr als jeden Sturm. Charlie würde immer am Rande des Abgrunds leben – dem Augenblick hingegeben, ohne sich um die Konsequenzen zu kümmern.
Vielleicht hat Charlie ja Recht, dachte Joe. Vielleicht verstehe ich wirklich keinen Spaß mehr. Aber wir sind keine Kinder mehr. Wir sind siebzehn, werden bald achtzehn. Mit dem Alter kommt doch sicher auch die Reife – der Augenblick, da wir für unsere Handlungen die Verantwortung tragen müssen? Joe vergrub das Gesicht in den Armen, und seine Gedanken wanderten zu dem Anwesen, das ihm eines Tages gehören würde, zu den Rindern und Pferden, die er über grüne Weiden treiben würde; zu der Farm, auf die er jeden Abend zurückkehren würde. Es brauchte nichts Großartiges zu sein, diese Farm, von der er träumte – nur ein Ort, den er Zuhause nennen könnte.
Charlie fröstelte im kalten Wind, der zur Höhle hereinfuhr. Das war das Leben. Das war Lebendigkeit. Das war die Aufregung, nach der er sich in den öden, endlosen Tagen seiner Jugend gesehnt hatte, als es nichts als Armut und harte Arbeit gegeben hatte. Er grinste und bereute es augenblicklich, als Staub ihm in den Mund drang und zwischen den Zähnen knirschte. Er spuckte aus, vergrub den Kopf tiefer in den Armen und malte sich die Zukunft aus. Eine Zukunft, in der er mit wilden Pferden über die Ebenen zog. In der er gewaltige Reisen unternahm, zu neuen Abenteuern, neuen Menschen, neuen Orten. Dieses Land war für Männer wie ihn geschaffen. Männer, die keinen Ort ihr Zuhause nannten, die neue Wege bahnten, auf denen andere ihnen folgen konnten. Männer aus dem Holz, aus dem man Legenden schnitzte.
Die Ungeduld saß Charlie im Nacken, als der Wind an seinen Kleidern zerrte, und er sehnte sich danach, die wilde Freiheit dieses Windes zu spüren und sich seinem wahnwitzigen Rasen anzuschließen. Aber er wusste, dass dies noch nicht der richtige Augenblick war. Er hatte noch eine Menge im Leben zu erledigen, und einstweilen würde er sich damit begnügen müssen, den gemesseneren Schritten seines Bruders zu folgen.
Die Brüder hatten keine Ahnung, wie lange sie so im Dunkeln an der kalten Felswand kauerten, aber irgendwann ließ das Heulen des Windes nach, und der Sandsturm verebbte. Sie hoben die Köpfe und lauschten. Der Sturm wanderte nordwärts; immer noch heftig, immer noch heulend und klagend, zog er einen Pfad der Zerstörung über das Flachland, aber für sie war die Gefahr vorüber. Sie krochen aus ihrem Versteck, spuckten Staub aus und rieben ihn aus den Augen. Sie waren glücklich davongekommen.
Die Pferde bäumten sich auf, als sie ihnen die Decken von den Köpfen nahmen und sie untersuchten. Eine braune Stute hatte einen Schnitt am Bein; offenbar hatte sie gegen die Felssäule ausgeschlagen. Aber er war nicht allzu tief, und Joe wusste, dass er bald verheilt sein würde. Satan rollte mit den Augen, und das Weiße schimmerte im Dunkeln. Er zog die Oberlippe hoch und schnappte nach Joes Hand, als der das Zaumzeug zurechtzog.
Charlie lachte. Noch immer strömte Adrenalin in seinen Adern. »Du wirst diesen Bastard niemals zähmen«, sagte er. »Solltest ihn mir überlassen. Ich würd’s ihm bald zeigen.«
Joe streichelte die lange, kastanienbraune Nase und fuhr mit der Fingerspitze um die weiße Blesse auf der stolzen Stirn. »Manieren kann man einem Pferd nicht einprügeln«, sagte er gedehnt. »Er schnappt, weil er Angst hat. Er wird’s noch lernen, wenn er so weit ist. Ich will ihm das Feuer nicht vollständig austreiben.«
Charlie schnaubte und trank in tiefen Zügen aus seinem Wasserschlauch. »Ich wette einen Dollar, dass ich ihn in einem Tag auf Vordermann bringe. Wie wär’s?« Seine blauen Augen glitzerten, und sein breites Grinsen wirkte gezwungen.
Joe sah, dass es Charlie danach drängte zu beweisen, dass er der bessere Mann war, stärker und abenteuerlustiger als sein Bruder, und dass er das Erstgeburtsrecht besaß, nur weil er eine Stunde älter und einen Zoll größer war. Es war eine vertraute Szene, die immer wieder aufgeführt wurde, so lange Joe zurückdenken konnte. Nur, dass der Einsatz diesmal zu hoch war und er nicht nachgeben würde. Er schüttelte den Kopf. »Satan gehört mir, und das bleibt auch so. Um ihn wird nicht gewettet.«
Charlie band die Zügel von dem Steinpfeiler los und führte seine Pferde zum Höhleneingang. Werden wir ja sehen!, sagte er bei sich.
Ellie öffnete die Augen. Sie war fast begraben unter dem Mantel ihres Vaters, und sein Gewicht lastete auf ihr und machte das Atmen schwer. »Dad?« Sie stemmte sich gegen ihn und versuchte, unter ihm hervorzukriechen, aber es gelang ihr nicht. Sie rang nach Luft, und Panik stieg in ihr auf, weil ihr Vater nicht reagierte. »Dad!«, sagte sie entschlossener und stieß ihn hart in den Bauch. »Geh runter! Du zerquetschst mich noch.«
John lag reglos und schwer auf ihr; seine Mantelschöße flatterten in dem nachlassenden Wind, der über die Ebene fegte. Ellie wand sich und versuchte ihn wegzuschieben. Als ihr klar wurde, dass sie ihn nicht atmen hörte, begann ihr Herz heftig zu schlagen. »Dad?«, schrie sie. »Dad, wach auf!« Das Entsetzen verlieh ihr die Kraft, sich noch härter gegen ihn zu stemmen.
John rollte zur Seite und lag ruhig im Staub. Sein aschgraues Gesicht war von getrocknetem, staubverkrustetem Blut verschmiert. Sein Mund war zu einem lautlosen Schrei geöffnet, und seine Augen starrten leer und von Staub verklebt in den Himmel.
»Dad?«, flüsterte sie und drückte die zitternden Finger an den Mund. Sie sah nicht, dass ihre Tränen dunkle Flecken in der Staubschicht auf ihren Händen hinterließen, als sie niederkniete und sein kaltes Gesicht berührte. Sein Kopf rollte zur Seite, und sie fuhr zusammen, als sie das klaffende Loch an seiner Schläfe sah. »Nein!«, schrie sie. »Du kannst mich hier nicht allein lassen. Das erlaube ich nicht. Wach auf! Wach auf!« Sie schüttelte ihn, stieß ihn, schlug ihm ins Gesicht und weinte, weil sie wusste, dass es nicht helfen würde.
John lag da, reglos und still wie die Umgebung. Eine Hand lag an seiner Seite, zum Himmel hin geöffnet, die Finger gekrümmt, als winke er Ellie zu sich. Sie warf sich über seine Brust, und die Tränen zogen winzige Pfade durch den Staub auf seinen Kleidern. »Du darfst nicht sterben«, schluchzte sie. »Ich lass dich nicht.« Sie legte die Wange auf seine Brust und schlug in einem letzten Versuch, ihn ins Leben zurückzuholen, mit beiden Fäusten auf ihn ein.
Aber er zeigte keine Regung; die hagere Brust hob und senkte sich nicht, und kein Atemzug kam aus seinem offenen Mund. Aller Kräfte beraubt, sackte sie auf ihm zusammen und überließ sich der Verzweiflung. Er war alles, was sie hatte. Und jetzt war er fort.
Die Sonne stand fast im Zenit, als Ellie schließlich den Kopf hob und der Wirklichkeit ins Auge blickte. Sie schaute ihren Vater an, dem der Tod den Ausdruck und die Gesichtsfarbe geraubt hatte. Er war ihr fern wie ein Fremder. Sie küsste sanft seine Wange. »Ich liebe dich«, flüsterte sie. »Ich weiß, du wolltest mich nicht verlassen.« Sie rieb sich die Tränen aus den Augen. »Aber ich habe Angst, Dad. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Sie kniete neben ihm und schaute hinaus in die endlose Leere. Der Sturm hatte den Weg, dem sie gefolgt waren, spurlos beseitigt, und die wenigen Bäume, die das Unheil überlebt hatten, waren kahl. Die Pferde waren verschwunden. Kein Laut war zu hören, und nirgends sah man die willkommene Staubwolke, die einen anderen Reisenden ankündigte. Sogar die Vögel schienen sie verlassen zu haben.
Ellie fror trotz des warmen Windes. Noch nie hatte sie sich so allein gefühlt, so klein und unbedeutend. Sie kroch dichter an die Seite ihres Vaters. Ihr Blick wanderte über den scheinbar endlosen Horizont und suchte nach irgendeiner vertrauten Wegmarke, während die Sonne auf ihren entblößten Kopf brannte, und schließlich entdeckte sie in weiter Ferne violette Schemen, die vermutlich die Berge von Cloncurry waren.
Schließlich raffte sie sich auf und schaute ihren Vater an, und sie schauderte. Schon schwärmten Fliegen um seinen Kopf, wimmelten um die Wunde und krochen um seine Augen und seinen Mund. Sie erkannte, dass sie den Mut finden musste, ihn zu begraben. Denn der Tod lockte die Aasfresser an; das hatte sie auf den Landstraßen gesehen, auch wenn ihr Vater sich bemüht hatte, sie vor dem Grauen zu bewahren. Sie dachte an diese Lumpenbündel, die einmal Männer gewesen waren, deren Suche nach etwas Besserem zu einem unheilvollen Ende geführt hatte. Sauber abgenagt von Krähen und Dingos, vergessen und unbetrauert lagen sie da. Das hatte Dad nicht verdient.
Ellie schloss die Augen. »Leb wohl, Dad«, wisperte sie. Sie erhob sich, zog den Hut hervor, den sie in die Tasche ihres Overalls gestopft hatte, und holte tief Luft. Selbstmitleid würde nicht helfen. Sie musste sich ihren Verstand bewahren, wenn sie überleben wollte.
Schatten glitten über die Erde, und sie schaute hoch. Oben kreiste ein Schwarm Krähen dunkel vor dem Mittagshimmel. »Verschwindet!«, schrie sie und wedelte mit dem Hut. »Weg, ihr Mistviecher! Ihr kriegt ihn nicht.«
Sie sah sich um. Panische Hilflosigkeit machte sich in ihr breit. Die Pferde waren weg und mit ihnen das Gepäck mit der Ausrüstung. Sie hatte nichts, womit sie graben, und nichts, womit sie die Vögel verscheuchen konnte. In jähem Zorn stieß sie sämtliche Schimpfwörter hervor, die sie je gehört hatte, und dann packte sie einen scharfkantigen Stein und fing an, die Erde rund um ihren toten Vater aufzuscharren. Es war harte Arbeit, und sie verfluchte alles um sich herum. Die Sonne brannte vom Himmel, die Krähen versammelten sich, und das Loch wurde und wurde nicht größer.
Die Hitze war unerbittlich; der Schweiß verdunstete auf Ellies Haut, und ihr Durst wurde immer schlimmer, während sie an der letzten Ruhestätte ihres Vaters arbeitete. Sie erinnerte sich an den Rat des schwarzen Viehtreibers und hob einen kleinen, glatten Kieselstein auf, den sie sich unter die Zunge legte. Sie wusste nicht, ob das schreckliche Verlangen nach einem Schluck Wasser dadurch nachlassen würde, aber sie hatte keine andere Wahl, bis sie einen Bach oder einen Billabong finden würde. Dad musste begraben sein, bevor es Nacht wurde. Die Sonne stand jetzt weiter im Westen und bereitete sich auf ihre letzte Strahlenpracht vor, ehe sie hinter dem Horizont verschwand. Bis zur Dunkelheit blieben Ellie nur noch zwei Stunden.
Schließlich machte sie eine Atempause. Die Grube war jetzt tief genug, aber Ellies Fingernägel waren abgebrochen, und hinter den Augen plagte sie ein pochender Schmerz. Sie kniete ein letztes Mal neben ihrem Vater nieder und faltete seine Hände auf der Brust. Mit traurigem Seufzen durchsuchte sie seine Taschen. Viel war nicht da; seine Uhr und seine Brieftasche aus Schlangenleder hatte er vor ein paar Monaten verkauft, damit sie etwas zu essen kaufen konnten. Aber der Rest ihres Lohns und zwei Fotos waren ihr geblieben.
Ellie hockte sich auf die Fersen und betrachtete die zerknitterten und ziemlich verblichenen Aufnahmen von ihrer Mutter Alicia. Es überraschte sie, dass er sich die Mühe gemacht hatte, sie zu behalten, nachdem sie mit ihrem texanischen Ölmann durchgebrannt war und Mann und Tochter sich selbst überlassen hatte. Jetzt erkannte sie, dass Dad nie aufgehört hatte, Alicia zu lieben, und immer geglaubt hatte, sie liebte ihn und Ellie noch genug, um zu ihnen zurückzukehren.
»O Dad«, seufzte sie. »Sie wäre nie zurückgekommen.« Sie steckte Fotos und Geld in die Tasche und unterdrückte die Tränen. Dad hatte es nie geschafft, in Mum das selbstsüchtige Biest zu sehen, das sie war. Aber ihr, Ellie, kam es nicht zu, über ihn zu urteilen, denn trotz der Reife, die sie auf den Straßen der Domain gewonnen hatte, war die Welt der Erwachsenen immer noch viel zu kompliziert für sie, um vollständig zu begreifen, was sich zwischen Männern und Frauen abspielte.
Ellie begann die Erde zurück in die Grube zu schieben. Zuerst bedeckte sie seine Füße und dann – das war der schwerste Teil – sein Gesicht. Als ihr Vater vollständig unter der zimtbraunen Erde verschwunden war, erkannte sie, dass der flache Hügel leicht von Dingos aufgewühlt werden konnte. Nach dem Sturm war der Boden von Geröll und Schieferbrocken übersät, und bald hatte sie genug Steine zusammengetragen, um das behelfsmäßige Grab mit einer dicken Schicht zu bedecken. Einen Grabstein kann es nicht geben, nicht einmal ein rohes Holzkreuz, um die Stelle zu markieren, dachte sie betrübt. Es gab nichts, was sich dazu geeignet hätte.
»Und jetzt?«, murmelte sie und kniete nieder. Sie war noch nie bei einer Beerdigung gewesen, aber sie wollte ihr Bestes tun für diesen wunderbaren Mann, der so gut für sie gesorgt und sie in ihrem kurzen Leben wohlbehalten durch schlimme Zeiten geführt hatte. Zögernd begann sie das Vaterunser aufzusagen. Es war das einzige Gebet, das sie kannte, aber die Worte schienen zu dem Anlass zu passen, und Gott würde sicher nichts dagegen haben, wenn sie nicht alles genau richtig machte.
Schließlich stand sie auf. »Amen«, sagte sie leise. Das Grab sah so klein aus, so einsam in der leeren Weite des Outback, dass sie sich fragte, ob sie es je wiederfinden würde. Sie schaute zu den Bergen von Cloncurry hinüber, die im Sonnenuntergang orangegelb leuchteten, und tat einen Schritt auf sie zu.
Ein leises Grollen ließ sie erstarren. Mit geweiteten Augen schaute sie sich um.
Die Dingo-Hündin war mager, ihr Fell ockerfarben wie die Erde, und die Schwanzspitze mit dem weißen Tupfen zuckte erwartungsvoll. Sie war nicht allein. Wachsam und reglos stand sie da, ihre Welpen dicht neben sich.
Ellie schaute in die kalten Augen, die sie unverwandt anstarrten, und sie wusste, was die Hündin wollte. Das Tier zog die Lefzen zurück, und Ellie sah die Zähne und den Sabber, der an der Schnauze glitzerte. Sie hob ein paar kleine Steine auf und fing an, damit zu werfen, und dabei schrie sie, so laut sie konnte, um das Tier zu verscheuchen.
Die Hündin zog sich ein kleines Stück zurück und setzte sich. Bald würde es dunkel sein. Sie konnte warten.
Die Pferde waren offensichtlich immer noch nervös nach dem Sturm, und Satan ließ sich nur mit Mühe bändigen, als die Zwillingsbrüder aus den Canyons heraus und auf die Ebene ritten. »Müssen uns beeilen, Joe«, sagte Charlie und kam an seine Seite. »Der verdammte Sturm hat uns fast einen halben Tag gekostet, und der Job wird nicht auf uns warten.«
Satan ist nicht der Einzige, bei dem der Sturm Folgen hinterlassen hat, dachte Joe. Charlie war offensichtlich immer noch berauscht. »Die Pferde sollen sich erst beruhigen. Wenn ich Satan die Zügel schießen lasse, wird er davonsausen wie ein Bumerang, und die anderen werden nicht mitkommen.« Er behielt einen gleichmäßigen Trab bei, die Zügel straff gespannt, die Knie fest an Satans Flanken gepresst.
Charlie zog sich den Hut über die blauen Augen und spähte über die meilenweite Ebene vor ihnen. »Mach nur so weiter«, sagte er, »und wir sind den verdammten Job los.«
»Hör auf mit dem Gemecker«, erwiderte Joe. »Reiten wir zu schnell, sind sie bald erschöpft. Und dann kommen wir nirgends hin. Wir sind schnell genug.«
Charlie schwieg, aber Joe merkte, dass die Ungeduld seines Bruders wuchs. Er sah es daran, wie der die Schultern straffte, wie seine Fingerknöchel weiß wurden, als er die Hände um die Zügel zu Fäusten ballte, und wie es unter den stoppelbärtigen Kieferknochen sanft pulsierte. Pech!, dachte Joe. Kein Job ist es wert, dass man sich dafür den verdammten Hals bricht; und wenn sich Satans nervöse Energie entladen würde, müsste er damit rechnen.
Die Sonne stand hoch am Himmel, als Joe seinen Hengst endlich in den Galopp fallen ließ. Das Pferd schwitzte, aber wenn er es eine kurze Strecke in diesem Tempo laufen ließ, zerrte es nicht länger nervös am Zaumzeug, und die anderen Pferde schienen nicht viel dagegen zu haben und hielten Schritt.
»Hast du das gehört?«, fragte Charlie, als sie die Tiere nach einer Weile wieder zügelten.
Joe nickte, und sein Blick wanderte über die Landschaft. »Ja«, sagte er leise. »Wahrscheinlich nur ein Dingo.«
Charlie schüttelte den Kopf. »Hab noch nie gehört, dass ein Dingo solchen Radau macht. Hört sich eher nach einer Frau an.«
Joe lachte. »Du hast nur Weiber im Kopf, Junge! Hast so lange keine Frau mehr gesehen, dass du anfängst zu fantasieren.« Aber als der Ton erneut zu hören war und in der Stille verhallte, runzelte er doch die Stirn. »Schätze, wir sollten uns trotzdem drum kümmern. Wenn’s eine Frau ist, ist sie in Schwierigkeiten.«
Charlie fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und rückte seinen Hut zurecht. »Wenn ich doch bloß Zeit hätte, mich zu rasieren und zu waschen«, sagte er mit einer betrübten Grimasse. »Ich muss ja stinken wie ein Dingo.«
»Schätze, das wird sie nicht weiter stören«, meinte Joe. »Ist ja nicht so, als ob du mit ihr tanzen gingst.«
Sie grinsten einander zu und ritten dann südwärts in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Der Job in Richmond würde auch morgen noch da sein.
Ellies Entsetzen war einem kalten Überlebenswillen gewichen. Steine und Geschrei hatten wenig Wirkung auf den Dingo, und Ellies Kräfte waren erschöpft. Der heftige Durst erschwerte das Denken. Keuchend stand sie da und beobachtete ihre stumme, abwartende Feindin.
Die Dingo-Hündin lag auf dem Bauch. Ihre Schnauze ruhte auf den Vorderpfoten; ihre Ohren waren aufgestellt, und die gelben Augen beobachteten wachsam, wie die Welpen um sie herumtollten.
Ellie war sich nur allzu bewusst, dass die Sonne westwärts wanderte und dass die Schatten, die sie auf den Boden warf, immer länger wurden. Sie würde etwas tun müssen, bevor es zu spät war. Denn der Dingo jagte nachts. Seine Augen konnten im Dunkeln sehen, und seine Nase witterte jede Beute. Sie würde sich nicht verstecken können.
Die Dingo-Hündin schnappte nach den spielenden Welpen und legte sich auf die Seite, um sie zu säugen. Sie fürchtete sich nicht vor der Dunkelheit. Sie hatte noch Zeit genug, um ihre Jungen trinken zu lassen, bevor die Jagd begann – und sie würde leichte Beute haben.
Ellie trat einen Schritt zurück. Dann noch einen und noch einen. Ihr Puls raste, und sie murmelte vor sich hin, während sie die Angst niederkämpfte und sich zwang, nicht loszurennen. »Wenn ich renne, wird sie mich verfolgen, wenn ich renne, wird sie mich verfolgen«, murmelte sie mit klappernden Zähnen. Es war ein Mantra. Es hielt sie aufrecht. Auf einen Schritt rückwärts folgte noch einer und noch einer, und dann zwei weitere.
Die Hündin richtete sich auf, und die Welpen krochen hastig unter sie. Sie beobachtete Ellie. Ihre gelben Augen ließen die zurückweichende Gestalt nicht los.
Ellie entfernte sich langsam immer weiter und konzentrierte sich dabei fest auf diese Augen. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, sie abzulenken, dachte sie verzweifelt. Wenn doch nur etwas anderes auftauchen würde, was sie jagen könnte. Wo zum Teufel sind all die verdammten Kaninchen, wenn man sie mal braucht? Staub wirbelte unter Ellies Stiefeln auf, als sie zurückwich. Die Sonne brannte in ihrem Rücken, und noch immer beobachtete der Dingo Ellie wachsam.
Sie schob den Fuß zurück, glitt mit dem Spann über einen großen Stein und verlor das Gleichgewicht. Sie ruderte mit den Armen, verrenkte sich schmerzhaft den Knöchel und fiel in den Staub. Ihr Atem entwich laut, als sie hart auf einem Gegenstand in ihrer Tasche landete. Ohne auf den Schmerz zu achten, rappelte sie sich wieder auf und richtete ihre ganze Aufmerksamkeit sofort wieder auf den Dingo.
Die Hündin fixierte sie, schüttelte die Welpen ab und erhob sich. Ihr Schwanz war gesenkt, die Schultern angespannt. Sie war bereit zum Sprung.
Ellie wühlte in ihrer Tasche und fischte Wang Lees Abschiedsgeschenk hervor. Dies war ihre einzige Chance – eine, an die sie nicht gedacht hatte, bis sie gestürzt war. Sie warf Schachtel und Seidenpapier beiseite und atmete auf, als sie sah, dass nichts zerbrochen war. Sie hielt den kleinen, verzierten Spiegel in die Sonne und richtete den gleißenden Lichtstrahl geradewegs auf die Augen der Dingo-Hündin.
Das Tier schüttelte den Kopf und wich dem blendenden Licht seitwärts aus.
Ellie drehte den Spiegel und betete, dass die Sonne länger anhalten möge als die Entschlossenheit des Dingo. Sie bewegte das strahlende Glas so, dass das helle Sonnenlicht gebündelt in die gelben Augen stach.
Der Dingo wich zurück, die Ohren gesenkt, den Schwanz eingeklemmt. Geduckt wandte er sich ab und schlich davon.
Ellie zitterte so sehr, dass sie kaum noch stehen konnte. Aber sie hielt sich aufrecht und wartete, während die Hündin mit ihren Welpen über die Ebene davonschnürte, und erst als die Tiere nur noch Pünktchen in der weiten Landschaft waren, wagte sie zu glauben, dass sie in Sicherheit war.
Joe hatte in der Ferne etwas kurz aufblitzen sehen, aber es war schwer zu sagen, wo es gewesen war, und jetzt, da das Schreien aufgehört hatte, gab es keinen Anhaltspunkt mehr. Er zügelte Satan. Der Hengst atmete schwer, und nach dem hektischen Ritt über die Ebene glänzte der Schweiß auf Hals und Flanken. Joe nahm den Hut ab und wischte sich mit dem Ärmel übers Gesicht. »Kannst du was sehen?«, keuchte er.
Charlie kniff die Augen zusammen und suchte den Horizont ab. »Nicht die Bohne«, knurrte er. »Und dabei war ich schon fest entschlossen, eine Jungfer in Not zu retten.«
Joe beobachtete nachdenklich die Umgebung; er lockerte seinen Hemdkragen und versuchte, dem Wind, der mit dem Sonnenuntergang eingesetzt hatte, ein wenig Kühlung zu entlocken. Irgendjemand war da draußen, aber sie könnten hier einen ganzen Tag lang reiten und die Leute trotzdem um eine Meile verfehlen. Die Ebenen des Outback waren einfach zu riesig, und in der bevorstehenden Nacht konnte ein einzelner Reisender mir nichts dir nichts verschwinden.
Sie stiegen von den erschöpften Pferden und führten sie in ruhigem Schritt. »War wahrscheinlich nur ein Tramp, der Dampf abgelassen hat«, brummte Charlie. »Das Blinken, das wir gesehen haben, kam bestimmt von seiner Grogflasche, und jetzt schläft er seinen Rausch aus.«
»Ist nicht lange her, dass wir auf den Wallaby-Pfaden gewandert sind, Alter. Wir hatten vielleicht nicht die nötigen Pennys für Grog, aber erinnerst du dich, wie einsam es war? Wie ungeheuer diese leere Weite? Schätze, wir sollten ihn suchen gehen. Nur um sicher zu sein, dass ihm nichts passiert ist.«
Grüne Augen blickten in blaue, und sie dachten an die Nächte, in denen sie sich unter eine Plane gekauert hatten, die den Regen jedoch nie hatte abhalten können. An die meilenweiten Wanderungen durch drückende Hitze zur nächsten Polizeistation, wo sie ihre kargen Wohlfahrtsrationen abgeholt hatten. So etwas wie Brüderlichkeit hatte es unter den Tramps, die sie getroffen hatten, nicht gegeben. Durch ihre Entschlossenheit, Arbeit zu finden, und durch ihre Jugend hatten sie sich von den anderen abgehoben. Sie hatten Nächte in einer Zelle auf der Polizeistation verbracht, nachdem man sie ohne Fahrkarte im Zug erwischt hatte. Nach einer Tracht Prügel war Charlie einmal fast vierundzwanzig Stunden lang bewusstlos gewesen, und es hatte endlos lange Tage gegeben, an denen sie nichts zu essen, keine Unterkunft und keine Arbeit gehabt hatten.
»Wir hatten aber auch gute Zeiten, oder?« Joe starrte in die Ferne, wo eine Staubwolke in den Himmel stieg. »Der Viehtrieb rauf nach Curry oder der Wildpferdefang. Haben ein paar gute Kumpel gefunden.« Sein Blick verharrte am Horizont. »Da drüben.« Er streckte den Zeigefinger aus. »Da wirbelt jemand Staub auf.«
Ellies Stiefel schlurften durch den Staub, als sie in die Richtung stapfte, in der hoffentlich Cloncurry lag. Sie hatte keine Ahnung, wie weit es bis dorthin war, aber das machte ihr keine Angst, denn sie war im Laufe des Jahres schon viele Meilen zu Fuß gegangen und war daran gewöhnt. Aber die Einsamkeit schien sie immer enger zu umfangen, je näher die Dunkelheit kam, und zum ersten Mal im Leben fühlte sie sich wirklich allein. Immer war Dad da gewesen; sie hatte mit ihm reden und mit ihm gehen können, und sie hatte die Leiden und Strapazen des Wanderlebens mit ihm geteilt. Jetzt war niemand mehr da.
Der Durst war ihr größter Feind. Sie hatte fast den ganzen Tag nichts getrunken. Ihre Zunge fühlte sich geschwollen an, und sie konnte nicht mehr genug Speichel aufbringen, um den Staub auszuspucken, der immer noch in ihrem Mund knirschte. Sie strich mit der Zunge über die trockenen Lippen und suchte nach irgendeinem Anzeichen für einen unterirdischen Wasserlauf, nach einem Bohrloch oder einer Wasserstelle. Ihr Mut sank. Hier gab es nichts als ein paar verkrüppelte Bäume, und gelegentlich kam die staubige Straße zum Vorschein, beschienen vom ersterbenden Glanz der roten Sonne.
Noch immer flirrte die Hitze am fernen Horizont. Papierdürres Gras raschelte, und Eukalyptusbäume welkten. Ihre Schritte waren ein einsames Geräusch in dieser endlosen Wildnis, begleitet vom aufreizenden Gebrumm der Fliegen und dem gelegentlichen Krächzen eines Raben. Dann aber wurde die Stille von einem Laut durchbrochen, und Ellie blieb wie angewurzelt stehen. Sie beschirmte ihre Augen vor dem grellen Licht und sah plötzlich, wie sich die Silhouetten zweier Reiter schwarz gegen den Sonnenuntergang abhoben.
Die Begeisterung darüber, dass jemand sie gefunden hatte, wurde durch Vorsicht gedämpft. Sie hatte zu viele Monate in der Domain verbracht, um irgendjemandem unbesehen zu vertrauen, erst recht, wenn es ein Fremder war. Sie bückte sich nach einem schweren Stein. Sie konnte nicht weglaufen oder sich irgendwo verstecken, und wenn die beiden wirklich Böses im Schilde führten, würde sie mit fliegenden Fahnen untergehen.
Sie beobachtete, wie die beiden abstiegen, und erkannte, dass sie nicht viel älter waren als sie selbst. Der eine war dunkelhaarig, der andere blond. Gut aussehende Jungen, drahtig, offensichtlich an das Leben im Outback gewöhnt. Trotzdem war es besser, sie nicht gleich wissen zu lassen, dass sie ein Mädchen war. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie dieses Theater spielen musste, und nach dem Treck hinauf nach Longreach hatte sie jede Menge Übung darin. Sie drückte den Hut fest auf ihr struppiges Haar, reckte die Schultern und schaute den beiden entgegen. »Ich heiße Ed. Und wer seid ihr?«
Zwei Augenpaare weiteten sich erstaunt. Das blaue erinnerte sie an das Meer, und das andere war grün wie Wintergras. »Da soll mich doch…«, flüsterte der Hellhaarige. »Was macht denn ein kleines Kerlchen wie du so allein hier draußen?«
»Ich kümmer mich um meinen eigenen Kram«, schoss sie zurück und reckte sich zu ihrer vollen Größe von anderthalb Metern auf. »Und klein bin ich auch nicht. Ich bin fast vierzehn.« Sie sah den ungläubigen Blick, der zwischen den beiden hin und her ging, und wünschte sich zum hundertsten Mal, sie wäre größer. Es war peinlich, so ein Knirps zu sein. Niemand nahm einen ernst. Sie hob das Kinn. »Wer seid ihr?«, wiederholte sie.
»Ich bin Joe, und das ist mein Bruder Charlie. Dachten uns, du brauchst vielleicht Hilfe – aber wenn du schon so erwachsen bist, sollten wir vielleicht wieder verschwinden?«
Ellie sah das spöttische Blitzen in den smaragdgrünen Augen und musste das betörende Lächeln unwillkürlich erwidern. Zugleich wurde sie das Gefühl nicht los, dass diese Begegnung ihrer aller Leben auf irgendeine Weise verändern würde. Es war eine Vorahnung ferner Schatten.
EINS:VIERUNDDREISSIG JAHRE SPÄTER
Claire kämpfte mit dem Ersatzreifen. Als das verdammte Ding endlich an seinem Platz war, streckte sie ihren Rücken und schaute wütend hinaus auf den verlassenen Highway. Die endlosen Meilen des Outback von Queensland lagen vor ihr, und die Hitze tanzte in Wellen über den Horizont. Sie hatte seit Stunden kein anderes Auto gesehen, und auch wenn sie durchaus in der Lage war, ein Rad zu wechseln, wäre es doch nett gewesen, ein bisschen Hilfe zu haben. Deshalb konnte sie das Outback nicht leiden: Es war zu leer, zu einsam, und nach ihren vier Jahren in Sydney war sie gewöhnt an Menschen und Lärm und das Treiben der Großstadt.
Voller düsterer Gedanken wischte sie sich den Schweiß vom Gesicht. Das lange blonde Haar klebte ihr am Hals, und der Minirock aus Baumwolle, der am Morgen noch frisch gewesen war, sah jetzt schlaff und verknautscht aus. Das war nicht die richtige Art, ihr Examen als Tiermedizinerin zu feiern; wenn es nach ihr ginge, wäre sie jetzt mit ihren Freunden am Strand, statt hier draußen mitten im Nirgendwo zu sitzen. Aber den Ruf nach Hause, nach Warratah, konnte sie nicht ignorieren. Ihre Großtante Aurelia hatte ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit sei, die Atmosphäre zu bereinigen und der Entfremdung von ihrer Familie ein Ende zu machen. Und Aurelia widersprach man nicht. Nicht, wenn einem sein ruhiges Leben am Herzen lag.
Claire schlang ihr Haar zu einem groben Knoten und sicherte es mit einem Clip, und dann trank sie in tiefen Zügen. Die Flasche hatte auf dem Beifahrersitz gelegen, und das Wasser war unangenehm warm. Aber es wirkte, und bald konnte sie die letzte Radmutter anziehen und den Wagenheber herunterlassen. Sie warf das Werkzeug hinten in den Bus, stieg ein und startete den Motor.
Der Bus war ein alter grüner Holden, den ihr Dad bei einer Auktion in Burketown ergattert hatte. Der Wagen sah aus wie ein Wrack, aber der Autoschlosser von Warratah hatte den Motor überholt, und jetzt schnurrte er so gut wie neu, auch wenn der Rost durch den abgeblätterten Lack schimmerte und die Hecktüren an den Griffen zusammengebunden werden mussten, damit sie sich nicht öffneten. Oft genug hatte man ihr angeboten, den Wagen mit Flower-Power-Blümchen und Make-Love-Not-War-Emblemen zu schmücken, aber sie hatte immer widerstanden. Es war schlimm genug, das Ding durch den Verkehr von Sydney zu steuern, ohne dass es aussah, als gehöre es zu einem Zirkus.
Claire ließ den Motor im Leerlauf brummen und zündete sich eine Zigarette an. Der Gedanke an zu Hause und an ihre Familie trat wieder in den Vordergrund, und jetzt, da sie nur noch wenige Tagereisen von Warratah entfernt war, empfand sie gemischte Gefühle. Es würde gut sein, das alte Anwesen wiederzusehen. Den Duft der zitronengelben Akazienblüten einzuatmen, der wuchernden Rosen, die das alte Farmhaus bedeckten. Ihre Mutter Ellie hatte eine leidenschaftliche Vorliebe für Rosen, und in den milden Nächten des Outback erfüllte deren Moschusduft das ganze Haus. Aber sie erinnerte sich an die Anspannung, die an jenem letzten Tag vor fünf Jahren zwischen ihnen allen geherrscht hatte, und sie wusste, dass dieser Ruf nach Hause Tante Aurelias Versuch war, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Und das bereitete Claire Unbehagen. Denn die Fragen, die sie verfolgten, würden nun endlich beantwortet werden – und sie wusste nicht, ob sie schon darauf gefasst war. Sie hatte sich in Sydney eingerichtet. Sie hatte Freunde dort, und nach Weihnachten würde sie ihre Stelle in einer angesehenen Tierarztpraxis antreten. Die Schatten, die sie einmal verfolgt hatten, waren so gut wie gebannt, und der Gedanke, dass sie noch einmal zurückkehren sollten, missfiel ihr.
Claire drückte ihre Zigarette aus, legte den ersten Gang ein und fuhr zurück auf den Highway. Sie war nicht mehr das naive Mädchen vom Land, das Warratah vor all den Jahren verlassen hatte. Auch wenn ihre Tante einen Ölzweig geschwenkt hatte, wusste Claire, dass diese Heimkehr nicht einfach werden würde. Aber sie war auch klug genug, um zu wissen, dass sie nicht in alle Ewigkeit weglaufen konnte. Es war Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, so hart sie auch sein mochte.
Ellie hatte eine ruhelose Nacht hinter sich gebracht. Sie schlief nicht gern allein, aber ihr Mann war beim alljährlichen Viehauftrieb, und das Haus schien voller Echos zu sein, seit Leanne und Claire es verlassen hatten. Ellie hatte im Dunkeln gelegen, auf das Knarren und Seufzen der alten Balken gelauscht und sich gefragt, wo die Jahre hingegangen waren. Es war, als sei sie erst vor kurzer Zeit nach Warratah gekommen – ein schmächtiges Gör, das nichts besaß als ein paar zerlumpte Kleider und ein altes Pony –, aber jetzt nahte ihr achtundvierzigster Geburtstag mit Riesenschritten, und sie war Herrin über eine der größten Rinderfarmen in Northern Queensland.
Die Geister der Vergangenheit krochen heran, und sie gab den Gedanken an Schlaf vollends auf. Sie warf die Decke zurück, stieg aus dem großen Messingbett und tappte barfuß in die Küche. Hier war der Mittelpunkt des Hauses – der Ort, an dem die Kinder gespielt und Hausaufgaben gemacht und die Männer über das Vieh, das Wetter und die Rindfleischpreise diskutiert hatten. Es sah jetzt alles so ordentlich aus, erkannte sie, während sie darauf wartete, dass das Wasser kochte – so aufgeräumt. Früher hatte ein wirrer Haufen von Reitstiefeln in der Ecke gelegen und die schmutzige Wäsche sich in einem Korb neben dem Wasserboiler getürmt, und alles war von Spielsachen und Büchern übersät gewesen, die man hatte liegen lassen, wo sie hingefallen waren. Glückliche Zeiten!, dachte sie wehmütig.
»Es zeigt, dass du alt wirst, wenn du dich darüber beschwerst, wie ordentlich alles ist«, brummte sie schlecht gelaunt, während sie Tee aufgoss und zwei Löffel Zucker dazugab. Sie nahm einen kleinen Schluck und verzog das Gesicht. Selbstgespräche waren ein weiteres Anzeichen für das Alter, und sie merkte, dass sie in letzter Zeit öfter welche führte. Die Wahrheit war, dass die Mädchen ihr fehlten. Ihr munteres Geschnatter und ihre Energie – sogar ihre heftigen Streitereien. Es war einfach zu still hier, verdammt.
Sie schaute sich in der Küche um und sah sie zum ersten Mal richtig, obwohl sie so viele Stunden hier verbracht hatte. Die Holzbalken der Wände und der Decke waren schwarz vom Rauch des antiken Herds, den sie vor fünf Jahren durch einen neuen ersetzt hatte, und das primelgelbe Linoleum war rissig und zu einem Cremeweiß verblichen. Der solide Küchentisch und die Stühle waren in der Tischlerei gemacht worden und trugen die Narben jahrelanger Misshandlung durch Kinder und Viehtreiber. Die Schränke passten nicht zusammen und hatten einen neuen Anstrich nötig. Das Spülbecken war alt, der Gaskühlschrank unzuverlässig, die Fenstervorhänge verschossen. Doch obwohl die Reklame in den Illustrierten dazu verlockte, sich eine dieser neuen, modernen Küchen anzuschaffen, war es ihr so lieber. Dies war ihr Zuhause, und hier fühlte sie sich wohl.
Ohne wirklich zu wissen, warum, wanderte sie aus der Küche in die quadratische Diele an der Vorderseite des Hauses und öffnete die Türen der Schlafzimmer an jeder Seite. Es waren insgesamt vier, angebaut im Laufe der Jahre, als die Kinder kamen. Aus ihrem eigenen Zimmer schaute man hinaus auf die Eukalyptusbäume und den Billabong. Musselingardinen wehten vor den Fliegengittern und machten das helle Licht weicher, das nachmittags hereinstrahlte. Das Messingbett füllte das Zimmer fast ganz aus, und das Moskitonetz aus Spitzengewebe verlieh ihm einen Hauch von Exotik. Reihen von Fotos standen auf der ramponierten Kommode, Pferdebilder zierten die Holzwände, und der gebohnerte Fußboden schimmerte zwischen den im Raum verstreuten Schaffellteppichen hervor.