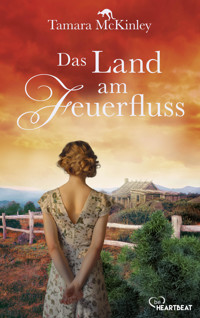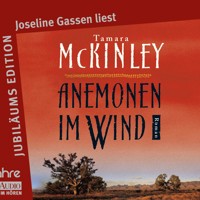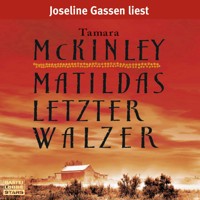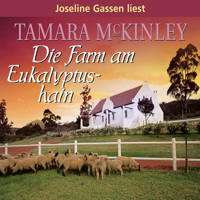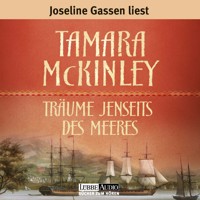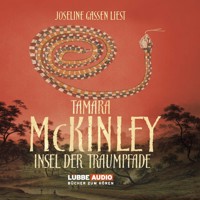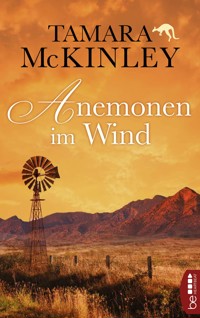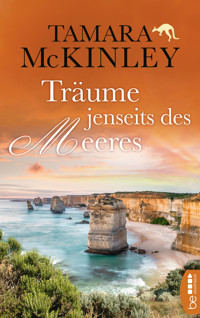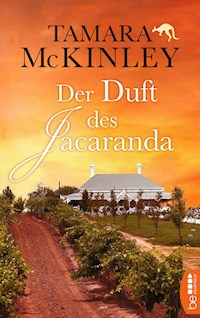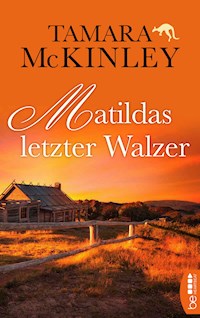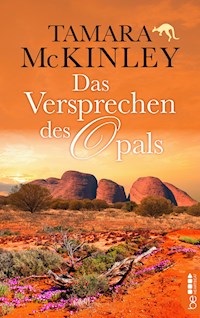
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe und Sehnsucht in Australien
- Sprache: Deutsch
Die Macht der Liebe und der Zusammenhalt der Familie
Ein schwarzer Opal, der ihr aus einer alten Spieldose entgegenpurzelt, weckt bei Miriam eine Flut von Erinnerungen. Wehmütig denkt sie zurück an das abenteuerliche Leben, das sie mit ihrem Vater führte, der als Opalsucher durch Australien zog. Bis er eines Tages nicht aus seiner Mine zurückkehrte und die kleine Miriam allein in der Wildnis zurückblieb - ebenso wie die Frau, die er liebte ...
Eine atmosphärisch dichte Familiensaga, die von Irland nach Australien führt und Liebe und Leid von drei Generationen umspannt.
"Ein Geschichte zum Mitleiden, zum Schwelgen und Hoffen!" Neue Presse, Hannover
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
PROLOG 1969
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
EPILOG
DANKSAGUNG
Erschienene Titel der Autorin
Die Ozeana-Trilogie:
Band 1: Träume jenseits des Meeres
Band 2: Insel der Traumpfade
Band 3: Legenden der Traumzeit
Anemonen im Wind
Das Land am Feuerfluss
Das Lied des Regenpfeifers
Das Versprechen des Opals
Der Duft des Jacaranda
Der Himmel über Tasmanien
Der Zauber von Savannah Winds
Die Farm am Eukalyptushain
Jene Tage voller Träume
Matildas letzter Walzer
Sehnsucht nach Skye
Über dieses Buch
Die Macht der Liebe und der Zusammenhalt der Familie
Ein schwarzer Opal, der ihr aus einer alten Spieldose entgegenpurzelt, weckt bei Miriam eine Flut von Erinnerungen. Wehmütig denkt sie zurück an das abenteuerliche Leben, das sie mit ihrem Vater führte, der als Opalsucher durch Australien zog. Bis er eines Tages nicht aus seiner Mine zurückkehrte und die kleine Miriam allein in der Wildnis zurückblieb – ebenso wie die Frau, die er liebte ...
Eine atmosphärisch dichte Familiensaga, die von Irland nach Australien führt und Liebe und Leid von drei Generationen umspannt.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Tamara McKinley wurde in Australien geboren und verbrachte ihre Kindheit im Outback des fünften Kontinents. Heute lebt sie an der Südküste Englands, aber die Sehnsucht treibt sie stets zurück in das weite, wilde Land, dessen Farben und Düfte sie in ihren Büchern heraufbeschwört. Mit ihren großen Australien-Romanen hat sie sich eine weltweite Fangemeinde erobert.
Homepage der Autorin: http://www.tamaramckinley.co.uk/.
Tamara McKinley
Das Versprechen des Opals
Aus dem australischen Englisch von Rainer Schmidt
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2003 by Tamara McKinley
Titel der englischen Originalausgabe: „Summer Lightning“
Originalverlag: Judy Piatkus (Publishers), London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2004/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Übersetzung der Verse in Kapitel 3 von Christopher Marlowe aus „The Passionate Shepherd to his Love“: Werner von Koppenfels, entnommen aus: Friedhelm Kemp und Werner von Koppenfels (Hg.), Englische und amerikanische Dihtung, Beck 2000
Covermotive: © shutterstock/imagevixen; © PhotoItaliaStudio/shutterstock; © MemoryMan/shutterstock
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7517-0212-6
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Brandon John Morris, den Ersten der nächsten Generation
PROLOG 1969
Miriam Strong trat hinaus auf die Veranda der Bellbird-Farm. Der Morgen würde erst in einer Stunde dämmern. Sie hatte eine ruhelose Nacht hinter sich, eine Nacht voller Träume und Bilder der Vergangenheit, herauf beschworen von den Ereignissen des Tages. Als Miriam den frischen Duft des regennassen Grases und den süßen Hauch von guter roter Erde einatmete, spürte sie, wie ihre Tatkraft und Entschlossenheit zurückkehrten. Beides würde sie brauchen, denn der Kampf, der vor ihr lag, würde nicht gerade angenehm werden.
Sie schloss die Augen und bemühte sich, die nächtlichen Bilder zu vertreiben, indem sie ihre glücklichen Stunden Revue passieren ließ. Ihr Leben hatte vor beinahe fünfundsiebzig Jahren zwar im kühleren Grün Südaustraliens begonnen, aber sie hatte doch das Gefühl, in diese heiße, sepiafarbene Welt hineingeboren zu sein, mit dem Zirpen der Grillen, dem Gelächter des Kookaburra, dem Seufzen des warmen Windes in den Bäumen. Das war ihre Heimat, und sie würde niemals fortgehen, denn hier fand sie Kraft und Trost. Auf dieser Farm im Outback hatte sie die Unwägbarkeiten des Lebens kennen gelernt, in der harten Schule voll schrecklicher Schönheit, die sie umgab. Und auf dem Farmhof hatte sie ihr erstes Pony geritten. Hier hatte sich ihr Leben abgespielt, und fast konnte sie hören, wie Lachen und Weinen in der Stille kurz vor Morgengrauen widerhallten.
Bellbird lag in der entlegenen Nordwestecke von New South Wales, ein Queenslander-Haus mit sechs Zimmern, vor fast einem Jahrhundert erbaut. Es hatte eine Küche im hinteren Teil, ein selten benutztes Wohnzimmer und drei Schlafräume. Zwanzig Jahre zuvor war ein Badezimmer dazugekommen, und das alte Plumpsklo hinter dem Haus war bald den Termiten und den Elementen zum Opfer gefallen.
Das unvermeidliche Wellblechdach senkte sich schräg über die breite Veranda, die rings um alle vier Seiten des Haupthauses reichte. Das Leben spielte sich zum größten Teil auf dieser Veranda ab, vor allem in der Hitze des Sommers, und Miriam hatte ein Schlafsofa mit Moskitonetz in der einen, einen Tisch mit ein paar Stühlen in der anderen Ecke aufgestellt. Etliche ramponierte Korbsessel standen hier und da zwischen riesigen Töpfen mit Farnen und anderen Grünpflanzen, die den kühlen Schatten der Bäume ringsum ergänzten. Die Bäume beherbergten Gallahs und Wellensittiche in allen Farben – und natürlich auch den winzigen Bellbird, den Glockenvogel, dessen eintöniges Flöten zu den reinsten Klängen im Busch gehörte.
Miriam setzte sich mit einem tiefen Seufzer in einen der Korbsessel und stellte die Spieldose behutsam auf den wackligen Tisch. Darüber würde sie später nachdenken. Ihr Besucher würde bald eintreffen, und sie brauchte diesen Augenblick der Stille, um für das, was bevorstand, ihre Kräfte zu sammeln. Wie ihre Familie reagieren würde, wusste Gott allein.
Chloe, ihre Tochter, würde wahrscheinlich sagen, sie solle nicht so viel Aufhebens machen. Unruhe jeglicher Art konnte sie nicht ausstehen. Sie versteckte sich lieber mit ihren Bildern in dem großen, weitläufigen Strandhaus an der Byron Bay. Das Mädchen hat immer nur in seinen Träumen gelebt, dachte Miriam müde. Sie schaute über den Hof hinaus und sah Chloe vor sich, das kleine Mädchen mit dem Lichtkranz aus kupferroten Haaren und diesen grünen Augen, die nichts von ihrem Strahlen verloren hatten. Vermutlich war sie glücklich, aber wer wusste das schon? Sie und Leo waren zwar geschieden, aber Miriam hatte den Verdacht, dass sie sich besser miteinander verstanden, seit sie getrennt lebten – und das konnte nur gut sein. Oder nicht? Miriam schnalzte mit der Zunge. Zu viele Dinge gingen ihr durch den Kopf, und die Probleme ihrer Familie waren ihre geringste Sorge.
Der Gedanke an ihre Enkelinnen entlockte ihr ein Lächeln. Die beiden unterschieden sich wie Feuer und Wasser. Fiona würde das Abenteuer der bevorstehenden Schlacht wahrscheinlich genießen, aber Louise? Die arme, unterdrückte, frustrierte Louise würde die Auseinandersetzung nur als ein weiteres Problem in ihrem Leben betrachten.
Miriam schob die Gedanken an ihre Familie beiseite und quälte sich in ihre Stiefel. Die Rückenschmerzen waren hilfreich, denn sie erinnerten sie beständig an ihre Sterblichkeit. Sie schimpfte leise, als die Schnürsenkel sich selbstständig machten und sich einfach nicht binden lassen wollten. Es war ein verdammtes Kreuz mit dem Altsein, und sie war weit davon entfernt, auf ihr Alter stolz zu sein: Sie verfluchte es. Was würde sie nicht dafür geben, noch einmal jung und gelenkig zu sein! Die ganze Nacht schlafen zu können, ohne zur Toilette zu müssen. Stundenlang über die Weiden zu reiten, ohne sich danach tagelang steif und zerschlagen zu fühlen.
Sie zog eine Grimasse. Die Alternative war nicht verlockend, aber sie konnte nicht gut akzeptieren, was mit ihr geschah. Ihr Leben lang war sie eine Kämpferin gewesen, und sie wollte verdammt sein, wenn sie jetzt aufgab. Sie grunzte zufrieden, als es ihr endlich gelungen war, die Schnürsenkel zuzubinden. Sie warf noch einen Blick auf die Spieldose und schaute dann hinaus über die Koppel.
Der Himmel war heller geworden; im ersten zarten Rosa der Morgendämmerung erhob sich die Silhouette der Bäume vor den dunklen Nebengebäuden. Die Vögel erwachten, und das scharfe, raspelnde Krächzen der Kakadus wurde gemildert durch das rollende, beinahe sinnliche Schettern der Elstern.
Miriam blieb auf der Veranda. Rauch wehte aus dem Kamin des Küchenhauses, und die Vögel erhoben sich zum ersten Flug des Tages, eine Wolke aus Rosa, Weiß und Grau, während die kleinen grünen und blauen Sittiche begeistert zwischen den Gallahs umherschwirrten und Kurs auf den Billabong nahmen. Miriam beobachtete sie eine Zeit lang, und ihr scharfes Auge sah, dass die ersten Kleinen ihre Nester verlassen hatten. Eine neue Generation war flügge geworden. Bald würde es Zeit sein, ihr Platz zu machen.
»Aber noch nicht«, flüsterte Miriam. »Ich brauche noch Zeit, um erst alles in Ordnung zu bringen.«
Widerstrebend richtete sie ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf die Spieldose. Das Kirschholz war mit Perlmuttintarsien verziert und trug Zeichen des Alters, die den Zauber jedoch nur verstärkten, denn diese Kratzer und Schrammen erzählten von weiten Reisen durch die ganze Welt, von Zeiten, die sie in den rauesten Gegenden der Erde verbracht hatte. Als Kind hatte Miriam sich auszumalen versucht, wie sie entstanden waren, hatte sich bemüht, die Menschen heraufzubeschwören, die diese Spieldose einst besessen und so gehütet hatten, dass sie heil überdauert hatte.
»Bis heute«, brummte sie verärgert und betrachtete den zerbrochenen Sockel. Ihre Unachtsamkeit hatte eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die leicht außer Kontrolle geraten konnte, wenn man nicht Acht gab. Denn durch das Zerbrechen der Spieldose war ein Geheimnis ans Licht gekommen – ein Geheimnis, das das Leben ihrer ganzen Familie für immer verändern könnte.
Sie strich mit einem Finger über den Deckel, und ihre Zweifel wuchsen. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Geister der Vergangenheit ruhen zu lassen? Zu akzeptieren, was gefunden worden war, und es zu benutzen, um ihrer Familie zu helfen? Das hier konnte sie nicht gebrauchen – nicht jetzt. Aber wie sollte sie den Fund ignorieren? Es war der erste echte Beweis dafür, dass ihr Verdacht zutreffend gewesen war, ein handfestes Geschenk aus der Vergangenheit – und es schrie danach, dass die Wahrheit offenbart wurde.
Ungelenk drehte sie den winzigen goldenen Schlüssel und klappte den Deckel auf. Der schwarze Harlekin tanzte mit seiner bleichen Columbine vor den wolkigen Spiegeln in vollkommener Harmonie mit den blechernen Klängen eines Strauß-Walzers, und ihr Gesichtsausdruck hinter den Masken war rätselhaft.
Miriam betrachtete das schimmernde Kostüm des Harlekins und die zierlichen Rüschen am Kleid der Columbine. Schön war die Spieluhr, musste sie gestehen, und wahrscheinlich sehr selten, denn ein schwarzer Harlekin war ungewöhnlich. Aber schon als Kind hatte sie die glasigen Augen hinter den Masken als gespenstisch empfunden, und die gefühllose Umarmung war ihr steif und gekünstelt vorgekommen. Sie verzog das Gesicht. Vielleicht hatten die beiden immer gewusst, welches Geheimnis sich unter ihnen verbarg, und deswegen so hochmütig ausgesehen.
Die Musik erstarb, und die Tänzer kamen zum Stehen. Miriam schloss den Deckel und versuchte die bevorstehende Ankunft ihres Besuchers zu vergessen, indem sie sich den Klängen und Düften einer Vergangenheit hingab, die sie nur aus den Erzählungen ihrer Kindheit kannte. Es war eine Zeit, in der sie noch nicht geboren war. Aber sie war dennoch die stumme, unschuldige Zeugin eines Dramas gewesen, dessen letzter Akt fünfundsiebzig Jahre später stattfinden sollte.
EINS
Irland 1893
Fröstelnd zog Maureen sich den dünnen Mantel fester um die Schultern, während sie auf Henry wartete. So spät war er noch nie gekommen, und sie machte sich allmählich Sorgen. Ob oben im großen Haus etwas passiert war? Etwas, das ihn daran hinderte, sich hinauszuschleichen? Sie knirschte mit den Zähnen, um das Klappern zu unterdrücken. Es war ein weiter Weg vom Dorf in den Wald; das lange dunkle Haar klebte regennass an ihrem Kopf, und eiskalte Tropfen liefen an ihrem Hals herunter und in ihr Kleid. Aber nicht der messerscharf schneidende Wind ließ sie frieren, sondern der Gedanke, dass sie vielleicht verraten worden waren – dass er vielleicht gar nicht mehr kommen würde.
In der Tür der verlassenen Jagdhüterhütte, in der Maureen Schutz gesucht hatte, lehnte sie sich an das raue Holz des Türpfostens und wischte sich den Regen aus dem Gesicht. Der Tag passte gut zu ihrer Stimmung, denn der Himmel war seit dem Morgen bleigrau, und es wurde zusehends dunkel. Bald würde sie gehen müssen, denn sonst würde man sie zu Hause vermissen, und sie wollte Dad nicht gern unter die Augen kommen: Er würde eine Erklärung verlangen. Aber ihre Angst, Henry zu verpassen, war zu groß. Sie hatten Dinge zu besprechen, die nicht warten konnten – nicht, wenn sie vor ihrem siebzehnten Geburtstag geklärt werden sollten.
Das Trommeln des Regens auf dem eingestürzten Strohdach übertönte alle anderen Geräusche. Maureen stand in der rasch herabsinkenden Düsternis und spähte in die Schatten hinaus, und die Worte, die sie zu sagen hatte, überschlugen sich in ihrem Kopf. Leicht würde es nicht werden, aber sie musste Vertrauen zu Henry haben. Er würde sie doch jetzt nicht im Stich lassen?
»Maureen.«
Als sie die leise Stimme hörte, fuhr sie herum. Er sprang vom Pferd. Vor Glück und Erleichterung aufschluchzend, stürzte sie in seine ausgebreiteten Arme. »Ich dachte, du kommst nicht mehr«, keuchte sie.
Er ließ die Zügel fallen, zog sie an sich und legte das Kinn auf ihren Scheitel. Zusammen flüchteten sie sich unter das eingefallene Dach. »Ich wäre auch fast nicht gekommen«, sagte er grimmig. »Mein Bruder ist da, und mein Vater bestand darauf, dass wir die Verwaltung des Anwesens besprechen. Ich bin nur hier, weil eine der Stuten fohlt; sie hat Schwierigkeiten, und ich habe mich erboten, Hilfe zu holen.«
Widerstrebend löste er sich von ihr und strich ihr die nassen Haare aus dem Gesicht. Dann fasste er ihr Kinn mit seinen langen, eleganten Fingern. »Es tut mir Leid, Liebling. Aber ich kann nicht bleiben. Vater hat eine seiner Launen, und ich wage nicht, allzu lange wegzubleiben.«
Maureen schaute in sein hübsches Gesicht. Henry Beecham-Fford war zweiundzwanzig. Sein blondes Haar klebte nass an seinem wohlgeformten Kopf. Er hatte blaue Augen mit dichten Wimpern, eine lange, gerade Nase und einen sinnlichen Mund, den ein adretter Schnurrbart zierte. Sie nahm seine Hand und drückte einen Kuss in die Handfläche. »Kannst du nicht wenigstens einen Augenblick bleiben?«, flehte sie. »Ich habe dich in den letzten paar Tagen so selten gesehen. Wir haben anscheinend nie Zeit, miteinander zu reden.«
Er küsste sie, zog sie an sich und umschlang sie, und die Wärme seiner Umarmung durchflutete sie wie ein Feuer. Sie zerschmolz an seinem Körper, sie konnte ihn schmecken und atmete seinen Duft von feinem Eau de Cologne und nassem Tweed.
»Wir treffen uns morgen nach der Jagd wieder hier«, sagte er und schob sie betrübt von sich. »Dann können wir reden.« Seine blauen Augen leuchteten humorvoll. »Was immer es ist, kann ja nicht so wichtig sein – alles, was gesagt werden muss, haben wir eben gesagt, mit diesem Kuss.«
Sie trat einen Schritt zurück. Wenn er sie noch einmal küsste, wäre sie verloren, und sie musste sich konzentrieren. »Henry«, begann sie.
Er legte ihr sanft den Finger an die Lippen. »Morgen«, sagte er unnachgiebig. »Wenn wir hier bleiben, laufen wir Gefahr, entdeckt zu werden, aber wenn ich bei Vater etwas erreichen will, muss ich ein pflichtbewusster Sohn sein.« Ein hastiger Kuss, und dann wandte er sich ab und griff nach dem Zügel. Er stieg in den Sattel, beugte sich herab und strich Maureen über das nasse Haar. »Lauf nach Hause, und sieh zu, dass du wieder trocken wirst, ehe du dir den Tod holst. Und vergiss nicht, dass ich dich liebe. Vertrau mir, Liebling! Wir werden einen Weg finden, für immer zusammen zu sein. Das verspreche ich dir.«
Maureen schlang die Arme um die Taille, als er den Kopf des Pferdes herumriss und davongaloppierte. Sie blieb eine ganze Weile so stehen und lauschte dem schwindenden Hufgetrappel und dem Prasseln des Regens auf dem Blätterdach des Waldes. Sie hatte nichts weiter gesagt, denn es war klar, dass er ihr nicht zuhören würde. Er hatte es zu eilig, hatte zu viel Angst, ertappt zu werden. Aber die Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen, gefielen ihr nicht. Konnte sie ihm vertrauen? Oder benutzte er sie nur?
Henry entstammte einer Familie von reichen englischen Protestanten. Ihnen gehörte das Land, das sich vom Hafen bergauf erstreckte, durchzogen von einem Spinnennetz aus steinernen Mauern. Land, das in Parzellen aufgeteilt war, die wenig größer waren als die Wohnstube der O’Hallorans. Land, das kaum genug hervorbrachte, um die Bauern zu ernähren, wenn sie die Pacht bezahlt hatten. Henrys Herkunft bedeutete, dass ihre Liebe verboten war. Würde Henry die Kraft haben, sich gegen seinen tyrannischen Vater zu stellen? Liebte er sie so sehr, dass er riskieren würde, alles zu verlieren?
Mit eingezogenem Kopf, die Arme fest um die Taille geschlungen, trat sie aus dem Schutz der Hütte und suchte sich ihren Weg durch den Wald. Er hatte gesagt, sie solle ihm vertrauen – aber konnte sie das? Wagte sie wirklich zu hoffen, dass er sein Versprechen halten würde und sie eines Tages zusammen sein würden? Würde er sie immer noch wollen, wenn die gesellschaftliche Saison begann und die Jagden und Bälle im Herrenhaus ihn in Anspruch nahmen?
Sie glitt auf dem nassen Laub aus und stolperte über abgebrochene Äste und dorniges Gestrüpp. Ihr blieb nichts anderes übrig, als seinem Wort zu vertrauen. Aber Gott mochte ihr gnädig sein, wenn sie sich irrte.
Ein scharfer Wind schlug ihr entgegen, als sie den Schutz des Waldes verließ und auf den Pfad gelangte, der sich zu dem Dorf am Ufer hinunterschlängelte. Er peitschte ihr das Haar aus dem Gesicht, presste ihr die Röcke an die Beine und ließ sie um ihre Knöchel flattern. Sie stemmte sich ihm entgegen und presste das Kinn tief in den Kragen ihres Mantels. Möwen schrien über dem Hafen, die Fischerboote zerrten an ihren Leinen, die Atlantikwellen donnerten gegen die steinerne Mole, und der matte Lichtschein aus den Hüttenfenstern war ein willkommener Anblick. Beinahe tränenblind kämpfte sie sich den Hang hinunter.
Die Frauen sah sie erst, als es bereits zu spät war. Henry ließ Dan Finnigan im Stall zurück, und als er dafür gesorgt hatte, dass sein Pferd trocken war und genug Futter und Wasser hatte, rannte er über das Kopfsteinpflaster zum Haupthaus. Der Regen war noch heftiger geworden und peitschte beinahe waagerecht über den Hof. Hoffentlich war Maureen wohlbehalten zu Hause angekommen. In einer solchen Nacht jagte man nicht einmal einen Hund vor die Tür.
Bei dem Gedanken an Maureen musste er lächeln, während er, immer zwei Stufen überspringend, die Treppe hinauf und in sein Zimmer stürmte. Das er Maureen liebte, war nicht verwunderlich; er hatte sie schon als Kind angebetet. Er riss sich die nassen Sachen vom Leib und zog sich hastig zum Abendessen um. Die Kinderzeit war die beste gewesen; die gesellschaftliche Kluft zwischen ihnen war ihm zwar schon damals bewusst gewesen, aber sie hatten mehr Freiheiten gehabt – Freiheiten, in denen ihre Freundschaft trotz der unterschiedlichen Lebensumstände hatte gedeihen können.
Seufzend plagte er sich mit dem gestärkten Kragen und den goldenen Manschettenknöpfen. Mit dem Erwachsenwerden hatte sich das alles geändert, die Kluft war breiter geworden. Was hatte Irland nur an sich, dass es die Menschen zu solchem Hass anstachelte? Er war auf beiden Seiten nicht zu übersehen, weder in den protestantischen Enklaven noch in den katholischen Slums, aber es musste doch eine Lösung geben – eine Möglichkeit, dieses arme, ungebildete Land von seinen Jahrhunderte alten Problemen zu erlösen?
Er band sich die Schleife um und schlüpfte in sein Jackett. Dann betrachtete er sich im Spiegel und zog spöttisch eine Augenbraue hoch. Was verstand er schon von irischer Politik, ganz zu schweigen von den Möglichkeiten, diese endlosen Kämpfe zu beenden? Er wusste nur, dass er Maureen liebte und dass er entschlossen war, einen Weg zu finden, immer mit ihr zusammen zu sein. Was kümmerte es ihn, dass sie katholisch war und dass ihr Vater zu den Unruhestiftern gehörte, die stimmgewaltig nach irischer Herrschaft riefen?
Die unbehagliche Erinnerung daran, dass sein Vater energische Einwände gegen eine solche Verbindung erheben würde, ließ ihn stocken, als er nach dem Türknauf griff. Die Bigotterie war beiden Seiten angeboren. Hatte er die Charakterstärke, Generationen von Beecham-Ffords die Stirn zu bieten und seinem Herzen zu folgen? Konnte Maureen mit der standfesten Tradition des Hasses auf die Engländer brechen und mit ihm davonlaufen?
»Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden«, murmelte er, riss die Tür auf und marschierte die matt erleuchtete Galerie entlang.
Beecham Hall war ein quadratischer Steinbau, der fast ein Jahrhundert zuvor von einem reichen Vorfahren errichtet worden war. In einsamer Pracht stand er inmitten der Hügel, die Lough Leigh vor den Westwinden schützten, die vom Atlantik hereinfegten. Die hohen, eleganten Fenster boten einen Ausblick über den übertrieben gepflegten Garten und die geschwungene, von Heckenskulpturen gesäumte Zufahrt. In den kopfsteingepflasterten Stallhof gelangte man durch einen Torbogen in einer hübschen Mauer, die von Kletterrosen und Geißblatt überwuchert war, und verborgen hinter dem großen Waschhaus lag der Küchengarten.
Das Haus war von gutem Weideland für Rinder und Pferde umgeben, und in den Wäldern gab es ungezählte Fasane für die Jagdgesellschaften, die sein Vater jedes Jahr veranstaltete. Der Fluss, der von Lough zum Meer floss, war sehr fischreich, und die Rudel von Rehen in der Parklandschaft boten frühmorgens einen anmutigen Anblick, auch wenn sie ein Alptraum für den Wildhüter waren, der die Wilderer abzuwehren hatte. Henry hatte den größten Teil seines Lebens hier verbracht; das grüne Irland war ihm lieber als London mit seinem Getriebe und dem rauchigen Nebel. Hier, in den grünen Hügeln an der zerklüfteten Küste, hatte man Platz zum Atmen. Und die Burgruinen und baufälligen Hütten hatten etwas nahezu Mystisches an sich, das seine Künstlerseele ansprach. Und dann natürlich dieses Haus: Er liebte die hohen Decken mit ihren zierlichen Stuckarbeiten und die gemütlichen Fensterbänke, auf denen er als Junge hinter den schweren Vorhängen gesessen und gelesen hatte. Aber am meisten liebte er das Sommerhaus, denn hier konnte er sich in seine Malerei vertiefen.
Auf dem Treppenabsatz blieb er stehen und spähte in die Nacht hinaus, während aus dem Salon leise Stimmen zu ihm heraufwehten. Dort draußen war das Sommerhaus, versteckt in einer entlegenen Ecke des Gartens, fast in Vergessenheit geraten, seit Vater neben dem Haus die Orangerie hatte bauen lassen. Henry nestelte an seiner Schleife und wünschte sich, er könne das Abendessen schwänzen und sich in seinen Schlupfwinkel flüchten – zu dem Gemälde, das fast fertig war. Aber die Pflicht rief, also eilte er seufzend das letzte Stück Treppe hinunter und durchquerte die Diele. Die Großvateruhr schlug acht, als er den Salon betrat.
»Wo zum Teufel hast du gesteckt?«, fuhr Sir Oswald ihn an.
Henry sah seinen Vater an, der breitbeinig wie immer vor dem Kamin saß. Sein Haar glänzte silbern im Lampenschein. Das vorzüglich geschnittene Jackett betonte seine Gestalt, die er durch die Jagd schlank hielt. »Ich war im Dorf, um Dan Finnigan zu holen«, antwortete Henry gleichmütig. »Und dann musste ich die nassen Kleider ausziehen.«
»Hast aber ziemlich lange gebraucht, alter Junge«, näselte sein Bruder Thomas, und sein durchdringender Blick forschte in Henrys Miene nach irgendeinem Zeichen der Unaufrichtigkeit. »Du hast doch wohl nicht irgendwo eine appetitliche kleine Dirne versteckt, oder?« Er lachte schnaubend und strich sich das hellbraune Haar zurück. »Macht sicher Spaß, aber da muss einer schon ziemlich verzweifelt sein, wenn er an so einem Abend draußen unterwegs ist.«
Henry funkelte den älteren Bruder an; ballte die Fäuste und schluckte seine Erwiderung herunter. Thomas verstand es, ihn zu reizen; er spürte seine Schwächen auf und verhöhnte sie dann.
»Hier sind Damen anwesend«, dröhnte Sir Oswald. »Halt den Mund, Junge!«
Thomas wurde rot. Er wandte sich ab und ging zu seiner Frau. Emma saß mit einer Handarbeit auf der niedrigen Chaiselongue und hielt den Blick gesenkt, als fürchte sie, dass man sie bemerken könne.
»Komm zum Feuer, mein Lieber, und wärme dich auf.« Lady Miriam klopfte mit der flachen Hand neben sich auf die Couch. Sie und Henry wussten beide, wie leicht in dieser Familie Streitereien ausbrechen konnten, und Henry sah an der Haltung ihres Kinns, dass sie entschlossen war, jede Konfrontation zu vermeiden. »Wie geht es der Stute?«
Henry wagte nicht, seinen Vater anzusehen. Er nahm sich ein Glas Sherry von dem Silbertablett auf dem Beistelltisch und setzte sich zu seiner Mutter. Die Bemerkung seines Bruders war allzu nah an der Wahrheit gewesen, und der alte Gauner besaß einen messerscharfen Verstand, wenn es darum ging, Fehltritten auf die Spur zu kommen. »Finnigan glaubt, sie kommt durch«, sagte er. »Aber das sollte ihr letztes Fohlen sein. Sie ist zu alt.«
Lady Miriams Diamanten blitzten im Lampenlicht, als sie über ihren seidenen Rock strich. »Danke, dass du dich an einem solchen Abend auf den Weg gemacht hast«, sagte sie leise.
Ihre scharfen blauen Augen betrachteten ihn eine ganze Weile. Dann schaute sie weg, aber Henry hatte die Frage in ihrem Blick gesehen, den Zweifel, und er fragte sich, wie lange er diesen lächerlichen Anschein noch würde wahren können. Vielleicht sollte er sich seinem Vater nach dem Abendessen stellen – es war besser, die Konfrontation selbst zu suchen, als sich auf frischer Tat ertappen und in die Defensive drängen zu lassen. Aber bei dem Gedanken bekam er ein flaues Gefühl im Magen, und kalter Schweiß rann ihm über den Rücken, während sein Vater sich darüber verbreitete, welche Unwägbarkeiten es mit sich brachte, in diesen Zeiten politischer Unruhe in Südirland einem Haushalt vorzustehen.
Henry verschloss die Ohren vor der väterlichen Stimme und dachte an Maureen und daran, wie nass ihr Haar gewesen war, wie kalt der Wind, wie dünn ihr Mantel. Es war ungerecht, dass er so gut behütet vor dem warmen Feuer sitzen durfte, während sie durch den Regen zum Dorf zurückwandern musste. Der Gedanke schmerzte ihn so sehr, dass er ein Stöhnen unterdrücken musste. Wenn sie doch nur mehr Zeit füreinander haben könnten! Diese gestohlenen Augenblicke waren eine Plage, diese heimlichen Rendezvous, bei denen jedes Geräusch bedeuten konnte, dass man sie entdeckt hatte. Irgendetwas würde geschehen müssen – und zwar bald. Er ertrug es nicht, noch länger von ihr getrennt zu sein.
Das Essen schien eine Ewigkeit zu dauern, und die Atmosphäre war so bedrückend, als liege ein Donnerwetter in der Luft. Sir Oswald arbeitete sich schweigend durch die fünf Gänge und nahm die Anwesenheit seiner Familie kaum zur Kenntnis. Lady Miriam tat ihr Bestes, um das gedehnte Schweigen mit Geplauder zu unterbrechen, und Thomas schwafelte von der bevorstehenden Wahl und seiner Zuversicht, dass er seinen Sitz im Parlament behalten werde.
Thomas’ Frau stocherte in ihrem Essen herum. Im Licht der Gaslampen wirkte ihr weiches braunes Haar stumpf, und ihr blasses kleines Gesicht lag im Schatten. Sie erinnerte Henry an eine kleine graue Maus, die er als Kind einmal gehabt hatte. Aber vielleicht war das herzlos. Die arme Emma, dachte er, als er schließlich die Serviette beiseite warf und zu essen aufhörte. Ihre letzte Fehlgeburt war die dritte in ebenso vielen Jahren – wenn Thomas sich doch nur zurückhalten und der armen Kleinen ein bisschen Zeit zu ihrer Erholung gewähren wollte. Aber das war typisch für seinen älteren Bruder. Dachte immer nur an sich.
Die Diener brachten Brandy und Zigarren. Lady Miriam rauschte aus dem Zimmer, und Emma huschte ängstlich hinterher. Die Erleichterung der beiden war mit Händen zu greifen, und Henry rutschte auf seinem Stuhl hin und her und wünschte, er könne mitgehen. Der Abend wollte kein Ende nehmen, und er sehnte sich nach der Einsamkeit seines Schlafzimmers, nach einem Bleistift und sauberem, dickem Papier zum Zeichnen. Er wollte Maureens Gesicht einfangen – ihre wunderbaren grünen Augen und ihr dunkles Haar, die sanft geschwungenen Lippen und runden Wangen und das entschieden spitzbübische Grübchen, das erschien, wenn sie lächelte. Sie war einfach vollkommen. Man musste sie einfach lieben.
Die Stimme seines Vaters riss ihn aus seinen Gedanken. »Habe heute Morgen einen Brief von Brigadier Collingwood bekommen«, dröhnte er. »Hat für nächste Woche ein Vorstellungsgespräch in London für dich arrangiert.« Seine buschigen Brauen überschatteten schmale Augen. »Wird Zeit, dass du etwas Nützliches tust, statt hier herumzulungern wie ein weibischer Taugenichts.«
Thomas’ hämisches Grinsen entging Henry nicht, ebenso wenig wie der streitlustige Blick seines Vaters. Er atmete tief durch und zwang sich, ruhig zu bleiben. Es war eine alte Auseinandersetzung, aber er musste fest bleiben. »Es ist nicht mein Wunsch, zur Armee zu gehen«, sagte er tonlos. »Wir haben diese Diskussion schon öfter geführt, und ich habe nicht die Absicht –«
Sir Oswald explodierte. »Du wirst verdammt noch mal tun, was man dir sagt, du Grünschnabel!« Er schlug mit der Faust auf den Eichentisch, dass die Gläser klirrten. »Ich nehme diesen Unfug nicht länger hin. Du bist es deiner Familie schuldig, eine Lauf bahn einzuschlagen, und wenn du dich weigerst, dir selbst etwas auszusuchen, hast du dich meinen Wünschen zu fügen.«
Henry erhob sich vom Tisch. Alle Farbe war aus seinem Gesicht gewichen, und ein tiefer Zorn ließ ihn beben. »Ich habe mich immer bemüht, dir zu Gefallen zu sein, Vater, aber das ist anscheinend nicht möglich. Ich weiß, dass ich dir und Mutter verpflichtet bin, aber ein Leben in der Armee oder in der Kirche ist nichts für mich.« Er holte tief Luft. »Ich habe ein Talent – und zufällig bin ich davon überzeugt, dass mich dieses Talent zu etwas wirklich Lohnendem führen wird, wenn man mir erlaubt, es auszuüben. Aber das kann ich nicht, wenn ich auf irgendeinem ausländischen Schlachtfeld bis zum Hals in Schlamm stecke, gespickt von den Speeren der Eingeborenen.«
»Talent!« Die buschigen Brauen hoben sich verblüfft und senkten sich dann wieder düster über glühenden Augen. »Papperlapapp! Du glaubst den Worten eines verzärtelten so genannten Künstlers und bildest dir tatsächlich ein, du könntest deinen Lebensunterhalt auf diese Weise bestreiten? Quatsch!« Wieder klirrten die Gläser, und die Kerzen flackerten, als die Faust wiederum auf den Tisch schlug. »Du bist zweiundzwanzig Jahre alt. Es wird Zeit, dass du erwachsen wirst.«
Henry trat hoch erhobenen Hauptes vom Tisch zurück und reckte entschlossen das Kinn vor. »Ich bin erwachsen genug, um zu wissen, dass ich niemals ein Soldat oder Geistlicher sein werde«, sagte er steif. »Und was den Künstler betrifft, den du so verächtlich abtust, so ist er soeben von Ihrer Majestät beauftragt worden, ihr Porträt zu malen.«
Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken, um das Zittern zu unterdrücken, und starrte seinem Vater entschlossen ins Gesicht. »Thomas hat den Beruf des Politikers ergriffen; das war seine Entscheidung. Du hast dein Geld mit Baumwollspinnereien und Zechen verdient. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. All das hier« – er deutete mit weiter Gebärde in den getäfelten Raum, auf Kristall und feines Eichenholz –, »all das hier wird niemals mir gehören, und als jüngerer Sohn muss ich meinen eigenen Weg gehen dürfen. Warum kannst du mich nicht so akzeptieren, wie ich bin, und es dabei belassen? Dies ist ein alter Streit, und ich habe ihn mehr als satt.«
»Wie kannst du es wagen?« Sir Oswald war puterrot angelaufen, und in seinen grauen Augen blitzte stählerne Wut. »Ich hätte gute Lust, dir eine Tracht Prügel zu verabreichen«, schnarrte er.
Henry knirschte mit den Zähnen, und nur das Zucken in seiner Wange ließ seine Wut erkennen, mit der er sich an die schrecklichen Schläge erinnerte, die er als Junge von seinem Vater bekommen hatte. »Ich bin kein Kind mehr, Vater«, sagte er eisig. »Du kannst mich nicht mehr durch Prügel gefügig machen.«
»Geh mir aus den Augen!«, brüllte Sir Oswald.
Henry verspürte einen Moment lang den Drang, seinem Vater von Maureen zu erzählen, aber Sir Oswald brannte auf einen Streit, und es hatte keinen Sinn, noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Ohne ein weiteres Wort verließ Henry das Zimmer.
»Schaff deinen Arsch hier raus, Paddy Dempster, und komm erst wieder, wenn du nüchtern bist!«
Eine kräftige Hand versetzte Paddy einen Stoß in den Rücken, sodass er über die Türschwelle des Dubliner Pubs stolperte. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten, und nur der Arm, den das Mädchen um seine Taille geschlungen hatte, bewahrte ihn vor einem Sturz in die Gosse. Es war nicht das erste Mal, dass er aus einer Wirtschaft hinausgeworfen wurde, und mit seinen neunundzwanzig Jahren rechnete er nicht damit, dass es das letzte Mal sein würde. Das viele Bier, das er getrunken hatte, forderte seinen Tribut: Er musste sich übergeben, und das Erbrochene besudelte seine Stiefel und die Hosenaufschläge, ohne dass er darauf achtete.
»Dann geb ich mein Geld eben anderswo aus!«, schrie er und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. »Von deinem stinkigen Ale muss ich sowieso kotzen.«
»Du musst aber Glück haben, wenn dir noch irgendeiner was gibt, du besoffenes Schwein«, gab der Wirt zurück und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Paddy stand schwankend da und starrte stupide die Tür an. »Ich bring ihn um«, knurrte er und ballte die fleischigen Fäuste.
»Komm schon, Paddy! Du hast mir ein schönes Abendessen versprochen, und mein Magen glaubt schon, dass man mir die Kehle durchgeschnitten hat.« Das Mädchen schmiegte den Kopf an seine Schulter, schlängelte den Arm unter den seinen und zog ihn voran.
Paddy stierte auf sie hinunter und versuchte sich zu erinnern, wer zum Teufel sie war und warum er ihr ein Essen versprochen hatte. Sein verschwommener Blick milderte die harten Konturen ihres Gesichts, sodass ihr verfilztes Haar und der schmutzige Hals beinahe ansprechend aussahen. Aber er konnte sie noch durch den eigenen Gestank riechen, und die Reste des Biers, das er getrunken hatte, brodelten in seinem Bauch.
»Komm schon«, drängte sie, und ihre Stimme wurde schrill. »Oder willst du mich die ganze Nacht warten lassen?«
»Hau ab!«, knurrte er. »Lass mich in Ruhe!« Er bog ihre Krallenfinger auf und stieß sie von sich. Er war ein großer, starker Mann, zumal wenn das Gewicht mehrerer Pints erschwerend hinzukam. Das Mädchen war nicht darauf vorbereitet; es fiel gegen die Mauer der Schenke und rutschte in die Gosse.
Paddy trabte schwerfällig davon. Er musste weg von ihr. Fort vom Lärm des Pubs und von dem Gestank der Gasse. In seinem Magen rumorte es, die Galle schmeckte bitter in seinem Mund, und das giftige Gekreische verfolgte ihn durch die Dunkelheit.
»Du schuldest mir noch was«, schrie das Mädchen und sprang ihm auf den Rücken. Es versuchte ihm die Augen zu zerkratzen, und seine Beine umklammerten ihn wie eine Schraubzwinge. »Bezahl mich, du Schwein, oder ich rufe die Polizei!«
Er schüttelte die Zudringliche ab, wie ein Hund das Regenwasser aus seinem Fell schüttelt, und sie fiel wieder auf das harte Kopfsteinpflaster. »Gib mir mein Geld!« Sie war gleich wieder auf den Beinen und sprang ihn von neuem an. »Hilfe! Polizei! Polizei! Ich werde beraubt!«, schrie sie, und er stieß sie zurück und wollte weiter die Gasse hinunterwanken. »Haltet den Dieb!«
Paddy sah Rot. Eine scharlachrote Wolke erfüllte seine benebelte Welt und drang in seinen schmerzenden Kopf. Er musste ihr das Maul stopfen, musste sie zum Schweigen bringen, ehe die Polizei tatsächlich auftauchte. Er fuhr herum, und seine große Hand packte den dürren Hals und erstickte den Schwall von Vitriol, der ätzend durch seinen Kopf flutete. Und dann drückte er zu, drückte und drückte. Er brauchte Ruhe, Frieden, Zeit zum Nachdenken, Zeit, die schrecklichen Schmerzen in Bauch und Kopf zu lindern – und erst als sie aufhörte zu zappeln, wurde ihm klar, dass etwas schief gegangen war.
Verwirrt und fasziniert starrte er die Hure an, als ihr die Zunge aus dem Mund und die Augen aus den Höhlen quollen. Er spürte, wie sie erschlaffte, und ließ sie los. Wie eine Lumpenpuppe fiel sie zu Boden. Er stieß sie vorsichtig mit der Stiefelspitze an, und als sie sich nicht rührte, grunzte er in dumpfem Entsetzen. Jetzt war er geliefert. Die Polizei würde jeden Augenblick hier sein, und bei seinem Vorstrafenregister würden sie ihm diesmal ganz sicher den Strick um den Hals legen.
Er warf einen kurzen Blick über die Schulter, als Polizeipfeifen und das Getrappel von schweren Stiefeln durch die Mietshausgassen hallten. Die Biernebel waren verflogen. Nichts macht einen Mann so nüchtern wie die drohende Henkersschlinge, dachte er grimmig.
Für einen großen Mann bewegte er sich sehr behände durch die Dunkelheit, ein Talent, das durch ein zwanzigjähriges Leben außerhalb der Gesetze geschärft worden war, eine Fähigkeit, die er schon in frühester Jugend hatte erlernen müssen, um auf der Straße zu überleben.
Paddy schlängelte sich durch das labyrinthische Gewirr von verwahrlosten Häusern und lärmerfüllten Schenken, bis er zum Fluss kam. Der Liffey glänzte wie geschmolzenes Blei unter den jagenden Wolken und einem übellaunigen Mond. Flink kletterte Paddy über die niedrige Steinmauer und versteckte sich in einem schmalen Kanal unter einer Brücke. Er roch den fauligen Müll am Ufer und das kalte, trüb grüne Wasser, das in öliger Lautlosigkeit vorüberfloss.
So hockte er in seinem klammen, stinkenden Versteck und schlang fröstelnd die Arme um sich. Seine Jacke war abgetragen, das Hemd darunter dünn und geflickt. Was würde er nicht geben für die elende kleine Kammer in den Welsh Valleys – für die kühle Finsternis in einer Kohlenzeche, wo die Arbeit ihm Geld in die Taschen und Essen in den Magen brächte! Warum zum Teufel war er nach Irland zurückgekommen?
Er zog eine Grimasse, vergrub das stoppelbärtige Kinn im Kragen und betrachtete den Mond, der sich im schmutzigen Wasser spiegelte. London hatte sich als zu gefährlich erwiesen, und er war dem Gesetz zu oft um Haaresbreite entronnen, als dass er sein Glück noch weiter auf die Probe hätte stellen wollen. Er hatte sich nach Wales verzogen und dort in einem winzigen Zechendorf in den Bergen Arbeit und Kameraden gefunden, aber seine Langfinger hatten nicht lange stillhalten können, und bei einem Einbruch in eine in der Nähe gelegene Schenke wäre er beinahe ertappt worden.
Mit schwieligen Händen rieb er sich das Gesicht. Irland hatte seine Zuflucht werden sollen; er hatte zu Menschen heimkehren wollen, denen etwas an ihm lag. Aber Mam war tot, und seine Geschwister waren auf der Suche nach dem Glück in alle Himmelsrichtungen verschwunden. In ihrem alten Cottage wohnten Fremde, und niemand wusste, was aus Dad geworden war. Er war einfach eines Morgens fortgegangen und nicht mehr zurückgekommen.
»Ich muss hier weg«, flüsterte er. »Muss einen Weg finden, irgendwas aus mir zu machen, ehe der Henker mich erwischt.«
Kate Kelly hielt das Baby fest im Arm, als sie aus dem Schatten hinter dem Vorhang hervortrat und dem Mann nachschaute, der da die Gasse hinunterrannte. Ihr Herz hämmerte, und sie hatte einen trockenen Mund. Sie hatte sein Gesicht im Lichtschein des Pubs ganz deutlich gesehen, und sie wusste, sie würde es niemals vergessen.
Ein Schauder überlief sie, als sie den Blick der reglosen Gestalt zuwandte, die in der verdreckten Gasse lag. Das Mädchen sah so jung aus, so verwundbar. Seine schmutzigen Haare schwammen im Regenwasser der Gosse, und die kleinen Handflächen waren gen Himmel gerichtet. Kate bekreuzigte sich und murmelte ein Gebet, als Polizisten und Soldaten herbeigelaufen kamen. Um Gottes willen – das Mädchen war doch tot! Mussten sie es behandeln wie ein Stück Fleisch?
Kate fuhr zusammen, als einer der Männer auf blickte. Mit schmalen Augen hielt er Ausschau nach Zeugen, und Kate wich in den Schatten zurück. Wenn sie ihnen erzählte, was sie gesehen hatte, würde die Familie Schwierigkeiten bekommen – und die konnte sie nicht gebrauchen. Sie hatten schon genug Schwierigkeiten.
Das Baby wimmerte im Schlaf, und sie drückte den Kleinen an sich und murmelte tröstende Worte in das daunenweiche Haar. Ihr kleinster Bruder war ein Schatz, aber seine Ankunft hatte Mam erschöpft. Dad war nicht zu gebrauchen, wenn es darum ging, sich um die anderen neun Kinder zu kümmern, und so lastete die Verantwortung dafür, dass alles reibungslos lief, bis es Mam wieder besser ginge, auf Kates schmalen Schultern. Dabei hatte Dad keine Angst vor harter Arbeit; er sorgte für seine stetig wachsende Familie und war aschgrau vor Müdigkeit, wenn er abends aus der Gerberei nach Hause kam.
Sie legte das Baby auf die Matratze zu den anderen schlafenden Kindern und kehrte zum Fenster zurück. Die Tote war weggeschafft worden, und die düstere Gasse lag da wie immer.
»Was siehst du da? Mir war, als hätte ich Geschrei gehört.«
Die leise Stimme ließ Kate zusammenschrecken, und sie fuhr herum. »Du solltest schlafen«, sagte sie sanft. Mam hatte dunkle Ringe um die Augen, und ihre Haut schimmerte beinahe wie Alabaster.
»Ach, ich werde noch lange genug schlafen, wenn ich erst tot bin.« Finola Kelly winkte ab und zog sich den dünnen Schal fester um die schmalen Schultern. »Was ist denn da unten vorgegangen? Wieder eine Katzbalgerei unter den Huren?«
Kate erzählte ihr, was sie gesehen hatte, ohne weiter auf den Mann einzugehen, den sie genau hätte beschreiben können. »Geh wieder ins Bett«, sagte sie, um das Thema zu wechseln. »Dad kommt gleich, und er wird böse, wenn er dich so früh auf den Beinen findet.«
»Dein Dad wird für nichts mehr Augen haben. Er wird so müde sein, dass er im Stehen einschläft.« Finola Kelly packte ihre Tochter bei den Armen und schaute ihr tief in die Augen. »Pass auf, dass du nicht in die gleiche Falle tappst wie ich, Kate«, sagte sie eindringlich. »Verschwinde von hier, bevor diese Stadt dich ins Verderben stürzt.«
»Mam?« Kate wich vor dem wilden Blick ihrer Mutter zurück. So hatte sie sie noch nie reden gehört. »Ist es das, was wir alle für dich sind – eine Falle?«
»Ach, Kind, du bist alt genug, um zu verstehen, was ich meine. Die Welt ändert sich, und du bist noch jung genug, um das Beste draus zu machen.« Mit ihrer rauen Hand strich sie Kate eine dunkle Haarsträhne aus dem Gesicht. »Du bist achtzehn – älter, als ich war, als ich dich geboren habe. Du darfst nicht den gleichen Fehler machen wie ich und glauben, dass das Leben nichts weiter zu bieten hat. Auf deinen Schultern sitzt ein kluger Kopf, Kate. Vergeude deinen Verstand nicht!«
»Ich weiß, dass wir es nicht leicht haben«, stammelte Kate. »Aber wenn ich erst wieder in der Gerberei arbeiten kann, wird das zusätzliche Geld uns helfen.«
»Davon rede ich nicht«, fuhr Finola sie an. »Du musst Irland verlassen. Fahr übers Meer – und weiter, wenn du Lust hast. Bleib nicht hier, wo du nur verrottest wie wir andern, Kate, denn für uns Katholiken wird es hier nicht besser.«
Kate verspürte ein erregendes Kribbeln, aber auch einen Anflug von Angst. Die Zimmerchen hier in dieser Dubliner Gasse waren alles, was sie kannte. Ihre Familie zu verlassen, übers Meer zu fahren und unter Fremden ein neues Leben zu beginnen, das war ein Gedanke, den sie nie ernsthaft in Betracht gezogen hatte – bis jetzt. Nun bekam ihre Phantasie Flügel. Von Amerika und von den neuen Kolonien in Australien hatte sie schon gehört; es gab Familien, deren Söhne und Töchter sich dort hingewagt hatten und Geld nach Hause schickten. Sie hatte den Geschichten von den endlosen Weiten gelauscht, von der Luft, die so rein und frisch war, dass einem die Lunge wehtat, von den Möglichkeiten, die sich in diesen fernen Gegenden boten, wo Herkunft und Religion niemanden daran hinderten, sein Glück zu machen.
Aber die Vernunft sagte ihr, dass sie nur träumte. Langsam schüttelte sie den Kopf. »Ich weiß nicht …«
Finola legte die Hand auf den Arm ihrer Tochter. Ihre Stimme war leise, aber der eindringliche Ton war nicht zu überhören. »Mach dir klar, wie deine Zukunft aussieht, wenn du bleibst«, flüsterte sie. »Mord und Totschlag auf der Straße, ein Haus, das du mit drei Familien teilst, kein Geld. Wenn du hier bleibst, sitzt du in der Falle. Du kriegst jedes Jahr ein Baby, und deine Seele zerfällt zu Staub.«
Sie schüttelte den Kopf. In ihren dunklen Locken schimmerten die ersten grauen Strähnen, als sie sich zu ihren schlafenden Kindern umdrehte. »Ich möchte, dass du mehr bekommst als das hier, Kate.«
Kate betrachtete ihre Geschwister. Sie lagen dicht nebeneinander wie Heringe auf einer Platte, und sie wusste, dass die Matratze bis zum Morgen durchnässt sein würde. Sie holte tief Luft, und zum ersten Mal bemerkte sie, wie feucht und verkommen die beiden Kammern unter dem Dach des dicht bevölkerten Hauses waren. Im neuen Licht der Verheißung wurde ihr das durchdringende, überwältigende Gemisch der Gerüche von ungewaschenen Körpern und schalen Kochdünsten plötzlich bewusst, das den Schmutz der Armut und den scharfen Gestank uringetränkter Windeln und Wolldecken überlagerte. »Aber wie –«
»Ich habe nicht nur untätig herumgelegen«, sagte Finola in einem munteren Ton, der jedoch nicht über ihre Müdigkeit hinwegtäuschen konnte. »Ich habe ein Wörtchen mit Father Pat gesprochen, und es gäbe da eine Pfarrhausstelle in Liverpool.«
Kate schaute ihre Mutter an, und die Hoffnung besiegte ihre Angst vor dem Unbekannten. »In Liverpool?« Das waren nicht die Kolonien, aber dennoch war sie noch nie so weit gereist.
»Sie brauchen dort eine Haushälterin.« Finola legte den Arm um die Taille ihrer Tochter. »Die Arbeit ist leichter als in der Gerberei, und du bekommst drei Mahlzeiten am Tag. Ein guter Anfang für ein neues Leben, fern von hier.«
Kate starrte aus dem Fenster auf das feuchte Kopfsteinpflaster vor dem Haus. Es war, als habe es das Mädchen dort unten nie gegeben; da war keine Spur von ihm und niemand, der trauerte. Der Mörder war längst fort, ein anonymes Gesicht in der Finsternis verlorener Hoffnungen, die diese Gassen erfüllte. Sie wandte sich zu ihrer Mutter um und sah die Erschöpfung in ihren Augen und in den tiefen Falten um den Mund. Jawohl, entschied sie. Es war Zeit zu gehen, wenn sie noch etwas aus ihrem Leben machen wollte.
Die Frauen waren durchnässt, die Säume ihrer Röcke aus selbst gewebtem Tuch schwer von dem Schlamm, in dem sie standen und auf Maureen warteten. Ihre Blicke waren finster, ihre Münder schmal vor Wut. In wortloser Eintracht umringten sie sie.
Maureen bemühte sich, ihre Angst zu verbergen, und schrie gegen den Wind: »Was wollt ihr?«
Das Kreischen der Möwen und das Tosen der Brandung an der Hafenmauer waren das Einzige, was sie hörte, als die Frauen den Ring enger zogen.
Verzweifelt schaute Maureen in die Gesichter dieser Frauen, die sie schon ihr ganzes kurzes Leben lang kannte. Das waren die Mädchen, mit denen sie als Kind gespielt hatte, die Frauen, mit denen sie im Torfmoor gearbeitet und die sie für ihre Freundinnen gehalten hatte. Aber in diesen gnadenlosen Blicken war kein Schimmer von Mitleid, keine Spur von Freundschaft – nichts als eine glasige, beinahe puritanische Raserei. Sie umzingelten und bedrängten sie und ließen sie nicht entkommen.
»Bitte«, flehte sie, »was wollt ihr?« Sie suchte den Blick ihrer besten Freundin Regan, und sie wusste, wie die Antwort lauten würde – wusste, welche Strafe sie erwartete. »Warum tut ihr das?«, flüsterte sie.
Regan reckte das Kinn vor. Ihr feuerrotes Haar umgab ihren Kopf wie ein Heiligenschein, und in ihren Augen strahlte fanatische Selbstgerechtigkeit. »Als ob du das nicht wüsstest«, fauchte sie. »Wir haben dich mit diesem englischen Bastard gesehen. Hast dich hingelegt wie eine Hure, und das bist du auch. Du bist hier nicht erwünscht, Maureen O’Halloran.«
Ihr Herz schlug so schnell, dass sie kaum noch atmen konnte. »Dann gehe ich«, stammelte sie. »Lasst mich vorbei.« Sie versuchte einen Schritt vorwärts zu machen.
Ihr Wutgeheul übertonte die Schreie der Möwen, als sie wie die Moorhexen auf sie eindrangen. Hände krallten sich in ihre Kleider, schmutzige Fingernägel zerkratzten sie, und schwere Stiefel traten auf sie ein, während sie ihr die Kleider vom Leib rissen. Maureen konnte sie riechen: ihren Schweiß, ihre ungewaschenen Leiber, ihre nassen Röcke. Sie wehrte sich, aber sie fühlte die scharfen Nägel, die zwickenden, bohrenden Finger und den heißen Atem, der in der kalten Luft dampfte, und verstand die Schimpfworte kaum, die sich wie ätzende Säure über sie ergossen.
Die Angst verlieh ihr ungeahnte Kräfte, und sie kämpfte – Faustschlag um Faustschlag, Stoß um Stoß, Fußtritt um Fußtritt. Aber sie waren zu viele, sie waren stark von der endlosen Arbeit auf dem Feld, und ein unersättlicher Hunger nach dem, was sie für Gerechtigkeit hielten, machte sie noch stärker. Sie packten sie bei den Armen und Beinen, warfen sie zu Boden und drückten ihr Gesicht in die Erde.
»Ich bekomme keine Luft«, schrie sie und versuchte, dem Schlamm zu entrinnen, der ihr in Mund und Nase quoll. Sie wollte den Kopf heben, aber alle Luft entwich ihrer Brust, als jemand ihr auf den Rücken sprang.
Maureen strampelte und schlug um sich. Sie musste die Last auf ihrem Rücken loswerden und Luft in die schmerzende Lunge saugen. Ihr Stiefel fand ein Ziel, und mit leiser Genugtuung hörte sie das Grunzen, das der Tritt hervorrief. Aber die Vergeltung kam auf der Stelle, und ein Fußtritt traf ihre Rippen.
»Halt still, du Biest«, zischte Regan. Sie war es, die auf Maureens Rücken saß, sich vorbeugte und an ihren Haaren riss. »Du entkommst uns nicht. Also nimm deine Strafe entgegen.«
Maureen bog den Kopf in den Nacken; Regan zerrte so heftig an ihren Haaren, dass sie sie gleich ausreißen würde. Ihr Flehen blieb ungehört, sie kümmerten sich nicht um ihr Schluchzen und Sträuben, als sie Scheren zückten und anfingen, ihr die Haare abzuschneiden. Die Scheren waren scharf, und sie gingen achtlos damit um. Bald rieselte das Blut warm über Maureens Gesicht und Hals.
Maureen erstarrte vor Entsetzen; sie hatte Angst, dass eine Scherenspitze ihr ins Auge fahren könnte, und als die Frauen fertig waren und Regan nach einem letzten, bösartigen Kniestoß von ihrem Rücken stieg, blieb sie kraftlos im Schlamm liegen.
Aber die Qual war noch nicht zu Ende. Raue Hände schmierten ihr etwas auf den Kopf und über den Körper, eine strafende Salbung, von dreisten Fingern genüsslich vollzogen. Es brannte in Maureens Schnittwunden, und der intensive Schmerz ließ sie aufschreien. Der Geruch verriet ihr, was es war, und sie wimmerte vor Angst: Teer.
»Feine Federn für eine feine Dame«, schrie eine der Frauen mit hartem Gelächter und öffnete einen Jutesack. Hühnerfedern wirbelten hervor und senkten sich herab. Hände drückten sie an ihrem Körper fest, schmierten sie in die verbliebenen Haarbüschel und bedeckten den misshandelten Leib von oben bis unten damit.
»Reif zum Rupfen«, kreischte eine, und die andern brachen in obszönes Lachen aus. Dann ließen die Frauen sie los, wandten sich ab und marschierten Arm in Arm den Hang hinunter und zum Dorf zurück.
Maureen zog schützend die Knie an die Brust und blieb erschöpft in Schlamm und Regen liegen. Sie war zu zerschunden, um sich zu bewegen, zu schockiert, um zu denken. Die Stimmen verhallten, und bald hörte sie nur noch die Schreie der Möwen, die über ihr kreisten. Der Teer brannte sich in ihre Haut, und der Wind zerrte an den Federn. Noch immer fühlte sie den glühenden Hass der Frauen und ihre bösen, kräftigen Fäuste. Der Gedanke daran, ins Dorf zurückzukehren, war grauenvoll, aber sie wusste, dass sie hier nicht bleiben konnte. Sie wusste, dass sie sich irgendwie säubern musste, bevor der Teer unlösbar auf der Haut klebte.
Schließlich richtete sie sich auf und betastete behutsam ihren misshandelten Kopf. Die Wunden würden verheilen, die Haare nachwachsen – aber vorläufig war sie so unübersehbar gezeichnet wie Kain.
Ihre Kleider lagen in Fetzen um sie herum, und die langen schwarzen Haarsträhnen kringelten sich wie einsame Schlangen im Schlamm. Sie raffte ihren Mantel auf, der gottlob keinen allzu großen Schaden erlitten hatte, legte ihn um die Schultern und zog sich die Kapuze bis über die Augen. Der Mantel war durchnässt, aber er war der einzige Schutz vor den Elementen, den sie hatte.
Es dauerte noch eine Weile, bis sie die Kraft zum Aufstehen fand. Der stechende Schmerz in ihren Rippen ließ sie zusammenfahren, und sie zitterte am ganzen Körper. Sie schlang den Mantel fest um sich und machte sich auf den Weg hinunter ins Dorf. Ihr blieb nichts anderes übrig, als nach Hause zu gehen, aber wie sollte sie ihren Eltern entgegentreten? Ihrem Vater?
Michael O’Halloran war nicht der Mann, der es schätzen würde, wenn seine älteste Tochter ihm Schande machte – zumal wenn der Fehltritt mit einem Engländer begangen worden war. Wenn er den Grund für den Überfall erfuhr, würde er sich nicht hinter seine Tochter stellen. Er war ein stolzer Ire, und sein Hass auf die englischen Grundbesitzer färbte seine Sicht auf das Leben. Maureen wusste, dass er sie nicht trösten würde, im Gegenteil: Er würde seinen Gürtel abnehmen und die Lektion, die ihr heute erteilt worden war, vollenden.
Die Erinnerung an frühere Prügel versetzte sie in Angst und Schrecken, und sie überlegte, ob sie sich irgendwie ins Haus schleichen könnte, ohne dass er sie sah. Aber sie wusste, dass das unmöglich war. Die Hütte hatte nur zwei Zimmer, und sie schlief mit ihren drei jüngeren Schwestern im Alkoven. Selbst wenn Dad auf einer seiner geheimnisvollen Reisen in den Norden wäre, musste sie damit rechnen, dass ihre Mutter am Feuer saß und auf seine Rückkehr wartete.
Maureen schaute zu dem Wald zurück, aus dem sie gekommen war. Vielleicht sollte sie lieber versuchen, sich Teer und Federn im Lough abzuwaschen? Aber gleich verwarf sie diese Idee. Sie würde eine gute halbe Stunde brauchen, um zum Lough Leigh zu kommen, und dazu müsste sie Sir Oswalds Besitz überqueren und riskieren, dass sie Fergus, seinem Jagdhüter, über den Weg lief. Sie war zu erschöpft, zu durchfroren und zu zerschlagen, um eine solche Wanderung in Betracht zu ziehen. Es gab keine andere Möglichkeit: Sie musste nach Hause gehen.
»Henry«, wimmerte sie, und der Regen spülte die letzten Reste ihres Mutes davon. »Wo bist du, wenn ich dich brauche? Hörst du nicht, wie ich dich rufe?«
Sie kämpfte die Tränen nieder und tadelte sich für solche Hirngespinste – denn wie sollte ein Engländer die Wunderlichkeiten des irischen Glaubens an das Mystische verstehen? Natürlich konnte er ihren Schmerz und ihre Ratlosigkeit nicht spüren. Er war nur ein Mensch – und ein Fremder, wenn es darum ging, irisches Denken wirklich zu verstehen. Sie raffte den Mantel fester um sich und setzte ihren beschwerlichen Weg zum Fischerdorf fort.
Das Steinhäuschen war eines von fünfen in einer kurzen Gasse am Steilhang oberhalb des Hafens. Das Strohdach war reparaturbedürftig, aber die Fenster waren sauber, und die Tür war frisch gestrichen. Das leise Muhen der Milchkuh kam aus dem Stall neben dem größeren der beiden Zimmer, und die Hühner gackerten verärgert über die Störung, als sie die Hinterpforte öffnete und den schlammigen Hof betrat. Der Lichtschein des Herdfeuers flackerte im Fenster, und sie spähte hinein.
Bridie O’Halloran saß zwischen trocknenden Wäschestücken an ihrem gewohnten Platz am Kamin und hatte Nähzeug auf dem Schoß, während sie mit dem Fuß die roh gezimmerte Holzwiege schaukelte, in der das drei Monate alte Baby schlief. Ihre Augen waren dunkel vor Mattigkeit, und Altersfalten durchzogen ihr schmales Gesicht, das nicht vermuten ließ, dass sie erst dreiunddreißig Jahre alt war.
Maureen biss sich auf die Lippe. Dad war nirgends zu sehen. Vielleicht konnte sie sich Mam anvertrauen?
Bridie blickte von ihrer Handarbeit auf, als kalter Wind und Regen mit ihrer ältesten Tochter in die Stube drangen. Sie schrie auf. »Heilige Mutter Gottes! Was um alles in der Welt …?« Das Nähzeug fiel zu Boden, und das Baby in der Wiege war vergessen, als sie von ihrem Schaukelstuhl aufsprang.
Maureen schloss die Tür und lief zum Feuer. Sie streckte die Hände der Wärme entgegen, und sie merkte, dass sie nicht aufhören konnte zu zittern. Aber es war nicht nur die Kälte, die sie zittern ließ – es war der Gedanke an Dads Heimkehr. »Mam, es tut mir Leid«, brachte sie stockend hervor. »Es tut mir so Leid. Aber ich wusste nicht, wohin ich sonst gehen sollte.«
Bridie streckte die Hand aus und schlug die Kapuze zurück. Dann presste sie die bebenden Hände an den Mund und riss entsetzt die Augen auf. »Was hast du getan?«, flüsterte sie. »Lieber Gott im Himmel, was hast du getan?«
»Das ist nicht so wichtig, Mam.« Hastig holte Maureen den Zuber, der an der Tür hing, und füllte ihn mit heißem Wasser aus dem Kessel über dem Herd. »Ich muss sauber sein, bevor Dad nach Hause kommt. Wenn er mich so sieht, wird er …«
Angst blitzte in Bridies Augen auf, und schluchzend bekreuzigte sie sich. »Schnell, schnell, er wird bald wieder hier sein. Er ist nur auf ein Bier zu Donovan’s gegangen.«
Mit steifen Fingern legte Maureen den Mantel ab.
Bridies Augen wurden schmal, und sie bekreuzigte sich noch einmal. »Von wem ist es?«, fauchte sie mit eisiger Verachtung.
Maureen fing an, die Federn aus der Schmiere zu zupfen, die ihren Körper bedeckte. In ihrer Hast war sie ungeschickt, und immer wieder huschte ihr Blick zur Tür. »Von Henry«, gestand sie.
»Von Hen…? Der Herr sei uns gnädig! Weiß er es?« Bridies Stimme klang schneidend, und in ihren Augen funkelte so etwas wie Abscheu.
»Noch nicht. Ich wollte es ihm heute Abend sagen.« Maureen warf die Federn ins Feuer und sah zu, wie die Flammen sie verschlangen. »Aber er konnte nur einen Augenblick bleiben, und –«
Die Ohrfeige war ebenso unerwartet wie heftig. Maureens Wange glühte, und ihr Kopf füllte sich mit dunklen Wolken. »Du dummes Luder!«, fuhr Bridie sie an. Sie packte Maureen bei den Armen und schüttelte sie, und ihre Stimme wurde lauter. »Du bist nicht besser als eine Hure! Ein dummes kleines Flittchen, das von ihm und seinesgleichen benutzt und weggeworfen wird. Schöne Worte und feines Benehmen, das gefällt dir vielleicht, aber ihm liegt nichts an dir – du bist ein Spielzeug, mit dem er sich die Zeit vertreibt, wenn er nichts Besseres zu tun hat.«
Dann kamen ihr die Tränen, und sie schlang sich die Arme um die magere Taille. »Dein Dad wird dich umbringen«, flüsterte sie. »Er bringt uns beide um, wenn er es erfährt. Du musst fort. Auf der Stelle. Bevor er zurückkommt.«
Maureen warf einen bangen Blick zur Tür, bevor sie sich in das heiße Wasser sinken ließ und anfing, sich den Schmutz vom Leib zu schrubben. »So kann ich nicht gehen«, stieß sie hervor und biss die Zähne zusammen. Die Kombination aus Teer, Kratzwunden, Blutergüssen und Seifenlauge war fast unerträglich – und so kurz nach dem Überfall war die Reaktion ihrer Mutter niederschmetternd.
»Was ist denn, Mam?« Die schlaftrunkene Stimme kam aus dem Alkoven, und dann erschienen die drei kleinen Mädchen hinter dem Vorhang.
»Ab ins Bett«, befahl Bridie, und ihr scharfer Ton duldete keinen Widerspruch. Sie warf bange Blicke auf Uhr und Hintertür, denn sie rechnete damit, dass ihr Mann jeden Augenblick zurückkehren und sie ertappen würde, während sie die letzten Federn in eine alte Zeitung wickelte und ins Feuer warf. Sie begann vor sich hin zu murmeln – die Worte des Rosenkranzgebets strömten unverständlich über ihre Lippen –, griff nach der Wurzelbürste und machte sich daran, Maureens Rücken zu reinigen.
»Sei still!«, zischte sie, als Maureen protestierend aufschrie. »Du bist ganz allein schuld. Wenn ich daran denke, wie oft ich dir eingeschärft habe, dich rein zu halten. Der Himmel weiß, was Father Paul dazu sagen wird.«
»Das geht ihn einen verdammten Dreck an«, erwiderte Maureen und unterdrückte einen Schmerzensschrei, denn ihre Mutter schrubbte ihr den Rücken mit einer Heftigkeit, die sicher nicht notwendig war.
Wieder bekam sie einen Schlag, diesmal an den geschundenen Hinterkopf. »Hüte deine Zunge, du!«, knurrte Bridie. »Es ist schon schlimm genug, dass du Schande über dieses Haus bringst, du musst nicht auch noch unflätige Reden führen.«
Maureen sparte sich jede Entschuldigung; wenn Mam in dieser Stimmung war, hielt man am besten den Mund.
»Wer hat dir das angetan?«, fragte Bridie; sie sprach leiser, als habe sie sich plötzlich daran erinnert, wie dünn die Mauern der Cottages waren.
»Jede Frau, die noch dazu fähig war, den Berg hinaufzusteigen«, antwortete Maureen und nahm ihrer Mutter die Bürste weg, um sich die Arme zu waschen. »Und es hat ihnen Spaß gemacht. Hättest ihre Gesichter sehen sollen. Sogar Regan Donovan war dabei.«
»Du weißt, was das bedeutet, oder?« Grimmig raffte Bridie saubere Sachen von dem Stapel neben dem Herd. »Man wird uns meiden. Dabei ist es auch so schon schwer genug, Arbeit zu ergattern.« Ihre abgearbeitete Hand ruhte kurz auf der schmalen Schulter ihrer Tochter – ein flüchtiger Augenblick der Vertrautheit, wie ihn nur zwei Frauen teilen konnten.
Die Berührung verriet Maureen, dass ihre Mutter sich sehr wohl um sie sorgte, aber sie ahnte auch, dass Bridie nicht wusste, wie sie mit diesem schrecklichen Geschehen umgehen sollte, das unfassbar in ihr Leben eingebrochen war.
»Warum nur, Maureen? Bei allem, was heilig ist: Warum bist du mit ihm gegangen? Du wusstest doch, welche Strafe dich erwartet, wenn du ertappt wirst. Erinnere dich, was mit Finbars Tochter passiert ist, nachdem sie sich mit dem englischen Soldaten eingelassen hatte.«
Maureens Tränen waren getrocknet, aber sie war am Ende ihrer Kräfte. »Es tut mir Leid, Mam«, flüsterte sie. »Aber ich liebe ihn.« Sie schaute in das schmale, sorgenvolle Gesicht ihrer Mutter und versuchte zu lächeln. »Und er liebt mich. Er hat mir versprochen, dass wir immer zusammen sein werden.«
Bridie verschränkte die Arme und funkelte ihre älteste Tochter an. »Wenn du das glaubst, bist du noch dümmer, als ich dachte.«
Die Tür flog krachend gegen die Wand, und die beiden fuhren zusammen. Bridie sprang vom Zuber zurück und wurde totenbleich. Maureen packte das kleine Handtuch und versuchte damit ihre Nacktheit zu bedecken.
Die Atmosphäre war elektrisiert, und die Stille, die auf Michael O’Hallorans Erscheinen folgte, war von Angst erfüllt.