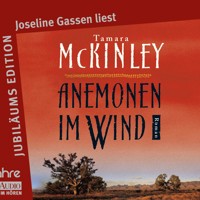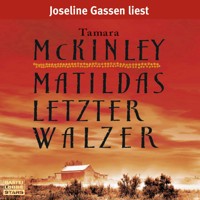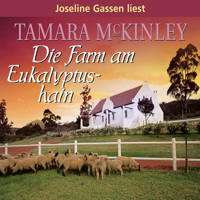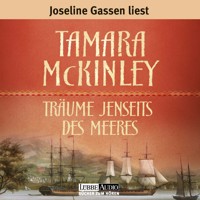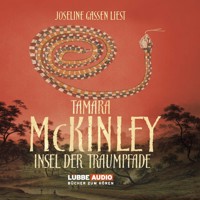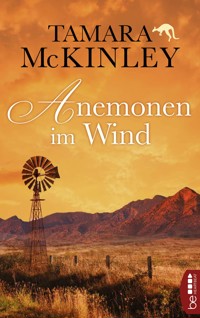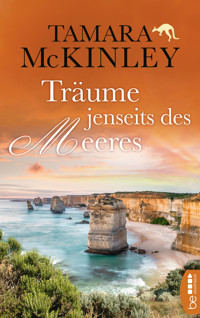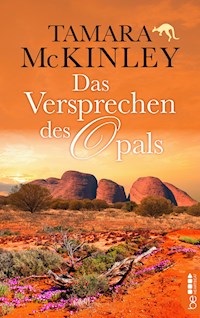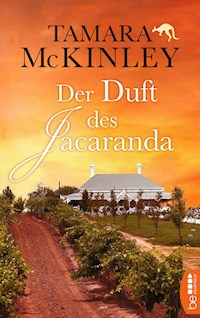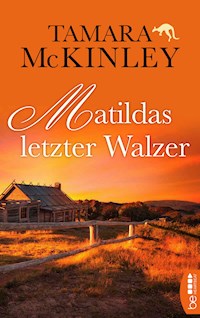7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ozeana-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Von den Gipfeln der Blue Mountains zu den Minen der Goldsucher - eine unvergessliche Reise ins Land der roten Erde
Noch ahnt die junge Ruby nicht, dass in ihrem australischen Paradies Gefahren lauern. Doch das Goldfieber verführt ihren Mann James, und er verlässt sie. Ganz allein muss die junge Frau nun die Schaffarm führen. Nur der attraktive Finn unterstützt sie bei der Bewirtschaftung des Hofs. Ruby nimmt den Kampf ums Überleben auf und versucht gleichzeitig, ihre einzige Freundin, eine Aborigine, vor den Übergriffen der Weißen zu schützen. Aber dann kehrt James zurück - und beschwört aus Eifersucht eine Katastrophe herauf ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 687
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
ERSCHIENENE TITEL DER AUTORIN
Die Ozeana-Trilogie:
Band 1: Träume jenseits des Meeres
Band 2: Insel der Traumpfade
Band 3: Legenden der Traumzeit
Anemonen im Wind
Das Land am Feuerfluss
Das Lied des Regenpfeifers
Das Versprechen des Opals
Der Duft des Jacaranda
Der Himmel über Tasmanien
Der Zauber von Savannah Winds
Die Farm am Eukalyptushain
Jene Tage voller Träume
Matildas letzter Walzer
ÜBER DIESES BUCH
Von den Gipfeln der Blue Mountains zu den Minen der Goldsucher – eine unvergessliche Reise ins Land der roten Erde
Noch ahnt die junge Ruby nicht, dass in ihrem australischen Paradies Gefahren lauern. Doch das Goldfieber verführt ihren Mann James, und er verlässt sie. Ganz allein muss die junge Frau nun die Schaffarm führen. Nur der attraktive Finn unterstützt sie bei der Bewirtschaftung des Hofs. Ruby nimmt den Kampf ums Überleben auf und versucht gleichzeitig, ihre einzige Freundin, eine Aborigine, vor den Übergriffen der Weißen zu schützen. Aber dann kehrt James zurück – und beschwört aus Eifersucht eine Katastrophe herauf …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
ÜBER DIE AUTORIN
Tamara McKinley wurde in Australien geboren und verbrachte ihre Kindheit im Outback des fünften Kontinents. Heute lebt sie an der Südküste Englands, aber die Sehnsucht treibt sie stets zurück in das weite, wilde Land, dessen Farben und Düfte sie in ihren Büchern heraufbeschwört. Mit ihren großen Australien-Romanen hat sie sich eine weltweite Fangemeinde erobert.
Homepage der Autorin:
Tamara McKinley
Legenden derTraumzeit
Aus dem australischen Englisch von Marion Balkenhol
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Tamara McKinley
Titel der englischen Originalausgabe: »Legacy«
Published by arrangement with Hodder & Stoughton Ltd., London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2009/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Covermotive: © shutterstock/Elenamiv; © shutterstock/Nokuro
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0215-7
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Meine Reise in die Zeit der ersten Besiedlung Australiens, die mit »Träume jenseits des Meeres« begann, war eine Fahrt auf der Achterbahn. Der schwierigste Teil einer jeden Reise ist der erste Schritt, doch nachdem ich ihn getan habe und am Ziel angekommen bin, habe ich das Gefühl, wirklich etwas geleistet zu haben. Ich wusste nicht so recht, ob ich ein so ehrgeiziges Projekt schaffen würde, doch ich habe in den letzten drei Jahren so viel gelernt und weiß inzwischen wirklich zu schätzen, wie viel ich den Menschen verdanke, die mich lieben und mir Mut machen, auch wenn es zäh vorangeht.
Diesen Menschen – und sie wissen, wer gemeint ist – widme ich »Legenden der Traumzeit«. Ohne sie wäre ich nicht so gesegnet.
Das Vermächtnis von Helden ist die Erinnerung an
PROLOG
Tiefe Verbundenheit
Moonrakers Farm, New South Wales, 1835
Nell Penhalligan erwiderte den Blick ihrer Enkelin und bemühte sich vergeblich um eine finstere Miene. Ruby war ein entzückendes Kind mit einem passenden Namen, denn sie hatte rotes Haar und ein aufbrausendes Temperament. Sie war so wissbegierig und herrisch, wie ihre Mutter Amy mit fünf Jahren gewesen war, und es fiel Nell schwer, angesichts Rubys entschlossenen forschenden Blicks nicht zu lächeln. »So zu starren ist unhöflich«, sagte sie milde.
»Du bist heute sehr alt geworden, Grandma, nicht wahr?« Sie legte den Kopf schief, und die blauen Augen musterten sie eindringlich.
Nell streckte den üppigen Busen vor. »Ich bin siebzig geworden«, sagte sie stolz.
»Das ist noch gar nichts«, schaltete Alice Quince sich ein. »Ich bin schon vierundsiebzig.«
Nell betrachtete die kleine Frau an ihrer Seite. »Ja, aber ich bin gesünder«, entgegnete sie. »Und ich arbeite noch von morgens bis abends.«
»Phh!« Alice schob einige verirrte weiße Haarsträhnen unter ihre Haube zurück. »Das bisschen Waschen und Bügeln ist doch keine Arbeit«, sagte sie herablassend. »Ich helfe noch immer bei der Schafschur mit.«
»Stehst im Weg rum, besser gesagt«, murmelte Nell.
Das Kind hörte neugierig zu. »Warum streitest du dich mit Tante Alice, Grandma?«
»Weil sie die meiste Zeit Unsinn redet«, schnaubte Nell und zog sich den dünnen Schal fester um die runden Schultern. Trotz der brennenden Sonne war ihr kalt. Sie hätte ihr dickeres Tuch mitnehmen sollen, doch sie würde nicht darum bitten – dann würde Alice garantiert spötteln, dass sie auch gar nichts aushalte.
»Und du nicht?«, höhnte Alice. »Du stopfst den Kopf des Kindes mit lauter Quatsch voll – Sachen, die es unmöglich begreifen kann.«
Nell blinzelte Ruby zu, die sie anstrahlte. »Ruby und ich verstehen uns blendend«, erklärte sie. »Besser, sie erfährt die Geschichten von mir als eine entstellte Version von Fremden.«
»Ich glaube kaum, dass es angebracht ist, ihr etwas über deine Zeit als Strafgefangene zu erzählen«, murmelte Alice vor sich hin, während sie die knochigen Schultern als Zeichen ihrer Missbilligung straffte. »Vor allem, wenn man bedenkt, warum du verschifft wurdest.« Ihr funkelnder Blick sprach Bände.
Nells Leben als Londoner Hure hatte mit ihrer Ankunft in Australien geendet. »Du weißt genau, dass ich ihr so was nicht erzähle«, fuhr sie Alice an.
Ruby kletterte auf Nells breiten Schoß und schmiegte sich an sie. »Mir gefallen Grandmas Geschichten.« Sie schaute zu Nell auf. »Erzähl mir, wie Tante Alice beinahe von einem Dingo gefressen wurde und wie du ihn totgeschossen hast! Das ist gruselig.«
Alice klappte ihren Fächer auf. »Ich erzähle die Geschichte viel besser als du«, brummte sie. »Schließlich hat der Dingo mich verfolgt.«
»Ja, aber du würdest heute nicht hier stehen, wenn ich nicht so eine gute Schützin wäre«, gab Nell zurück. »Wird es nicht Zeit für dein Nachmittagsschläfchen?«
Alice verengte die braunen Augen zu Schlitzen. »Nicht alle schnarchen sich durch den halben Tag«, konterte sie und erhob sich mühsam mit raschelnden Röcken, die im Sonnenlicht blauschwarz glänzten. »Ich bleibe nicht hier sitzen, während du dir das Ganze zurechtspinnst. Deine Tochter Sarah braucht Hilfe, sie teilt Tee aus.«
Nell sah ihrer Freundin nach, wie sie über die Lichtung humpelte und vorsichtig die Treppe vor dem Haus überwand. Sie wurden beide gebrechlich; obwohl keine von ihnen auch nur im Traum daran dachte, es zuzugeben. Ja, trotz ihres ständigen Gezänks hatte ihr Witwenstand sie im Laufe der Jahre einander nähergebracht, und inzwischen waren sie wie Schwestern. Das Kind auf ihrem Schoß bewegte sich, und sie zuckte zusammen. Ihre Gelenke schmerzten, selbst unter Rubys Fliegengewicht beklagten sie sich. »Gib mir einen Kuss zum Geburtstag, Ruby, und dann geh und hilf deiner Mum!«
»Aber ich will eine Geschichte hören«, schmollte sie.
»Später«, versprach Nell.
»Ich hab dich lieb, Grandma, und Tante Alice auch. Bitte, sei nicht sauer auf sie, denn sie ist wirklich so alt! Bindi sagt, er hört, wie die Geister für sie singen.« Das Kind zog die Stirn kraus. »Aber ich höre niemanden singen, du, Grandma?«
Als Ruby ihr die Arme um den Hals schlang und ihre Wange küsste, überlief Nell ein kalter Schauer. Sie würde mit Bindi reden. Wie konnte dieser Aborigine es wagen, dem Kind mit seinem Aberglauben Angst einzujagen?
»Ruby, mein Liebes«, murmelte sie. »Den einzigen Gesang, den du heute hörst, ist der für mich, wenn ich meinen Kuchen anschneide.« Nell hielt sie fest und genoss die Vitalität des kleinen Mädchens, das sie liebte. »Und jetzt lauf!«, murmelte sie zerstreut.
Das Kind hüpfte auf bloßen Füßen durch das Gras, das rotblonde Haar glänzte, Bänder flatterten. Das Abenteuer des Lebens wartete auf Ruby, und Trauer überfiel Nell, Trauer um ihre eigene verlorene Jugend. Wo waren all die Jahre geblieben? Wie konnten sie entwischen und ihr nur traumähnliche Schnappschüsse eines Lebens hinterlassen, verbracht von einer Nell, die nur wenig Ähnlichkeit mit der alten Frau hatte, die hier saß und sich selbst bedauerte?
Nell ärgerte sich, weil sie ihren Gedanken freien Lauf gelassen hatte. Wild entschlossen, sich von Bindis Aberglauben nicht den Tag verderben zu lassen, lehnte sie sich in das Polster und beobachtete, wie die anderen im Schatten der Bäume Tische aufstellten und die Kinder der Eingeborenen mit Zuckerstangen bestachen und verscheuchten.
Bindi hockte mit den anderen Aborigines am Fluss; die Frauen der Eingeborenen schnatterten wie Kakadus und platschten im Wasser auf der Suche nach den Flusskrebsen, die sie yabbies nannten. Der kleine Junge, dem Nells Mann Billy das Leben gerettet hatte – seine letzte Heldentat –, war inzwischen ein Erwachsener mit grau durchsetztem Haar. Seufzend nahm Nell das Bild in sich auf.
Eukalyptusbäume neigten ihre hellen Stämme über ockergelbe Uferstreifen; ihre Blätter zitterten, wenn bunte Finken hin und her schossen. Der Himmel war klar, das Blau gebleicht von der Hitze, die über dem Horizont flimmerte, und in der Ferne hörte sie das Glucksen des Kookaburra und den traurigen Schrei einer Krähe. Die Szenerie war bezeichnend für das Wesen dieses uralten Landes, das Nell ihr Zuhause nannte; dieser Anblick war vertraut, aber gefährlich trügerisch, denn unter dem heiteren Äußeren verbarg sich eine Grausamkeit, die Nell und Alice zuweilen an den Rand der Verzweiflung getrieben hatte. Doch als Nell ihre Familie betrachtete, empfand sie Zufriedenheit. Das Bemühen, sich diese ursprüngliche Landschaft untertan zu machen, hatte ihrer Familie großen Segen gebracht, auch wenn das einen hohen Preis gefordert hatte.
Ihr Sohn Walter wäre seinem Vater noch ähnlicher, besäße er nicht dunkelrotes Haar. Ihr wurde schwer ums Herz, wenn sie seine geschmeidige, kräftige Figur und den silbrigen Glanz an den Schläfen sah – wie einst bei Billy. Aber trotz dieser Ähnlichkeit mit seinem Vater besaß Walter nicht dessen sorglose Lebenseinstellung; er nahm alles viel zu ernst. Und er bekam noch immer Wutanfälle, obwohl die mit zunehmender Reife seltener geworden waren. Aber wenn er erst einmal in Fahrt war, wahrte seine Familie wohlweislich Abstand. Walter war seit vier Jahren verwitwet und hielt die Zügel auf Moonrakers fest in der Hand. Offenbar war er nicht geneigt, wieder zu heiraten.
Walters vier Jungen rannten umher und standen allen im Weg. Nell lächelte, als deren kleine Kusine Ruby, die Hände in die Hüften gestemmt, mit ihnen schimpfte. Die Jungen waren unruhig wie Fohlen – nur gut, dass ihr Vater diese Energie für das Anwesen nutzbar machte und sie vor Unfug bewahrte.
Nells Blick richtete sich auf das Haus. Moonrakers hatte sich nicht groß verändert, und obwohl sie mit Alice in Jacks Hütte gezogen war, nachdem Walter geheiratet hatte, war es noch immer das Herzstück des Anwesens. Das Haus war als Schutz vor Überflutung und Termiten auf Stützpfeilern errichtet und ein paarmal erweitert worden, um Walters Familie unterzubringen. An der Vorderseite lief eine breite Veranda entlang, Fliegengitter und Fensterläden hielten die Insekten draußen, an den Pfosten und am Dach entlang rankten Rosen. Ein knorriger alter Pfefferbaum spendete zusätzlich Schatten.
Der Schurschuppen war stabil, und obwohl man einige Scheunen umgebaut und die Pferche vergrößert hatte, war ihr Zuhause im Wesentlichen unverändert geblieben. Während Nell dort saß, ein Ruhepol inmitten des Chaos, und die gegenwärtigen Vorgänge beobachtete, blickte sie zugleich in die Vergangenheit.
Die ersten Jahre, in denen sie sich abmühten, das Land zu roden, eine Unterkunft zu errichten, Getreide anzubauen und ihre Schafe zu versorgen, waren hart gewesen; doch Billy und sie sowie Alice und ihr Mann Jack hatten nie den Glauben verloren, dass sie eines Tages die beste Farm in ganz New South Wales haben würden. Sie spürte den vertrauten Schmerz, als sie sich an das Buschfeuer erinnerte, in dem Billy und Jack ihr Leben verloren hatten, und an die schreckliche Überschwemmung, der eine längere Dürreperiode gefolgt war. Alice und sie hatten all das überlebt; sie hatten ihre anfängliche Feindseligkeit zusammen mit ihren Männern zu Grabe getragen und sich auf der Suche nach Trost und Hilfe einander zugewandt.
Sie zwang sich, an glücklichere Zeiten zu denken. Ihr Blick blieb an Niall hängen, und sie lächelte. Der junge Ire hatte vor vielen Jahren ihrer ältesten Tochter Amy den Hof gemacht. Wie unbeholfen und schüchtern er damals in seiner geflickten Hose und den ausgetretenen Stiefeln doch gewesen war! Ein Jugendlicher noch, aber seine Augen hatten nach seinen Jahren als kindlicher Strafgefangener von den Erfahrungen eines misshandelten Menschen gezeugt – ganz anders als der wohlhabende Mann, der gerade mit seinem Schwager Walter sprach, während ihre Kinder um sie herumsprangen. Im Laufe der Jahre hatten Niall und Amy Freude und Leid erfahren, doch die Liebe hatte ihnen darüber hinweggeholfen, und jetzt wohnten sie in dem feinen Haus, das Niall vor kurzem hinter seiner neuen Schmiede in Parramatta gebaut hatte. Niall hatte bewiesen, dass der menschliche Geist, und sei er noch so gepeinigt, nicht zu besiegen war.
Sie betrachtete ihre Enkel, insgesamt zehn, eine beachtliche Zahl, doch damit war die Zukunft für Nialls Schmiede und Walters Moonrakers gesichert. Und die Kinder brachten wieder Leben in diesen alten Ort. Nell beobachtete Ruby, die Jüngste von Amys sechs überlebenden Kindern. Eigentlich sollte sie das Mädchen nicht bevorzugen, doch es hatte etwas an sich, bei dem Nell warm ums Herz wurde. Vielleicht lag es daran, dass die Kleine so gern die Geschichten hörte, die Nell und Alice ihr erzählten, oder daran, dass Ruby zu schätzen wusste, wenn sie beide sich Zeit für sie nahmen, wenn ihre Eltern beschäftigt waren. Wie auch immer, das Kind bereitete Nell und Alice eine Menge Freude.
»Alles in Ordnung, Mum?«
Nell schrak aus ihren Gedanken auf und blickte zu Sarah empor. »Ich zähle nur meine Nachkommen. Welch ein Segen«, antwortete sie. »Ich wünschte, ich hätte ihre Energie.«
Der Blick ihrer Tochter verschattete sich, als sie die Kinder über die Lichtung rennen sah.
Nell konnte Sarahs Bedauern nachvollziehen, denn ihre Jüngste hatte nie geheiratet. Sie sorgte für ihren verwitweten Zwillingsbruder und seine Jungen, und nun, mit zweiundvierzig, würde sie wahrscheinlich nie mehr die Freuden der Mutterschaft erleben. »Wo ist Alice?«
Sarah strich mit den Händen über die Schürze, die blauen Augen gegen die Sonne zusammengekniffen. »Sie erteilt vom Küchenstuhl aus Befehle wie ein Hauptfeldwebel«, antwortete sie kichernd. »Ich bin überrascht, dass du deinen Senf nicht auch noch dazugibst. Das machst du doch sonst auch.«
»Eigentlich sollte ich an meinem Geburtstag nicht arbeiten. Aber wenn Alice im Weg ist, schaffe ich sie raus.«
Sarah lachte. »Bleib, wo du bist, Mum! Wir brauchen keinen neuen Streit, wenn so viel zu tun ist.«
Nell machte es sich wieder in den Polstern bequem. Sie hatte eigentlich nicht die Kraft, mit Alice zu streiten, und es war angenehm, hier im Halbschatten zu sitzen. »Hol mir meinen dickeren Schal, Liebes! Der Wind ist ein bisschen frisch.«
Bald hatte Nell den flauschigen Schal um die Schultern, und sie wollte schon um eine Tasse Tee bitten, als von der anderen Seite des Flusses Rufe ertönten. Nialls Familie war zu Pferde oder mit Fuhrwerken angekommen, eine ganze Schar, begleitet von Dudelsack und Fiedeln. Sofort hob sich ihre Laune, denn die Iren hatten immer etwas zu erzählen, ein Lied auf den Lippen oder ein Instrument, mit dem sie aufspielten, und ihr gefiel, wie gern sie feierten.
Sie überquerten die Brücke über den Fluss, die in der letzten, fünf Jahre anhaltenden Trockenheit ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden war. Niall hatte seine Mutter oder seine Schwestern daheim nie vergessen; er hatte sie und seine Schwäger finanziell unterstützt, hatte ihnen die Überfahrt von Irland nach Australien bezahlt und ihnen Arbeit gesucht. Die meisten waren in Parramatta oder in der Umgebung der Stadt geblieben und waren regelmäßige, gern gesehene Besucher auf Moonrakers.
»Hilf mir aufstehen!«, befahl sie. »Es ist mein Fest, und ich sitze hier mutterseelenallein rum.«
Mühsam kam Nell auf die Beine. Sie brauchte eine Weile, um Atem zu schöpfen und ihre Haube zu richten. Es war eine alte, doch sie hatte die Bänder erneuert und sie mit ein paar Akazienzweigen geschmückt, die ihrem grünen Kleid schmeichelten. Sie war zwar alt, doch das war keine Entschuldigung, Maßstäbe herunterzuschrauben. Sie hatte nichts übrig für schwarze Trauerkleidung und schlichte Hauben, wie Alice sie bevorzugte, doch Alice hatte auch nie ein Auge für Abenteuer gehabt. Sie wartete, bis Sarah ihren Fächer und die gehäkelten Handschuhe aufgehoben hatte, hakte sich bei ihr unter und steuerte den Tisch an.
»Das ist schon dein drittes Kuchenstück.«
Nell hielt mitten im Kauen inne. »Wenigstens habe ich immer noch genug Zähne im Mund, um zu essen, was ich will.«
»Weshalb du so dick bist.« Alice zog ihre Lippen ein.
»Pff! Immer noch besser, als mager zu sein – das macht so alt. Außerdem pustet der leiseste Windhauch dich weg.«
Alice verzog das Gesicht. »Um dich von der Stelle zu bewegen, müsste schon ein Hurrikan kommen«, brummelte sie. »Mich wundert, dass der Stuhl noch nicht zusammengebrochen ist.«
»Mein Billy hat die Sachen für die Ewigkeit gebaut.« Sie aß ihren Kuchen auf und überlegte, ob sie noch ein Stück nehmen sollte.
Alice überraschte sie und hielt dem nichts entgegen. »Ja«, seufzte sie. »Billy kannte noch den Wert guter Handwerkskunst. Mein Jack natürlich auch. Unser kleines Haus am Fluss wird noch stehen, wenn wir längst nicht mehr sind.«
»Jetzt wirst du trübsinnig«, sagte Nell. Bindis Gerede über »Gesänge« und der abwesende Ausdruck in den Augen ihrer Freundin beunruhigten sie.
Alice hatte ihre Bemerkung offenbar nicht gehört. »Weißt du noch, unser erster Streit über die Schafe?«
Nell war sich nicht sicher, wohin das führen sollte. Diese erste Auseinandersetzung hatte nur wenige Minuten nach der Ankunft von Alice auf Moonrakers stattgefunden und ihnen nachhaltig vor Augen geführt, dass sie Frauen unterschiedlicher Herkunft waren. Die Feindseligkeit, die sie an jenem Tag füreinander empfunden hatten, hatte jahrelang angehalten. »Ich war ein Mordsweib, das steht fest«, erklärte sie zögernd.
»Du warst damals ganz schön eingebildet«, überlegte Alice. »Und das bist du auch heute noch.« Ihre hellbraunen Augen zwinkerten, als Nell auffuhr. »Aber ich schätze, wir können es miteinander aufnehmen, und ich muss zugeben, ich habe deine Kabbeleien immer genossen.«
Nell hob eine Augenbraue und strich Krümel von ihrem Busen. Die Augen ihres Gegenübers ließen noch immer die jüngere Alice erkennen, doch ihr Gesicht war nach den zahllosen Jahren in der gnadenlosen Sonne zerfurcht, die Hände waren knorrig, und ihre Magerkeit wurde von dem locker sitzenden Kleid nur noch betont. Das Alter und die Elemente der Natur hatten ihr übel mitgespielt. »Du wirst doch jetzt nicht nachsichtig mit mir, oder?«
Alice schüttelte den Kopf, dass die gebundenen Bänder ihrer Strohhaube flatterten. »Ich denke nur gerade, es war ein Glück, dass wir uns hatten – und wie viel wir zusammen erreicht haben.« Sie deutete mit dem Kopf auf die fröhliche Kakophonie aus Geschnatter und Gelächter am anderen Ende des Tisches, wo Ruby selig auf dem Knie ihres Vetters Finn hockte und ihn bewundernd anschaute. »Danke, dass du deine Familie mit mir geteilt hast. Es wäre ein einsames Alter gewesen ohne eigene Kinder.«
»Jetzt wirst du aber sentimental«, sagte Nell verärgert. Diese ungewöhnliche Zurschaustellung von Gefühlen störte sie. Schon wollte sie ihren Stuhl zurückstoßen, als Alice ihren Arm packte.
»Du bist meine beste Freundin«, sagte sie leise. »Streite nicht mit mir, Nell, nur dieses eine Mal in deinem Leben!«
Nell spürte einen Stich. Alice benahm sich höchst merkwürdig, und in ihrer Stimme lag eine gewisse Dringlichkeit, die sie seit Jahren nicht gehört hatte. Als wäre sie sich bewusst, dass die Zeit knapp wurde und sie Frieden schließen musste, bevor es zu spät war. Vielleicht war Bindis Aberglaube doch nicht so dumm, wie sie angenommen hatte?
Der Gedanke, dass sie die Freundin verlieren könnte, war erschütternd. Sanft ergriff Nell die verkrüppelte Hand, denn sie wusste, wie sehr Alice unter Arthritis zu leiden hatte, auch wenn sie es sich nur selten anmerken ließ. »Ich weiß nicht, worum es hier eigentlich geht«, sagte sie leise. »Wir beide haben uns doch immer gestritten – das hat uns aufrecht gehalten. Glaub nur nicht, dass ich dich nicht liebe, weil ich dich eine alberne, alte Närrin nenne.« Sie schluckte den Kloß in ihrem Hals herunter und zwang sich zu lächeln. »Aber wag bloß nicht, jemandem zu erzählen, dass ich das gesagt habe! Sonst erzähle ich denen, wie du zusammengebrochen bist, als Henry Carlton starb.«
Alice wurde rot und zog ihre Hand mit einem Ruck weg. »Bin ich nicht.«
Nell nickte zufrieden, nachdem Alice wieder ihr gewohntes schroffes Wesen zeigte. »Ich habe dich gehört«, sagte sie triumphierend. »Hast wie ein liebeskrankes Mädchen in deine Kissen geschluchzt.«
»Obwohl du schändlich mit ihm geflirtet hast, war Henry mein Kavalier, nicht deiner. Um ihn zu trauern war mein gutes Recht.« Alice funkelte Nell an, hielt die zornige Miene jedoch nicht lange durch und begann zu lächeln. »Oh, aber er hat gut ausgesehen, was?«
Nell grinste. »Stimmt. Und klug war er auch. Ohne ihn wären wir nicht halb so gut zurechtgekommen.«
Sie verfielen in ein angenehmes Schweigen, während die Geräusche der Party in den Hintergrund traten und ihre Erinnerungen übermächtig wurden. Henry Carlton hatte neue Wärme in ihr Leben gebracht, nachdem sie verwitwet waren, und seine Abwesenheit machte sich noch immer deutlich bemerkbar. Seine Freundschaft und Anleitung war von unschätzbarem Wert gewesen, seine Lieferung von Zuchtschafen aus Südafrika hatte die Qualität ihres Merinobestandes gesichert nach der schrecklichen Dürre, die andere in die Knie gezwungen hatte.
»Manchmal denke ich, wir haben zu lange gelebt«, sagte Alice seufzend.
»Dummes Zeug!«, platzte Nell heraus. »Wie kann jemand zu lange leben?«
»Wir sind fast die Letzten unserer Generation, Nell, und jedes Jahr bringt neue Todesnachrichten. Das ist irgendwie ungerecht.«
Nell hatte die Nase voll. Sie umklammerte die Stuhllehnen und hievte sich mühsam in den Stand. »Ich jedenfalls hab nicht vor, den verdammten Löffel abzugeben«, fuhr sie Alice an. »Du kannst versauern, wenn du willst, aber solange ich noch Luft zum Atmen habe, werde ich mich amüsieren.« Sie klopfte auf den Tisch, um auf sich aufmerksam zu machen. »Spielt Musik«, befahl sie, »ich will tanzen.«
»Mach dich nicht lächerlich, Mutter!«, bellte Walter. »Das gehört sich nicht für eine Frau in deinem Alter. Außerdem hält dein Herz das nicht mehr aus.«
Sie betrachtete ihren Sohn. Er lief Gefahr, sich aufzublasen, und das Bedürfnis, ihn zurechtzuweisen, war unwiderstehlich. »Ob es sich gehört oder nicht, die alte Pumpe hier schlägt immer noch. Ein bisschen Übung wird ihr guttun – und dir würde es auch nicht schaden«, fuhr sie ihn an und nahm seinen Leibesumfang in Augenschein. Sie wandte sich an Nialls Neffen, einen hübschen, ungefähr fünfzehnjährigen Jungen mit grünen Augen und pechschwarzen Locken. »Wie wär’s, Finn?«
Finnbar Cleary ergriff Nells Hand, und seine Augen strahlten fröhlich, als er sich formvollendet verbeugte. »Es wäre mir ein Vergnügen, mit dem Geburtstagskind zu tanzen, aber sicher. Und ein Walzer scheint mir angemessen zu sein für die Gelegenheit. Der Tanz ist in Europa der letzte Schrei.« Die anderen nahmen rasch Fiedeln, Dudelsack und die große tellerförmige Trommel zur Hand, die man mit einem Stock in Gestalt eines Knochens schlug, um den Rhythmus vorzugeben.
»Mutter! Ich verbiete es!« Walters Gesicht war puterrot.
»Du kannst verbieten, was du willst. Ich bin alt genug und kann tun, was mir gefällt.« Nell zwinkerte Finn zu und nahm mit ihm die Tanzhaltung ein. »Beachte ihn gar nicht!«, flüsterte sie. »Walter war schon immer ein Wichtigtuer.«
Seit Jahren hatte sie nicht mehr getanzt, und das Gefühl eines starken Arms um sich, einer warmen Hand, die sich um die Finger schließt, ließ sie die Unannehmlichkeiten des Alters vergessen, und während er sie langsam führte, atmete sie den Geruch seines frisch gewaschenen Hemdes ein und fühlte sich wieder jung.
Die Fiedeln spielten ihre beschwingte Melodie zu den beklemmenden Tönen des Dudelsacks, während die Trommel Füße und Herz anregte. Am Ende des Tanzes war Nell außer Atem, und ihr war schwindelig. Sie erlaubte Finn, sie zu ihrem Platz zu bringen, und ließ sich auf das Polster fallen. »Das hat Spaß gemacht«, keuchte sie, fächerte ihrem erhitzten Gesicht Luft zu und atmete schwer.
»Das Vergnügen war ganz meinerseits.« Er vollführte eine Verbeugung, und eine dunkle Locke fiel über seine Augen. Er strich sie zurück, zwinkerte ihr zu und schloss sich den anderen an, die einen wilden Freudentanz aufführten.
»Er hat Glück gehabt, dass du keinen Herzinfarkt bekommen hast«, murmelte Alice.
»Wenigstens hab ich’s versucht«, entgegnete Nell, die noch immer um Atem rang. »Wie ich sehe, machst du nicht mit.«
»Ich bin vernünftiger.« Alice zog den Schal noch fester um ihre knochigen Schultern. »Du wirst mich nicht dabei erwischen, wie ich eine Närrin aus mir mache mit einem Jungen, der mein Enkel sein könnte.«
»Wie gut, dass er dich dann nicht aufgefordert hat.«
»Bin zu alt für so einen Unsinn«, erwiderte Alice. Ihr Ausdruck wurde milder, als sie sah, dass Finn seine Kusine Ruby durch eine schnelle Polka wirbelte. »Aber er ist ein gut aussehender junger Kerl, da gebe ich dir recht.«
»Er gleicht Billy so sehr, obwohl sie nicht verwandt sind«, seufzte Nell. »Sogar die Haare fallen ihm in die Augen wie Bill.«
Alice trank schweigend ihre Limonade. Ihr Fuß wippte im Takt mit, und ihr Blick folgte den Tänzern eine Weile, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf Nell richtete. »Ich bin froh, dass dir dein Fest gefällt, und ich beneide dich um deine Vitalität. Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich liebend gern getanzt.« Sie lächelte liebevoll, als sie aufstand und Nell einen Kuss auf die Wange drückte. »Herzlichen Glückwunsch, Nell!«
»Wohin willst du? Das Fest ist noch nicht vorbei.«
Alice tätschelte ihre Schulter. »Ich bin müde«, sagte sie. »Zeit für mich, ins Bett zu gehen. Aber es war ein wunderschöner Tag, Nell. Wirklich wunderschön.«
Nell war versucht, ihr zu folgen, um sich zu vergewissern, dass sie ihren Weg im Dunkeln fand. Doch sie musste sich eingestehen, dass Alice den Weg ebenso gut kannte wie sie und dass ihre Freundin nach dem langen, geschäftigen Tag etwas Ruhe brauchte. Sie schaute Alice hinterher, bis sie in der Dunkelheit verschwunden war, und widmete ihre Aufmerksamkeit dann wieder den Tanzenden. Sie wurden rauflustig; die enormen Mengen Rum und Bier trugen zu deren Begeisterung bei, doch nicht unbedingt zu ihrem Geschick, während sie über das Gras wirbelten und taumelten. Selbst Walter war so gelöst, dass er sich immerhin das Jackett ausgezogen hatte und zur Musik in die Hände klatschte.
»Grandma, ich bin müde«, sagte Ruby und lehnte sich an Nells Schenkel. »Erzähl mir eine Geschichte.«
Nell nahm sie auf den Schoß. Rubys Locken waren ein einziger Wirrwarr, die Bänder hatte sie längst verloren, Finger und Mund klebten vom Kuchen. Sie lächelte, als sie das kleine Mädchen an sich drückte. »Es war einmal vor ganz langer Zeit, als ich jünger war als deine Mummy, da begab ich mich auf ein Abenteuer«, sagte sie leise. »Ich segelte mit einem großen Schiff, das viele Masten hatte, an denen die Matrosen wie Beutelratten bis an die Spitze hinaufkletterten. Das Schiff hat mich von England in dieses Land gebracht, in dem noch nie Weiße gelebt hatten. Damals war es hier ziemlich beängstigend. Das Land war dicht mit Bäumen bewachsen und voller fremdartiger Tiere; und schwarze Männer, die Speere warfen, lebten hier. Es gab keine Häuser, und wir mussten die Ackerflächen roden, um unsere Nahrung anzubauen.« Sie rückte das Kind in eine angenehmere Lage. »Aber keiner von uns wusste, wie man Weizen anbaut, und nach zwei Jahren waren wir halb verhungert. Billy war für die Vorratslager der Regierung verantwortlich, doch das änderte auch nichts daran, und wir mussten mit dem auskommen, was wir fangen oder sammeln konnten.«
»Erzähl mir was von Grandpa Billy!«, murmelte das Kind mit dem Daumen im Mund.
»Billy war groß und sah umwerfend aus. Mit einem Zwinkern in den Augen und einem starken Arm, der mich führte«, flüsterte Nell mit weicher Stimme, je deutlicher die Erinnerungen wurden.
»So wie Finn«, brummelte das Kind. »Wenn ich einmal groß bin, heirate ich Finn, und dann werden wir so wie du und Grandpa.«
Nell lächelte, denn Ruby hatte ihre Liebe zu Finn schon oft kundgetan. »Das wäre wunderbar«, erwiderte sie. »Aber ich habe dir gerade von Billy erzählt. Er hat mich gerettet, als ein furchtbarer Kampf am Strand stattfand, an dem Tag, an dem ich mit den anderen Frauen an Land gegangen bin, und wir sind viele Jahre zusammengeblieben. Er hat mit Onkel Jack Moonrakers gebaut, und hier ist deine Mummy geboren.«
»Sie schläft, Mum«, flüsterte Amy und küsste Nell auf die Wange. »Ich bringe sie ins Bett.«
Nell berührte das Gesicht ihrer Tochter und lächelte. »Der Gedanke ans Bett hat was«, gab sie zu. »Ich glaube, ich gehe auch rein.«
Amy hievte sich Ruby auf die Hüfte, wobei sich ihr kupferfarbenes Haar mit Rubys verhedderte und im Kerzenlicht glänzte. »Bleib hier, ich hole dich, wenn ich das Kind hingelegt habe.«
»Nicht nötig. Ich kenne den Weg.« Sie küsste Amy, liebkoste die weiche, schlummernde Wange ihrer geliebten Ruby und lächelte. »Danke für das Fest! Ich habe mich köstlich amüsiert.«
Amy kicherte, als sie einen Blick zu Niall hinüberwarf, der alle mit einem irischen Lied erfreute. »Morgen werden ein paar Leute einen dicken Kopf haben; aber ja, es war ein schöner Tag.«
Nell nahm den ihr angebotenen Arm und ließ sich aus dem Sessel hochziehen. Als Amy auf das Haus zuging, warf Nell noch einen längeren Blick auf die Versammelten, bevor sie sich abwandte. Das Fest schien noch nicht zu Ende zu gehen, doch die kleine Hütte am Fluss und das bequeme Bett warteten auf sie.
Die Klänge der Feier hallten durch die Stille und wurden leiser, je weiter sie am Flussufer entlangtippelte. Nach all den Jahren kam es Nell noch immer komisch vor, nicht zum Haus und in das Schlafzimmer zurückzukehren, das sie mit Billy geteilt hatte. Deshalb blieb sie einen Augenblick stehen, um zu verschnaufen. Da sah sie, dass sich der Mond auf dem Wasser spiegelte. Diese Spiegelung hatte Billy einst inspiriert, den Ort Moonrakers zu nennen, und sie lächelte, als ihr einfiel, wie der ehemalige Schmuggler über seine Schlauheit gebrüllt hatte vor Lachen. »Oh, Billy«, murmelte sie. »Du fehlst mir so!«
Ein Rascheln im Buschwerk ließ sie zusammenfahren. »Wer ist da?«, krächzte sie.
»Bindi, Missus.« Der Aborigine trat aus dem Dunkel, sein wilder Haarschopf glitzerte silbrig im Mondschein.
»Was zum Teufel fällt dir ein, mir so einen Schrecken einzujagen?«
Furchen entstanden auf seiner breiten Stirn, und die bernsteinfarbenen Augen blickten verwirrt. »Bindi wartet auf Missus. Bringe Sie sicher nach Hause.«
»Ich kenne meinen Heimweg, danke, Bindi. Ich bin ihn weiß Gott oft genug gegangen.« Sie lächelte und bedauerte, ihn so schroff abgefertigt zu haben. Sie kannte ihn seit seiner Geburt, und er gehörte ebenso zu Moonrakers wie sie. »Geh wieder zum Fest zurück!«, sagte sie. »Und kein Wort mehr über Gesänge zu Ruby. Das versteht sie nicht und beunruhigt sie nur.«
Der bernsteinfarbene Blick war hypnotisierend. »Missus versteht«, sagte er. Dann nickte er wie zur Bestätigung seiner Feststellung, bevor er mit der Dunkelheit verschmolz.
Nells Herz schlug zu schnell, und das Atmen fiel ihr schwer. Bindi hatte sie erschreckt, ohne Zweifel – warum zum Teufel musste er alles mit diesem Blick verderben? Sie schauderte und machte die kühle nächtliche Brise dafür verantwortlich, während sie ihren Weg fortsetzte. Sie war wütend über sich selbst, weil sie sich so leicht aus der Fassung bringen ließ, und wütend über Bindi, weil er so wirres Zeug daherredete. Der Aberglaube der Eingeborenen, dass der Tod mit einem Lied von den Geistern komme, wurde von manchen für ziemlich romantisch gehalten – doch in ihrem Alter war er beunruhigend. Und obwohl sie kein Wort davon glaubte, ertappte sie sich dabei, wie sie auf die Geräusche in der Nacht lauschte für den Fall, dass man die Geister doch im Dunkeln flüstern hörte.
Wie erwartet brannte kein Licht, das sie die flachen Stufen hinaufgeleitet hätte, aber als sie sich auf die Veranda zog, erkannte sie, dass Alice in ihrem Sessel saß. Sie blieb stehen, um Atem zu schöpfen. »Hattest du nicht gesagt, du wolltest ins Bett gehen?«
Sie erhielt keine Antwort. »Komm schon, Alice, du kannst hier nicht schlafen. Es ist kühl. Du holst dir noch eine Erkältung.« Sie ergriff die Hand der anderen Frau und sank mit einem Aufschrei der Qual in den Sessel neben ihr. Alice war in einen Schlaf gesunken, aus dem sie nie wieder erwachen würde.
Nell schlug das Herz bis zum Hals, als sie die leblosen Finger packte und hinzunehmen versuchte, was passiert war. »Du hast es gewusst, nicht wahr?«, murmelte sie vor sich hin. »So wie Bindi. Alles, was du gesagt hast, unsere gemeinsamen Erinnerungen, das war deine Art, dich zu verabschieden.«
Tränen rannen über ihre Wangen. Sie blinzelte in den Mond, der hoch über ihr in einem Meer von Sternen schwamm. »Oh, Alice«, schluchzte sie. »Mit wem soll ich denn jetzt streiten, verdammt noch mal?«
Sie verlor jegliches Zeitgefühl, während sie die Hand ihrer Freundin hielt und dem Lauf des Mondes über den Himmel folgte. Ihr Herz hämmerte, und sie war nach dem langen Weg und dem Schreck, den Bindi ihr eingejagt hatte, noch immer außer Atem. Sie hatte so viele Jahre mit Alice gemeinsam verbracht, sie hatten sich gezankt, aber auch gefeiert wie ein altes Ehepaar, doch auch in den finstersten Zeiten hatte ihre gegenseitige Liebe und ihr Respekt nie nachgelassen. Sie hatten wie eine Person gelebt und gearbeitet, und es war ungerecht von Alice, einfach so zu verschwinden – und sie in dieser schrecklichen Stille, in dieser Leere alleinzulassen.
Doch als der Mond tiefer sank und Nells Tränen versiegten, glaubte sie den schwachen Klang von Gesängen in der nächtlichen Brise zu vernehmen. Sie waren schön, und ein großer Friede senkte sich über sie, denn sie erkannte, dass sie heimgerufen wurde. »Jack ist bei dir, nicht wahr, Alice? Kannst du meinen Billy sehen?«
»Ich bin hier, Liebling.« Die leise Stimme kam aus der Dunkelheit. Er tauchte in einen hellen, vom Mond beleuchteten Fleck ein, sein dunkles Haar fiel ihm in die Augen, und er setzte das gemächliche, reizende Lächeln auf, das sie nie vergessen hatte. »Du hast doch nicht geglaubt, ich würde dich allein lassen, Nell, oder?«
»Billy!«, seufzte sie, erhob sich aus dem Sessel und ergriff seine ausgestreckten Hände.
»Komm, Nell! Es wird Zeit.«
Sie warf einen Blick über ihre Schulter auf Moonrakers, wo ihre Familie schlief.
»Wir werden gemeinsam auf sie aufpassen«, sagte Billy und zog sie an sich, »weil ich weiß, dass du die kleine Ruby nicht aus den Augen lassen willst.«
Beim Blick in seine Augen spürte sie die reinste Freude, und als er sie in das blendende Leuchten führte, folgte sie ihm mit dem geschmeidigen Schritt einer jungen, verliebten Frau.
ERSTER TEIL
Auf der Heimreise
EINS
Auf dem Track, Oktober 1849
Ruby zog den Kragen ihres Ölmantels bis ans Kinn und schauderte, als die Stute durch den Schlamm platschte. Sehr romantisch war es nicht, ein Leben als Ehefrau auf diese Weise zu beginnen, und obwohl sie die Wärme ihrer Großmutter Nell zu spüren glaubte, hatte sie nicht damit gerechnet, so niedergeschlagen zu sein.
Die letzte Dürreperiode war zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt zu Ende gegangen, denn es lagen noch viele Meilen vor ihnen, bevor sie das Tal hinter den Blue Mountains erreichen würden. Der Regen, der unentwegt auf Rubys Hut trommelte, bog den Rand nach unten, und das eisige Wasser rann ihr in den Nacken und durchnässte sie bis auf die Haut. Das Trommeln des Regens war das Einzige, was zu hören war, als die vier Ochsen durch das Tal trotteten, denn es überdeckte sogar das Dröhnen des Wasserfalls ganz in der Nähe. Reden war unmöglich. Ohnehin hatten sie und die anderen fünf genug damit zu tun, die Schafe und Pferde zusammenzuhalten und zu verhindern, dass der überladene Karren im Schlamm stecken blieb.
Ruby hatte James Tyler ein Jahr zuvor kennengelernt, und für beide war es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Er war auf Arbeitssuche nach Moonrakers gekommen und hatte eine Energie und Abenteuerlust mitgebracht, die ihrer eigenen glichen. Er hatte sie mit seinem Charme, seinem guten Aussehen und seinem schalkhaften Lächeln schier umgeworfen, und als er den Wunsch geäußert hatte, der von Blaxland, Lawson und Wentworth neu entdeckten Route durch die Blue Mountains zu den endlosen, für die Schafzucht bestens geeigneten Weiden und reichlich vorhandenem Wasser zu folgen, hatte sie gewusst, dass sie mit ihm gehen musste. Ihre kindliche Leidenschaft für Finn war nicht mehr als Schwärmerei gewesen, und James – der freundliche, friedfertige James – war genau der Mann, auf den sie gewartet hatte. Als er vor sechs Monaten um ihre Hand anhielt und ihr den Ring überstreifte – als er sie zum ersten Mal küsste und im Mondschein fest an sich drückte –, hegte sie keinen Zweifel mehr, dass sie mit ihm den Rest ihres Lebens verbringen wollte.
Ihr Vater Niall hatte sich zunächst geweigert, die Heirat seiner Tochter mit einem englischen Protestanten gutzuheißen, waren doch in der stets wachsenden irischen Gemeinde durchaus gute katholische Ehemänner zu finden. Noch mehr störte ihn die Absicht des jungen Paares, in die Wildnis zu ziehen, aus der Schafzüchter immer häufiger von regelmäßigen Überfällen durch die Eingeborenen berichteten. Am Ende hatte er vor ihrer unbeirrbaren Hartnäckigkeit kapituliert, mit der sie in die Fußstapfen ihrer Großmutter, einer Pionierin, treten wollte. Ruby hatte James vor drei Wochen an ihrem neunzehnten Geburtstag geheiratet. Nialls Geschenk an die Frischvermählten war der Pachtvertrag für mehrere Tausend Morgen erstklassigen Weidelands gewesen.
Niall, der immer noch über einen scharfen Blick verfügte, hatte sowohl den Börsenkrach vor fünf Jahren als auch die neue Gesetzgebung genutzt und Schafe für Sixpence das Stück sowie Vieh, das einst sechs Guineen gekostet hatte, für sieben Schillinge gekauft und riesige Landparzellen für wenige Pennys erworben. Sein vorausschauendes Denken sicherte Rubys und James’ Zukunft, solange der Wollpreis und die Nachfrage nach Wolle nicht einbrachen.
Die vier Ochsen zogen trampelnd den großen Rollwagen, der mit Vorräten beladen war. Die Schafe hatten ihren Übermut abgelegt und ließen sich als durchnässter Haufen vom schottischen Schäfer und seinen Hunden antreiben. Die drei bedingt Strafentlassenen – Sträflinge, die freigelassen waren, für den Rest ihrer Strafzeit jedoch einer Lohnarbeit nachgehen mussten – führten die aufgereihten Pferde durch den Regen, bereit, mit den Schultern gegen die Räder zu drücken, sollten sie wieder stecken bleiben; und James hatte seinen Platz auf dem Karren verlassen und das Geschirr des ersten Ochsen gepackt, um ihn anzuspornen.
Der Regen bildete einen undurchdringlichen Vorhang, und die Bäume ringsum zitterten unter seiner Gewalt. Ruby verkroch sich noch tiefer in ihren Mantel. An guten Tagen schafften die Ochsen zwölf Meilen, nur drei oder vier an Tagen wie diesem, und sie fragte sich allmählich, ob sie das Tal jemals erreichen würden, denn der steile Anstieg durch die Berge lag noch vor ihnen. Dennoch waren die Träume, die sie gehegt hatte, seit sie die Geschichten von Grandma Nell und Tante Alice gehört hatte, noch vorhanden – so wie das Verlangen, ihr eigenes Abenteuer zu erleben. Rubys Phantasie war von den Erzählungen angeregt worden, und obwohl die Mühen und Strapazen einer Pionierin entmutigend waren, stärkten sie doch ihre Entschlossenheit. Mit dem Geist von Nell, der sie leitete, würde sie mit James diesen Treck ins Ungewisse überstehen; sie würden ihre Herde vergrößern, und ihre Kinder würden in einer freien Landschaft aufwachsen, weit entfernt von den überfüllten Siedlungen, die Sydney inzwischen umgaben und sich an der Küste entlang erstreckten.
Ein Ruf riss sie aus ihren Gedanken, und sie spähte unter ihrem tropfenden Hutrand hervor. James hatte die Ochsen angehalten. »Was ist los?«
»Der Fluss schwillt an«, rief er zurück. »Wir haben zwei Möglichkeiten: hierzubleiben und uns überfluten lassen oder ihn zu überqueren auf die Gefahr hin zu ertrinken.« Er nahm den Hut ab und fuhr sich verdrossen mit den Fingern durch das helle Haar.
Ruby betrachtete den reißenden Fluss, bemerkte, dass er weiter oben flacher aussah und schaute wieder zu ihrem Mann. »Wir können hier nicht bleiben. Das Land liegt nicht so hoch, dass es Schutz bieten würde, wenn der Fluss über die Ufer tritt. Aber wenn wir weiter flussaufwärts fahren, gibt es einen Weg hinüber.«
James blickte sie nachdenklich aus seinen braunen Augen an, setzte den Hut wieder auf und wandte sich an die anderen. »Was meint ihr?«
Anscheinend stimmten die Männer ihr zu, und James stieg wieder auf den Karren, um Peitsche und Zügel aufzunehmen. Nur widerspenstig trotteten die Ochsen stromaufwärts bis an eine Stelle, an der das Wasser über Fels und Schiefer rann und eine gefährliche Möglichkeit zum Hindurchwaten bot.
Ruby stieg ab, der Schäfer und seine Hunde trieben unterdessen die Schafe ans Ufer. Die Ochsen brüllten vor Angst. Sie konnte es nachvollziehen, denn die Aussicht war entmutigend. Der Fluss strömte über glänzenden Schiefer, wirbelte um Felsen herum und zerrte an Baumwurzeln und Schilfrohr, die sich ans Ufer klammerten. Abgebrochene Äste und Grasbüschel sausten vorbei, und im rasch schwindenden Licht sah sie einen aufgedunsenen Kadaver eines Wallaby, der sich zwischen zwei Felsen verfangen hatte.
»Ich gehe als Erster und suche einen Weg«, rief James. Er reichte Fergal die Zügel, dem stämmigsten ihrer Männer. »Wenn ich ein Zeichen gebe, bringt sie rüber!«
Gespielt tapfer zwinkerte er Ruby zu, und ihr Herz begann zu pochen, als ihr klar wurde, dass er ebenso ängstlich war wie sie.
Schritt für Schritt fand er festen Halt im glitschigen Flussbett und stemmte sich der Kraft des Wassers entgegen. Es reichte ihm zunächst bis an die Hüften, dann bis an die Taille, doch er pflügte sich weiter hindurch.
Rubys Mund wurde trocken, ihr Herz hämmerte, und sie versuchte, ihn kraft ihres Willens ans andere Ufer zu lotsen.
Dann war er verschwunden.
Ruby schrie auf und wäre ihm nachgesprungen, wenn der Schäfer sie nicht daran gehindert hätte. »James«, kreischte sie. »James, wo bist du?«
»Da!«, rief Fergal. »Da drüben ist er ja.«
James klammerte sich weiter stromabwärts an einen Felsen, doch er war noch immer in Gefahr. Rubys Atem kam stoßweise, als er versuchte, gegen die Strömung anzukommen. Sie drängte ihn weiter, spannte jeden Muskel an, als kämpfe auch sie ums Überleben.
James rang mit dem rutschigen Stein und gewann allmählich an Boden. Zoll für Zoll zog er sich hoch, bis er auf einer Felsnase zusammensackte. Kriechend und rutschend benutzte er diesen natürlichen Damm, um auf die andere Seite zu gelangen.
Ruby brach in Tränen aus, als er vom anderen Ufer herüberwinkte.
»Keine Zeit für Tränen«, murmelte Duncan, der schottische Schäfer. »Ich muss die Schafe hier noch rüberschaffen.«
Ruby war erleichtert, dass James in Sicherheit war, vergaß ihre übliche Scheu gegenüber dem Schotten und schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. »Dann brauchen Sie jede nur mögliche Hilfe«, sage sie. »Was soll ich tun?«
Er schaute sie finster an und nuschelte etwas vor sich hin, dass sie nicht hörte. Dann drehte er sich um und stellte Hunde und Schafe auf.
Ruby zuckte mit den Schultern. Duncan Stewart war ein freier Mann und ein fähiger Schäfer, doch für seine Manieren würde er nie einen Preis gewinnen. Sie wandte sich an den ältesten der Strafentlassenen, der gerade die Seile überprüfte, mit denen ihre Habseligkeiten auf dem Fuhrwerk befestigt waren. »Wie wollen wir vorgehen, Fergal?«
Der Ire schaute über den Fluss. »James hat signalisiert, dass das Flussbett da, wo er den Halt verloren hat, stark absinkt, also muss ich die Tiere in die Mitte treiben und dann nach Süden auf die Felsen zu.« Er schob den Hut in den Nacken, kniff die Augen gegen den Regen zusammen und warf einen prüfenden Blick auf den Fluss. »Die Schafe sind eine andere Sache«, murmelte er und kratzte sich die Bartstoppeln. »Wenn die Strömung stark genug ist, dass sie Ihren Mann wegspülen kann, dann hat ein Schaf keine Chance.«
»Wir können die Lämmer auf den Rücken nehmen«, erwiderte sie.
Fergal schaute kurz zu den wimmelnden Schafen hinüber und schüttelte den Kopf. »Sie haben alle Hände voll mit den Packpferden zu tun. Ich werde den Wagen rüberschaffen, ihn entladen und wieder zurückkommen, um die Schafe zu holen. Anders geht es nicht.«
Ruby nahm die Zügel von zwei zusätzlichen Pferden und saß wieder auf, während Fergal dem Schotten seinen Plan darlegte. Die anderen folgten ihrem Beispiel. Fergal kletterte auf den Wagen und trieb die Ochsen mit einem Peitschenhieb in den Fluss. Sie scheuten und schnaubten, als das Wasser ihre Beine umspülte, doch die Peitschenhiebe und die Rufe der Männer hielten sie auf Trab, und schon bald war der Wagen bis zu den Achsen im Wasser.
Ruby führte ihre Stute in den Fluss, und als das kalte Wasser um die Steigbügel strudelte, hatte sie die größte Mühe, das Pferd ruhig zu halten. Die Tiere hatten die Ohren angelegt und verdrehten panisch die Augen. Sie warfen die Hälse zurück und rissen an den Zügeln. Die Hufe der Stute rutschten über den Schiefer, und bei jedem Ruf, bei jedem Peitschenhieb spürte Ruby, wie sie zusammenzuckte.
»Ruhig, mein Mädchen«, murmelte sie, bemüht, die Zügel fest in der Hand und im Sattel das Gleichgewicht zu halten. Das Wasser reichte ihr bis an die Schenkel, die Packpferde wurden von der Strömung erfasst, und die schwer beladenen Satteltaschen drohten sie hinabzuziehen.
»Steh schon auf!«, schrie Fergal, als der Ochse strauchelte, brüllte und fast stehen blieb. »Hopp, weiter mit euch, ihr Bastarde!«
Die Ochsen spannten sich an, als die Räder des Wagens über die trügerischen Felsen schabten, die im Flussbett verstreut waren, und im weichen Schiefergestein einzusinken drohten. Die dicht versiegelten Fässer am Boden der Ladung waren durchweicht, als der Wagen sich der Flussmitte näherte, und bei jedem Ruck der Räder verschob sich die wertvolle Fracht.
Ruby wusste, sie konnten nichts tun, falls sie sich löste, und während sie mit den beiden Männern die Ochsen antrieb, hoffte sie inständig, sie würde halten, bis sie die andere Seite erreicht hatten.
Immer wieder knallte die Peitsche, und Fergal verwendete jeden ihm bekannten Fluch, um die Tiere anzutreiben – und als sie die Zuflucht des anderen Ufers rochen, begannen sie endlich, ihre Last bereitwillig zu ziehen.
Ruby war völlig durchnässt, ihre Hände taub vor Kälte, als sie die Pferde schließlich auf festen Boden trieb. Sie glitt aus dem Sattel und suchte nach James. Doch der war den anderen zu Hilfe gegangen, denn sie mühten sich noch immer ab, ans Ufer zu gelangen.
Die Männer erreichten einer nach dem anderen festen Boden, und den Ersatzpferden wurden Fußfesseln angelegt. Fergals Stimme war heiser vom Brüllen, als die Ochsen den Wagen vom Ufer wegzogen. »Beeilung!«, krächzte er und sprang ab. »Der Fluss steigt immer höher.«
In stummer Verzweiflung nestelten ihre tauben Finger an den durchweichten Seilen herum und trugen Bündel, Säcke und Kisten unter die Bäume. Werkzeug, Samen, Möbel und Kleidung wurden schnellstens abgeladen und unter einer wasserdichten Leinwand verstaut, die das Meiste bisher trocken gehalten hatte.
Ruby half Fergal, drei Ochsen auszuspannen und ihnen Hobbel anzulegen, damit sie nicht umherstreunten, und ordnete das Geschirr, damit das verbleibende Tier den Wagen ziehen konnte. Wiederholt warf sie einen Blick hinüber zu Duncan, der inmitten der Schafe wartete, die treuen Hunde keuchend zu Füßen. Der Fluss war angestiegen und die Strömung reißender – und der Ochse würde seine Zeit brauchen, um ihn zu überqueren, bevor er den Weg noch einmal antreten musste. Das Risiko war beträchtlich, doch ihnen blieb nichts anderes übrig.
»Ich habe eine Idee«, rief James. »Montiert die Räder ab, bindet die Seile an die hinteren Ecken und schlingt sie um diese Baumstämme. Wir lassen den Wagen schwimmen, führen ihn aber mit den Seilen, sodass man ihn über den Fluss ziehen kann.«
Die stabilen Radnaben waren rasch abgeschlagen, und die mit Eisen beschlagenen Holzräder von der Achse gezogen. Sobald die Seile befestigt waren, setzte James sich rittlings auf den Ochsen, der den Wagen durch den Schlamm ins Wasser zog.
Ruby hängte ihr spärliches Gewicht an die Seile, während die Männer die Baumstämme als Gegengewicht benutzten und langsam nachgaben. Sie hielten die Luft an, sobald die Strömung den Wagen erfasste und an ihm zerrte – doch die Seile hielten ihn ruhig, und er schwamm ordentlich hinter dem Ochsen her.
Als das Tier schließlich die andere Seite erreichte, ließen sie die Seile dankbar los, James holte sie ein und band sie um den nächsten Baum. Er und Duncan müssten sie auf der Rückfahrt wieder abrollen.
Ruby spähte durch den Regen und konnte nur die beiden Männer ausmachen, die den Leithammel auf den Wagen lockten. Sie wollte schon wieder in den Sattel steigen, als Fergal sie anhielt. »Bleiben Sie hier!«, befahl er.
»Ihr braucht jede Hand, wenn wir sie sicher herschaffen wollen«, konterte sie.
»James will nicht, dass Sie wieder in Gefahr geraten«, rief er über das Donnern von Regen und Fluss hinweg. »Tun Sie, was man Ihnen sagt, und bleiben Sie hier!« Ohne auf eine Entgegnung zu warten, führte er sein Pferd zurück ins Wasser.
Ruby ballte die Fäuste. Als nutzlos abgestempelt zu werden, obwohl sie durchaus fähig war zu helfen, machte sie rasend. Sie stand am Ufer, bebend vor Wut, während Fergal und die anderen sich zur gegenüberliegenden Seite aufmachten.
Duncans Hunde arbeiteten rasch, zwickten und drängten die zögernden Schafe, bis sie ihrem Anführer auf den Wagen folgten. Duncan, der die beiden kleinsten Lämmer sicher in seine weiten Manteltaschen gesteckt und ein drittes an den Beinen um den Hals gebunden hatte, betrat den Wagen, und der Ochse wurde eilig wieder ins Wasser geschickt.
Ruby stockte der Atem. Die Schafe waren dicht gedrängt und gerieten in Panik, sodass das provisorische Floß plötzlich ins Schwanken geriet. Zwei Böcke verhakten sich mit den Hörnern, während die Mutterschafe drängelten. Ihre Lämmer liefen Gefahr, zertrampelt zu werden, und blökten in Todesangst. Die Hunde rannten über ihre Rücken, zwickten und knurrten, um sie zur Ordnung zu bringen, doch sie waren zu aufgeschreckt. Ein Mutterschaf tat einen fliegenden Sprung, landete im Wasser und wurde weggeschwemmt. Schon folgte ihr ein zweites.
Fergal gelang es, ein Tier am Fell zu packen, aus dem Wasser zu hieven und quer über seinen Sattel zu werfen; die anderen führten ihre Pferde längsseits des Wagens, um eine Barriere zu bilden, damit nicht noch mehr dieser dummen Geschöpfe folgten. Doch die Reiter mussten nicht nur mit nervösen Pferden fertig werden, sondern auch mit dem Sog der Strömung und dem schwankenden Floß, das dazu bestimmt schien, seine Fracht zu ertränken.
Ruby schwang sich in den Sattel. Die Mutterschafe traten um sich, versuchten sich einen Weg zu bahnen, und dabei war ein Lamm ins Wasser gestoßen worden, was den Männern entgangen war. Sie bohrte ihrer Stute die Fersen in die Flanken und galoppierte am Ufer entlang. Das Lamm blökte erbärmlich im reißenden Strom, und Ruby wusste, ihre einzige Hoffnung war, es weiter unten abzufangen.
Die Strömung war jetzt stärker, die Stute wieherte vor Angst, als sie gezwungen wurde zu schwimmen. Ruby sah das Lamm, das von den tosenden Strudeln hin und her geworfen und im Kreis gedreht wurde. Die Stute kämpfte gegen den Strom an, doch Ruby erhöhte den Schenkeldruck, ließ die Zügel los und streckte die Hände aus.
Ihre Finger berührten durchweichte Wolle, und sie packte das Lamm am Nacken. Sie hievte das verängstigte Geschöpf aus dem Wasser, steckte es vorn in ihren weiten Ölmantel und nahm die Zügel wieder auf. Jetzt musste sie nur noch zurück ans Ufer. Der Fluss zerrte und zog und riss der Stute beinahe die Beine weg, doch Ruby trieb sie mit schmeichelnden Worten weiter. Das Lamm strampelte und blökte, seine kleinen Hufe schlugen an ihre Brust, da es versuchte, sich zu befreien, doch Ruby ignorierte das Unbehagen, wild entschlossen, sich und die beiden Tiere in Sicherheit zu bringen.
Sie gelangten in seichteres Wasser, und als sie schließlich auf höheren Boden kam, zitterte sie so stark vor Kälte und Angst, dass sie nicht absteigen konnte. Sie blieb im strömenden Regen sitzen. Das Lamm hatte sich beruhigt, sein Kopf lugte aus ihrem Kragen, und der Ochse zog endlich den Wagen aus dem Fluss. Sie schluchzte vor Erleichterung, als die Schafe in den Busch rannten, die Hunde hinterher. James war in Sicherheit, und obwohl ein Mutterschaf und zwei Lämmer verloren gegangen waren, hatte der größte Teil ihrer Herde es geschafft.
Ruby reichte Duncan das Lamm, der sie wütend anfunkelte und sich wortlos abwandte, und als sie die Energie aufbrachte abzusteigen, wurde sie von James aus dem Sattel gerissen.
Er drückte sie fest an seine Brust. »Mach nie wieder so etwas Wahnsinniges!«, sagte er finster. »Ich dachte, ich hätte dich verloren.«
Sie klammerte sich an seinen durchnässten Mantel, während der Regen auf sie niederprasselte, und war besänftigt. Hunderte von Meilen lagen noch vor ihnen, doch welche Gefahren dort auch auf sie lauern mochten, Rubys Glaube war unerschütterlich. Solange sie und James zusammen waren, würden sie überleben.
Kumali wusste, die gubbas, die Weißen, konnten sie nicht sehen, denn sie war durch die Bäume gut getarnt. Sie blieb im Halbdunkel und beobachtete die Eskapaden im Fluss. Die Frau war tapfer und stark, und obwohl ihr Mann wütend war, lag ihm offensichtlich etwas an ihr, und Kumali spürte, dass es gute Menschen waren.
Kumali gehörte den Gundungurra an, deren Stammesland im Süden den Wollondilly River, im Osten den Nepean River und im Nordwesten die Höhlen von Binnoomur umfasste. Mandarg, ihr Urgroßvater, hatte über die gubbas Geschichten erzählt, die an die Verwandten ihrer Mutter weitergegeben worden waren. Er hatte gewusst, dass diese weißen Eindringlinge bald einen Weg über ihre heiligen Berge finden würden, hatte aber auch von den guten Männern gesprochen, die er in seiner Zeit in Warang kennengelernt hatte. Dennoch hatte er sie vor der Wildheit anderer gewarnt, vor der Sorglosigkeit, mit der alle Weißen die geheiligten Traumplätze und Traumpfade raubten. Man war seinem weisen Rat gefolgt, doch niemand von ihnen hatte die verheerende Wirkung der Weißen richtig begriffen, bis es zu spät gewesen war.
Sie waren gekommen, viele Monde nachdem Mandarg zu den Geistern im Himmel gegangen war, und jetzt waren ihrem Volk die Jagdgründe hinter den Bergen untersagt. Die weißen Männer hatten ihre Frauen, ihre Arbeiter und ihr Vieh mitgebracht und das traditionelle Land der Gundungurra gestohlen. Ihre Feuerstöcke hatten die Wälder geleert und die Beutelratten, Koalas und Vögel verscheucht. Ihre Pflüge hatten die Grasnarbe aufgerissen, auf der Kängurus und Wallabys einst gegrast hatten, und ihre Waffen und das vergiftete Mehl hatten die hungerleidenden Gundungurra umgebracht.
Kumali war das Herz schwer. Zwischen den gubbas und den wenigen Überlebenden ihres Stammes war es zum Krieg gekommen, doch der Diebstahl von Vieh, Schafen und Getreide wurde mit dem Strang – oder einem schlimmeren Tod – bestraft durch die Schafzüchter und ihre schwarzen Viehzüchter, die sich offenbar einen Spaß daraus machten, selbst die Jüngsten ihres Stammes abzuschlachten. Wie ihr Großvater mütterlicherseits vorhergesagt hatte, waren die Feindseligkeiten der Stämme untereinander von den Weißen dazu benutzt worden, das Land zu säubern, und die Möglichkeiten, die ihrem Volk blieben, waren dürftig: frei zu bleiben, zu hungern und gejagt zu werden oder mit den Weißen zu leben und ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein.
Kumali verzog das Gesicht. Im Moment war sie frei. Sie war viele Meilen gelaufen, um dem Boss zu entkommen, der sie geschlagen und in sein Bett gezwungen hatte, doch sie wusste aus Erfahrung, dass er einen seiner schwarzen Fährtensucher ausschicken würde, um sie zu finden und in Ketten zu seiner Farm zurückzubringen, denn sie war nicht zum ersten Mal fortgelaufen.
Sobald die Reisenden sich im grauen Regenschleier verloren, tauchte Kumali zwischen den Bäumen auf. Der Fluss war reißend und tief, und obwohl sie eine gute Schwimmerin war, wollte sie ihn nur ungern durchqueren. Die Ältesten hatten ihr von Mirringan und Gurrangatch erzählt, und sie fürchtete, dass Gurrangatch, halb Fisch, halb Reptil, vielleicht von seiner Höhle im Wingeecaribbee River in dieses Wasser geschwemmt worden war und jetzt in den Tiefen lauerte, um sie zu fangen.
Sie zögerte und zupfte mit den Fingern an dem dünnen Baumwollkleid, dass die Missus ihr geschenkt hatte. Es war ihr einziger Schutz vor der Kälte, und es klebte nass an ihr wie eine zweite Haut. Kumali blinzelte und starrte ins Wasser. Gurrangatch war noch immer wütend, weil er von Mirringan, der Tigerkatze, gejagt worden war, und Kumali schauderte, denn sie glaubte, etwas Silbernes im dahinschießenden Wasser aufblitzen zu sehen. Sie kaute auf ihrer Unterlippe und erwog ihre Möglichkeiten.
Ihr Leben hatte in einer Missionsstation begonnen, in der Initiationsriten und die Unterweisung durch die Ältesten heimlich vonstatten gehen mussten – der Pfarrer hatte es verboten. Sie war ohne großes Verständnis für die alten Traditionen aufgewachsen, von denen die Ältesten sprachen, denn das Leben bei den Weißen zerstörte unweigerlich das unabhängige Denken oder Handeln. Jagen war verboten, ihre magere Essensration kam aus der Mission. Neue Gesetze verwehrten ihnen das Recht, mehr als zwei Personen zu treffen, demzufolge gab es keine corroborees mehr, und obwohl man ihnen erlaubte, gunyahs als Unterkünfte zu bauen, konnten diese jederzeit durchsucht werden, sollte der Pfarrer den Verdacht hegen, darin sei Rum versteckt. Frauen und Kinder wurden eingefangen und gezwungen, in den Häusern und auf den Feldern der gubbas zu arbeiten. Häufig wurden sie meilenweit fortgeschickt und nie wieder gesehen. Kumali kannte deren Schicksal, denn ihr war es ebenso ergangen.
Sie trat vom Fluss zurück und hockte sich in den Schutz eines Baumes. Drei Jahre zuvor hatte man sie geholt, als sie zwölf war, und sie konnte sich noch immer an die Schreie ihrer Mutter erinnern, hörte noch immer ihren Vater, der den Mann anflehte, sie freizulassen. Man hatte ihr Seile um Hals und Handgelenke gebunden und sie weggezerrt. Die Schreie ihrer Mutter hallten noch lange hinter ihr her, nachdem sie schon längst außer Sichtweite war. In der ersten Nacht hatte man ihr brutal die Unschuld geraubt, und im Verlauf der langen Reise hatte sie erfahren, dass diese Behandlung ihre Zukunft war.
Kumali wischte sich mit den Fäusten die Tränen aus den Augen. Sie weigerte sich, dem Schmerz und der Verwirrung nachzugeben, die sie zuweilen noch immer zu überwältigen drohten, obwohl sie inzwischen fünfzehn war. Ihr neuer Herr war grausam, und seine Schläge hatten Spuren hinterlassen, nicht nur an ihrem Körper, sondern in ihrer Seele. Sie war nichts wert, und wenn sie heute im Fluss stürbe, würde niemand die rituellen Gesänge anstimmen und ihren Tod betrauern.
Das Donnern des Regens ließ nach, und sie schaute aus ihrem dürftigen Unterschlupf hinaus. Die Wolken hellten sich auf, die Sonne brach hindurch. Kumali betrachtete den Fluss, zögerte aber noch immer. Der Gedanke an den Tod war erschreckend. Aber sie wusste, was sie in dem Viehzuchtbetrieb erwartete, wenn sie vom Fährtensucher eingefangen würde, und so war diese geringe Chance, die Freiheit zu erlangen, es auf jeden Fall wert. Sie würde leben wie die Vorfahren und versuchen zu lernen, wie es damals gewesen war.
Doch sie ließ den Gedanken sofort wieder fallen. Kumali wusste nicht, wie man im Busch überlebte; sie wusste nicht, wie man jagte, kannte sich in ihrer Umgebung nicht genau aus, besaß weder Speer noch Messer. Sie hatte von den großen Städten gehört, die sich weiter im Süden und Osten ausbreiteten, hatte aber den Verdacht, dass das Leben dort genauso hart sein würde, denn auch sie waren von gubbas bevölkert. Dasselbe galt für die Küstenebenen, wo sie noch verletzlicher wäre, da die Stämme der Schwarzen dort traditionelle Feinde waren. Tief aufseufzend wrang sie ihr Kleid aus. Alles, was sie über das Leben wusste, hatte sie in einer Missionsstation und in einem Viehzuchtbetrieb gelernt – somit hatte sie wenig gute Aussichten.
Ein Sonnenstrahl fiel auf das gegenüberliegende Ufer. Er bahnte einen Pfad durch die Bäume, als wolle er einen Weg weisen.
Kumali starrte auf den goldenen Strahl und erkannte ein Zeichen darin. Sie streifte alle Bedenken ab und watete ins seichte Wasser. Wenn sie die Überquerung überlebte, dann würde sie den Spuren des Ochsenkarrens und der Frau folgen, die so tapfer gewesen war.
Auf See vor Tahiti, Oktober 1849
Hina Timanu stand an Deck des Walfängers Sprite und schaute in den schmutziggrauen Dunst am Horizont. Beinahe zwei Jahre hatte er seine Heimat nicht mehr gesehen, und obwohl sie noch einige Seemeilen von ihren Gestaden entfernt waren, glaubte er bereits den Duft von Kochstellen, Jasminbäumen und Hibiskus wahrzunehmen.
Hina war achtundzwanzig, sehr sprachbegabt und ein erfahrener Walfänger. Er trug die übliche Leinenhose und das Sergehemd eines Matrosen, doch seine hohe, muskulöse Statur, die langen schwarzen Haare und die blauen Augen hoben ihn von den Europäern ab, mit denen er segelte. Im Lauf der Jahre hatte er sich daran gewöhnt, denn sein Volk hatte braune Augen und war von kleinem Wuchs – doch das Vermächtnis des weißen Urgroßvaters seiner Mutter lebte in ihm weiter. Er schämte sich keineswegs, sondern trug seine Andersartigkeit mit Stolz.