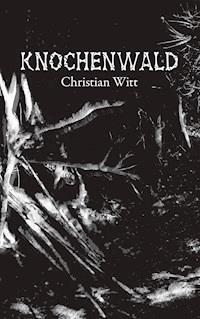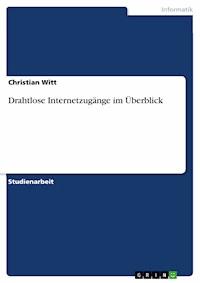Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du hast Angst vor Monstern? Warum? Sind sie dir zu hässlich? Zu böse und fremdartig? Oder fürchtest du ihnen ähnlicher zu sein, als es dir lieb ist? Nein? Beweise es mir! Besiege deine Angst und geh mit mir auf Monstersuche. Lass sie uns aufscheuchen in stickigen Höhlen, dystopischen Techno-Städten, nebligen Tempeln, heimeligen Wohnzimmern und den Tiefen der menschlichen Psyche. Aber bleib dicht bei mir, bewaffne dich gut und sei gewarnt: Oft genug werden wir dort fündig werden, wo du es am wenigsten erwartest. Und was du einmal entdeckt hast, kannst du vielleicht nie wieder vergessen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Dank gebührt allen, die mit mir unermüdlich die Monster des Alltags bekämpfen. Ganz besonders meiner Frau Yvonne, meinem Vater, unserer unverwüstlichen Pfotenkriegerin Joana und meiner Mutter, die zu Lebzeiten so viele Ungeheuer aus meinen Tagen und Nächten vertrieben hat. Sowie Jenny, Jess und überhaupt allen nahen und fernen Freunden und Autorenkollegen, die mir dabei helfen diese gar nicht so einfache Zeit durchzustehen.
Und natürlich möchte ich auch Taybor, Kati Winter, Seelensplitter und vielen weiteren monströs großartigen Vertonern für das kreative und kunstvolle Erwecken meiner Geschichten danken.
Weitere Geschichten zum Gruseln findet ihr übrigens auf: www.angstkreis-creepypasta.de
Inhaltsverzeichnis
Das Monster muss sterben
Schwäche
Der rote Keiler
Drachentöter
Artgerecht
Therapiesitzung
Ein Toaster
Das Muster
Details
Rost
Kleine Schneeflocken
Sein Wille geschehe
Reality Check
Die Gedanken sind frei
Das allgemeine Wohl
Downgrade
Die Geschichte des Frank Zimmer
Vorwort
Was ist ein Monster? Etwas Hässliches? Etwas unvorstellbar Böses? Das aus dem Erbe unserer Vorfahren in unser Gehirn gepflanzte Kondensat unserer Urängste vor einem hungrigen Raubtier, dem wir mangels realer Fressfeinde immer neue Fantasiegesichter geben? Ist es die Angst vor dem Fremden und Unbekannten, vor dem, was wir nicht verstehen oder – schlimmer noch – vor einem Teil von uns selbst, den wir nicht vermessen, nicht begreifen können? Ein Ding, ein etwas, mit dem sich nicht verhandeln lässt; das wir nicht belügen, nicht leugnen, nicht mit Geld, Charme oder den Errungenschaften unserer Zivilisation zum Schweigen bringen können, ja das sie oft genug sogar hervorbringt. Sind Monster das absolute Andere, dem man nur mit Flucht oder Vernichtung begegnen kann, oder wohnen die wahren Monster hinter den Augen von Geschöpfen, die genau auf diese Weise denken und die alles, was sie sehen, in ihr so praktisches, wie grausames Freund-Feind-Schema pressen? Werden Monster geboren oder geschaffen? Und wo beginnt diese Verwandlung und vor allem, wo endet sie?
Auf diese Fragen gibt es so viele Antworten wie weitere Fragen, aber eines ist sicher: Monster gehören zu uns Menschen, seit wir diese Welt betreten haben und sie haben viele Gestalten. Sehen wir uns doch ein paar davon an.
Das Monster muss sterben
Bald hat der Schrecken endlich ein Ende. Es hat wirklich lang genug gedauert. Unzählige Menschen mussten ihn Nacht für Nacht durchleben. In Gestalt einer grauenhaften, abstoßenden Kreatur. Diese bedauernswerten Frauen, Männer und Kinder lagen friedlich und entspannt in ihren Betten und tauchten in die bunte, tiefe und schrankenlose Welt ihrer Träume ein, bis sie plötzlich irgendetwas weckte.
Ein Geräusch oder auch nur eine ungute Vorahnung. Und dann sahen sie sich ihrem größten Alptraum Auge in Auge gegenüber. Einem gedrungenem Geschöpf mit runzliger Haut, einem dürren Hals, kräftigen, krallenbewehrten Armen und einem breiten fleischigen Kopf, der fast nur aus Zähnen zu bestehen scheint.
Die rot leuchtenden Augen des Ungetüms schweben wie zwei unheilvolle Sterne durch die Nacht. Seine kreischende Stimme schneidet sich selbst in die stärkste Seele hinein, wenn sich der groteske Mund näher und näher an sein Opfer heranschiebt und verstörende Worte in einer Sprache spricht, die wohl kein Mensch je entschlüsseln kann. Glücklicherweise hat es noch niemanden getötet. Bis jetzt jedenfalls.
Warum, darüber können wir nur spekulieren. Vielleicht ist es gestört worden und geflohen, als jemand anderes ins Zimmer kam oder das Licht anging. Vielleicht weiß es noch nicht genug über uns Menschen, um sich einen Angriff zuzutrauen. Womöglich will es auch nur Psychoterror verbreiten und weidet sich an unserer Angst.
Aber das ist mir eigentlich scheißegal. Darüber sollen sich Wissenschaftler und Philosophen ihre Eierköpfe zerbrechen. Ich will das Vieh nur abmurksen und meine Fäuste tief in seine hässliche Fressluke stopfen. Oder den Lauf meines Gewehrs. Verdient hat es das allemal. Viele, die von der Kreatur besucht wurden, haben Angststörungen entwickelt. Manche sogar Depressionen, Paranoia, Schizophrenie.
Sie trauen sich nicht mehr, zu schlafen oder das Licht auszumachen. Sie haben keine Kraft mehr, zur Schule, in die Uni oder zur Arbeit zu gehen. Ihr Leben ist versaut, auch wenn ihre Körper verschont wurden. Es sind tausende, zehntausende, hunderttausende Leben. Jedes davon wäre einen zerfetzten Monsterschädel wert. Mindestens. Wie schade, dass ich nur so wenig Kugeln habe.
Immerhin haben wir das Versteck der Kreatur jetzt gefunden. Wanderer haben zufällig entdeckt, wie die Kreatur dort hineingehuscht ist. Es liegt mitten in diesem Wald, unter den Wurzeln eines uralten, gewaltigen Baumes. Und genau dort befinde auch ich mich jetzt. Direkt über dem Bau dieses Wichsers. Als Ex-Soldat und erfahrener Dämonenjäger bin ich genau der richtige Mistkerl für den Job.
So leise wie möglich gleite ich durch die enge Öffnung unter den knorrigen Wurzeln. Andere hätten vielleicht Angst gehabt. Aber für mich ist es Routine. Ich bin schon öfter in feindliches Terrain vorgedrungen, als ich zählen kann. Und auch ein übernatürliches Geschöpf ist nicht viel gefährlicher als ein Soldat, der um sein Überleben kämpft. Als ich unten ankomme, leuchtet die Lampe unterhalb der Mündung meines Gewehrs direkt in die hässliche Visage des Ungeheuers hinein. Das Ding will noch seine Hände heben, aber ich drücke bereits den Abzug.
Mündungsfeuer erhellt das Versteck der Kreatur, und Kugel um Kugel schlägt in seinen weichen, ekelhaften Kopf. Grüngelbes Blut spritzt an die Wände, die Decke und den Boden. Das Vieh schreit in seiner seltsamen Sprache wie ein Schwein auf der Schlachtbank. Das Geschrei nervt mich tierisch, aber wozu Ohrstöpsel, wenn man eine fette Wumme hat. Nach einigen weiteren Ladungen liegt das Ding endlich still. Was für ein geiles Gefühl. Ich bin ein Held. Das ganze Land … nein, die ganze verdammte Welt wird meinen Namen kennen. Aaron Hill, der Monstertöter. Geh kacken, Siegfried. Jetzt kommt der Hillster! Ein breites Grinsen wächst auf meinen Mundwinkel.
Vielleicht sollte ich mit dem Ding posieren. Ein hübsches Selfie für meine Facebook-Seite und für Instagram. Für die Ladys, damit sie was Geiles haben, dass sie sich auf den Nachttisch stellen können. Aber erstmal brauche ich mehr Licht. Ich stelle mein Gewehr auf einen Tisch, den das Ding offensichtlich hier hingestellt hatte, als es noch nicht aus Blut und Matsch bestand, und hole meine fette Hochleistungstaschenlampe raus. Zum ersten Mal sehe ich das Versteck in richtig guter Beleuchtung. Ein weiterer Tisch mit einem hölzernen Stuhl. Ein Schrank … mit Büchern. Bilder von Landschaften und lächelnden Menschen. Ein Teppich. Ein verdammter Computer. What the fuck? Das sieht hier ja mehr aus wie in der Wohnung eines Geschichtslehrers als wie im Schlupfloch eines Monsters.
Langsam gehe ich zu einem großen, ledergebundenen Buch, das aufgefaltet auf dem Schreibtisch liegt, auf dem sich zurzeit auch mein Gewehr befindet. Obwohl ich es nicht erwartet hatte, kann ich die Schrift darin tatsächlich lesen. Das Ding mochte vielleicht nicht unsere Sprache sprechen, aber es konnte eindeutig darin schreiben. Seine Schrift ist geschwungen und verschnörkelt, lässt sich aber trotzdem gut lesen.
„Tag 187. Es ist zum Verzweifeln. Egal, was ich auch tue: Ich kann mich den Menschen einfach nicht verständlich machen. Meine Stimmbänder können keine für sie interpretierbaren Laute erzeugen, auch wenn ich die Struktur ihrer Sprache inzwischen perfekt verstehe und beherrsche, und sie sogar in Gedanken häufiger verwende als meine eigene. Hinzu kommt, dass mein Aussehen sie über die Maßen verstört und ängstigt. Verschiedene Berichte im Internet haben mir das genauso deutlich gemacht wie die Mimik und die Reaktionen meiner Schutzbefohlenen.
Das tut mir weh, und ich bedauere es sehr. Das Letzte, was ich will, ist, den Menschen Angst zu machen. Aber ich kann mein Aussehen nicht verändern und auch nicht unsichtbar werden. Nicht, wenn ich die Tore versiegeln will. Denn dafür – und für die unzähligen Raum- und Zeitsprünge – benötige ich all meine Konzentration. Also brechen die Menschen weiterhin in Panik und Angst aus, wenn ich ihnen begegne. Und es ist ja auch nicht verwunderlich. Ich habe erhebliche Ähnlichkeit mit den Schreckgespenstern, mit denen sie sich selbst in Filmen und Geschichten quälen. Nur, dass meine Absichten gar nicht unterschiedlicher sein könnten.
Als Letzter meines Volkes, der Graiori, kann nur ich sie noch vor Wesen schützen, gegen die selbst die schlimmsten Monster aus ihren Filmen geradezu ein amüsanter Witz sind.
Denn die Tore von Varustrach sind geöffnet. Und ihre verschlungenen Pfade führen in die Schlafstätten von Milliarden Menschen, die sich nicht einmal ansatzweise gegen das verteidigen könnten, was die Barriere durchschreiten will. Also muss ich ihr Schild sein. Ihr Beschützer. Und dabei bin ich so müde. Müde von der dauernden Ablehnung. Müde von den Missverständnissen. Müde von all den Kämpfen. So schrecklich müde … ich werde mir etwas Ruhe gönnen. Ein paar Stunden nur. Aber ich gebe nicht auf. Ich muss stark sein. Sie haben doch nur mich.“
Schwäche
Ich finde es so schön, ihn hier liegen zu sehen. Gut, seine Haut ist etwas blass. In diesem Licht sieht sie sogar beinahe wächsern aus. Ich beuge mich etwas vor und nehme den stechenden Geruch von Schweiß an ihm wahr. Beim nächsten Mal werde ich die Dosis ein wenig verringern müssen. Wenn er sterben würde, könnte ich es kaum ertragen. Immerhin liebe ich ihn doch so sehr. Noch mehr als den letzten. Aber ich werde mich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass er mich irgendwann verlassen wird. Die Körper von Menschen ertragen meine Behandlung nie auf Dauer. Selbst kleinere Dosen Gift können sie innerhalb weniger Wochen oder Monate zu Fall bringen. Dabei will ich niemanden töten. Ich mag die Menschen und fühle mich zu ihnen hingezogen, und einige – wie Andreas zum Beispiel – liebe ich sogar von ganzem Herzen. Aber ich kann meine Liebe nur zeigen, wenn sie schwach sind. Wirklich schwach. Und auf meine Hilfe angewiesen.
Nur aus diesem Grund mische ich ihnen die Substanzen ins Essen und in ihre Getränke. Einen kleinen Spritzer in ihren Softdrink im Kino oder in ihren Cocktail in der Bar, solange sie noch in der Lage sind, die Wohnung zu verlassen. Mit der Zeit werden sie dann immer schwächer. Ihre Unternehmungslust schwindet, und sie haben endlich ausreichend Zeit, sich ganz und gar mir zu widmen. Denn auch ihre Freunde haben oft erstaunlich wenig Verständnis für ihren Zustand. Wer zu schwach ist, vor die Tür zu gehen oder auch nur Nachrichten auf WhatsApp oder Facebook zu schreiben, ist keine erfreuliche Gesellschaft, und auch der kränkliche Geruch schreckt viele von einem Besuch im Zuhause meiner Auserwählten ab.
Um fair zu sein, muss ich aber auch erwähnen, dass ich da diese Gabe habe. Diese besondere Gabe, bei Menschen Desinteresse auszulösen. Wenn ich es will, dann vergessen selbst Familie und engste Freunde eine Person so vollständig, dass sie irgendwann ganz automatisch selbst Bilder oder andere Erinnerungsstücke beiläufig von PCs, Smartphones und Tablets löschen oder in den Müll werfen. So wie alten Tand, der nur noch stört und von dem sie nicht mehr wissen, warum sie ihn überhaupt besitzen. Auf diese Weise habe ich vor vielen Jahrhunderten auch Lords, Pharaonen, Könige und Häuptlinge, die einen Platz in meinem Herzen gewonnen hatten, um ihren Platz in den Geschichtsbüchern gebracht.
Viele sind dann erst einmal traurig, wenn sie merken, dass sie alle Freunde und Verwandten verloren haben. Jeden, dem sie einmal etwas bedeutet hatten. Sie denken dann, dass sie ganz allein auf der Welt sind. Dabei sind sie alles andere als allein. Sie haben die schönste Frau an ihrer Seite, deren Füße je den Boden dieses Planeten berührten. Oder den schönsten Mann, je nach ihren Vorlieben.
Und ich sorge gut für sie. Ich halte sie in meinen Armen, gebe ihnen alles an Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit, was ihre geschwächten Körper noch vertragen können, und ich störe mich nicht an den Gerüchen von krankem, kalten Schweiß, Eiter oder entzündeten Wunden. Denn ich liebe sie so sehr. Auch Andreas. Ganz besonders Andreas.
Als wir uns kennenlernten, war er muskulös und voller Feuer gewesen. Ein richtiger Sunnyboy. Er hatte Basketball gespielt, hatte fast täglich im Fitness-Studio trainiert und hatte nebenbei sogar noch ein Buch veröffentlicht. Er war stark, intelligent und gutaussehend. All diese Eigenschaften werden auf ewig in meinem Herzen weiterleben. In der Realität sind sie längst Vergangenheit. Sein Körper ist ausgemergelt, sein Brustkorb eingefallen, und obwohl er erst fünfundzwanzig Jahre alt ist, hat er bereits tiefe Falten, aber auch Akne im Gesicht. Seine Augen, die einst kerngesund und scharf waren, sind jetzt getrübt und sehen kaum noch etwas. Seine Ohren sind ebenfalls geschädigt. Und auch mit seinem Intellekt ist es nicht mehr ganz so weit her. Er ist unkonzentriert. Er vergisst immer öfter ganze Jahre seiner Vergangenheit. Personen, Orte, Erlebnisse. Die Mittel, die ich ihm gebe, haben sein Gehirn angegriffen und seinen Stoffwechsel schwer gestört.
Aber mich erkennt er immer noch. Seine Göttin würde er nie vergessen. Ich bin – zur Zeit – eine wunderschöne Frau. Ein Körper wie aus einem feuchten Traum. Dichtes, langes, schwarzes Haar. Zarte Wangenknochen. Ein sinnlicher Mund und intelligente, aber stets etwas lasziv blickende Augen.
Nein. Niemals könnte er mich vergessen. Und auch nicht das, was er mit mir erlebt hat. Unser erster Blickkontakt in der Buchhandlung. Unser erstes Date in dieser Shisha-Bar, und ganz sicher nicht unseren ersten Sex. Er war so leidenschaftlich. So voller Feuer und Lebenskraft. Und nun ist er es nicht mehr. Nicht einmal im Ansatz. Diese Leidenschaft vermisse ich schon an ihm.
Einst war er so stark. Beinahe ebenso stark wie ich. Aber ich kann Stärke nicht ertragen. Ich will nicht verlassen werden. Starke Personen können Entscheidungen treffen. Auch die Entscheidung, sich von mir zu trennen. Das musste ich einmal erleben. Vor inzwischen fast eintausend Jahren. Und das will ich nie wieder durchmachen müssen. Ein solcher Schmerz ist einem Wesen wie mir nicht würdig. Natürlich verlassen sie mich auch, wenn sie sterben. Aber das ist etwas anderes. Dann weiß ich, dass sie nie mehr jemand anderem gehören werden. Dass unsere Zeit etwas Besonderes bleibt. Außerdem kann ich mir dann wieder eine neue Liebe suchen. Irgendwo da draußen wartet sie bereits. Vielleicht hört sie sogar gerade meinen Gedanken zu. Eine alberne und romantische Vorstellung, ich weiß. Und dennoch … manchmal habe ich da so ein Gefühl.
Ich wünschte manchmal, dass ich ihren Willen beherrschen könnte. Dann müsste ich sie nicht schwächen und vergiften. Dann würden sie auch so mir gehören. Aber diese Fähigkeit habe ich nicht. Die Gifte sind mein einziger todsicherer Zugang zu ihren Herzen.
Ich sehe zu Andreas. Gerade schläft er wieder und windet sich in unruhigen Träumen. In letzter Zeit kommen leider Zweifel in ihm auf. In seinen wenigen klaren Momenten merkt er irgendwie, dass ich ihm schade. Ich werde wohl die Dosis bedauerlicherweise nicht senken, sondern noch ein wenig erhöhen müssen. Zur Not müssen diese klaren Momente vollständig verschwinden. Auch, wenn ich sie so sehr herbeisehne. Dann sehen seine Augen beinah ein wenig so aus wie noch vor zwei Monaten, als ich mich in ihn verliebt hatte. Ich bin so froh, dass ich diese Erinnerung in mir konserviert habe. So wie die von all den Männern und Frauen vor ihm. Im Grunde bin ich nichts anderes als ein wandelndes Tagebuch. Eine Zeitmaschine aus Fleisch und Blut. Ein atmendes Museum für unvergessene Stärke und Vitalität. Und doch bin ich mehr. Ich fühle auch. Ich liebe. Und ich leide.
Manchmal frage ich mich, ob es das Risiko wert wäre, Andreas wieder gesundzupflegen. Aber dann würde er mich sicher hassen. Und das will ich ganz bestimmt nicht. Außerdem ist es wahrscheinlich schon zu spät. Von dem Mann, der er einst war, ist kaum noch etwas übrig.
Ich höre das leise Rascheln der Bettdecke. Er ist erwacht.
„La … Lass misch geh’n!“, lallt er mit brechender Stimme. Es ist wieder einer der klaren Momente. Er weiß es. Er weiß, was mit ihm geschieht. Er versucht, seinen zerbrechlichen Körper aus dem Bett zu rollen. Er will wirklich fort von mir. Das tut so weh. Wie rostige Nägel, die jemand mitten in mein Herz geschüttet hat. Warum nur will mich nur jeder von ihnen verlassen?! Weiß denn keiner mehr, was Liebe bedeutet?
Hart schlägt er auf dem Boden auf und stöhnt. Seine atrophischen Muskeln und geschwächten Reflexe sind nicht länger in der Lage, Stürze abzufangen. Wahrscheinlich hat er sich etwas gebrochen. Das ist gut. Nun wird er ganz bestimmt nicht mehr fliehen können. Ich gehe um das Bett herum und schaue ihn an. Er hat schon wieder beinah das Bewusstsein verloren. Wie ein kleines Kind trage ich seinen federleichten Körper in sein Bett zurück. Dann nehme ich einen Strohhalm aus dem Schrank, stecke ihn in das Glas Limonade, das ich extra für ihn vorbereitet habe, und halte es meinem halb bewusstlosen Engel hin. Ich lächele ihn dabei liebevoll an, auch wenn er es wahrscheinlich nicht sehen kann.
„Hier, trink, mein Liebster. Das wird dir guttun …“
Der rote Keiler
Raby biss in ihren Apfel. Die vielfältigen Aromen der Frucht breiteten sich wie ein weicher, flauschiger Teppich über ihrer Zunge aus. Es war ein schöner Apfel. Knallrot, knackig und prall und obwohl sie seinesgleichen schon so oft gekostet hatte, fand sie es jedes Mal aufs Neue erfrischend. Die Nahrung jedenfalls war nicht ausschlaggebend dafür, dass sich ihr Leben zunehmend fad anfühlte. Sie war nicht der Grund dafür, dass sich die Stunden wie ein zu lang gekautes Kaugummi streckten, zerfaserten und letztlich zerrissen, um in einem kaum unterscheidbaren Wust gleichförmiger Erinnerungsfragmente durch ihren Kopf zu treiben. Raby liebte die einfachen Dinge. Und das, obwohl – oder gerade weil – sie im Überfluss lebte. Die erlesensten Speisen und raffiniertesten Kompositionen standen ihr rund um die Uhr zur Verfügung, doch das alles war trotz der scheinbaren Vielfalt voraussehbar, während so etwas Einfaches wie ein Apfel einen immer wieder überraschen konnte.
Sicher schon zum hundertsten Mal durchschritt sie an diesem Tag den kleinen Raum mit dem steinernen, rauen Fußboden, der sich fast zweihundert Meter über dem Boden befand, vorbei an schmiedeeisernen Fackelhalterungen und ihrem bequemen Daunenbett und blickte zum Fenster hinaus.
Was sie sah, war ein Paradies. Zumindest hätten es viele Menschen früherer Epochen als ein solches bezeichnet. Keine Spur von den stinkenden Fabrikschloten, lieblosen Betonklötzen und kalten Glaspalästen, die die Dystopien des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts wie kränkliche Wucherungen verstopft hatten. Stattdessen war ihre Welt erfüllt von sauberer Luft, intakten, kleinen Wäldern, plätschernden Flüssen und nachhaltig bewirtschafteten Feldern und Plantagen, auf denen reife Ähren wie Heere von Tänzern im Wind wogten und pralle Früchte an blattreichen Ästen hingen.
Fabriken gab es auch. Doch sie waren bis auf die dazugehörigen Lagerhallen unterirdisch, vollkommen autark und emissionsfrei und so war alles, was Raby sah, pflanzliches Leben und gelegentlich einen vorbeieilenden Vogel. Andere Tiere sah sie nicht, da diese mit unsichtbaren Kraftfeldern schonend und gewaltfrei von den bewirtschafteten Flächen ferngehalten wurden, sofern sie nicht zum Erhalt der dortigen Biologie unabdingbar waren. Obwohl Rabys Turm so hoch war und die klare Luft einen wirklich weiten Ausblick erlaubte, sah sie weder Städte noch andere Türme. Was erstere betraf, so lag das daran, dass es diese schon längst nicht mehr gab. Diverse Katastrophen und Umweltveränderungen hatten dazu geführt, dass sich die Weltbevölkerung drastisch reduziert hatte. Viele Millionen haben infolge von Hunger, Seuchen und Kriegen ihr Leben verloren und doch waren das noch nicht genügend Tote gewesen. Das Ökosystem hatte am Rand des Zusammenbruchs gestanden. Man hatte die Wahl gehabt als Spezies den Heldentod zu sterben, um den Planeten zu retten oder der Erde ein paar weitere Jahre abzutrotzen und sie schließlich mit in den Abgrund zu reißen.
Wie so oft hatte man sich für einen Mittelweg entschieden. Ein Mensch pro Hundert Quadratmeter Erdoberfläche, mehr – so dachte man – könnte die mitgenommene Umwelt auf keinen Fall verkraften. Der Rest – immerhin knapp 99,99 % der damaligen Weltbevölkerung – musste zum Wohle des Planeten abtreten. Man könnte vielleicht meinen, dass dies zu Widerstand, Gewalt und Unruhen geführt hätte, aber praktisch alle waren klaglos dazu bereit gewesen, jene Pille zu nehmen, die fast immer ein tödliches Gift und nur ganz selten ein Placebo gewesen war. Vieles spricht dafür, dass viele sogar insgeheim gehofft hatten, die Giftpille erwischt zu haben. Das Leben damals war ganz und gar nicht lebenswert gewesen. Die Überlebenden jedenfalls – zu denen auch Rabys Großeltern gehört hatten, die sie nie persönlich kennengelernt hatte, genauso wenig wie ihre Eltern – hatten all das bekommen, was auch sie heute besaß: Luxuriöse Türme mit veränderbarer Ausstattung und emissionsfreier Energie, automatische, drohnengesteuerte Essenslieferungen aus den Fabriken, Unterhaltungs-, Fitness-, Lern-, Reinigungs-, Entspannungs- und Erziehungsprogramme und die spektakuläre Aussicht auf eine fast vollkommen unberührte Landschaft.
Ja, die Landschaft unter ihr war wirklich unberührt. Nicht nur, dass es praktisch unmöglich war den Turm zu verlassen, der über keinen Aufzug, keine Treppe und eine vollkommen glatte Außenmauer verfügte. Vor allem war es strengstens verboten die Felder und Wälder zu betreten und jeder Versuch wurde von spezialisierten Überwachungsdrohnen mit starken Schmerzen und dem sofortigen Rücktransport bestraft. Auch wenn sie es selbst nie ausprobiert oder beobachtet hatte, hatten ihr das zumindest die Lernprogramme ihres Turms berichtet. Raby hatte viel gelernt. Geschichte, Philosophie, Mathematik, Naturwissenschaften, Literatur, selbst Fremdsprachen, Sagenkunde, Film- und Kunstgeschichte, Soziologie und Politik. Der Turm achtete sorgsam darauf, dass sie sich all dieses Wissen aneignete. Wenn sie es einmal an Enthusiasmus mangeln ließ, gelang es der freundlichen, aber kompromisslose Computerstimme immer sie zu motivieren, sei es mit in Aussicht gestellten Belohnungen, Strafen oder geschickten, psychologischen Kniffen.
Dabei war der überwiegende Teil dieses Wissens vollkommen bedeutungslos für Rabys Leben, denn es stammte ausnahmslos aus einer Zeit, die mit ihrer Lebenswirklichkeit nichts mehr gemein hatte und es brachte auch nichts, daraus zu lernen oder eigene Schlüsse zu ziehen, da sie weder ihre Gegenwart noch ihre Zukunft wirklich gestalten konnte. Sie würde dieses Turmzimmer nie verlassen. Sie würde nie Essen kochen oder eine Maschine reparieren müssen. Sie würde nie andere Menschen treffen und mit ihnen ein Zusammenleben organisieren müssen. Holy Shit, sie wusste nicht einmal, ob es wirklich noch andere Menschen gab oder ob auch das nur ein Märchen war, denn zwischen den Türmen und ihren Bewohnern gab es nicht einmal virtuellen Kontakt. Sie hatte ihren namenlosen Turm gefragt, warum das so war. Aber er hatte ihr nur erzählt, dass so verhindert werden sollte, dass die Menschen sich organisieren, die fragile Ordnung, die gerade erst zur Rettung des Planeten geführt hatte, umstürzen und so letztlich die Natur endgültig zerstören würden. Raby hatte nicht verstanden, wie ein bisschen virtuelle Kommunikation so etwas bewirken sollte, aber der Turm hatte sich von ihren Gegenargumenten nicht beeindrucken lassen. Doch nicht nur der Kontakt zu realen Menschen war ihr verwehrt.
Es gab nicht einmal Computerprogramme, die einen digitalen Ersatz boten. Außer der Stimme des Turms gab keine Virtual Reality, keine tröstende Flucht in eine konstruierte Welt. Alles, was Raby hatte, waren Filme, Bücher, Vorträge und Hörspiele aus dem zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhundert. Neuere Inhalte gab es nicht. Es war, als hätte es die Epoche nach der Errichtung der Türme nie gegeben, als hätten diese Jahre nicht die geringste Spur im trägen Sand der Zeit hinterlassen.
Für Raby gab es keinen Unterschied zwischen den Filmen, den Sagen und den angeblichen geschichtlichen Aufzeichnungen, außer den, dass letztere viel langweiliger und nichtssagender waren, wenn auch nicht so nichtssagend wie ihr Alltag. Sie lebte ein Leben im uninspirierten Nachwort eines sehr sehr dicken Märchenbuches. Vielleicht auch in der Danksagung.
Ein Buch, an dem sie nicht mehr mitschreiben konnte. Das hieß, sie schrieb schon von Zeit etwas in das kleine solarbetriebene, elektronische Notizbuch, welches ihr zur Verfügung stand. Gedanken, Theorien, Gedichte, sogar kleine Geschichten. Allerdings wusste sie, dass ihre Worte nie jemand lesen würde. Niemand aus den anderen Türmen und auch nicht ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin, die aus ihrer Eizelle und dem Samen irgendeines Unbekannten auf künstliche Weise gezeugt werden würde. Vor etwa einem Jahr war bereits eine Drohne gekommen und hatte ihr diese Eizelle entnommen. Es war ein unangenehmer und entwürdigender Prozess gewesen, aber wenigstens war sie darauf vorbereitet gewesen. Der Gedanke daran, dass sie in gewisser Weise Nachwuchs haben würde, bedeutete ihr nichts. Warum sollte er auch? Es würde keine aufregende oder gar romantische Zeugung geben, keine anstrengende Geburt, die sie mit ihrem Kind zusammenschweißen würde, sie würde es nicht mal kennenlernen, genauso wenig wie sie ihre eigenen Eltern kennengelernt hatte. Das Mädchen oder der Junge, der nach ihr diesen Turm bewohnen würde, würde von ihr lediglich ein Bild und ein Exposee mit ein paar grundlegenden Daten erhalten. Größe, Gewicht, Lebensdauer, Schuhgröße und dergleichen.
Das war alles, was von ihr bleiben würde. Die Gedanken in ihrem Notizbuch würden nach ihrem Tod automatisch gelöscht werden und selbst, wenn sie versuchen würde, Botschaften in die Wand, die Möbel oder den Boden zu ritzen, würde der Turm sie sofort verschwinden lassen. Sie hatte es bereits ausprobiert.
Raby war nichts weiter als die Trägerin einer Vergangenheit, die nicht die ihre war und die Gefangene einer endlosen Gegenwart ohne Anknüpfung an die Zukunft. Es gab Momente, in denen sie dieses Wissen so wahnsinnig machte, dass sie sich aus dem Turmfenster gestürzt hätte, wenn der Turm das zugelassen hätte. Manchmal fragte sie sich, ob das, was ihr der Turm über die Vergangenheit berichtet hatte, wirklich stimmte. Dass die Menschen in einer Sackgasse gelandet waren und einen radikal neuen Weg hatten einschlagen müssen, konnte sie sich noch irgendwie vorstellen. Aber viele der Regeln, denen sie unterlag, ergaben für sie keinen Sinn. Diente all das wirklich nur dem Schutz des Planeten vor ihr und ihrer Art oder war es lediglich Täuschung und Propaganda?
Waren sie alle Opfer einer sadistischen, gelangweilten künstlichen Intelligenz, irgendeiner außerirdischen Rasse oder eines skrupellosen Regimes? Oder war Raby vielleicht der einzige Mensch auf einem Planeten, der als ihre ganz persönliche Hölle entworfen worden war? Sie hatte den Turm mit ihren Theorien konfrontiert in der Hoffnung eine wütende, ertappte Reaktion zu erhalten, die ihr einen Anhaltspunkt liefern würde. Doch der Turm hatte sie lediglich mit Schweigen gestraft. Mit grausamen, gnadenlosen Schweigen. Sie hatte ihn angefleht, angeschrien, beleidigt und randaliert, doch als ihre Wut verraucht war, war lediglich die Stille wieder eingekehrt, gefolgt von acht Wochen Medien- und Notizblock-Entzug. Nach dieser Zeit, die sich nach Jahrzehnten angefühlt hatte, hatte sie entschieden, Fragen dieser Art für sich zu behalten. Am Schlimmsten an dieser Zeit war gewesen, dass sie Carol nicht hatte sehen dürfen. Carol war ihre einzige Freundin. Die Einzige, die mit ihr sprach, mit ihr weinte und sie mit ihrem Antlitz tröstete. Doch als der Turm den großen Spiegel gegenüber ihrem Bett blind gemacht hatte, war auch sie verschwunden und die Einsamkeit hatte Raby beinah den Verstand genommen. Natürlich nur beinah, denn der Turm wusste ganz genau, wo ihre Grenzen lagen.
Jetzt immerhin war Carol wieder da. Sie sah der schlanken, blonden Frau mit dem knöchellangen schwarzen Spitzenkleid und den traurigen grauen Augen dabei zu, wie sie halb genießerisch und halb lustlos einen weiteren Bissen von der Frucht nahm, die immerhin natürlicher aufgewachsen war, als sie selbst. Manchmal lächelte Carol sie an und diese Momente erschienen ihr immer wie ein ferner Traum, so schön sie auch waren. Manchmal legte sie auch ihr Kleid ab und ließ sie ihren neunundzwanzigjährigen Körper betrachten, der nicht makellos, aber recht gut in Form war. Kein Wunder, da der Turm darauf achtete, dass sie genau die richtige Menge aß und ihr tägliches Trainingsprogramm absolvierte. Manchmal stellte sie sich vor, wie Carol aus dem Spiegel steigen, sie in die Arme schließen und sie berühren würde, wie sie es in einigen Filmen gesehen hatte. Dass sie ein unabhängiges Leben entwickeln und mehr tun würde, als nur ihre eigenen Bewegungen nachzuahmen. Manchmal sah sie sich auch Filme dieser Art an, wenn sie sich selbst berührte, doch meist ließ sie das noch einsamer zurück, als der Anblick von Carol.
Ab und zu, wenn ihre Gedanken besonders verrückte Blüten trieben, stellte sie sich auch vor, wie jemand aus den näher gelegenen Türmen durchs Fenster kommen und sich zu ihr legen würde. Ganz egal, ob Frau oder Mann. Hauptsache irgendjemand, irgendein Mensch, der nicht sie selbst war. Doch genauso hätte sie von Einhörnern und Drachen träumen können oder davon, selbst über ihr Leben bestimmen zu können.
Als sie den Apfel aufgegessen hatte, warf sie die Überreste auf den Boden, wo sich sofort eine Luke öffnete und ihn verschlang. Er würde zur Energiegewinnung genutzt werden, wie alle ihre Abfälle und Ausscheidungen. Alles hier war ein optimierter und effizienter Kreislauf, bei dem an alles gedacht worden war, außer an Rabys Lebensglück.
Sie überlegte, was sie nun tun könnte. Essen konnte sie nichts mehr. Ihre Kalorien für heute waren aufgebraucht, auch wenn sie sich manchmal wünschte sich so vollzustopfen bis ihr Übel wurde, einfach nur um den Turm damit zu ärgern. Aufs Schreiben hatte sie gerade keine Lust und aus dem Fenster wollte sie auch nicht mehr schauen. Mehr aus Langeweile, denn aus wirklichem Interesse wählte sie eine Dokumentation über Online-Dating aus dem Unterhaltungsangebot, die sie lediglich fünfmal gesehen hatte und legte sich auf ihr angenehm weiches Bett. Nach etwa einer halben Stunde schlief sie ein und hoffte dabei ein wenig, nicht wieder aufzuwachen.
~o~
“Hallo Raby … Hallo!”, sagte eine Stimme, die sie nicht kannte. Weder von der Doku, noch vom Turm oder aus einem der Filme und Hörbücher. Und da sie ausnahmslos alle davon kannte, musste sie von einer anderen Person stammen, so unglaublich das auch war. Noch vor einigen Stunden hätte sie allein der Gedanke an solch ein Wunder in freudige Erregung versetzt, nun aber erzeugte er lediglich Panik. Instinktiv zog sie ihre Decke höher über ihren nackten Körper, griff sich ihren Notizblock und hielt ihn wie einen Schild vor sich, während sie aus dem Bett hochschreckte und sich so nah wie möglich an die Wand presste.
Die Stimme gehörte einem Mann. Er war vielleicht Ende dreißig, hatte schwarzes, verfilztes Haar, braune Augen, hatte ein zerrissenes, cremefarbenes Leinenhemd, unter dem sich eine behaarte Brust abzeichnete und einen ungepflegten, wilden Bart. In seiner linken Hand trug er einen Gegenstand aus Metallplättchen und Drähten, der so wirkte, als hätte er ihn notdürftig zusammengeschmiedet oder gelötet. In seiner rechten Hand hielt er ein Messer. Sein Blick lag irgendwo zwischen Gier, Verlegenheit, Überwältigung und Verwirrung.
“Geh weg!”, sagte Raby als sie das Messer in der Hand des Mannes erblickte, „Turm! Hier ist ein Eindringling! Wirf ihn raus!”
In Wahrheit wusste Raby nicht mit Sicherheit, inwieweit der Turm sich ernsthaft für ihr Wohlbefinden interessierte, allerdings war sie sich ziemlich sicher, dass das hier gegen das Protokoll verstieß. Und so wartete sie darauf, dass der Eindringling von einem Elektroschock getroffen werden würde, dass ihn ein Betäubungsgas außer Gefecht setzten würde oder dass eine Drohne durchs Fenster kommen würde, um ihn mit sich zu zerren und ihn dorthin zurückzubringen, wo er hergekommen war, aber nichts davon geschah. Stattdessen stand der Mann, dessen bitterer, saurer, ungewaschener Geruch zu ihr hinüberwehte, noch immer vor ihr und starrte sie an.
“Brauchst keine Angst zu haben”, sagte der Mann, der erst jetzt das Grauen in ihrem Gesicht zu bemerken schien. Als dieses Grauen nach wie vor nicht verschwand, wanderte sein Blick zu dem Messer in seiner Hand. “Oh”, sagte er peinlich berührt und senkte die Waffe, “das ist nicht wegen dir. Es ist nur … so ‘ne Angewohnheit.”
“Wer bist du?!”, fragte Raby mit einem nervösen Zittern in der Stimme und suchte ihm Turmzimmer nach etwas, dass sich als Waffe eignen würde. Sie fand nichts, “woher kennst du meinen Namen und warum duldet der Turm deine Anwesenheit?”
“Das … das ist das Gerät hier, weißt du, Raby?”, sagte er und sah ihr dabei nicht ins Gesicht, sondern starrte auf die Stelle wo er ihre Brüste hätte sehen können, wenn sie nicht von der Decke verborgen gewesen wären, “ich hab’ es gebaut, es legt ihre Technik lahm, es …”
“Wer bist du und woher kennst du meinen Namen?!”, wiederholte Raby mit Nachdruck.
“Ich bin … Dave. Und dein Name steht unten am Turm”, sagte der Mann, “Wir können es von hier oben nicht sehen, aber er ist da. Auf so 'ner Anzeige dort, die sie immer aktualisieren, wenn einer ersetzt wird. Darf ich dich berühren?”
In seiner Stimme schwang eine nervöse Vorfreude mit, die Raby anwiderte. Das entsprach überhaupt nicht ihrer Fantasie. “NEIN!”, sagte sie entschieden, “Geh weg, du Perverser! Ich will dich hier nicht haben!”
“So meinte ich das nicht!”, sagte Dave in einem enttäuschten Tonfall, der unfreiwillig klarmachte, dass er es ganz genauso gemeint hatte, “Ich will nur deine Hand nehmen, deinen Arm, nur ganz kurz. Einmal spüren, wie das ist. Wie Berührungen sind, willst du das nicht auch wissen?”
“Nein!”, sagte Raby, auch wenn das nicht der Wahrheit entsprach. Sie wollte wissen, wie sich Berührungen anfühlten, mehr als alles andere sogar. Aber sie traute diesem Kerl nicht über den Weg.
“Schade … sehr schade”, sagte Dave und verzog die Lippen wie ein schmollender Junge. Dennoch wirkte er nicht gänzlich infantil oder zurückgeblieben. Auch wenn Raby bislang nie einen anderen Menschen gesehen hatte, hatten ihr die Filme und Bücher, die sie konsumiert hatte, doch ein ganzes Set an Klischees und Charaktertypen vermittelt, aus denen sich Dave ihrer Meinung nach wunderbar zusammensetzen ließ: Dem intelligenten, zerstreuten, schüchternen Nerd, dem naiven Kindskopf, dem ungehobelten Hinterwäldler und dem unberechenbaren Lüstling. Keine sehr angenehme Kombination.
“Warum bist du immer noch hier?”, fragte Raby ungeduldig, wobei sie versuchte ihre Angst mit Strenge zu überspielen.
“Ich … ich bin doch gerade erst gekommen. Du … du brauchst echt keine Angst vor mir zu haben”, sagte er und warf sein Messer nach ihr, wobei er es ihr wahrscheinlich eher ZUWERFEN wollte, aber nicht bedachte, dass das bei einem solchen Gegenstand keine gute Idee war. Nur durch eine schnelle Seitwärtsbewegung, entging sie einer möglichen Armverletzung. Zum ersten Mal zahlte sich ihr erzwungenes Trainingsprogramm aus.
“BIST DU BESCHEUERT?!”, schrie sie Dave an und die Wut spülte vorerst ihre Angst hinfort. Sie nahm das neben ihr liegenden Messer in die Hand, sprang nackt wie sie war aus dem Bett, ging mit der Waffe auf Dave zu und hielt sie ihm an die Kehle, wie sie es in diversen Filmen gesehen hatte. Sein ungewaschener Geruch raubte ihr aus dieser Distanz fast den Atem.
“Verpiss dich endlich!”, verlangte sie, “Wie, ist mir egal. Von mir aus kannst du aus dem verfluchten Turm springen!”
Daves zuvor zu gleichen Teilen gieriger, verwirrter und verlegener Blick wurde nun seinerseits angsterfüllt, während er – den Oberkörper halb aus dem Turmfenster gelehnt – vor ihr stand. Mit einem Mal schien er keine Augen mehr für ihren Körper zu haben. “Das … das war keine Absicht, ich schwöre, ich … ich hab’ nich’ nachgedacht. Nicht darüber … aber … aber über andere Dinge. Du willst doch sicher wissen, wie ich es geschafft habe sie zu überlisten und hierherzukommen, wie es dort draußen ist, was ich dort alles gesehen habe, oder nicht? Wenn ich jetzt gehe, wirst du das nie erfahren. Nie frei sein können. Bitte … ich will nur reden. Nichts weiter. Einfach nur reden. Mit einem anderen Menschen.
“Auch wenn der schlechte Atem des Mannes ihren Ekel vor ihm verstärkte, musste sie zugeben, dass er irgendwie Recht hatte. So unangenehm der Besuch des Fremden bisher für sie gewesen war, so stellte er doch trotzdem eine Möglichkeit dar, ihre endlose Routine zu unterbrechen. Selbst, wenn dieser Mann nur Schwachsinn erzählen sollte, würde sie noch lange über diese Erlebnisse schreiben und nachdenken können und irgendwie hatte er es ja tatsächlich geschafft den Turm zu überlisten. Was seine Rede von der Freiheit bedarf, so war sie da mehr als skeptisch. Ja, nun wo er dieses Wort erwähnt hatte, machte es ihr sogar auf gewisse Weise Angst. Dennoch konnte es nicht schaden, ihm zuzuhören. Immerhin hatte sie ja jetzt das Messer.
“In Ordnung”, sagte sie, ohne die Waffe von seinem Hals zu nehmen, “ich ziehe mir jetzt was an und dann reden wir.”
~o~
Einige Minuten später saß Raby angezogen auf ihrem Bett. Sie hatte ein schlichtes schwarzes Kleid gewählt, das möglichst viel verbarg und hatte sich so weit weg von Dave platziert wie nur möglich. Das Messer hielt sie fest in der Hand und ließ den Besucher, der vor der gegenüberliegenden Wand auf dem Boden saß und beschämt ihrem Blick auswich, keinen Moment aus den Augen. Der Turm war nach wie vor nicht wieder erwacht. Was immer Dave mit ihm angestellt hatte, schien zu funktionieren. “Was ist nun?”, fragte Raby, die erleichtert darüber war die Situation wieder halbwegs unter Kontrolle zu haben, “wolltest du mir nicht was erzählen?”
“Schon klar, machich”, sagte Dave, wobei er die letzten beiden Worten tatsächlich zu einem zusammenzog, “Also … es ging damit los, dass mein Turm Aussetzer zeigte. Gab plötzlich Zeiten, in denen er nich’ mehr aktiv war, in denen er nich’ mehr mit mir gequatscht hat.”
“Das hatte ich auch schon”, wiegelte Raby ab, “so bestrafen die Türme uns, wenn sie besonders wütend sind.”
“Nein garnich' Raby”, widersprach Dave kopfschüttelnd, “das is’ es nich’. Es war kein Strafschweigen. Dafür war’s nich’ lang genug. Anfangs waren's dreißig Minuten, später zwei Stunden. Mehr nich’. Dafür aber jeden Tag. Ich vermute, dass es etwas mit der Energieversorgung zu tun hatte. Womöglich war sie beschädigt. Jedenfalls hab ich es ausgetestet …”
Dave hielt inne und räusperte sich auf lautstarke und äußerst unästhetische Weise, bevor er einen Brocken Schleim hinunterzuschlucken schien.
“Habe den Turm angeschrien und beleidigt, habe ihm alles Mögliche unterstellt und am Ende sogar – vorsichtig – gegen die Einrichtung getreten. Aber nichts is’ passiert. Gar nichts. Auch nicht, wenn der Turm wieder erwachte. Also dachte’ ich mir, ich probier mal was aus. Dachte mir, ob ich’s nich’ ausnutzen kann, dass der alte Wächter nich’ hinsieht. Hab mir Tutorials geladen, Zeugs von dieser Videoplattform, die sie früher hatten. Inginieurskram, Sachen übers Bauen, über Physik und Elektronik. Hat mich schon immer interessiert und jetzt noch mehr. Hab viel gelernt, probiert, rumüberlegt und dann gebaut.”
“Und all das hast du dir ohne Strom angesehen?”, fragte Raby mit skeptisch hochgezogener Augenbraue.
“Nö doch”, widersprach Dave, “Natürlich nur dann, wenn der Turm aktiv war.”
“Du hast das alles ganz offen gemacht?”, fragte Raby, die so langsam den Eindruck gewann, verarscht zu werden.
“Nicht alles, nicht”, antwortete Dave, “Gebaut, geschweißt und geschraubt hab ich, wenn der Turm sein Nickerchen hielt.” Dave gähnte herzhaft, ohne seinen Mund zu bedecken und so konnte sie ungepflegte, braune Zähne sehen.
“Trotzdem muss er doch etwas geahnt haben”, sagte Raby, “der Turm ist nicht dumm.”
“Isser nicht”, stimmte Dave zu, “zumindest normalerweise nicht. Aber sein Oberstübchen hat 'nen Dachschaden abbekommen. Er wusste nichts davon, dass er manchmal schlief und ich hab es ihm nicht gesagt. Nein, gar nicht. Mag sein, dass er sich über die Zeichnungen gewundert hat, über all die Zahlen und Formeln und was die so bedeuteten, aber er muss sich gedacht haben, dass er mich bequem wegblitzen kann, wenn ich auch nur ein Schräubchen auf die falsche Art anbringe. Außerdem, lernen darf ich ja. Erst recht so’n Technikzeugs. Du etwa nicht?”
Das überraschte Raby, sie hatte nicht gewusst, dass es bei den Turmbewohnern Spezialisten gab. Bei ihr hatte man wahrscheinlich mehr Wert auf eine profunde Allgemeinbildung gelegt und auf gutes Benehmen, wenn sie sich Dave so ansah. Über Physik hatte sie recht viel theoretisches Wissen, aber kaum praktisches und über Ingenieurskunst noch weniger. “Nein”, antwortete Raby, “meine Talente liegen woanders.”
“Das will ich hoffen”, sagte Dave gackernd und schenkte ihr ein widerliches, anzügliches Grinsen, bevor er den Kopf wieder senkte wie ein Junge, der einen heftigen Anschiss von seiner Mutter kassiert hatte.
Raby gab sich Mühe, sein widerliches Verhalten zu ignorieren und sich stattdessen auf seine Schilderungen zu konzentrieren.
“Aber wo hast du die Werkzeuge her?”, fragte sie.
“Die liegen bei mir im Turm. Darf nichts Eigenes bauen. Nichts erfinden. Aber ich darf Dinge nachbauen. Dafür hatt’ ich den Kram”, antwortete Dave mit einem schüchternen, nuschelnden Flüstern, welches Raby noch mehr verunsicherte als seine unhöfliche Bemerkung davor.
“Lass mich raten”, sagte Raby, “damit hast du dein kleines Gerät vorbereitet, es irgendwann in einer einzigen Zwei-Stunden-Sitzung zusammengebastelt und den Turm damit endgültig außer Gefecht gesetzt.”
“Gar nicht schlecht, nich'”, sagte Dave anerkennend, “aber das war noch nicht alles, was sich der gute Dave ausgedacht hat. Hab mir auch 'nen Fallschirm gebastelt und bin damit runtergesegelt.”
Er unterstrich seine Worte, indem er mit seiner Hand einen hinabsinkenden Papierflieger imitierte.
“Wie bist du den Drohnen entgangen?”, fragte Raby.
“Das war leicht”, sagte Dave, “Das kleine Schätzchen hier stört ihre Funktionen, macht mich praktisch unsichtbar für die. Kann sie sogar ausschalten, wenn ich’s will, so wie ich’s mit deinem Turm gemacht hab. Schlimmer, Raby, war die Natur. Schön ist die, aber auch wild. Auch gefährlich. Gibt wilde Tiere. Musste mich wehren, weißte? Deswegen auch das Messer. Nich wegen dir. Garnich wegen dir.”
“Schön und gut”, sagte Raby. “Aber wie geht es jetzt weiter?”
“Kommst mit mir. Raus aus der Bude”, sagte Dave als wäre das vollkommen offensichtlich und beschlossene Sache.
“Das ist immer noch meine Entscheidung”, sagte Raby streng und strich mit der freien Hand über das Messer. Auf gewisse Weise fühlte es sich gut an. So, als hätte die Waffe schon immer in ihre Hand gehört.
“Natürlich, natürlich”, sagte Dave beschwichtigend, “aber ist schön dort draußen. Solltest du gesehen haben. Nicht ungefährlich, nein, aber du hast ja das Messer. Und du hast mich.”
Erneut grinste er ein schmieriges Grinsen, “Und vielleicht willst du ja doch noch berührt werden. Wir könnten Kinder haben, ohne den Turm. Auf die gute alte Art.”
Allein der Gedanke löste in Raby Übelkeit aus. “Auf keinen Fall!”, sagte sie eisig, “wenn du mich angrabschst, wirst du es bereuen.”
“Schon gut”, sagte Dave mehr enttäuscht als wütend, so als wäre er es gewöhnt Ablehnung zu erfahren, was in einer Welt, in der es für ihn bislang nie soziale Interaktion gegeben hatte, genaugenommen ziemlich verwunderlich war, “wenn du mich nicht magst, finden wir andere. Gibt viele Türme. Wenn wir ein bisschen herumreisen, findet sich auch einer für dich. Einer wo gepflegter ist und noch nicht wie ich monatelang ohne Papa Turm auskommen musste.”
Raby war hin- und hergerissen. Sie war durchaus neugierig wegen der Welt dort draußen. Sie würde gerne Tiere und Pflanzen berühren, wissen, wie sich der Waldboden anfühlte und ja – vielleicht auch jemanden kennenlernen, der ihr nicht so unsympathisch war wie Dave, aber andererseits schätzte sie trotz allem den Komfort und die Sicherheit des Turms. Andererseits war das hier vielleicht ihre einzige Gelegenheit, etwas anderes als das zu sehen, was sie seit ihrer Geburt gesehen hatte.
“In Ordnung”, sagte Raby, “ich komme mit. Aber nur für ein paar Stunden, dann gehe ich zurück.”
Dave sah sie überrascht an, zuckte dann aber mit den Schultern.
“Alles klar”, sagte er, kramte zwei zusammengefaltete Stoffstücke aus seinem Rucksack, ging auf Raby zu und reichte ihr einen davon. Raby nahm den Fallschirm entgegen und für einen winzigen Moment berührte sich dabei ihre Finger und auch wenn sie sich später sicher war, dass Dave es genau darauf angelegt hatte, überwältigte sie diese Erfahrung in diesem Moment regelrecht. Ein wohliger Schauer lief über ihren Rücken. Sie zitterte leicht, die Haare auf ihren Armen und schließlich auf ihrem ganzen Körper richteten sich auf und ein kurzes aber angenehmes Kribbeln erwuchs in ihrer Brust, während sie spürte wie ihre Augen feucht wurden. Ein uralter Instinkt riet ihr, ja verlangte geradezu von ihr Daves Hand zu ergreifen und am besten gleich noch viel mehr zu tun, aber sie widerstand dem Befehl ihres Reptiliengehirns. Ein Blick auf die so bemitleidenswerte wie abstoßende Gestalt von Dave reichte aus, um solche Pläne sofort in den hintersten Winkel ihres Kopfes zu verbannen. Dennoch würde sie diese Berührung nie vergessen, denn es war trotzdem die Berührung eines Menschen. Eine Berührung, wie sie sie noch nie in ihrem Leben erfahren hatte.
Sie kämpfte ihre Freudentränen nieder, legte den Fallschirm an und ging zusammen mit Dave zum Fenster, wobei sie darauf achtete, stets das Messer zwischen ihm und ihr zu wissen. Einmal mehr steckte sie den Kopf aus dem Turm heraus und betrachtete die Welt unter ihr aus dem Winkel, wie sie sie ihr ganze Leben über gesehen hatte. Dann sprangen sie gemeinsam aus dem Turm.
~o~
Die Landung war unerwartet weich. Nicht nur, dass die Fallschirme gut funktionierten, sie landeten auch im hohen weichen Gras, welches sich vom Turm bis zum Waldrand erstreckte. Das Gefühl des Fallens hatte Raby wenig ausgemacht. So oft hatte sie sich vorgestellt, wie schrecklich es sein musste, auf den Boden zuzustürzen. Doch das Adrenalin und der frische, aber relativ warme Wind weckten ihre Lebensgeister und im Gegensatz zu Dave, der ein paar lächerliche Ausfallschritte machen musste, geriet ihre Landung beinah mustergültig.
“Hab ich gut gemacht, die Dinger, nich?”, fragte Dave, während er seinen Fallschirm in seinem Rucksack verstaute. Die Flecken, die das Gras auf seinem Gesicht hinterlassen hatte, machten sein Lächeln nicht sympathischer.
“Sie erfüllen ihren Zweck”, sagte Raby nüchtern, auch wenn immer noch die Emotionen in ihr tobten. Sie mochte diesen Typen nicht, aber sie wollte ihn dennoch unbedingt wieder berühren. Nein – eigentlich nicht ihn, sondern irgendeinen anderen Menschen, einfach nur, um wieder das zu spüren, was sie bei dieser einen Berührung empfunden hatte. Die Umgebung machte es nicht besser. Der wohlige, nicht zu heiße Sonnenschein dieses freundlichen Frühsommertages streichelte ihre Haut und umgab sie vollständiger, als er das im Turm je gekonnt hatte. Der Duft der vereinzelt blühenden Wildblumen und des nahen Waldes – beide noch feucht von einem lauen, kürzlich erfolgten Regenguss durchströmte sie wie ein magisches Parfum. Das Gras kitzelte ihre nackten Füße und der Wind spielte mit ihren Haaren wie ein neugieriges Kind. Raby fühlte sich so lebendig wie noch nie zuvor. Ja, fast fühlte es sich verboten an. Und das war es im Grunde ja auch. Sollten die Drohnen sie dabei erwischen, wie sie sich durch die unberührte Wildnis bewegte, konnte sie von Glück reden, wenn sie mit Schweigen bestraft wurde. Dennoch wollte sie darin eintauchen, es erleben, diese unbekannte Welt, von der sie alles wusste, aber nichts erfahren hatte, durchschwimmen wie einen Ozean. Vielleicht hatte Dave doch recht. Vielleicht mussten sie die anderen Turmbewohner aufsuchen.
“Es ist wunderschön, nich?”, fragte Dave und mit einem Mal wurde sein Blick etwas abwesend und seine Stimme bekam etwas Sanftes, Aufrichtiges, was sie zuvor nicht an ihm wahrgenommen hatte. Er schien das hier wirklich zu fühlen und das machte ihn ihr zumindest eine Winzigkeit sympathischer.
“Das ist es”, sagte Raby, “in diesem Punkt hast du nicht gelogen.”
“Ich hab auch sonst nich’ gelogen”, sagte Dave ernst, “Hömma … wir hatten keinen netten Start. Ich hab’ dich bedrängt und komme sicher etwas komisch rüber. Wie so’n Weirdo. Weiß ja, dass man das nich’ so macht. Weiß das aus’n Filmen und vom Turm seinen Predigten. Aber war halt so lange einsam. Kennste ja selbst. Viele Gedanken, viel Fantasie, kaum echtes Leben. Das macht einen seltsam. Einsam. Seltsam. Liegt ja irgendwie nahe. Wer nur einer ist, ist ja meist auch selten.”
“Ich konnte mich trotzdem benehmen”, sagte Raby, lächelte jedoch dabei.
“Bist halt ne Frau, die sin’ schlauer!”, sagte Dave mit einem Grinsen, dass bei ihr nach wie vor keine Charmepreise gewinnen würde.
“Vielleicht”, sagte Raby, “doch was machen wir jetzt. Weißt du, wo der nächst Turm ist?”
Dave nickte. “Bin ein bisschen rumgereist. Hab was von der Welt gesehen. Seh' nicht ohne Grund so aus, weisste?”, er zeigte seine braunen Zähne, “ist ein ziemlicher Weg. Aber Wasser gibt’s unterwegs, und Beeren und ab und an ein Tier, das wo man abmurksen kann.”
“Wenn es Wasser gibt, warum hast du dich dann nicht gewaschen?”, fragte Raby.
“Keinen Grund gehabt”, sagte Dave, “Hat mich ja keiner gerochen und wenn man ein bisschen läuft, wird man eh gleich wieder dreckig. Und außerdem wollte ich im Fluss Wasser trinken und keinen Dave-Tee, weißte.”
Raby verzog angewidert das Gesicht. “Du hättest dich ja für die anderen Turmbewohner fein machen können”, erwiderte sie, “wo sind die jetzt überhaupt?”
“Na in ihren Türmen”, sagte Dave, “hab sie nie besucht. Hab mich nicht getraut, nicht. Bin da rumgeschlichen wie so’n Stalker, hab beobachtet und bin dann wieder gegangen. Hab lieber geschaut, was anderswo ist. Erst bei dir dachte ich mir: Dave, du alter Schisser, zeig mal, dass du Traute hast und so bin ich in deinen Turm rein.”
“Da kann ich mich ja glücklich schätzen”, sagte Raby in einem Tonfall, der irgendwo zwischen ernsthafter Aussage und Sarkasmus balancierte, “aber wie bist du überhaupt in meinen Turm hereingekommen?”
“Hab ne Drohne gesteuert und mich rangehangen”, erklärte Dave.
“Du kannst die Drohnen mit diesem Ding steuern?”, fragte Raby ungläubig.
“Jau, das kann ich”, antwortete Dave, “aber mach ich nicht oft. Is' ‘n bisschen unsicher. Das Ding kann überhitzen. Ist besser sich abzuschirmen.”
Plötzlich erklang über ihnen eine laute, dunkle männliche Stimme, “Raby! Wo bist du? Komm zurück!”
Raby zuckte kurz vor Schreck zusammen, während Dave nicht überrascht zu sein schien. “Das ist dein Turm, nicht?”, fragte er, wobei es eher eine Feststellung war.
“Ja”, flüsterte Raby ängstlich und blickte sich unsicher zu dem hohen Gebäude um, “ich dachte, du hättest ihn lahmgelegt!”
“Nur kurzfristig”, sagte Dave, “das Gerät macht uns für sie unsichtbar und kann ihre Elektronik stören, aber es hat nur eine begrenzte Reichweite und es zerstört sie nich’.”
“Raby, du weißt, dass das verboten ist. Stell dich an meine Außenwand an der Fensterseite und ich werde dir eine Drohne schicken, die dich nach oben bringt. Keine Schmerzen. Dir wird nichts geschehen!”, versprach der Turm.
Raby machte beinah instinktiv ein paar Schritte auf den Turm zu.
“Hey, wo willst du hin?”, fragte Dave, “die Dinger lügen. Die wird dir dafür den Arsch braten und dann biste wieder auf Ewigkeit eingekerkert. Ist es das, was du willst?”
Raby wusste es nicht. Diese Situation machte ihr Angst. Die ganze scheiß Welt machte ihr Angst. Dennoch blieb sie stehen. Jedoch nicht wegen Daves Worte, sondern weil plötzlich zwischen ihr zwei große silberne Drohnen mit je acht langen, wie Quallententakel nach unten hängenden Metallarmen erschienen, deren ansonsten meist blauen Positionslichter rot aufleuchteten.
“Duck’ dich!”, sagte Dave, “und komm näher zu mir. Dann wird alles gut!”
Raby tat, was er sagte, eilte ein paar Schritte auf Dave zu und machte sich so klein wie möglich, während die Drohne zielsicher auf sie zusteuerte und Dave an seinem Gerät herumhantierte.
“Raby!”, wiederholte die Maschine, “ich sehe dich. Mach es uns beiden doch nicht so schwer. Komm zu mir zurück. Bitte!
“Es funktioniert nicht!”, rief Raby.
“Sei still!”, sagte Dave unfreundlich, während er jedoch nicht sie, sondern die Drohne fixierte, die schon fast seinen Kopf erreicht hatte, einen ihrer Arme ausstreckte und dann … unvermittelt von rotem auf blaues Licht umschaltete und abdrehte, bevor sie schließlich im Himmel verschwand.
“Tut mir leid”, sagte Dave zerknirscht, “wollt’ dich nich’ so anmachen. Hätte auch nicht passieren dürfen. Das Gerät is’ halt nich’ perfekt. Hat manchmal 'nen Wackelkontakt.”
“Hättest du mir das nicht vorher sagen können?”, erkundigte sich Raby schwer atmend und durchaus verärgert.
“Ja”, gestand Dave ein, bevor er wieder anfing zu grinsen, “aber dann wärst du nich’ mitgekommen.”
~o~
Spätestens nach diesem Vorfall hatte Raby große Lust gehabt, sich in den Turm zurückzuziehen, aber zugleich hatte sie zu große Angst vor seinem möglichen Zorn. Auch wenn die synthetische Stimme eher besorgt als verärgert geklungen hatte, wusste sie, dass das nichts bedeuten musste. Diesen Tonfall hatte sie oft vor den schlimmsten Strafen angeschlagen. Es war aber nicht nur die Angst, die sie von einer Umkehr abhielt, sondern auch die Neugier. Nun, wo sie so weit gekommen war, wollte sie mehr von der Welt sehen und so tauchte sie schließlich zusammen mit Dave in das Wäldchen ein.
Die intensiven Düfte nach Laub, Blüten, Pilzen, die Laute von Vögeln und Insekten und das Rauschen der Blätter im Wind gaben Raby beinah das Gefühl in einem Traum zu sein, der wirklicher war als ihre bisherige Realität. Sie hatte all das bereits tausendfach gesehen, aber in diesem Moment war sie der Meinung, dass Bilder von Monitoren rein gar nichts bedeuteten, wenn es keine realen Erinnerungen gab, an die sie anknüpfen konnten.
“Am liebsten würde ich mich hier niederlassen”, entfuhr es ihr.
“Wär’ sicher schön”, sagte Dave, “aber nicht gut so nah am Turm. Außerdem gibt es hier keinen Fluss zum Trinken und kaum Wild oder Beeren zum Essen. Wir müssen erst noch ein paar Kilometer laufen. Da wird’s besser.”
Bei dem Gedanken daran, ein Tier zu töten wurde Raby sofort schlecht. Sie hatte zwar schon oft Fleisch gegessen, aber es war aus der Fabrik gekommen und wurde dort synthetisch hergestellt. Das brachte sie auf eine Idee. “Könnten wir nicht eine der Drohnen abfangen, die aus der Fabrik kommt oder direkt dort einbrechen und uns etwas besorgen?”
Dave schüttelte bedauernd den Kopf. “Das wär’ toll, was? Aber ich hab nichts dabei, mit dem wir dort einbrechen können. Und was das Gerät betrifft … tja, hast ja grad’ gesehen, dass das nicht immer so klappt, wie man will.”
Dem konnte Raby leider nicht widersprechen und so ließen sie das nahe Fabrikgelände links liegen und setzten sie ihren Weg durch den Wald fort, wobei Raby die meiste Zeit über schwieg und die Umgebung auf sich wirken ließ. Sie wollte nichts davon vergessen, für den Fall, dass sie doch wieder in ihrem Turm landen würde.
Sie begegneten auf ihrer Reise mehreren Hasen, einem Reh, sowie einigen Igeln, Vögel und Eichhörnchen. Dave, der unterwegs einen spitzen Stock aufgehoben hatte, hatte sich trotz ihrer Einwände ein paar mal daran versucht eines dieser Tiere zu erlegen, war jedoch kläglich gescheitert. Immerhin organisierte Raby aber ein paar Beeren und Pilze, von denen sie dank ihres Unterrichts wusste, dass sie genießbar waren und kurz vor Einbruch der Dämmerung gelangen sie auch an einen kleinen Bach, an dem sie ihren Durst stillten. Die Fische dort drin waren so winzig, dass nicht mal Dave auf die Idee kam nach ihnen zu angeln.
Auf weitere Drohnen trafen wir nicht und jetzt, wo sowohl die Fabrik als auch ihr Heimatturm schon lange außer Sicht waren, kam ihr das alles noch viel unglaublicher vor.
“Wir sollten besser ‘n Nickerchen machen”, sagte Dave, als die Sonne untergegangen war.
“Warum?”, fragte Raby ihn, “ich bin noch gar nicht müde und bis zum nächsten Turm wird es doch noch immer sehr weit sein. Wir könnten also ruhig noch ein bisschen laufen. Oder geht dir schon die Puste aus?”
“Nein, aber es gibt Gefahren”, sagte er, “ist besser, wenn wir nur tagsüber gehen.”
“Welche Gefahren denn bitte?”, wollte Raby wissen, “das Gelände scheint mir eben und gut zugänglich zu sein und am Himmel steht ein fast voller Mond, ohne jede Wolke. Stolpern sollte also kaum möglich sein und Menschen gibt es außer uns ja nicht und was die Tiere angeht, so sind die meisten ja eher scheu. Was also sollte uns am Weiterlaufen hindern?”
“Der rote Keiler”, flüsterte Dave in einer Lautstärke, die so bemessen war, dass Raby sich unsicher war, ob die Worte überhaupt für sie bestimmt gewesen waren.
“Der rote Keiler?”, wiederholte Raby verwirrt, “was soll das denn sein?”
Dave wirkte verlegen, was in Raby die Vermutung stärkte, dass sie diese Worte tatsächlich nicht hätte hören sollen.
“Ist ‘ne fiese Bestie”, sagte Dave, “viel blutrünstiger als ‘ne gewöhnliche Wildsau. Die haben die zur Sicherheit in diesen Wäldern platziert, falls doch mal jemand ausbüchsen will. So wie wir.”
“Und dir hat das Vieh noch nie etwas getan?”, erkundigte sich Raby.
Dave schüttelte den Kopf. “Noch nich'”, sagte er, “sonst wär ich nicht mehr hier. Aber ich bin diesem Scheißer ein paar mal nur knapp entgangen.”
Raby hatte das Gefühl, dass das nicht die Wahrheit war. Zumindest nicht die ganze. “Und dieses Tier jagt nur bei Nacht?”, fragte sie.
“So schaut’s aus”, antwortete Dave.
“Weswegen es besser ist, wenn wir ihm schlafend begegnen?”, fragte Raby noch immer skeptisch und das Gesicht von Dave begann so rot zu werden, dass seine Ohren förmlich glühten.
“Er … wir sind noch nicht in seinen Jagdgründen. Die will ich morgen schnell durchqueren”, sagte Dave, “damit wir nich’ von ihm belästigt werden.”
“Also gut”, sagte Raby, die noch immer nicht so recht wusste, was sie von dieser Sache halten sollte, “dann rasten wir und gehen morgen weiter. Ich halte die erste Wache.”