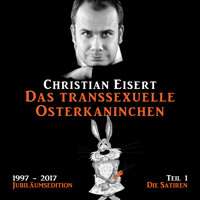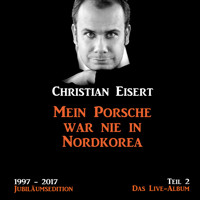9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Irgendwann ist jeder Mann kein junger Mann mehr. Die Lebenszeit, die vergangen ist, scheint länger zu sein, als die, die noch kommt. Auch für Bestsellerautor Christian Eisert beginnt die zweite Halbzeit seines Lebens. Was nun? Die Suche nach der Antwort verlangt ihm einiges ab. Denn nicht nur die Mängel werden mehr, auch die Möglichkeiten, sie zu beseitigen. Ob Hormonpillen, Lichtatmung oder Entspannungsbrillen, Eisert schreckt vor nichts zurück. Zum Leidwesen der zwei Frauen an seiner Seite. Bald geht es nicht mehr nur um Eitelkeiten, sondern um die Frage: Was gewinnen Männer, wenn sie älter werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Irgendwann ist jeder Mann kein junger Mann mehr. Die Lebenszeit, die vergangen ist, scheint länger zu sein, als die, die noch kommt. Auch für Bestsellerautor Christian Eisert beginnt die zweite Halbzeit seines Lebens. Was nun? Die Suche nach der Antwort verlangt ihm einiges ab. Denn nicht nur die Mängel werden mehr, auch die Möglichkeiten, sie zu beseitigen. Ob Hormonpillen, Lichtatmung oder Entspannungsbrillen, Eisert schreckt vor nichts zurück. Zum Leidwesen der zwei Frauen an seiner Seite. Bald geht es nicht mehr nur um Eitelkeiten, sondern um die Frage: Was gewinnen Männer, wenn sie älter werden?
Christian Eisert
Anpfiff zur zweiten Halbzeit
Wenn aus Jungs Männer werden
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Originalausgabe April 2018
Copyright © 2018 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagmotive: © Deniz Saylan, © Retales Botijero (gettyimages)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT ∙ Herstellung: Han
ISBN 978-3-641-18014-0V001
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Allen Müttern.Vor allem der, ohne die es das hier nicht gäbe.
EINS
»Na, wird ja wieder Zeit«, griff mir mein Friseur von hinten in mein wucherndes Seithaar. Dort habe ich mehr als in der Mitte. »Wie immer?«, fragte er.
Ich bestätigte.
Seine Hände verweilten an meinen dunkelblonden Kopfseiten. »Magst du’s farblich mal ’n bisschen vereinheitlichen?«
Es dauerte einen Augenblick, bis ich begriff, was er vorschlug. Ich war dagegen. »Männer mit gefärbten Haaren sehen immer albern aus.«
»Wird ein ganz natürlicher Look!«, versprach er und drehte mich, um die Notwendigkeit seines Vorschlags zu unterstreichen, in meinem Stuhl vor dem Spiegel halb zur einen, halb zur anderen Seite.
Das kalte Licht der Halogenleuchten setzte zwischen all meinen dunklen Haaren die weißen gnadenlos in Szene.
Mein Friseur ist in etwa so alt wie ich. Er trägt seinen schwarzen, fast hüftlangen Schopf zu einem Dutt gewunden, die Hälfte seines Gesichts bedeckt ein dichter dunkler Bart. Auf seiner muskulösen Brust, soweit die V-Ausschnitte seiner T-Shirts sie freigeben, sprießen und knistern die Haare ebenso wie auf seinen kräftigen Armen.
Mein Friseur ist Haar auf zwei Beinen. Glänzend und gepflegt wie ein frisch gestriegelter Rappe.
Ich dagegen schimmelte.
Wie gerne wäre ich in diesem Moment eine Amsel gewesen. Oder ein Meerschweinchen.
Oder wenigstens jünger als 18 Monate.
Dann wäre mir dieser Moment der Selbsterkenntnis erspart geblieben.
Die meisten Vogelarten, eben auch Amseln, sehen in ihrem Spiegelbild statt sich selbst einen potentiellen Partner. Vogelmännchen beginnen zu balzen, allein schon, weil das Gegenüber ja megagut aussieht. Oder sie versuchen, ihr Ebenbild voller Fürsorge zu füttern. Aggressivere Vögel, auch weibliche, attackieren ihre Spiegelung – in der Annahme, sie sei ein Konkurrent – mit dem Schnabel und fügen deshalb Autoscheiben, glänzenden Motorhauben und Chromfelgen mitunter schwere Schäden zu.
Im Flug reagieren Vögel, egal welchen Geschlechts, auf ihr Spiegelbild häufig mit einem dumpfen »Bumms«.
Die meisten Vögel halten eine Spiegelung für die Fortsetzung der Welt. Um sich im Flug darüber zu wundern, dass es sich anders verhält und das da vorne nur eine Bürohausfassade ist, dafür reicht meist die Zeit nicht mehr.
Meerschweinchen lässt ein Spiegel ziemlich kalt. Sie schnuppern kurz daran, stellen fest, dass es da nach nichts riecht, was sich besteigen lässt, und ziehen quiekend ihrer Wege.
Und der Mensch?
Die Antwort darauf erfordert einen kleinen Schlenker zu Charles Darwin und seiner stark behaarten Freundin Jenny.
1838 schob Darwin im Londoner Zoo der Orang-Utan-Dame Jenny einen Spiegel in den Käfig. Jenny versteckte sich angesichts ihres Ebenbildes erschrocken, kam zurück, grimassierte, posierte, wunderte sich über das parallele Tun ihres Gegenübers und guckte hinter dem Spiegel nach, wie’s da weitergeht. Dennoch begriff das Tier das Phänomen Spiegel nicht. »It could not understand puzzle«, notierte Darwin. »Es konnte Rätsel nicht lösen.«
Ob Jenny wusste, dass sie sich selbst sah?
Der Biopsychologe Gordon Gallup entwickelte 1970 eine Versuchsanordnung zur Erforschung des Ich-Bewusstseins von Tieren. Dafür malte er einem Schimpansen einen Punkt auf die Stirn, den dieser logischerweise nur im Spiegel sehen konnte. Reagierte er darauf und versuchte gar, ihn wegzuwischen, musste er begriffen haben, schlussfolgerte Gallup, dass das Gegenüber nicht irgendein gepunkteter Artverwandter war, sondern ein Abbild seiner selbst. Nicht nur Menschenaffen, auch Delfine, Elefanten und – mit Einschränkungen – Rhesusaffen bestanden den Test.
Die Annahme, dass die Fähigkeit, sich im Spiegel zu erkennen – das Selbsterkennen –, allein von der Entwicklung und Größe des Hirns abhängt, widerlegten mit Punkten versehene Saatkrähen und Elstern, die zu den für ihre Intelligenz bekannten Rabenvögeln gehören. Sie fuhrwerkten nach einem Blick in den Spiegel mit dem Schnabel in ihrem Gefieder herum, um die Markierung auf ihrer Brust zu entfernen, hatten also das Spiegel- als ihr Abbild identifiziert.
Nun zum Menschen.
Zur Erforschung des Selbst-Bewusstseins wurden Ende des 19. Jahrhunderts erstmals Kleinkinder vor einen Spiegel gesetzt. Die Tests wurden immer weiter verfeinert und allerlei Schlussfolgerungen gezogen.
Nach dem 5-Stufen-Modell der Selbst-Wahrnehmung des Schweizer Psychologen Philippe Rochat aus dem Jahr 2003 erreichen wir mit 18, spätestens 24 Monaten Phase drei, die sogenannte Stufe der Identifikation.
Falls uns unsere Eltern in diesem Alter für wissenschaftliche Versuche zur Verfügung stellen oder unsere Eltern einfach selbst gerne mit Kindern experimentieren, würden sie begeistert feststellen, dass auch wir Menschen – hat man uns einen Punkt auf die Stirn gemalt und vor einen Spiegel gesetzt – versuchen werden, diese Markierung zu entfernen. Einschränkend muss gesagt werden, dass zu dieser Leistung nicht alle von uns fähig sind. Philippe Rochat und sein Kollege Dani Zahavi weisen in einem Aufsatz von 2014 darauf hin, dass noch manche Sechsjährige bei diesem Spiegeltest, obwohl sie erkennbar Selbstbewusstsein besitzen, sich an die eigene Nase fassen, wenn man die Nase ihrer Mutter angemalt hat. Dagegen bestanden Menschen den Test, denen, etwa wegen einer Amnesie, wichtige Komponenten eines ausgebildeten Selbstbewusstseins fehlen.
Was Ich-Bewusstsein ist, darüber streiten Philosophen schon seit der Antike. Wer bin ich? Warum bin ich? Und natürlich: Wenn ja, wie viele?
Etwa seit den letzten vierzig Jahren arbeiten sich auch Naturwissenschaftler an diesen Fragen ab. Als Konsens gilt: Ich braucht ein Bewusstsein und den Zustand der Wachheit. Menschen in Koma oder Narkose fehlt beides, wer schläft, ist zwar nicht wach, kann sich aber in Träumen bewusst sein, dass er gerade träumt, wer im Wachkoma liegt, scheint wach, hat aber kein Bewusstsein.
Neben dem Moment des Selbsterkennens spielt die Wahrnehmung durch andere eine wichtige Rolle für die Herausbildung eines Ich-Bewusstseins. In unseren ersten zwei Lebensjahren sind Friseure hierbei kaum relevant, eher unsere Eltern. Gleichwohl bilden sich bis zum zweiten Geburtstag zwei Grundlagen unseres Beauty-Bewusstseins heraus, die wir meist bis ins hohe Alter in verschieden starker Ausprägung behalten: Scham und Stolz.
Scham zeigen wir zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat, wenn beispielsweise unser Lachen nicht erwidert wird oder wenn wir Neckereien nichts entgegenzusetzen wissen. Dann wenden wir uns ab, senken das Kinn, verschränken die Ärmchen, ziehen uns in uns zurück. Eine Emotion, die abhängt von der Anwesenheit anderer und unserem Bewusstsein dafür, dass sie uns wahrnehmen.
Haben wir als zwei Jahre alter Mensch einen Turm gebaut, der nicht umfällt, freuen wir uns wie irre über unser wackliges Werk – wir sind stolz.
Freuen sollen wir uns auch, wenn wir statt einfach so plötzlich nur in bestimmten Momenten pullern. Nämlich dann, wenn wir auf einem Plastiktopf sitzen. Besonders perfide Plastiktöpfe verstärken unseren Stolz auf diese Leistung, indem sie, nachdem wir Pipi oder Kacka herausgedrückt haben, lustig düdeln. Oder gar jubilieren: »Oooh, das hast du fein gemacht!« Letzteres hat für mehrere Töpfchen die Anne eingesprochen. Zu der gleich mehr.
Aber selbst wenn uns niemand einen Punkt auf die Stirn malt, kommt im Alter zwischen 18 und 24 Monaten eines Tages der Moment, in dem wir in einen Spiegel schauen und begreifen, dass wir gerade auf unseren eigenen Körper gucken. Von außendraußen!
Kein Wunder, dass in dieser Lebensphase Stolz entsteht.
Und Scham.
Diese Lebensphase lag fast 40 Jahre zurück, als mir vor dem Spiegel eines Berliner Friseursalons allerlei Existenzielles im Kopf herumging. Natürlich hatte ich schon mal das eine oder andere pigmentlose Haar entdeckt, aber die Möglichkeit, ja, gar die Notwendigkeit kosmetischer Maßnahmen war mir nie derart deutlich vor Augen geführt worden.
Mein Friseur unterbrach mein Grübeln: »Also, was machen wir?«
Er wollte eine Entscheidung.
Und ich entschied mich.
ZWEI
Am Tag nach dem Friseurbesuch saß ich hoch über einer Neuköllner Kopfsteinpflasterstraße auf dem Balkon. Zusammen mit Anne und einer Spinne, aber ohne zu ahnen, dass ich am Beginn eines Prozesses stand, der ein keinesfalls neues, eher altes und doch gänzlich anderes Leben in Gang setzte, an dessen Ende ein Scharfschütze für 1500 Euro Honorar in meinem Auftrag vor dem Bundeskanzleramt in Stellung ging und ich jeden Dienstag zuschaute, wie Herr Dettmar ertrank. Dazu später mehr.
Von schräg links fiel die Sonne dieses Junimorgens auf den Balkontisch. Welche Farbe und Beschaffenheit die Tischplatte hatte, war nicht zu erkennen. Frische Brötchen, Marmelade, Honig, Leberwurst, allerlei Käse, Obst, Orangensaft und was außerdem ein üppiges Sonntagsfrühstück ausmacht, bedeckten jeden Quadratzentimeter.
Für unsere Maßstäbe schien schon Vormittagssonne. Anne und ich sind Frühaufsteher, ab zehn ist Vormittag.
Unter Annes Missfallensbekundungen – sie frönt gerne ihrer Liebe zu Sonnenbädern – klappte ich den Sonnenschirm auf. Ein aus dem Sperrmüll am Straßenrand gerettetes Unikum, das Gestänge schwergängig und angerostet, die Bespannung aus schwerem gelbbraunen Stoff mit Blumenmuster.
Anne trug ein hellblaues Spaghettiträger-Top und olivfarbene Shorts. Manchmal glaube ich, sie hat nicht mehr Farbverständnis als ein Regenwurm. Der kann nur hell und dunkel unterscheiden. Da ich jahrelang die Sprecher-Texte für eine Fashion-Sendung im Nachmittagsprogramm schrieb, schickt sie mir manchmal Selfies aus Umkleidekabinen und bittet um modischen Rat. Ihre Bühnenoutfits haben wir gemeinsam ausgesucht.
Ihre langen Beine reichten bis zur Balkonbrüstung, dort wo der Schirmschatten nicht hinreichte, in den Halterungen der fehlenden Blumenkästen lagen ihre Füße, Rücken und Kopf lehnten am Rauputz der Hauswand. In der Kiste unter ihrem Po waren die Sitzpolster verstaut gewesen, die jetzt den Kistendeckel und zwei Stühle bequemer machten, alle gruppiert um den rechteckigen Tisch. Jedes Möbelstück von anderer Farbe, Gestaltung und Materialbeschaffenheit. Pippi Langstrumpf hätte sich hier bestimmt wohlgefühlt. Annes Frisur erinnerte dagegen weniger an den schwedischen Kinder-Hippie, sondern an meinen Friseur, nur waren ihre langen Haare blond und nachlässiger zum Dutt gezwirbelt.
»Dich stört ja gar nicht, dass die Leberwurst in der Sonne steht. Und die Milch. Und die Butter.« Anne kannte meine Marotten.
»Ist ja nicht meine Leberwurst und Milch und Butter. Außerdem weiß ich, wie sehr es dich nervt, wenn ich ständig aufspringe und Sachen kühl stelle.« Ich verschwieg, wie viel Selbstbeherrschung es mich gekostet hatte, die Lebensmittel nicht wenigstens in den Schatten zu schieben. Entlastung hatte ich mir durch das Aufspannen des Sonnenschirms versprochen, aber sein Schatten fiel in die falsche Richtung.
»Du bist schon ein seltsames Vögelchen.« Sie lachte herüber. Ihre weißen, gleichmäßigen Zahnreihen blitzten. Ich kenne niemanden, der perfektere Zähne hat. Hin und wieder fragen Kolleginnen Anne, bei wem sie die hat machen lassen. Worauf sie antwortet: »Bei Mama, Papa und meiner Zahnbürste.«
Wegen des Dreier-Rhythmus dieser Aufzählung lässt sie die anderen Pflegemaßnahmen weg: Antibakterielle Spülung, Zahnzwischenraumbürstchen, Fluoridgel, die Anti-Knirsch-Schiene mit leichter Korrekturfunktion in der Nacht. Bei unserem Bootsurlaub im Frühjahr hatte ich in der Zeit, in der sie ihre Zähne pflegte, das Frühstücksgeschirr inklusive Rühreipfanne gewaschen, abgetrocknet und weggeräumt.
Anne hielt, die Augen geschlossen, das Gesicht in die Sonne, deren Schein hinter dem Schirmschatten an der Hauswand herabkletterte. Ich ruckelte auf meinem Stuhl etwas weiter nach vorn.
Jetzt – beschloss ich – ist auch kein guter Moment, um Anne von meinen Nächten mit Gloria zu erzählen. Stattdessen flüsterte ich: »Nicht bewegen.«
Aus halb geöffneten Lidern beobachtete Anne, wie ich eine stecknadelkopfgroße Spinne vom Träger ihres Tops schnipste.
Annes Verhältnis zu Spinnen ist entspannt. Solange sie nicht auf ihrer nackten Haut herumkrabbeln. Da bevorzugt sie Finger.
Weil ich beim Schnipsen nah an ihr Gesicht kam, sagte ich: »Guck mal meine Haare!«
»Kürzer?«
»Auch …«
Sie kniff die Augen zusammen. »Du wirst grau.«
»Ja, aber das sieht man jetzt nicht mehr.«
Unter der Bedingung, dass es ganz natürlich aussehen würde, hatte ich meinem Friseur erlaubt, gegen meine Alterserscheinungen vorzugehen.
»Hast du sie etwa färben lassen?«
»Mein Friseur nannte es Re-Shade.«
»Riie-was?«
»Das ist ein Add-on«, erklärte ich fachmännisch. »Er hat versprochen, dass man es nicht sieht.«
»Das Versprechen hat er gehalten.«
»Auf jeden Fall sah man es auf der Rechnung.« Auch dort standen die englischen Fachbegriffe, das Wort Tönung fiel nie. »Vielleicht wird es noch dunkler«, ich drehte meinen Kopf vor der spiegelnden Balkontür, »wenn die Haare wachsen.«
Anne stieß vor Lachen fast den Schirm um.
Schließlich kriegte sie sich wieder ein und fragte: »Fahren wir eigentlich dieses Jahr nochmal Boot?«
Wir hatten vor einiger Zeit gemeinsam den Bootsführerschein gemacht für Binnen und See, durften also theoretisch auf allen Weltmeeren herumschippern, waren jedoch bei den bisherigen Ausflügen mit Charterbooten immer froh gewesen, wenn wir es unfallfrei aus dem Hafen schafften.
»Aber dann mal länger als nur übers Wochenende.« Ich schob die Butter in den Schatten.
Anne atmete hörbar aus. »Ich habe Domi im August schon zwei Wochen Urlaub versprochen.« Längere Zeit am Stück frei zu machen ist für Anne ebenso schwierig wie für mich. Allerdings kann ich unterwegs arbeiten. Anne braucht für ihren Job Mikrofon oder Bühne, meist beides.
»Vielleicht geht eine Kurzwoche von Montag bis Freitag«, sagte sie. »Anfang September ist Domi auf einem Lehrgang.«
»Da müsste schon Nachsaison sein, wäre billiger.« Ein kleines Kajütboot mit zwei Schlafkabinen – wir schlafen ja nicht in einem Bett – kostet für eine Woche ab 300 Euro pro Person. Mir fiel Gloria ein, die es vielleicht merkwürdig finden würde, wenn ich nicht mit ihr führe.
Anne sortierte ihre Extremitäten und streckte sich. »Boah, hab’ ich einen Muskelkater von gestern. Nur wegen Domi … Komm, lass uns anfangen, wir müssen nicht auf die Schlafmütze warten.«
Um Domi nicht zu wecken, hatte ich vorhin rücksichtsvoll aufs Klingeln verzichtet und stattdessen wie verabredet eine Nachricht geschickt, dass ich vor der Tür stehe.
Als Anne vor ein paar Jahren zum ersten Mal den Namen Dominik erwähnte, war ich weniger von dem Leuchten in ihren Augen überrascht gewesen. Vielmehr verwunderte mich, dass sie sich in jemanden verliebt hatte, der anders als seine Vorgänger nicht in der Fernsehbranche arbeitete, sondern als Sozialversicherungsfachangestellter bei der Deutschen Rentenversicherung. Und das schon länger, als Annes Schulzeit zurücklag.
Was Anne an dem zwölf Jahre älteren Mann begeisterte, verstand ich bald. Ob Keller- oder Wassereinbrüche, verlorene Wohnungsschlüssel oder ein aus heiterem Himmel über mich hereingebrochener Krankenhausaufenthalt, Dominik wusste, was zu tun war, verlor nie den Kopf, kannte die richtigen Leute und Pumpen, erkletterte Balkons und blieb klaglos an Annes Seite, als sie den ersten gemeinsamen Liebesurlaub abbrach, um mich in meinem Auto von einem bayerischen Provinzkrankenhaus wieder nach Berlin zu fahren, wozu ich selbst konditionell nicht mehr in der Lage gewesen war.
Vor zwei Jahren heirateten die beiden auf einem verschneiten Brandenburger Schloss. Am Ende meiner Rede als Annes bester Freund hatte ich die Gäste aufgefordert, ihr Gegenüber am Ohrläppchen zu ziehen, sich nach hinten zu beugen und »Huh!« zu brüllen. Eine Reminiszenz an unsere gemeinsame Arbeit für einen großnasigen Komiker. Während der Produktion von dessen Sketch-Show lernten wir uns kennen.
Das Ende meiner Hochzeitsrede hatten alle lustig gefunden. Bis auf die, die statt am Ohrläppchen am Ohrring gezogen wurden.
»Guten Morgen, liebe Sorgen!«, stand Dominik plötzlich im Türrahmen. Oder vielmehr dahinter, die Tür ist schmal.
Wie meist trug er ein Muscle-Shirt, dessen lustiger Aufdruck seiner breiten Brust die brutale Präsenz nahm. Ein zwinkernder Smiley prangte auf der Vorderseite.
Unsere Umarmung war ein Aneinanderstoßen, bei dem wir dem anderen zweimal hart mit der Handfläche den Rücken klopften.
Wenn ich gegen seine Muskeln prallte, war er, obwohl ein paar Zentimeter kleiner, ein Mann und ich ein Männchen.
Anne huschte nach drinnen.
»Ausgeschlafen?«, fragte ich Dominik.
»Nee …« Er gähnte. »Und das am Sonntag.« Dominik stellte sich an die Balkonbrüstung, die muskulösen Arme verschränkt, schaute er auf Neukölln, das auch noch nicht richtig wach war. Wer die Skulpturen von Hitlers Lieblingsbildhauer Arno Breker kennt, kann sich Dominik gut vorstellen. Sein Kinn war kantig, das blonde Haar wurde von einem akkuraten Linksscheitel geteilt, war oben lang, an den Seiten kurz geschnitten. Allerdings ohne irgendwelche ideologischen Hintergedanken.
Er drehte sich zu mir um. »Wie nennt man einen sehr kleinen Personenschützer?«
Ich wartete stumm die Antwort ab.
»Sicherheitshalber«, löste Dominik auf und boxte mir auf den Oberarm. »Sicherheitshalber!«
»Hm-hm, lustig.« Erst als er wieder auf Neukölln schaute, rieb ich mir meinen kleinen Bizeps. »Ich geh’ dann mal bald.«
»Ach, schon? Der Tag hat doch gerade erst angefangen.«
Annes Kopf erschien zwischen den offenen Flügeln des Küchenfensters, links vom Balkon: »Domi, wenn er geht, verschwinde ich ins Büro, muss meine Moderationen umschreiben.« Annes Kopf zog sich zurück.
»Aber wir wollten heute die neue Staffel Game of Thrones schauen!«, rief Dominik in die Küche.
»Ja, du wolltest das«, rief Anne aus der Küche. »Freitagabend kam ein neuer Ablaufplan, jetzt muss ich alles überarbeiten. Tut mir leid.«
»Warum hast du das nicht gestern …«
Annes Kopf guckte wieder heraus: »Nach vier Stunden Kletterhalle?«
Bevor Dominik wieder zu hören bekam, dass klettern zu gehen seine Idee war, fragte ich Anne: »Welche Branche diesmal?«
»Wandbefestigungssyteme.«
»Nicht übel sprach der Dübel – und verschwand in der Wand«, deklamierte Dominik.
Annes Kopf verschwand ebenfalls. Augen rollend.
Die größten Erfolge ihrer gut zehn Jahre währenden Schauspielkarriere hatte sie als Barfrau in einem TV-Sketch gehabt und als junge Mutter, die an Darmträgheit leidet und der von einer Freundin ein probiotischer Joghurt in die Hand gedrückt wird.
Durch einen Zufall rutschte sie in die Messe- und Tagungsmoderation und wurde darin zunehmend erfolgreicher. Daneben arbeitet sie als Werbesprecherin. Ein Raum der Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung war ihr Büro. Im halben stand Dominiks Hantelbank.
»Vorsicht!« Anne zirkelte ein Tablett durch die schmale Balkontüröffnung. Darauf ein Stapel blasser Scheiben und ein weißer Wackelberg.
»Was ist das denn?«, fragte ich.
»Eiweiß-Omeletts und Magerquark. Oder kurz: Proteine«, erklärte Dominik.
»Er hat jetzt einen Ernährungsplan.« Anne küsste Dominik auf die Wange.
»Tja, ich will eben fit bleiben für dich und …« Dominik küsste ihre Stirn. »… unsere Kinder.«
Tablett und Tisch trafen heftiger aufeinander, als es Anne wohl beabsichtigt hatte. Sie lenkte ab und ihr Kinn in meine Richtung. »Er hat seine Haare gefärbt!«
»Ach, sieht man gar nicht.«
»Das war ja auch der Sinn!«, murrte ich.
»Also von hier aus betrachtet«, Dominik stand mir im Rücken, ich spürte seinen Atem auf meinem Hinterkopf, »ist nicht die Farbe der Haare dein Problem, sondern die Menge.«
DREI
Wie wir die Welt interpretieren und wie wir Menschen bewerten, wird neben Vererbung und sozialer Prägung durch die Informationen bestimmt, die wir uns zusammensuchen oder die wir – was häufiger geschieht – einfach dem Informationspool entnehmen, der uns vorgesetzt wird.
Wir verknüpfen die erhaltenen Informationen – wiederum in Abhängigkeit von Genen und Prägung – mit der Erinnerung an bereits Erlebtes und Gelerntes und formen daraus unser Bild. Von der Welt, von einem Menschen oder der Beziehung zwischen Menschen. Zum Beispiel zwischen mir und Anne und Dominik.
Dominiks Bemerkung bezüglich meiner Haare schlug eine Kerbe, die mein Studienfreund Olaf vergrößerte.
Bei ihm tappt niemand lange im Dunkeln. Alle wesentlichen Informationen liefert er selbst. Wer ihn hört, weiß, woher er stammt, wer ihn sieht, kennt seinen Appetit, und wer ihn erlebt, begreift schnell, seine Freunde haben starke Nerven. Müssen sie haben. Anders geht es gar nicht.
Andere hätten zur Begrüßung »Hallo« gesagt, oder »Schön, dich zu sehen.« Olaf nicht.
Über den halben Alexanderplatz, wo wir uns wie verabredet vor dem Pressehaus trafen, dröhnte er: »Hömma, du kriegst ja ’ne Glatze.«
»Tja, der Verstand braucht Platz«, konterte ich und setzte hinzu: »Dein Haar wächst ja sehr dicht.«
»Jaja …«, Olaf strich zwei braune Strähnen aus der Stirn. »Dabei wollte ich dir beweisen, wie sehr ich an meinen Umgangsformen gearbeitet habe. Und dann gleich wieder sonn Ausfall.« Woran Olaf ganz sicher nicht arbeitete, war, seinen Ruhrgebietsdialekt zu unterdrücken. Wer ihn nicht kennt, unterschätzt deshalb seine intellektuellen Fähigkeiten. Olaf hatte nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann Politik- und Theaterwissenschaft studiert. Seine Einzimmerwohnung in Dortmund-Dorstfeld teilt er mit einem Schlagzeug, mehreren Gitarren und zwei Keyboards, die er alle ziemlich gut beherrscht. Seine Vermieterin ist schwerhörig. Das war sie aber schon, bevor er einzog.
Wir hatten uns seit letztem Herbst nicht mehr gesehen. Jetzt war es Anfang Juli, und er machte einige Tage Urlaub in Berlin.
»Schick siehst du aus!«, lobte ich Olafs Outfit aus Anzug und Krawatte.
»Ich erzähl’ gleich wieso. Lass uns erstma watt essen.«
Es war inzwischen Tradition geworden, dafür in einem Steakhaus einzukehren.
Ich bestellte ein großes Hüftsteak, eine Backkartoffel und einen kleinen Salat. Olaf nahm sich die Salatbar vor. Allerdings hatte sich der Preis des All-You-Can-Eat-Angebotes für das Gemüsebuffet inzwischen verdoppelt. Wahrscheinlich seit Olafs letztem Besuch.
»Weisse watt, früher hätt’ mich datt aufgeregt. Aber inzwischen ham wir’s ja.« Olaf verdient seit einiger Zeit mehr Geld, als er braucht. Und wohnt jetzt im Hotel, wenn er mich besuchen kommt. Nicht, weil er muss. Weil er’s kann!
Während des Studiums war Olaf ein wenig aus dem Tritt geraten, hatte viel länger als wir andern bis zum Abschluss gebraucht, sich dann als Website-Bastler und Altenpfleger über Wasser gehalten, bis er nach einem Jahr Hartz IV einen festen Job in einem Call-Center bekam und tagaus, tagein Menschen anrief, die ihn wegdrückten. Was das berufliche Auf-der-Stelle-Rudern privat auslöste, begeistert Olaf stets aufs Neue.
»Früher hätt’ ich datt gar nich’ geschmeckt. Na gut, früher hätt’ ich datt auch nich’ gegessen. Kaninchenfutter!«, mümmelte er.
»Aber seit du mit dem Rauchen aufgehört hast …«, nahm ich vorweg, was kommen würde. Olafs Schilderung seiner letzten Stunden als Raucher dauerte mein ganzes Hüftsteak lang. Er hatte irgendwann bis zu 80 Zigaretten am Tag geraucht. Oft die neue an der alten angezündet. Eines Tages entschied er sich, wenigstens privat voranzukommen. Er ging zum Büdchen gegenüber seiner Wohnung, kaufte dort zur Verwunderung des Inhabers von seinem letzten Geld keine zwei Schachteln wie sonst, sondern eine ganze Stange und rauchte die Nacht durch. Gegen fünf Uhr morgens riss er – schon ziemlich zitternd – die siebte Schachtel auf. Ehe er eine neue Zigarette herausklopfen konnte, kotzte er drauf. Seitdem ist Olaf clean.
Er stand auf, um grünen Nachschub zu holen. Kam, einen bunten Berg balancierend, wieder: »Wie du siehst, esse ich jetzt sogar gesund! Und hier is’ viel Platz für Gesundheit.« Er patschte zweimal auf seinen stattlichen Bauch.
Ich studierte die Karte wegen eines Nachtischs, winkte eine der Kellnerinnen herbei und bestellte Apfelstrudel mit Vanilleeis. Sie notierte und beäugte misstrauisch den bunten Berg auf Olafs Teller. Er versicherte: »Ich kenn’ die Regeln. Er kriegt nichts ab. Alles für mich.« Die Kellnerin wirkte nicht beruhigt.
Olaf spießte ein Tomatenviertel auf die Gabel, schob noch ein Salatblatt auf die herausstehenden Zinken, häufte Maiskörner auf beides und zwang die Gabel in seinen Mund. »Weisse, an meinem vierzigsten Geburtstag … oh, hab’ ich dich bespuckt?«
»Nein«, log ich und rückte etwas vom Tisch ab.
»An meinem vierzigsten Geburtstag bin ich wie jeden Tag zur Arbeit, hab’ meine Anrufe gemacht und gedacht: So, Olaf, zweite Halbzeit, gewinnen kannze eh nich’ mehr. Spiel einfach die Uhr runter.« Gerührt von sich selbst hielt er inne, was mir Gelegenheit gab zu fragen: »Wieso Halbzeit?«
»Statistik. Wir werden im Durchschnitt achtzig Komma neun Jahre alt. Also hat man an seinem Vierzigsten …«
»Jaja, schon klar. Ach herrje …«
»Bist du nich’ auch schon vierzig?« Olaf fuhrwerkte durchs Gemüse.
»Ich bin 39 und fühl’ mich wie 38!«
Olaf schob seine Gabel unter ein Radieschen. »Wer anfängt, sich jünger zu fühlen, als er ist, wird alt.« Das Radieschen ergriff kullernd die Flucht. »Deine erste Halbzeit wird im November abgepfiffen, richtig?«
»Wie lange kennen wir uns?«
»November war falsch? … Ich kann mir deinen Geburtstag nich’ merken.«
»Ich werde im Dezember vierzig. Außerdem ist dann nicht Abpfiff, sondern Anpfiff zur zweiten Halbzeit.«
»Positivling!« Olaf erstach das Radieschen.
»Warum trägst du denn nun Anzug?«
»Weil mich mit fast fünfzig ein Sonnenstrahl getroffen hat.« Olaf war zwar erst 47, aber eben ein Negativling. Positiv war: Seinen Chefs im Call-Center fiel auf, dass Olaf mehr konnte als vorgegebene Fragen abzulesen. Aus der Cold-Calls-Abteilung hatte man ihn daher erst zum telefonischen Kundendienst eines koreanischen TV-Herstellers versetzt, dann zur Technischen Hotline eines Druckmaschinenherstellers, dessen Geräte mal in Bayern, mal in Bombay nicht druckten, wofür Olafs fließendes Englisch ziemlich hilfreich war (wenn er Englisch spricht, ist seine Ruhrpott-Herkunft übrigens nicht zu hören).
Nicht immer hilfreich ist, dass Olaf in Meetings agiert wie ein Gelsenkirchener Stürmer, der sein Fußballhandwerk noch auf Ascheplätzen gelernt hat. Ohne taktische Spielchen, direkt, schnörkellos und frei von Rücksicht auf die Schienbeine der anderen tut er seine Meinung kund.
»Der Punkt ist, dass sie zugeben mussten, dass ich Recht hab’. Und weisse watt? Jetzt haben sie mich in die Interne Kommunikation geholt. Datt is Management-Ebene.«
»Deshalb der Anzug?«
»Deshalb der Anzug. Watt sachste zu meiner Krawatte?«
»Die Salatsoße passt nicht dazu.«
Olafs Daumen wischte auf dem roten Stoff drei Spritzer French Dressing breit. Er lutschte den Daumen ab. »Weg isset.«
Zur Sicherheit warf er die Krawatte über die rechte Schulter und stopfte einen Zipfel seiner Serviette zwischen zwei Hemdknöpfe.
»Trägst du den Anzug jetzt jeden Tag?«, fragte ich.
»Nee, ich hab’ noch zwei andre. Kann ja schlecht im T-Shirt zur Arbeit kommen.«
Farblich wäre Olaf zwischen den Businessoutfits seiner neuen Kollegen wohl nicht aufgefallen. Seit ich ihn kenne, trug er schwarzes T-Shirt zu schwarzer Jeans. »Brauchse morgens nich’ nachdenken und macht schlank«, war dazu sein Standardkommentar gewesen.
»Du weißt schon, dass du jetzt nicht auf der Arbeit bist.«
»Natürlich. Aber weisse, wenn ich mich so im Spiegel sehe, erinnert mich datt immer daran, dass aus mir noch watt geworden is’.«
Weil Olaf während unseres Mahls die ganze Zeit brav bei Salat geblieben war, orderte er, um sich zu belohnen, zwei große Kugeln Vanilleeis.
»Sachma«, dröhnte er, als wir kurze Zeit später vollgefuttert aus dem Steakhaus stapften. »Ob aus dir auch noch mal watt wird?«
Perplex sah ich ihn an. Er lachte. Schlug mir auf die Schulter. »Spässken! Dir scheint ja die Sonne aus’m Arsch.«
»Ansichtssache«, erwiderte ich.
Olaf winkte ab. »Ach watt … Komm, lass dich drücken.«
Wir umarmten uns. Dann spazierte Olaf durch die Sommernacht davon, schaukelnd wie ein Fass im Fluss.
VIER
In der klassischen Drehbuchdramaturgie kommt gegen Ende des ersten Aktes der erste Wendepunkt. Hier will, soll oder muss der Held etwas tun. Nach ein bisschen hadern mit sich und anderen zieht er schließlich los, rettet die Welt, begibt sich auf Schatzsuche oder kämpft um die Liebe einer Frau.
Das Leben hält sich leider nur selten an die Dramaturgielehre. Wer Lebensgeschichten erzählt, muss deshalb entscheiden, welche Momente er zu denen macht, an denen alles anders wurde. Außerdem muss er aus Zeit- und Platzgründen auf ganz viele Momente des Lebens verzichten, an denen zwar nichts anders wurde, die aber trotzdem stattfanden. In Filmen und Romanen wird darum sehr wenig ausgeschieden, Haare gewaschen und Zähne geputzt. Das mag auch daran liegen, dass solch alltägliches Tun kaum dazu beiträgt, Heldinnen und Helden mit einem Glorienschein zu versehen. Obwohl es bei seinen vielen Einsätzen in exotischen Ländern absolut nachvollziehbar wäre, will man doch erleben, wie James Bond in den ausweglosesten Situationen einen genialen Ein- und keinen Durchfall hat. Ich dagegen werde nicht behaupten, es hätte den einen Moment gegeben, der alles veränderte. Es waren viele kleine Momente: Augenblicke der Selbstwahrnehmung, Bemerkungen von Freunden – und ein Rechenfehler.
Diesen Impulsen war gemeinsam, dass sie auf die Frage hinausliefen, ob ich im Spiel des Lebens dem Gegner Alter entweder durch eine gezielte Offensive meine größer werdende Stirn bieten oder tatenlos zusehen sollte, bis die Uhr abgelaufen war.
Ich entschied mich für Variante eins, den Kampf, und sofort ergab sich die Frage nach dem Wie.
Ein Trainer, der anfängt, auf allen Positionen seiner Mannschaft herumzuexperimentieren, bekommt kein Siegerteam, sondern eine Chaostruppe. Besser ist es, den Weg der kleinen Schritte zu gehen und nach und nach herauszufinden, was sinnvoll ist und was nicht.
Das Re-Shade bei meinem Friseur war wohl der erste dieser Schritte gewesen. Am Tag nach dem Treffen mit Olaf ging ich den zweiten und rief Dr. Dschugaschwili an – einen Haarspezialisten. Ich bekam einen Termin sechs Wochen später, kurz vor dem geplanten Urlaub mit Anne. So konnte ich den dritten Schritt, nämlich meinen Besuch bei ihm, erst Ende August gehen.
In der Zeit bis dahin erfolgte ein Zwischenschritt, bei dem ich an die Tücken des Jungseins erinnert wurde und gezwungen war, über das Beziehungsleben von Glühwürmchen nachzudenken:
In einem von der Katholischen Kirche betriebenen Tagungszentrum hoch über Freiburg hatten sich die Stipendiaten einer parteinahen Stiftung Mitte Juli zu einem selbstorganisierten Bildungswochenende zusammengefunden.
Mich hatte man eingeladen, weil ich im Radio irgendwann mal etwas zum Thema ihrer Zusammenkunft gesagt hatte. Als letzter von drei Experten, deren Vorträge die studentischen Referate und Diskussionsrunden ergänzen sollten, war ich für den frühen Sonntagnachmittag als letzter Referent des Seminarwochenendes vorgesehen.
Was das erkerreiche Hauptgebäude des Tagungszentrums – bis zum Zweiten Weltkrieg Ruhesitz eines Schweizer Bankdirektors – von außen versprach, hielt die Inneneinrichtung: knarrende Holztreppen, dunkle Deckenbalken, Fenster mit bunten Butzenscheiben und im Vortragsraum ein Parkett, auf dem schon viele Schuhe und Stuhlbeine ihre Spuren hinterlassen hatten. Hinter den großen Fenstern in der linken und der hinteren Wand erstreckte sich ein Postkartenpanorama: das Auf und Ab roter Dächer, umringt von den grünen Höhenzügen des Breisgaus. Hochsommerliche Wolkenschatten zogen über die Landschaft.
Nachdem der letzte der jungen Menschen in den Raum geschlurft und auf einen Stuhl gefallen war, nahm ich Aufstellung an einem Stehpult.
Die Sitzordnung erinnerte an eine halbe Scheibe Brot, aus der das Innere herausgeknabbert worden war. Niklas, ein barfüßiger Zwanzigjähriger in knielanger schwarzer Hose und einem fäkalfarbenen T-Shirt moderierte mich an: »… und deshalb freuen wir uns, dass Sie unserem Seminarwochenende Vorurteile über Vorurteile einen weiteren Aspekt hinzufügen: Humor!« Er begann laut zu klatschen, und die meisten der jungen Menschen auf den in Form einer übriggebliebenen Brotrinde aufgestellten Stühlen machten mit.
Eine Reihenbestuhlung wäre nicht nur atmosphärisch, sondern auch in Anbetracht der Größe von Raum und Zuhörerschaft sinnvoller gewesen. Hintereinander gestaffelte Reihen jedoch führen zu einer Sitzhierarchie, und hier waren natürlich alle gleich.
Der Applaus verebbte, und die Mehrzahl der Klatscher nahm die Haltung ein, in der sich die Nichtklatscher bereits befanden, seit Niklas mich als »Comedy-Autor« vorgestellt hatte: vor der Brust verschränkte Arme.
Ich lächelte ins Halbrund, in dem zwar alle in der ersten Reihe saßen, aber die Hälfte in zehn Meter Entfernung mit dem Rücken dicht an den Heizkörpern unterm Fenster.
»Als ich die Einladung erhielt, heute einen Vortrag über Humor und Vorurteile zu halten, … und als ich erfuhr, dass ich vor Studenten sprechen darf … Und als sich dann auch noch herauskristallisierte, dass Sie politisch eher links bis ganz links orientiert sind, sich für Political Correctness einsetzen und auf geschlechtergerechtes Sprechen achten – da ploppten vor meinem geistigen Auge gleich ein paar Bilder auf …«
Kaum hatte ich das Wort »Studenten« ausgesprochen, ruckelten die ersten auf ihren Stühlen herum, dass das Parkett knarzte.
Politisch korrekt hätte ich von »Studierenden« sprechen müssen, was in diesem Fall sogar grammatisch korrekt gewesen wäre, denn die Menschen im Halbrund studierten gerade tatsächlich, nämlich mich. Dagegen waren sie gestern Abend, als ich kurz nach meiner Ankunft mit ihnen speiste, keine Studierenden gewesen, sondern an einer Universität immatrikulierte Essende.
Alternativ hätte ich das Sternchen oder den Unterstrich, die in Texten als Kennzeichen geschlechtergerechter Sprache verwendet werden, auch mündlich benutzen können, so wie Niklas es kurz zuvor getan hatte. Er hatte beim Sprechen mitten in den jeweiligen Wörtern abrupt eine Pause eingelegt: »Referent…innen«, »Diskutant…innen.«
Bis ich das System erkannt hatte, dachte ich, Niklas litte an Schluckauf.
»… da ploppten vor meinem geistigen Auge gleich ein paar Bilder auf: Verfilzte Frisuren, nackte Füße, Klamotten in erdigen Tönen. Dann kam ich gestern hier an und musste feststellen, dass meine Vorurteile …« Ich ließ das Satzende bewusst offen, und mein Blick schweifte über Filz-Frisuren und Erd-Klamotten. Einige schmunzelten, andere erstarrten, mehrere krümmten die nackten Zehen.
»Okay«, fuhr ich fort, »das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Anders: Wir haben gestern beim Abendessen – also der Niklas, die Shila und ich – das Thema dieses Wochenendes diskutiert, und dabei kamen wir darauf zu sprechen, dass Menschen, die sich für Political Correctness einsetzen, für Minderheiten und geschlechtergerechtes Sprechen, sich häufig mit dem Vorurteil konfrontiert sähen, sie seien humorlos.«
Shila nickte, und ein paar ihrer Dreadlocks wippten. Genau wie ihre Brüste, die unter einem baumstammfarbenen Top kein BH in Konventionen zwang.
»Aber ich dachte sofort, das mit der Humorlosigkeit kann nicht stimmen. Wenn sich nämlich politisch korrekte Menschen zu einem Diskussionswochenende in einem Tagungszentrum treffen, das betrieben wird von der weltgrößten Institution für Frauen-, Gesinnungs- und Homosexuellendiskriminierung – dann müssen sie Humor haben!«
Eine Taube spazierte draußen an der hinteren Fensterfront entlang, stoppte und drehte das Köpfchen zur Scheibe, als wundere sie sich über die bei uns da drinnen plötzlich hereingebrochene Stille. Dann flatterte sie davon, weil ebenso plötzlich Lärm ausbrach.
Sie lachten. Die Menge der verschränkten Arme vor mir geriet in Unterzahl. Nur Shila kreuzte zusätzlich die Beine.