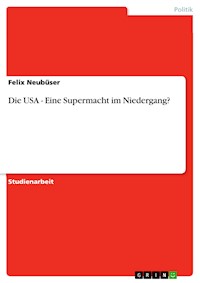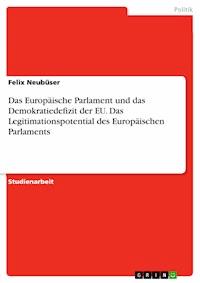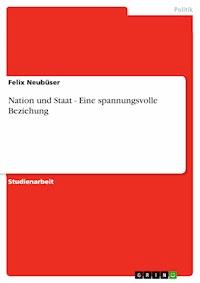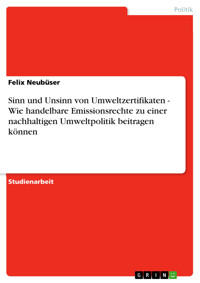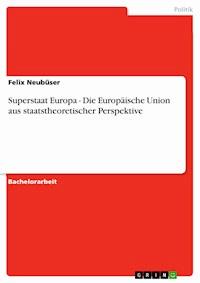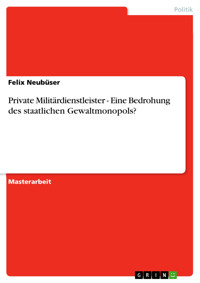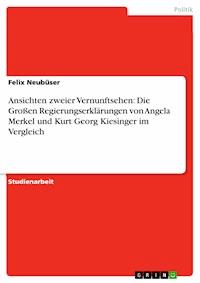
Ansichten zweier Vernunftsehen: Die Großen Regierungserklärungen von Angela Merkel und Kurt Georg Kiesinger im Vergleich E-Book
Felix Neubüser
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Sonstige Themen, Note: 2,0, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Sozialwissenschaften), Veranstaltung: Krise der politischen Kommunikation, Sprache: Deutsch, Abstract: Am 22. November 2005 wurde die CDU-Vorsitzende Dr. Angela Merkel vom Deutschen Bundestag mit 397 von 611 gültigen Stimmen zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Der Wahl waren fast drei Monate Verhandlungen und Planspiele vorangegangen, denn sowohl die SPD wie auch die CDU/CSU beanspruchten für sich, als Sieger aus der Wahl hervorgegangen zu sein. Das Ergebnis des zähen Ringens, in dessen Verlauf die verschiedensten Koalitionsmodelle, von „Ampel“ bis „Jamaika“, teils mehrfach durchexerziert worden waren, war eine große Koalition; die zweite auf Bundesebene seit Gründung der Bundesrepublik, die erste im wiedervereinigten Deutschland und die erste mit einer Frau an der Spitze. „Das Wort hat die Frau Bundeskanzlerin“ hieß es folgerichtig am 30. November 2005 im Berliner Reichstagsgebäude, worauf die frisch vereidigte Angela Merkel ans Rednerpult trat, um, der Tradition folgend, im Rahmen einer Großen Regierungserklärung die Ziele und Pläne ihrer „Koalition der neuen Möglichkeiten“ zu erläutern. Ein ganz anderes Bild hatte sich dem Plenum gut 40 Jahre zuvor, am 13. Dezember 1966, geboten. Auch damals stand ein frisch vereidigter Kanzler einer großen Koalition vor den Abgeordneten des Bundestages, um eine Große Regierungserklärung abzugeben. Auch damals hatte die Bundesrepublik mit einem, für die damalige Zeit, recht ansehnlichem Haushaltsdefizit zu kämpfen, auch damals war der gewählte Kanzler, Kurt Georg Kiesinger, Mitglied der CDU. Ort des Geschehens war allerdings nicht Berlin, sondern das rheinland-westfälische Bonn. Grund für die große Koalition waren nicht vorgezogene Neuwahlen, sondern der Ausritt der FDP aus der Koalition mit der CDU gewesen. Und auch eine Bezeichnung wie Merkels „Koalition der neuen Möglichkeiten“ wäre mehr als unpassend gewesen. Die Rede von Bundeskanzlerin Merkel fand ein breites Medienecho, und nicht wenige Journalisten stürzten sich bei ihren Analysen auf den bereits angedeuteten und ja auch nahe liegenden Vergleich der Rede mit der Regierungserklärung von Willy Brandt aus dem Jahr 1969. Erstaunlich wenig Aufmerksamkeit hingegen widmeten die Medien dem Vergleich mit der Regierungserklärung Kiesingers, dem doch bis zu Frau Merkels Wahl einzigen Kanzlers einer großen Koalition in Deutschland. Das soll in dieser Arbeit nachgeholt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Page 1
Page 3
Felix Neubüser - Vergleich der Regierungserklärungen ... 3 / 23Einleitung
Es scheint üblich, Abhandlungen zu diesem Thema mit den Worten des Bundestagspräsidenten einzuleiten: „Das Wort hat der Herr Bundeskanzler“. So fängt Klaus Stüwe sein kürzlich erschienenes Buch „Die Rede des Kanzlers“ (Stüwe 2005: 15) an, so leitet auch Karl-Rudolf Korte seinen Aufsatz „Die Regierungserklärung: Visitenkarte und Führungsinstrument des Kanzlers“ (Korte 2002a: 12) ein. Für diese Arbeit ist diese Einleitung jedoch nicht passend: der „Herr Bundeskanzler“ ist nämlich eine Frau. Am 22. November 2005 wurde die CDU-Vorsitzende Dr. Angela Merkel vom Deutschen Bundestag mit 397 von 611 gültigen Stimmen zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Der Wahl waren fast drei Monate Verhandlungen und Planspiele vorangegangen, denn sowohl die SPD (34,2 Prozent) wie auch die CDU/CSU (zusammen: 35,2 Prozent) beanspruchten für sich, als Sieger aus der Wahl hervorgegangen zu sein und somit den bzw. die Bundeskanzler(in) stellen zur dürfen. Das Ergebnis des zähen Ringens, in dessen Verlauf die verschiedensten Koalitionsmodelle, von „Ampel“ bis „Jamaika“, teils mehrfach durchexerziert worden waren, war eine große Koalition; die zweite auf Bundesebene seit Gründung der Bundesrepublik, die erste im wiedervereinigten Deutschland. Und die erste mit einer Frau an der Spitze, was die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden übrigens später sogar dazu animierte, das Wort „Bundeskanzlerin“ zum „Wort des Jahres 2005“ zu küren, noch vor der Bild-Schlagzeile „Wir sind Papst“ (Steinhauer 2006).