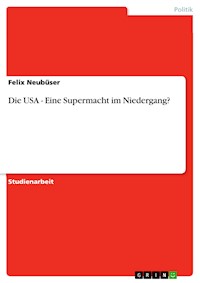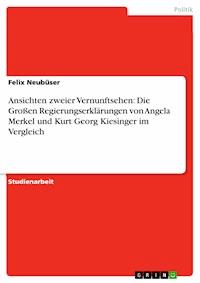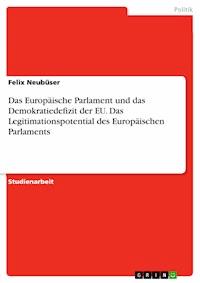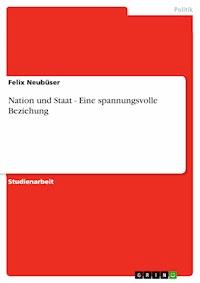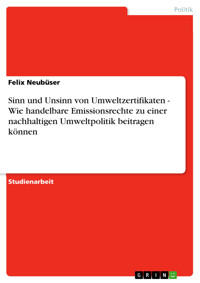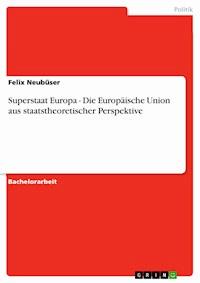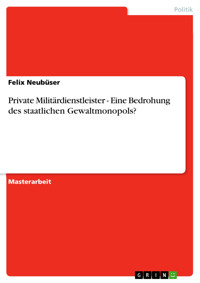
Private Militärdienstleister - Eine Bedrohung des staatlichen Gewaltmonopols? E-Book
Felix Neubüser
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Politik - Allgemeines und Theorien zur Internationalen Politik, Note: 1,7, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Sozialwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Branche privater Militär- und Sicherheitsdienstleister (PMS) boomt: geschätzte 100 Milliarden US-Dollar setzten Blackwater, DynCorp und Co 2003 um, bis 2010 wird sich diese Summe voraussichtlich verdoppelt haben. Allein im Irak sind zur Zeit mehr als 60 verschiedene Firmen mit insgesamt rund 20.000 Angestellten, sogenannten Contractors (zu deutsch: Vertragspartnern; der Begriff „Söldner“ wird von den Firmen tunlichst vermieden), direkt vor Ort im Einsatz. Vielfach sind sie für Nachschub und Logistik zuständig, als bewaffnete Eskorten bewachen sie aber auch Personen oder schieben Wachdienst an Gebäuden und nehmen oft sogar originär militärische Aufgaben wahr. Es scheint, als würden immer mehr Staaten in immer größerem Maße dazu übergehen, ehemals militärische Aufgaben mittels Outsourcing an private Firmen abzugeben. Grundsätzlich nichts Ungewöhnliches: Tatsächlich hat der Staat im Laufe seiner Geschichte immer wieder neue Aufgaben übernommen und andere wieder abgegeben. Entsprechend sei der Staat, konstatierte Max Weber, auch nicht über seinen Zweck zu definieren. Maßgebliches Definitionsmerkmal sei das ihm eigene Mittel: die physische Gewaltsamkeit. Einzig der Staat ist legitimiert, durch seine Organe, die Polizei und die Armee, Gewalt auszuüben, um so Recht und Ordnung bzw. die innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten. Kennzeichnend für die Entwicklung des modernen Staates ist daher die Monopolisierung der Gewalt, die wiederum eng mit der Etablierung stehender Heere verbunden ist. Mit dem zunehmenden Einsatz von PMS scheint sich diese Entwicklung umzukehren. Anders als eine Armee werden private Sicherheitsfirmen nur bei Bedarf und meist zeitlich begrenzt in den Dienst des Staates gestellt, erfüllen dabei allerdings ganz oder teilweise Funktionen, die eigentlich dem staatseigenen Sicherheitsapparat(en) zufielen. Und, wichtiger noch, sie bedienen sich dazu dem vom Staat monopolisierten Mittel: der physischen Gewaltsamkeit. Die „Privatisierung von Sicherheit“ (Kofi Annan) tangiert den Staat an seiner Wurzel: dem Gewaltmonopol. Stellen private Militärdienstleister aber deshalb eine Bedrohung für das staatliche Gewaltmonopol und somit letztlich für den Staat selber dar?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 3
1 Einleitung
Als erstes sieht man die jubelnden Iraker, erst dann fällt der Blick auf die zwei Leichen, die mit Seilen an den Metallverstrebungen der Brücke befestigt wurden. Beide sind bis zur Unkenntlichkeit verkohlt und hängen wie Trophäen über den Köpfen der Menschen. Das war Ende März 2004. Die Bilder, fotografiert von einem AP-Reporter, gingen damals um die Welt (vgl. Mascolo 2006). Ort des Geschehens war die irakische Stadt Falludscha, rund 50 Kilometer westlich von Bagdad. Die beiden Ermordeten sowie zwei weitere Männer, allesamt US-Amerikaner, hatten offenbar einen Lebensmitteltransport eskortieren sollen und hatten sich dabei verfahren, so berichtete die amerikanische Wochenzeitung „The Nation“ später. Alle vier waren demnach noch in ihrem Auto sitzend erschossen und anschließend aus Wut auf die Besatzungsarmee verstümmelt und verbrannt worden (vgl. Scahill 2006). Die genauen Umstände des Vorfalls sind bis heute ungeklärt. Interessant ist jedoch: keiner der vier Männer war zum Zeitpunkt seines Todes Angehöriger der US-Streitkräfte oder einer sonstigen im Irak stationierten Armee. In die Statistik gingen die vier als „getötete Zivilisten“ ein, denn Ihre Lohnschecks, schätzungsweise rund 900 US-Dollar pro Tag, hatten sie von der Firma Blackwater USA erhalten, einem privaten Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Moyock, North Carolina. Gegründet vor gerade einmal elf Jahren gilt Blackwater, nicht zuletzt dank des Irak-Krieges, als einer der Primusse einer boomenden Branche - mit hoch gesteckten Zielen: „We are trying to do for the national security apparatus what Fed Ex did for the postal service”, erklärte Blackwater-Gründer Erik Prince kürzlich gegenüber der ZeitschriftWeekly Standard,“They did many of the same services that the Postal Service did, better, cheaper, smarter, and faster by innovating [which] the private sector can do much more effectly” (zitiert nach: Hemingway 2006). Doch: kann man einen privaten Paketdienst wirklich mit einer Armee vergleichen? Seit Anfang der 1990er Jahre boomt die Branche privater Militär-und Sicherheitsdienstleister (PMS): geschätzte 100 Milliarden US-Dollar setzten Blackwater, DynCorp und Co 2003 um, bis 2010 wird sich diese Summe voraussichtlich verdoppelt haben. Allein im Irak sind zur Zeit mehr als 60 verschiedene Firmen mit insgesamt rund 20.000 Angestellten, sogenanntenContractors(zu deutsch: Vertragspartnern; der Begriff „Söldner“ wird von den Firmen tunlichst vermieden), direkt vor Ort im Einsatz. Vielfach sind sie für
Page 4
Nachschub und Logistik zuständig, als bewaffnete Eskorten bewachen sie aber auch Personen oder schieben Wachdienst an Gebäuden und nehmen damit vielfach originär militärische Aufgaben wahr. Es scheint, als würden immer mehr Staaten in immer größerem Maße dazu übergehen, ehemals militärische Aufgaben mittelsOutsourcingan private Firmen abzugeben, unter anderem da diese vielfach in dem Ruf stehen, effektiver und kostengünstiger zu sein. Allein für den Irak hat die amerikanische Regierung mittlerweile mehr als 600 Verträge mit solchen Firmen geschlossen (vgl. Avant 2005: 8; Krüger 2007; Singer 2003: 17). Das ist grundsätzlich auch nichts Ungewöhnliches. Tatsächlich hat der Staat im Laufe seiner Geschichte immer wieder neue Aufgaben übernommen und andere wieder abgegeben, siehe das Beispiel des privaten Paketdienstes. Entsprechend sei der Staat, konstatierte Max Weber, auch nicht über seinen Zweck zu definieren. Maßgebliches Definitionsmerkmal sei das ihm eigene Mittel: die physische Gewaltsamkeit. Einzig der Staat ist legitimiert, durch seine Organe, die Polizei und die Armee, Gewalt auszuüben, um so Recht und Ordnung bzw. die innere und äußere Sicherheit zu gewährleisten. Kennzeichnend für die Entwicklung des modernen Staates ist daher die Monopolisierung der Gewalt, die wiederum eng mit der Etablierung stehender Heere verbunden ist (vgl.: Elias 1997: 151-167; Weber 2006: 63f., sowie: Anter 1993: 21ff.; Schlichte 2000: 161-164). Mit dem zunehmenden Einsatz von PMS scheint sich diese Entwicklung umzukehren. Anders als eine Armee werden private Sicherheitsfirmen nur bei Bedarf und meist zeitlich begrenzt in den Dienst des Staates gestellt, erfüllen dabei allerdings ganz oder teilweise Funktionen, die eigentlich dem staatseigenen Sicherheitsapparat(en) zufielen oder unterstützen diesen in essentiellen Bereichen. Und, wichtiger noch, sie bedienen sich dazu auch dem vom Staat monopolisierten Mittel der physischen Gewaltsamkeit. Anders als der Staat sind PMS jedoch nicht dem Gemeinwohl verpflichtet, sondern streben als Wirtschaftsunternehmen gemäß der Marktgesetze vor allem nach Gewinnmaximierung. Während die Armee vom Staat mit Waffen ausgestattet und dauerhaft unterhalten wird, besitzen PMS in der Regel einen eigenen, vom Staat unabhängigen Fundus an Waffen. Dieser wird oft, etwa im Falle von Blackwater, sogar noch durch eigene Ausbildungsstätten und ein umfangreiches Repertoire an Ausrüstung und Transportkapazitäten ergänzt. Die Angestellten von PMS sind, anders als Soldaten, in der Regel nicht in eine staatlich vorgegebene, militärische Hierarchie
Page 5
eingebunden, innerhalb derer die Ausübung von Gewalt kontrolliert sind, sondern gelten formal als Zivilisten und sind nur durch einen Vertrag an das Unternehmen gebunden. Die „Privatisierung von Sicherheit“, wie Kofi Annan die Übertragung militärischer Aufgaben an private Dienstleister einmal bezeichnet hat (vgl. Holmqvist 2005: 8), ist also keineswegs mit der Privatisierung des Paketversandes zu vergleichen, sondern tangiert den Staat an seiner Wurzel: dem Gewaltmonopol. Stellen private Militärdienstleister aber deshalb eine Bedrohung für das staatliche Gewaltmonopol und somit letztlich für den Staat selber dar? Dieser Frage soll im Rahmen dieser Arbeit nachgegangen werden. Um sie zu beantworten sind zwei Schritte notwendig. Zunächst muss festgehalten werden, woran eine solche Bedrohung überhaupt festzumachen wäre bzw. ab welchem Grad der Privatisierung überhaupt von einer Gefahr zu sprechen wäre. Dafür wird zunächst die staatstheoretische Bedeutung der Monopolisierung von Gewalt insgesamt dargelegt und zwar in zweierlei Hinsicht: einerseits wird kurz die Entwicklung skizziert werden, wie sie etwa bei Norbert Elias in seinem „Prozeß der Zivilisation“ nachzulesen ist. Davon ausgehend wird dann die Bedeutung dieses Monopols als essentielles Merkmal moderner Staatlichkeit dargelegt werden.
In einem zweiten Schritt soll dann der Aufstieg der PMS skizziert werden, der in der zweiten Hälfte der 1990er begann und stetig an Fahrt zu gewinnen scheint. Zudem wird versucht werden, die unterschiedlichen Arten von PMS auf Grundlage ihres Aufgabenspektrums und ihrer Organisation einerseits voneinander, andererseits aber auch von der regulären Armee abzugrenzen. Im Folgenden sollen dann zum einen die Probleme untersucht werden, die sich daraus ergeben, wenn der Staat beginnt, die Ausübung von Gewalt zu privatisieren und damit seine Kernkompetenz zum marktwirtschaftlichen Gut zu machen. Dieser Teil der Arbeit wird auf die im ersten Teil dargelegten Überlegungen aufbauen und vor allem auf der Analyse P. W. Singers fußen, der mit seinem Buch „Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry” die wohl derzeit umfassendste Analyse zu diesem Thema vorgelegt hat. Einfließen werden aber auch andere Arbeiten, wie etwa die von David Shearer, der sich als einer der ersten mit dem Phänomen PMS befasst hat, oder auch Deborah D. Avant, die unter anderem auf die Unterschiede bei der Betrachtung „starker“ und
Page 6
„schwacher“ Staaten hingewiesen hat (vgl. Avant 2005: 7). Zudem ist zu unterscheiden, welche Gefahren und Probleme sich mit dem konkreten Einsatz von PMS, aber auch durch deren bloße Existenz ergeben und zu untersuchen, ob der Einsatz von PMS nicht vielleicht sogar eine Stärkung des staatlichen Gewaltmonopols bedeuten könnte. Am Ende folgt dann ein Fazit mit einer abschließenden Bewertung.
Hierbei ist anzumerken, dass die in dieser Arbeit angestellten Überlegungen zum Teil stark verallgemeinert sind. Dieser Umstand liegt in der Natur der Sache. So kann es sich bei dem modernen Staatsbegriff, der bei der Analyse zu Grunde gelegt werden wird, nur eine idealtypische Beschreibung handeln, die in der Realität durchaus von dem beschriebenem Typus abweichen kann. Gleiches gilt, wenn auch in geringerem Maße, für die PMS. Schon bei den rund 60 Firmen, die zurzeit im Irak tätig sind, ist bestenfalls eine Annäherung durch die Bildung verschiedener Kategorien und das Hervorheben gewisser Charakteristika möglich; gleiches gilt bei Annahmen, die zum Verhalten und zur Motivation ihrer Angestellten zu Grunde gelegt werden. Nichts desto trotz soll der Versuch gewagt werden, ein zwar idealtypisierte, aber in sich schlüssige und nachvollziehbare Argumentation zur Beantwortung oben stehender Frage abzuliefern.