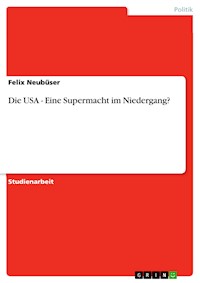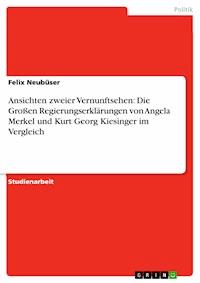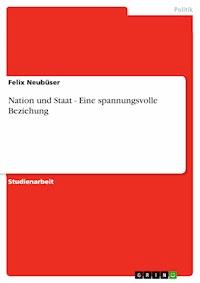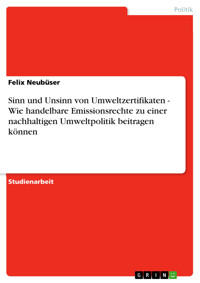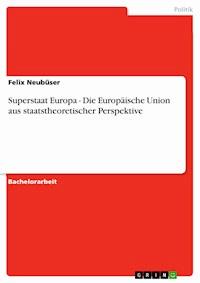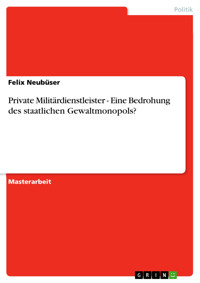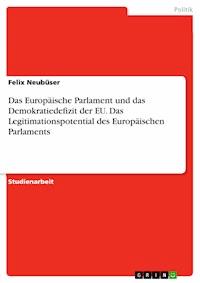
Das Europäische Parlament und das Demokratiedefizit der EU. Das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments E-Book
Felix Neubüser
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Politik - Thema: Europäische Union, Note: 1,7, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Politikwissenschaft), Veranstaltung: Das politische System der EU, Sprache: Deutsch, Abstract: Insbesondere in Hinblick auf die fortschreitende europäische Integration kann und muss sich die Europäische Union (EU) dieser Frage nach ihrer demokratischen Legitimität stellen. Denn: Europa rückt zusammen. Immer öfter bekommt der Bürger den langen Arm Brüssels zu spüren. Bestes Beispiel: Die Einführung der einheitlichen Währung, des Euros. Rund 80 Prozent aller auf den Binnenmarkt bezogenen Entscheidungen sind einigen Schätzungen nach mittlerweile in EU bzw. EG-Recht übergegangen. Ein weiteres Exempel sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofes: Sie sind für die Mitgliedsstaaten bindend und müssen national umgesetzt werden. Ein prominentes Beispiel etwa die Entscheidung zur Gleichstellung von Frauen und Männern beim Zugang zum Dienst in den Streitkräften. In einer Pressemitteilung des EUGH vom 7. Januar 2000 heißt es dazu wörtlich: „Die deutschen Rechtsvorschriften, die Frauen vollständig vom Dienst mit der Waffe ausschließen, verstoßen gegen den gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Gleichheit von Männern und Frauen.“ (EU Homepage 2002) Europäisches Recht bricht nationales Recht, die Bundesrepublik Deutschland musste sich der europäischen Rechtsprechung fügen. In den Mitgliedstaaten steht das Parlament als ein Repräsentationsorgan des Volkes im Mittelpunkt des Legitimationsprozesses von Regierungsgewalt. Es läge also eigentlich nah, dem Europäischen Parlament als einzigem, unmittelbar durch Wahlen vom europäischen Volk direkt legitimierten Organ diese Rolle auf europäischer Ebene zu unterstellen. Anscheinend nicht, denn nicht nur in der politikwissenschaftlichen Fachliteratur wird zumindest mit Fragezeichen versehen über das sogenannte „Demokratiedefizit der Europäischen Union“ diskutiert (vgl. z.B. Pfetsch 1997, Lord 1998 oder Schmidt 2000). Doch auch in den Medien und nicht zuletzt im Hinblick auf die aktuelle Verfassungsdebatte wird dieses Thema immer wieder kontrovers diskutiert. Die Legitimation einer zunehmenden Anhäufung von Rechtsetzungsbefugnissen zu Gunsten der EU, (und damit gleichzeitig zu Lasten der nationalen Parlamenten), ist gemessen an den, in den Mitgliedstaaten üblichen demokratiepolitischen Standards, also zumindest streitbar. In dieser Hausarbeit werde ich mich daher mit folgenden Fragen beschäftigen: Gibt es ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union? Und in diesem Zusammenhang: Welches Legitimationspotential bietet das Europäische Parlament?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2002
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
Einleitung / Forschungsfrage
1. Das Demokratiedefizit der Europäischen Union
1.1. Die Demokratiethese
1.2. Die These vom „Demokratiedefizit“
1.3. Fazit
2. Das Europäische Parlament
2.1. Die Wahl des Europäischen Parlaments
2.2. Kompetenzen im Institutionengeflecht und deren Grenzen
2.2.1. Kontrollfunktion
2.2.2. Gesetzgebungsfunktion
2.2.3. Wahlfunktion
2.2.4. Artikulationsfunktion
2.2.5. Kommunikationsfunktion
2.3. Fazit
3. Das EU-Reformkonvent
3.1. Hintergrund
3.2. Die Debatte um die Verfassung der EU
4. Das Legitimationspotential des Europäischen Parlaments
4.1. Derzeitiges und zukünftige Legitimationsfähigkeit
4.2. Eigene Stellungnahme
5. Zusammenfassung
6. Literatur
Einleitung / Forschungsfrage
„Mit welchen guten, zustimmungsfähigen Gründen läßt sich rechtfertigen, daß die Europäische Union Rechtssetzungsmacht über mehr als 360 Millionen Bürger ausübt?“ (Kielmannsegg 1997, Seite 47) Sicherlich nicht unberechtigt ist diese Frage von Peter Graf Kielmannsegg. Insbesondere in Hinblick auf die fortschreitende europäische Integration kann und muss sich die Europäische Union (EU) dieser Frage nach ihrer demokratischen Legitimität stellen. Denn: Europa rückt zusammen. Immer öfter bekommt der Bürger den langen Arm Brüssels zu spüren. Jüngstes Beispiel: Die Einführung der einheitlichen Währung, des Euros. Rund 80 Prozent aller auf den Binnenmarkt bezogenen Entscheidungen sind einigen Schätzungen nach mittlerweile in EU bzw. EG-Recht übergegangen (vgl. Pfetsch 1997).
Ein weiteres Exempel sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofes (EUGH): Sie sind für die Mitgliedsstaaten bindend und müssen national umgesetzt werden. Ein prominentes Beispiel etwa die Entscheidung zur Gleichstellung von Frauen und Männern beim Zugang zum Dienst in den Streitkräften. In einer Pressemitteilung des EUGH vom 7. Januar 2000 heißt es dazu wörtlich: „Die deutschen Rechtsvorschriften, die Frauen vollständig vom Dienst mit der Waffe ausschließen, verstoßen gegen den gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz der Gleichheit von Männern und Frauen.“ (EU Homepage 2002) Europäisches Recht bricht nationales Recht, die Bundesrepublik Deutschland musste sich der europäischen Rechtsprechung fügen.
In den Mitgliedstaaten steht das Parlament als ein Repräsentationsorgan des Volkes im Mittelpunkt des Legitimationsprozesses von Regierungsgewalt. Es läge also eigentlich nah, dem Europäischen Parlament (EP) als einzigem, unmittelbar durch Wahlen vom europäischen Volk direkt legitimierten Organ diese Rolle auf europäischer Ebene zu unterstellen.
Anscheinend nicht, denn nicht nur in der politikwissenschaftlichen Fachliteratur wird zumindest mit Fragezeichen versehen über das sogenannte „Demokratiedefizit der Europäischen Union“ diskutiert (vgl. z.B. Pfetsch 1997, Lord 1998 oder Schmidt 2000). Doch auch in den Medien und nicht zuletzt im Hinblick auf die aktuelle Verfassungsdebatte wird dieses Thema immer wieder kontrovers diskutiert.
Die Legitimation einer zunehmenden Anhäufung von Rechtsetzungsbefugnissen zu Gunsten der EU, (und damit gleichzeitig zu Lasten der nationalen Parlamenten), ist gemessen an den, in den Mitgliedstaaten üblichen demokratiepolitischen Standards, also zumindest streitbar.
In dieser Hausarbeit werde ich mich daher mit folgender Frage beschäftigen:
Gibt es ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union?
und in diesem Zusammenhang:
Welches Legitimationspotential steckt im Europäischen Parlament?
1. Das Demokratiedefizit der Europäischen Union
Das europäische Demokratiedefizit – zahlreiche Veröffentlichungen schmücken sich mit dieser Losung im Titel. Kaum noch ist dieser Vorwurf aus den Diskussionen um die EU-Osterweiterung wegzudenken. Und auch im Hinblick auf das EU-Reformkonvent, das im März 2002 seine Arbeit aufgenommen hat, wird nicht selten der vermeintliche Mangel der EU an demokratischer Legitimation angeprangert. Selbst Belgiens Premierminister Guy Verhofstadt wird in der Wochenzeitung „Die Zeit“ mit den Worten zitiert, im Schoße der Union gebe es nur „den Anschein demokratischer Legitimität“ (Fritz-Vannahme 2000).
Ist dieser Vorwurf berechtigt? Gibt es überhaupt dieses viel zitierte, aber selten klar definierte, Demokratiedefizit? Möglicherweise sogar die Legitimitätskrise, vor der manche Sozialwissenschaftler so eindringlich mahnen? Oder wird hier schlicht dramatisiert, um die eigene These interessanter zu machen, wie Peter Graf Kielmannsegg anzudenken wagt (vgl. Kielmannsegg 1997)?
Ohne es weiter auszuführen verpflichtet sich die Union in der Präambel ihres Vertrages, auf demokratischen Grundsätzen zu beruhen. Aber tut sie das? Und wenn ja, wie?